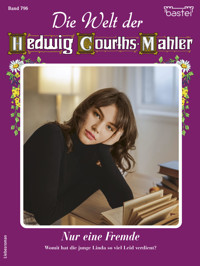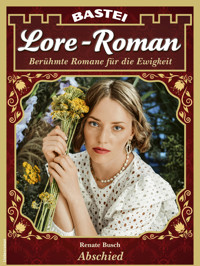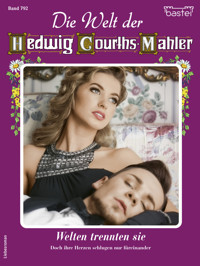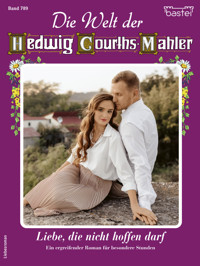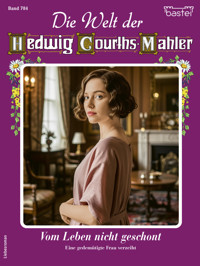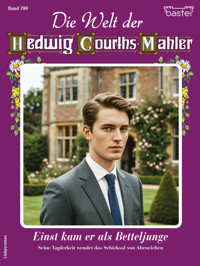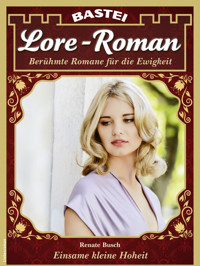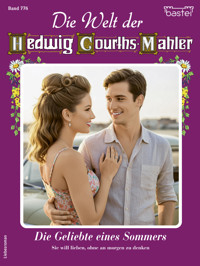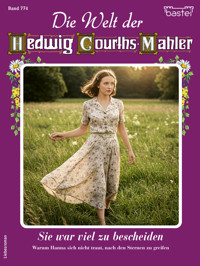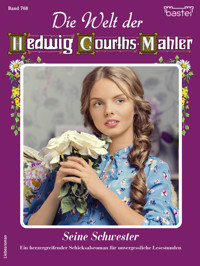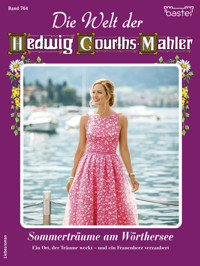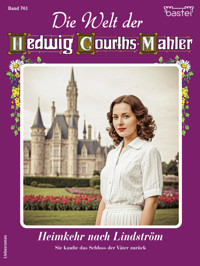1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Miriam an ihrem vierzehnten Geburtstag erwacht, ahnt sie nicht, dass dieser Tag ihr ganzes Leben verändern wird. In einer behüteten Welt voller kindlicher Unbeschwertheit, Musik und mütterlicher Wärme aufgewachsen, trifft sie der plötzliche Verlust ihrer Mutter wie ein Donnerschlag. Einsam, voller Angst und Zweifel, muss sie ihre vertraute Heimat verlassen und sich einem Großvater stellen, der ihr fremd ist - in einem Herrenhaus, das statt Geborgenheit Kälte und alte Standesdünkel ausstrahlt. Doch Miriam ist nicht bereit, sich in das vorgegebene Leben einer Baronesse zu fügen. Mit Mut beginnt sie, ihren Platz in einer neuen Welt zu suchen - und findet dabei Verbündete, wo sie es nicht erwartet hätte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Liebe, die den Schmerz überwand
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Liebe, die den Schmerz überwand
Das Schicksal einer Waise
Von Renate Busch
Als Miriam an ihrem vierzehnten Geburtstag erwacht, ahnt sie nicht, dass dieser Tag ihr ganzes Leben verändern wird. In einer behüteten Welt voller kindlicher Unbeschwertheit, Musik und mütterlicher Wärme aufgewachsen, trifft sie der plötzliche Verlust ihrer Mutter wie ein Donnerschlag. Einsam, voller Angst und Zweifel, muss sie ihre vertraute Heimat verlassen und sich einem Großvater stellen, der ihr fremd ist – in einem Herrenhaus, das statt Geborgenheit Kälte und alte Standesdünkel ausstrahlt. Doch Miriam ist nicht bereit, sich in das vorgegebene Leben einer Baronesse zu fügen. Mit Mut beginnt sie, ihren Platz in einer neuen Welt zu suchen – und findet dabei Verbündete, wo sie es nicht erwartet hätte ...
»Da bist du ja, Mama.« Miriam flog ihrer Mutter wie immer, wenn sie nach Hause kam, um den Hals.
Mutter und Tochter ähnelten sich sehr. Die ältere, schlanke Frau besaß noch immer die Figur eines jungen Mädchens, wenngleich das Leben auch seine Runen in das aparte, Frauengesicht geschrieben hatte. Aber das üppige, seidene kastanienbraune Haar hatte noch immer die gleiche Leuchtkraft wie das der Tochter.
»Oh, Mama, ich bin schon schrecklich aufgeregt«, flüsterte Miriam ihrer Mutter zu. »Nun werden wir doch dreizehn auf meiner Geburtstagsparty. Dreizehn ist ja eigentlich eine Unglückszahl, aber ich will nicht abergläubisch sein. Du hast mir oftmals gesagt, Aberglaube sei etwas sehr Dummes.« Sie sprudelte alles hervor, während sie ihre Mutter mit in das kleine, trauliche Wohnzimmer zog.
»Du weißt ja, Ilse war krank gewesen, eine grässliche Ohrengeschichte, ich bin gleich nach der Schule noch einmal kurz zu ihr gegangen. Sie ist wieder gesund, da habe ich sie natürlich auch noch eingeladen. Das ist dir doch recht, nicht wahr?«, fragte sie.
»Du bist die liebste Mutti der Welt.« Miriam umarmte ihre Mutter abermals herzlich. »Weißt du, es ist schrecklich aufregend, vierzehn Jahre alt zu werden«, gestand sie ihrer Mutter.
Frau Gabriele lächelte mütterlich nachsichtig und verstehend.
Obwohl es sie danach drängte, jetzt an die Arbeit zu gehen, nahm sie sich noch für einen Plausch mit Miriam Zeit.
»Hast du eingekauft, was ich dir aufgeschrieben habe?«
»Aber ja doch, Mama!«
»Ich habe herrliche Erdbeeren für die Torte bekommen, Mama. Natürlich habe ich sie gleich in den Eisschrank gestellt. Ich freue mich schrecklich auf morgen. Ich helfe natürlich beim Backen.«
Frau Gabriele lachte belustigt. »Du bist schon ein richtiges Schleckermaul. Aber jetzt schreiten wir besser zur Tat. Das Mittagessen brauchen wir nur aufzuwärmen, das erspart uns Zeit und Mühe.«
Sie erhob sich.
Miriam verzog ein bisschen den Mund. Sie hätte gern noch weitergeplaudert. Aber ihre Mutter hatte natürlich recht, für den morgigen Tag gab es noch sehr viel zuzubereiten.
»Gut, dass wir sonnabends jetzt keine Schule mehr haben, nicht wahr, Mama?« Miriam deckte mit flinken Händen den Tisch, während ihre Mutter das schmackhafte Gericht vom Vortag wärmte.
»Ja, wenn ich Dienst habe, ist es eine große Hilfe. Du bist jetzt schon alt genug, um die Einkäufe zu erledigen und im Haus mitzuarbeiten.«
Miriam hielt in ihrer Tätigkeit inne. »Ich habe gerade gestern darüber nachgedacht, Mama. Du musst es doch furchtbar schwer mit mir gehabt haben, als Paps schon so früh gestorben ist. Weißt du, wenn man ein kleineres Kind ist, denkt man gar nicht darüber nach und nimmt alles so selbstverständlich hin.«
Auf Miriams Zügen lag ein grübelnder Ausdruck.
»Darüber solltest du wirklich nicht nachdenken. Eine Mutter empfindet die Mehrbelastung nicht, die sie durch ihre Kinder hat. Und ich meine, wir beide sind doch immer prima durchgekommen, nicht wahr?«
»Wunderbar, Mama!« Miriam eilte auf sie zu und umarmte sie. »Du warst mir immer die beste Mutter der Welt, wie Paps der beste Vater gewesen war.«
Über Frau Gabrieles Gesicht huschte ein schmerzlicher Ausdruck. Hans Joachim war nun schon Jahre tot, aber den Verlust hatte sie noch nicht überwunden.
Freilich hatte sie sich damals nicht ihrem Schmerz hingeben können, Miriam war dagewesen, und ein Kind beansprucht seine Rechte. Und das war gut so gewesen. Wer weiß, wie sie sonst mit diesem schrecklichen Schicksalsschlag fertig geworden wäre?
»Ja, dein Vater war wirklich ein großartiger Mensch, Miriam«, sagte Frau Gabriele sinnend.
»Ihr seid doch sehr glücklich miteinander gewesen, nicht wahr, Mutsch?« Miriam schmiegte ihren Kopf an der Mutter Schulter.
»Ja, das waren wir«, sagte die junge Frau fest.
Offenbar hatte Miriam noch etwas auf dem Herzen.
»Vor ... einem guten Jahr ... hat dich Doktor Vogel oftmals nach Haus gebracht.« Sie wurde rot. »Ich dachte schon, ich meinte ...« Sie brach ab und errötete.
Frau Gabriele zuckte ein bisschen zusammen. Miriam war also doch nicht mehr das kleine Mädchen, das sie häufig noch in ihr sah. Dann hatte sie sich also über die Zuvorkommenheit und Hilfsbereitschaft des Arztes auch ihre Gedanken gemacht. Sie hatte dagegen angenommen, Miriam bemerke das Werben des Arztes nicht.
»Doktor Vogel hat mich damals gebeten, seine Frau zu werden«, sagte Frau Gabriele endlich zögernd. »Es wäre unrecht, nach Lage der Dinge noch damit hinter dem Berg zu halten.«
Die Nachricht verblüffte Miriam. »Und du hast ... ihn ...«
»Ganz recht, ich habe ihn abgewiesen«, bestätigte Frau Gabriele ruhig.
»Doch nicht etwa meinetwegen?« Miriam sah richtig erschrocken aus.
Ihre Mutter zögerte mit der Antwort.
»An dich habe ich auch gedacht«, gestand sie. »Aber du warst nicht der Grund. Ich habe mich geprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Papa in meinem Herzen noch einen viel zu großen Platz einnimmt, um mich an einen anderen Mann binden zu können. Ich hätte Doktor Vogel bitteres Unrecht zugefügt.«
Miriam schluckte und nickte. »Er war sicher schrecklich traurig, nicht wahr?«
»Ja, das stimmt, und er tat mir auch sehr leid. Aber ich bin kein Mensch, der sich mit Halbheiten abgeben kann, Kind.«
»Du hättest aber nicht mehr arbeiten müssen ... wenn du seine Frau geworden wärst – oder?«
»Ich glaube nicht, du dummer Spatz. Aber ich arbeite ja gern. Meine Tätigkeit als Schwester macht mir Freude.«
»Sie ist aber schrecklich anstrengend.«
Frau Gabriele schmunzelte. »Du musst dich in jedem Beruf arrangieren, wenn du ihn gut ausfüllen willst. Aber das wirst du auch noch merken.«
Wie jede andere Mahlzeit wurde auch diese für Mutter und Tochter zu einer fröhlichen Zweisamkeit. Miriam plauderte über ihre Freundinnen, über die Schule und über ihre Lehrer. Frau Gabriele hörte amüsiert zu und tat nur kurze Zwischenbemerkungen.
»Ach, ich habe ja ganz vergessen, dass Fräulein Thiemann mit ihren besten Schülerinnen ein kleines Konzert im Herbst geben will. Sie hat mir gestern gesagt, ich solle auf dem Flügel und auf der Geige spielen.«
»Wie schön, dann gehörst du also zu ihren besten Schülerinnen?« Frau Gabriele war erfreut und glücklich. Miriam machte ihr in der Tat nur Freude.
In der Schule hatte sie noch niemals Schwierigkeiten gehabt, im Gegenteil. Sie brachte stets die besten Noten nach Hause und das, obwohl sie sich leider sehr wenig um Miriams Schulaufgaben kümmern konnte. Da Miriam sehr musikalisch war, hatte sie schon sehr zeitig Musikunterricht bekommen. In all den Jahren hatte sie Miriam noch niemals ermahnen müssen, die Übungsstunden einzuhalten. Miriam hatte aus Freude am Musizieren stets unaufgefordert nach den Notenheften griffen.
»Mutsch, jetzt legst du dich erst ein Stündchen hin – bitte«, bettelte Miriam nach dem Mittagessen. »Ich säubere die Küche, dann können wir zusammen backen.«
In jedem anderen Fall hätte Frau Gabriele bestimmt widersprochen, jetzt nickte sie matt. Sie wusste auch nicht, was plötzlich mit ihr los war. Sie fühlte sich einfach nicht wohl. Der Tag war wohl reichlich anstrengend gewesen.
Verflixt, nun hatte sie auch noch Leibschmerzen! Das fehlte ihr noch, da so viel Arbeit auf sie wartete!
Sie stand schon nach kurzer Zeit wieder auf, weil sie sich einbildete, beim Herumwirtschaften habe sie keine Zeit, auf ihre Unpässlichkeit zu achten.
Aber die Schmerzen ließen nicht nach. Auch eine schmerzstillende Tablette half nicht.
Am Abend waren die meisten Vorbereitungen für den morgigen Tag getroffen. Allerdings konnte sich Frau Gabriele nun auch nicht mehr auf den Beinen halten.
»Mama, ist etwas?«, fragte Miriam bestürzt, als ihr auffiel, wie blass ihre Mutter war und wie tief die Ringe untter ihren Augen wirkten.
»Nein, nein ...«, sie hielt sich die Seite. Diese verdammten Schmerzen setzten doch schon wieder mit aller Heftigkeit ein. Sie hatte Schweiß auf der Stirn und musste sich erbrechen.
Miriam war vor Schreck ganz ratlos.
»Mama, du bist krank«, murmelte sie verstört.
»Unsinn«, widersprach Frau Gabriele energisch. Sie durfte doch jetzt nicht krank werden. Miriam hatte sich so auf die Party gefreut.
»Ich rufe einen Arzt«, sagte Miriam, während sie ihre Mutter angstvoll beobachtete.
»Na gut«, sagte Frau Gabriele endlich matt. »Versuche, Doktor Schröter zu erreichen.«
Miriam nickte nur, nahm Geld und sauste los. Sie besaßen leider kein eigenes Telefon, da Mama und sie sparen mussten. Wenn Mama vom Krankenhaus gewünscht wurde, nahmen nette Nachbarn das Gespräch entgegen. Jetzt waren sie allerdings verreist.
Miriam lief den ganzen Weg bis zur Telefonzelle. Dann starrte sie entsetzt auf das Schild an der Tür. ›Außer Betrieb‹.
Irgendwelche böswilligen Menschen hatten eine Scheibe eingeschlagen und das Telefonkabel aus der Wand gerissen. Also jagte Miriam weiter und war völlig außer Atem, als sie endlich die nächste Telefonzelle betrat. Sie steckte zwei Groschen in den Geldschlitz und erlebte, dass einer immer wieder herausfiel. Anderes Kleingeld war nicht in ihrer Börse.
Erst der dritte Straßenpassant hatte Geld bei sich und konnte ihr eine Mark wechseln.
Endlich blieb das Geld in dem Apparat. Aber das Telefon ihres Hausarztes blieb tot. Während Miriam den Hörer ans Ohr presste, trippelte sie von einem Bein auf das andere. Sie war voller Ungeduld und Angst um ihre Mutter.
Dann musste sie begreifen, dass der Hausarzt nicht daheim war. Vielleicht besaß er ein Wochenendhaus oder machte irgendwo einen Verwandtenbesuch.
Eine automatische Fernsprechanlage teilte ihr die Telefonnummer des Arztes mit, der Bereitschaftsdienst hatte.
Am liebsten wäre sie zwischendurch nach Hause gelaufen, um sich davon zu überzeugen, dass es ihrer Mutter ganz bestimmt nicht schlechter ging. Aber das wäre natürlich Irrsinn gewesen.
Jetzt war Miriam so aufgeregt, dass sie sich zweimal verwählte.
Dann hatte sie endlich die Frau des Arztes, der Bereitschaftsdienst hatte. Miriam sprudelte hervor, welche Schmerzen ihre Mutter hatte.
»Mein Mann ist im Moment auf Patientenbesuch, wenn er zurückkommt, werde ich ihn sofort schicken«, versprach die fremde Stimme.
»Danke«, murmelte sie und gab ihre Adresse an. Dann eilte sie den Weg zurück.
Die Schmerzen ihrer Mutter waren noch heftiger geworden. Frau Gabriele lag mit schweißbedeckter Stirn und mit verzogenem Gesicht auf der Couch. Aber sie rang sich ein Lächeln ab, als ihr Töchterchen zurückkam.
»Wie geht es, Mutsch?«, rief Miriam schon an der Tür.
»Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
»Hast du noch immer Schmerzen?« Miriam war bei ihrer Mutter und fasste nach deren Hand. »Die ist ja ganz heiß«, murmelte sie erschrocken.
»Ich werde ein bisschen Fieber haben«, murmelte die Kranke so heiter wie möglich. »Hast du den Arzt erreicht?«
Miriam nickte und erzählte dann von ihren Schwierigkeiten beim Telefonieren.
»Soll ich dir eine Wärmflasche machen, Mama?«, fragte sie dann voller Sorge.
Denn so sehr sich Frau Gabriele auch bemühte, sie konnte die heftigen Schmerzen vor ihrem Kind nicht mehr verbergen.
»Nein, höchstens einen Eisbeutel.«
»Eisbeutel?« Miriam war verblüfft.
»Nun, ich glaube fast, dass mein Blinddarm ein bisschen streikt«, sagte die Kranke so gleichmütig wie möglich.
»Blinddarm? Mama, du musst sofort ins Krankenhaus!« Miriam sprang erschrocken auf.
»Nun, nun, der Arzt wird ja sicher bald kommen, dann wird er mir schon eine Überweisung schreiben. Wir müssen ruhig und vernünftig bleiben«, beschwichtigte Frau Gabriele.
Miriam stand auf und ging alle paar Minuten zum Fenster. Sie erwog, abermals zum Telefon zu eilen, um ein Taxi anzurufen. Aber während der Zeit kam bestimmt der Arzt ...
Dass Frau Gabriele nicht nur die Schmerzen zusetzen, zeigte sie nicht.
»Kind, packe mir die Tasche für die Klinik«, bat sie endlich. »Wenn der Arzt nicht kommt, wirst du zu Nachbarn gehen und sie um Hilfe bitten.«
Miriam nickte. Ihr Gesicht war kalkweiß. Sie packte ein, was ihre Mutter ihr aufgab. Ihr Herz raste vor Sorge um ihre Mutter. Jedes Mal, wenn ein unterdrücktes Stöhnen der Kranken zu ihr drang, zuckte sie schmerzlich zusammen.
Da klingelte es. Miriam stürzte zur Tür. Ein fremder Mann mit einer Arzttasche stand vor ihm.
»Oh, Herr Doktor, kommen Sie, kommen Sie«, murmelte Miriam erleichtert.
Der Arzt untersuchte Frau Gabriele nur flüchtig. »Seit wann haben Sie die Schmerzen?«
Die Kranke gab ihm wahrheitsgemäß eine Antwort. Er nickte.
»Wo ist Ihr Telefon?« Er sah sich suchend um.
»Wir besitzen keins.«
Er nickte. »Sie müssen auf der Stelle ins Krankenhaus – Blinddarmvereiterung.«
»Ich habe es mir gedacht«, sagte Frau Gabriele leise.
Er schrieb eine Einweisung ins Krankenhaus aus, versprach schnellstens einen Krankenwagen zu bestellen und verabschiedete sich.
Miriam fiel ein Stein vom Herzen. Endlich war der erste Schritt getan, um Mama von den heftigen Schmerzen zu befreien.
»Miriam, komm zu mir«, bat Frau Gabriele. Sie mochte nicht daran denken, ihr Töchterchen jetzt für etliche Zeit zu verlassen! »Kind, ich hätte dir so gern eine schöne Geburtstagsparty ausgerichtet«, murmelte sie traurig.
»Mama, denke bitte nicht daran«, bat Miriam. »Ich habe ja im nächsten Jahr wieder Geburtstag, dann holen wir alles nach.«
»Kind, du weißt ja, wo das Geld liegt, du musst nun ohne mich fertigwerden. Du kannst dir ja schon kleine Gerichte kochen. Wenn du einmal dazu keine Zeit und Lust hast, gehst du essen.«
»Ja, ja, Mama, mach dir darüber bitte keine Sorgen«, bat Miriam flehend. Sie hielt noch die Hand ihrer Mutter, als es endlich klingelte und zwei Sanitäter vor der Tür standen. Sie luden die Kranke auf eine Trage.
»Kopf hoch, Kind, ich komme ja bald wieder«, sagte ihre Mutter, als Miriam neben der Trage herging.
Miriam nickte. Sie hätte jetzt nicht sprechen können, sonst hätte sie losgeheult.
»Wohin bringen Sie ... meine Mutter«, flüsterte sie endlich den beiden Männern zu.
»In die Städtischen Krankenanstalten, kleines Fräulein.«
Einer der Sanitäter nickte und lächelte. Dann waren sie mit ihrer Mutter verschwunden.
Miriam kam sich so grenzenlos einsam und verlassen vor! Sie warf sich auf die Couch, die noch die Körperwärme ihrer Mutter trug. Sie vergrub ihren Kopf in die Kissen, auf denen Mama noch vor kurzem geruht hatte und weinte verzweifelt.
Irgendwann musste sie vor Erschöpfung und Verzweiflung eingeschlafen sein. Sie erwachte, als ihr erbärmlich kalt war. Zuerst wusste sie gar nicht, wie sie auf die Couch kam, dann fiel ihr all das Schreckliche des vergangenen Abends wieder ein.
»Mama, Mutsch«, murmelte sie. Sicher war ihre Mutter nun bereits operiert. Hoffentlich war alles gutgegangen! Aber eine Blinddarmoperation ist ja heutzutage nicht mehr schlimm, sagte sie sich.
Sie richtete sich auf, rieb sich die Augen und sah auf die Uhr. Sie lächelte kläglich. Nun war sie bereits vierzehn Jahre alt! Der Tag hatte für sie so froh und heiter werden sollen.
Miriam entkleidete sich und kroch ins Bett. Aber die verlassene Wohnung war schrecklich. Sie konnte nicht schlafen, sondern musste nur immerfort an ihre Mutter denken.
***
An deren Bett standen inzwischen mehrere Ärzte und machten bedenkliche Gesichter. Der Chefarzt war Hals über Kopf aus dem Bett getrommelt und in die Klinik geholt worden.
»Warum warten die Menschen nur immer so lange, bis sie einen Arzt rufen«, murmelte der leitende Arzt und sah in das blasse Gesicht der Frischoperierten, die noch in der Narkose lag.
Die anderen Mediziner nickten. Sie alle wussten, dass ein Wunder geschehen musste, wenn diese junge Frau durchkommen sollte.
»Bitte verständigen Sie morgen früh gleich die Angehörigen«, sagte der Chefarzt, als er noch einmal den Puls von Frau Gabriele fühlte, noch ein paar weitere Anordnungen traf und dann mit leicht nach vorn hängenden Schultern davonging.
Die Aufnahmeschwester bekam am nächsten Morgen heraus, dass die in der Nacht eingelieferte Patientin mit einer Krankenschwester der internen Abteilung identisch war. Und bald wusste jeder, dass Gabriele, die in der Intensivstation lag, Professor Schröters Mitarbeiterin war.
Gabriele war aus der Narkose erwacht. Sie hatte allerdings hohes Fieber, aber sie wusste, wo sie sich befand. Sie fühlte sich sehr schwach. Aber das war es nicht, was sie beunruhigte. Sie lag auf der Intensivstation – das allein sagte ihr genug. Ihr Kopf schmerzte und sie musste sich anstrengen, wenn sie nachdenken wollte.
Gabriele schloss die Augen. Mein Gott, sie konnte und durfte doch nicht an einer Blinddarmoperation sterben und Miriam allein zurücklassen!
Ihr Blinddarm war also geplatzt gewesen! Ihr Kopf schmerzte wieder! Sie hatte Durst.
»Wasser«, murmelte sie.
»Es tut mir leid, trinken dürfen Sie nicht!« Die Schwester sah sie voller Mitleid an und benetzte dann ihre Lippen mit Wasser.
Der Chefarzt kam. Gabriele kannte den Professor. Er untersuchte sie. Und sie bekam wieder einen Beweis dafür, wie schlecht es um sie stand.
»Wie geht es mir?«, fragte sie. Gabriele beobachtete ihn und sah das ärztlich hoffnungsvolle Lächeln auf seinen Zügen. Sie kannte es, hatte es doch selbst schon so manches liebe Mal an Krankenbetten aufgesetzt.
Sie schloss die Augen, den Kopf bewegen vermochte sie der Schläuche wegen nicht.
»Ich muss also sterben«, sagte sie tonlos.
»Aber, aber ... Frau ...« Er wusste ihren Namen nicht, wusste auch nicht, dass sie selbst Krankenschwester war. Für ihn war sie ein Fall, ein sehr schwerer Fall.
»Späher ist mein Name, und ich bin selbst Krankenschwester«, sagte sie so fest, wie sie es vermochte. »Sie brauchen nicht zu fürchten, dass ich hysterisch werde, wenn ich die Wahrheit weiß.« Das Sprechen fiel ihr schwer, das Denken machte ihr Mühe. »Aber ich habe noch ein Kind – vierzehn Jahre wird meine Tochter heute«, fuhr sie fort, während ein wehes Lächeln um ihre Lippen huschte. »Ich muss ihr noch manches sagen, Herr Doktor. Ich habe auf dieser Welt noch nicht alles geordnet ... die Krankheit überfiel mich so plötzlich, wie ja fast immer«, schloss sie leise.
Der Arzt räusperte sich. »Es steht in der Tat nicht gut um Sie, Frau Späher«, sagte er zögernd und beobachtete Gabriele. Er war sich nicht sicher, ob sie diese Nachricht tatsächlich gefasst aufnahm.
Und sie tat es. Sie zuckte wohl leicht zusammen und nickte dann.
»Ich fühle es ... und sehe es. Wie ... lange bleibt mir noch?«