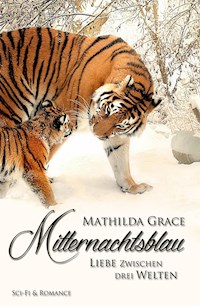
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tom Markson weiß, dass sein neuer Auftraggeber ihn belügt, doch einen zerstreuten Genetiker und dessen Sohn auf Urlaubsreise zu begleiten, hört sich nach einem leichten Job an. Vater und Sohn planen einen Roadtrip durch die USA hoch nach Kanada. Wozu sie dabei einen Söldner brauchen ist Tom schleierhaft, aber die Bezahlung ist gut und dann ist da noch Seth. Ein Kind, das ihn auf eine ungesunde Weise anzieht. Tom ist entsetzt, denn er hat sich nie für Kinder interessiert und hält Abstand zu dem Jungen, der bei jeder Gelegenheit seine Nähe sucht und ihn damit immer wieder in Bedrängnis bringt. Nach fünf Tagen wirft Tom den Auftrag schließlich hin, doch da ist es längst zu spät, denn Seth ist kein Kind und er will den Mann, den er erwählt hat, nicht mehr gehen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mathilda Grace
MITTERNACHTSBLAU
Mitternachtsblau
1. Auflage, November 2019
Impressum
© 2019 Mathilda Grace
Am Chursbusch 12, 44879 Bochum
Text: Mathilda Grace 2017/2018
Foto: Sponchia; Pixabay
Coverdesign: Mathilda Grace
Korrektorat: Corina Ponta
Web: www.mathilda-grace.de
Alle Rechte vorbehalten. Auszug und Nachdruck, auch einzelner Teile, nur mit Genehmigung der Autorin.
Sämtliche Personen und Handlungen sind frei erfunden.
Mitternachtsblau enthält homoerotische Handlungen.
Mathilda Grace
Sci-Fi & Romance
Liebe Leserin, Lieber Leser,
ohne deine Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit könnte ich nicht in meinem Traumberuf arbeiten.
Mit deinem Kauf dieses E-Books schaffst du die Grundlage für viele weitere Geschichten aus meiner Feder, die dir in Zukunft hoffentlich wundervolle Lesestunden bescheren werden.
Dankeschön.
Liebe Grüße
Mathilda Grace
Tom Markson weiß, dass sein neuer Auftraggeber ihn belügt, doch einen zerstreuten Genetiker und dessen Sohn auf Urlaubsreise zu begleiten, hört sich nach einem leichten Job an. Vater und Sohn planen einen Roadtrip durch die USA hoch nach Kanada. Wozu sie dabei einen Söldner brauchen ist Tom schleierhaft, aber die Bezahlung ist gut und dann ist da noch Seth. Ein Kind, das ihn auf eine ungesunde Weise anzieht. Tom ist entsetzt, denn er hat sich nie für Kinder interessiert und hält Abstand zu dem Jungen, der bei jeder Gelegenheit seine Nähe sucht und ihn damit immer wieder in Bedrängnis bringt. Nach fünf Tagen wirft Tom den Auftrag schließlich hin, doch da ist es längst zu spät, denn Seth ist kein Kind und er will den Mann, den er erwählt hat, nicht mehr gehen lassen.
Prolog
Tom
Kriege sind ein Milliardengeschäft.
Darum gibt es auch so viele davon.
Es ist für die meisten Regierungen heutzutage profitabler, ihre Waffen in Kriegsgebiete zu liefern, statt sich engagiert um einen hoffentlich andauernden Frieden zu bemühen. Die jährlichen Absatzzahlen von Waffen und Militärgerät aller Art gehen in die Millionen. Die des Profits in die Milliarden.
Ich hatte allerdings schon alle Freunde verloren, als ich mit Mitte Dreißig endlich begriff, dass nichts Gutes daran war, in einem von Dürre geplagten Land humanitäre Hilfe zu leisten, wenn die Einheimischen unsere neu gebauten Brunnen in den Nächten wieder abrissen, da ihnen die Maschinen und Bauteile auf dem Schwarzmarkt mehr Geld einbrachten, als sie je zuvor besessen hatten und auch nie wieder besitzen würden. Es war in meinen Augen auch nichts Gutes daran, heimischen Rebellen oder den Regierungstruppen zu helfen, die sich mit Waffen bekämpften, die wir ihnen geliefert hatten.
An Kriegen ist überhaupt nichts gut, aber dennoch blieb ich an der Front, denn all das Leid und der Tod brachten mir eine Menge Geld. Auslandseinsätze werden verdammt gut bezahlt, vor allem mit vielen Dienstjahren auf dem Buckel.
Doch irgendwann begannen die Kriege noch schmutziger zu werden. Noch tödlicher. Biologische Kriegsführung. Häuser blieben unbeschädigt, während die Menschen in ihnen starben wie die sprichwörtlichen Fliegen. Eine vollkommen neue Art, um Kämpfe für sich zu entscheiden, aber wie immer hielt die erste Empörung der Welt nicht lange an.
Es gibt einfach zu viele Schlachten zu schlagen, wen stört da schon ein ausgerottetes Dorf irgendwo in einer namenlosen Wüste, um an die vorhandenen Bodenschätze zu kommen. In diese Gegenden setzt kein Reporter jemals einen Fuß, und falls es doch mal ein Mutiger versucht, wird er aus Versehen von einer Drohne mit Fehlfunktion getötet oder verschwindet für immer in den unendlichen Weiten zwischen vertrockneten Bäumen und Sanddünen.
Ich war sehr viele Jahre nicht besser als diejenigen, die uns regelmäßig mit Kanistern voller Giftgas und großen Kisten, bis zum Rand mit Waffen gefüllt, versorgten.
Sie lieferten den Tod, wir töteten.
Ich tötete.
Doch selbst ein völlig abgestumpfter Soldat, wie ich einer war, erreicht eines Tages den Punkt, an dem es genug ist. Bei mir war es ein Einsatz im Sudan. Dabei waren wir eigentlich nur dort, um aufzuräumen. Ein hinterhältiger Giftgasanschlag, durchgeführt von irgendeiner unbekannten Gruppe. Niemand hatte sich zu dem Anschlag bekannt und tat es auch nie. Mein Team wurde geschickt, um die Leichen zu bergen, weil das Gas ursprünglich von uns stammte. Also bargen wir die Leichen, um unseren guten Willen zu zeigen.
Einundzwanzig Erwachsene und mehr als fünfzig Kinder. Gestorben in der einzigen Schule der Gegend.
Ein Job wie jeder andere. Eigentlich.
Doch an diesem Tag rastete irgendetwas in mir aus. Ich hatte beinahe zwanzig Jahre lang alles ertragen, jeden Befehl befolgt, war gegangen, wohin man mich schickte – aber der Anblick dieser toten Kinder war zu viel.
Dabei hatte ich schon weitaus Schlimmeres gesehen. Selbst Leichen von Kindern waren bisher nichts Besonderes für mich, aber dann erreichte ihr viel zu früher Tod an dem Tag das, was sonst vielleicht keinem jemals gelungen wäre.
Ich hörte auf, ein schweigender, willenloser Soldat zu sein. Stattdessen wurde ich zu einem selbst denkenden Menschen, der den Anblick der toten Kinder einfach nicht verkraftete.
Nach einem Tag wollte ich keine Waffe mehr anfassen.
Nach zwei Tagen verweigerte ich zum allerersten Mal in meinem Leben einen Befehl.
Nach acht Tagen verprügelte ich einen jungen Private, der mich aus der Einzelhaft holte, als er dabei einen Scherz über die ermordeten Kinder machte.
Am selben Tag wurde ich als psychisch instabil eingestuft.
Am nächsten Tag schickte man mich heim.
Heim in eine Welt, die ich nicht mehr kannte, wo niemand auf mich wartete, in die ich nicht mehr gehörte. Man flog mich zurück in die Staaten, in der Tasche ein Attest und die höfliche Aufforderung, mich in der Heimat an einen Psychologen mit Traumaerfahrung zu wenden, was ich natürlich nicht tat. Mein Ziel, aus dem aktiven Dienst entlassen zu werden, hatte ich mit dem Attest erreicht, und nach Zahlung einer netten Abfindung und der Unterschrift auf einem Blatt Papier, das mir befahl auf ewig Stillschweigen über all meine Einsätze und das Erlebte zu bewahren, war ich frei.
Ein Zivilist.
Ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung.
Dafür mit einem halben Leben an Kriegserfahrung auf dem Buckel und mit genügend Geld in der Tasche, um wenigstens ein Jahr gut über die Runden zu kommen.
Aber so ein Jahr geht schnell vorbei, und als schließlich die Frage aufkam, womit ich in Zukunft mein Geld verdienen soll, um mir den Magen zu füllen und ein Dach über dem Kopf zu haben, entschied ich mich für das, was ich ohnehin am besten konnte, nur ab sofort zu meinen Bedingungen.
Ich wurde Söldner.
Kapitel 1
Tom
»Bist du sicher, Seth?«
Der Junge begann zu grinsen und nickte.
»Wirklich?«, fragte sein Vater zweifelnd, während ich kurz davor stand, dem hübschen Bengel einfach einen Schubs vom Steg ins Wasser zu geben. Wenn er hier unbedingt schwimmen gehen wollte, was sprach denn dagegen? Nicht das Geringste, aber der werte Professor war leider übervorsichtig, was seinen Sprössling anging, und das ging mir langsam auf die Nerven, dabei waren wir noch keine zwei Tage unterwegs.
Bodyguard für Papa und Junior auf einem Roadtrip durch die USA spielen. Was ich mir dabei gedacht hatte, wusste wohl nur der liebe Gott, dabei war ich weder gläubig noch hatte ich vor, es jemals zu werden. Also war vermutlich die fünfstellige Summe der Grund, die ich für einen Job von ein paar Wochen Dauer bekam. Ein leichter Job, was meine innere Alarmglocke schon warnend hatte aufheulen lassen, da hatte der zerstreute Professor sein verlockendes Angebot noch nicht mal zu Ende ausgesprochen.
Kurz gesagt, ich traute Professor Doktor Irgendwas Robert Richards nicht über den Weg. Ein erfolgreicher und bis zum Hals in Arbeit steckender Genetiker machte keinen Roadtrip quer durch die USA. Schon gar nicht mit seinem zwölfjährigen Sohn im Schlepptau, zu dem es keine Mutter gab.
Ich hatte mich über Richards schlau gemacht und sein Titel und der andere Kram stimmten, soweit ich an Informationen über ihn herangekommen war. Aber offiziell gab es kein Kind in seinem Lebenslauf auf der Webseite des Weltkonzerns, für den er arbeitete. Oder besser gesagt gearbeitet hatte, denn die Unterschrift auf seiner Kündigung war derart frisch, dass es in meinen Augen gleich noch mal verdächtig war.
Ich fand nur keine Beweise, um ihn damit zu konfrontieren, denn was Seth anging, war seine Begründung, sein Privatleben privat zu halten, hieb- und stichfest.
Dagegen konnte ich nicht argumentieren und nach außen hin sah alles danach aus, als hätte Professor Richards offiziell vor ein paar Wochen seinen Job gekündigt und wollte jetzt Zeit mit seinem Sohn verbringen, bevor er sich um eine neue Arbeit kümmerte. Grundsätzlich war ihm das positiv anzurechnen, denn welcher hochdekorierte Wissenschaftler tat das schon?
Mein Problem dabei war nur, dass der liebe Doc alles, was wir taten, mit Bargeld bezahlte, das er entweder bei sich trug oder irgendwo herzauberte, denn er benutzte nirgends seine Kreditkarte. Weder bei unseren Einkäufen noch bei den Hotels, in denen wir übernachteten. Das war zwar grundsätzlich kein richtiger Beweis, immerhin gab es gerade auf dem Land noch genügend Menschen, die ausschließlich Bargeld nutzten, aber ich wusste trotzdem, dass irgendetwas an dieser ganzen Sache nicht stimmte.
Wenn man lange genug in der Armee dient und außerdem im Ausland ständig damit beschäftigt ist, nicht hinterrücks von Heckenschützen ermordet zu werden, entwickelt man einen verdammt guten Instinkt für Menschen und Situationen. Und mein Instinkt sagte mir eindeutig, dass an dem höflichen Doc und seinem niedlichen Bengel etwas oberfaul war. Allerdings standen meinem misstrauischen Instinkt zehntausend Dollar gegenüber, die ich verdammt gut gebrauchen konnte, deshalb hatte ich schlussendlich zugesagt, als Richards anrief, um mich zu fragen, ob ich Junior und ihn als Beschützer begleitete.
Beschützer. Was für ein Witz.
Ich saß seit gestern die meiste Zeit faul in der Sonne herum und tat nichts weiter, als Seth dabei zu beobachten, wie er ein Buch nach dem anderen durchsah, mit kindlichem Erstaunen von seinem Vater alles über die hiesige Natur und ihre Tiere wissen wollte, oder, so wie jetzt, sämtliche Überredungskunst einsetzte, damit er in den See springen konnte, auf dessen Steg wir es uns vor einer Stunde gemütlich gemacht hatten.
Das Gewässer gehörte zum familiär geführten Hotelbetrieb und man hatte uns wärmstens ans Herz gelegt, das herrliche Frühsommerwetter auszunutzen und eine Runde schwimmen zu gehen. Oder zu wandern, denn die Gegend war angeblich ein wahres Mekka für Naturfreunde und Kletterer. Das glaubte ich sogar, denn es war nicht zu übersehen, dass wir uns bereits an den Ausläufern der Rocky Mountains befanden. Wir würden allerdings nicht lange genug bleiben, um die Naturwunder von Colorado gebührlich bewundern zu können, denn bereits morgen ging es weiter Richtung Wyoming.
»Du kannst noch nicht gut schwimmen.«
»Dad«, stöhnte Seth lang gezogen und ich verkniff mir ein Lachen. Offenbar nicht sonderlich gut, denn er grinste mich an, was wiederum seinem Vater auffiel, der mir daraufhin einen resignierten Blick zuwarf.
»Was?«, gab ich mich unschuldig. »Es ist fünfundzwanzig Grad warm und die Sonne scheint schon seit vielen Tagen fast ununterbrochen. Das Wasser dürfte also warm genug sein, und der Tümpel sieht mir außerdem nicht danach aus, als würde Seth in weniger als zwei Minuten von einem riesigen Weißen Hai gefressen.«
»Sie sind nicht hilfreich.«
Das hatte man mir in meinem Leben sehr oft vorgeworfen, allerdings war es noch nie von einem behütenden Vater gesagt worden. Ich war darüber ziemlich amüsiert. »Und Sie sind viel zu vorsichtig. Wir sind hier zu zweit und ich kann definitiv schwimmen. Seth kann also gar nicht absaufen.«
»Ich kann auch schwimmen«, mischte sich Seth ein und sah seinen Vater abwartend an.
»Aber erst seit Kurzem«, hielt der Doc dagegen und da war ich nicht der Einzige, der die Augen verdrehte, auch wenn Seth die genervte Geste hinter einem Schnauben versteckte.
»Na und? Tom rettet mich, wenn ich … äh … absaufe?«
Er klang, als hätte er das Wort noch nie gehört, und das ließ mich nicht zum ersten Mal die Stirn runzeln, denn es gab eine Menge, was der Junge nicht wusste. Zu viel für ein Kind seines Alters, aber dafür konnte es mehrere Erklärungen geben. Eine schwere Krankheit zum Beispiel oder vielleicht war Seth auch einfach nur sehr behütet aufgewachsen. Das würde zumindest seine Begeisterung und Neugier für alles in der Natur erklären, und vor allem die merkwürdige Tatsache, dass sein Wortschatz nicht gerade der Beste war. Und es erklärte ebenfalls, wieso der Doc offiziell überhaupt kein Kind hatte, denn falls die Mutter gestorben war und Seth bei ihr gelebt hatte …
Ja, das erklärte so einiges. Ich würde Richards heute Abend danach fragen, denn auch wenn er mich nur für meinen Schutz bezahlte, hieß das nicht, dass ich dazu bereit war, die berühmte Katze im Sack zu kaufen. Obwohl ich das längst getan hatte, das war mir durchaus bewusst. Aber zehntausend Dollar sind nun mal zehntausend Dollar. Und die würden mich für einige Monate über die Runden bringen, ohne sofort den nächsten Job für ein superreiches Papasöhnchen annehmen zu müssen, das zu dämlich war, sich die Schuhe zu binden.
»Genau, ich rette ihn«, stimmte ich dem Jungen feixend zu, damit er endlich ins Wasser kam, denn da wollte er unbedingt hin, seinem verträumten Blick auf die Wasseroberfläche nach zu urteilen, und schließlich gab sein Vater mit einem lässigen Schulterzucken nach.
»Na dann los. Aber schwimm bitte nicht weit raus.«
»Mach ich nicht«, versprach Seth ernst und sein Vater und ich grinsten, als er daraufhin einfach Anlauf nahm und in den See sprang.
Es dauerte nicht lange, bis er wieder auftauchte, etwas Wasser ausspuckte und lachte. Ein völlig normales Kind. Das allerdings wirklich nicht sehr gut schwimmen konnte, erkannte ich schnell und stand auf, um mich ans Ende des Stegs zu setzen, weil ich sehen wollte, wie er seine Beine einsetzte. Himmel, er strampelte herum wie ein ungelenkes Kleinkind. Das reichte, um sich über Wasser zu halten, aber für mehr auch nicht. In einem Gewässer mit Strömung wäre er verloren.
»Nicht so hektisch.«
»Was?«, fragte er verständnislos und ich bewegte die Beine langsam in einer gleichmäßigen Bewegung vor und zurück. Er sah mir zu und probierte es aus. »Verstehe«, murmelte er und winkte mit den Fingern. »Und meine Arme?«
Ich zeigte es ihm. »Lass dich einfach treiben. Das Wasser ist ruhig und hat kaum Strömung. Ins Meer würde ich dich nicht lassen, dazu fehlt dir die Übung. Ja, genau so ...« Ich nickte ihm zu, denn er bekam den richtigen Dreh schnell raus. »Siehst du? Geht sofort leichter, oder?«
Seth strahlte mich an. »Ja. Vielen Dank.«
Ich winkte lächelnd ab. »Kein Thema.«
»Was ist kein Thema?«
Ach ja, der Wortschatz. Ich winkte erneut ab. »Das war nur so ein Spruch. Kein Thema bedeutet in dem Fall: Kein Problem, ich habe dir gerne geholfen.« Und das stimmte auch, denn der Junge war nett und genauso neugierig wie ich als kleines Kind. Mir fiel etwas ein. »Seth, versuch nicht zu tauchen, okay?«
»Warum nicht?«, fragte er und an seinem Gesichtsausdruck erkannte ich, dass er genau das vorgehabt hatte. Aber mit den kaum vorhandenen Schwimmkenntnissen war mir die Gefahr zu groß, dass er unter Wasser in Panik geriet und ertrank. Erst einmal reichte es in meinen Augen vollkommen aus, dass sein Kopf oberhalb des Wassers blieb.
»Weil du das vernünftig lernen musst«, antwortete ich und warf ihm einen unmissverständlichen Blick zu. »Du könntest sonst leicht ertrinken.«
Seth nickte. »Verstehe. Ich versuche es nicht.«
Wohlerzogen, höflich und doch von Tuten und Blasen nicht die geringste oder zumindest wenig Ahnung. In welcher Höhle der Junge auch aufgewachsen war, hier draußen, in der Sonne und an der frischen Luft, mit seinem Vater an der Seite, war er eindeutig besser aufgehoben. Den Rest würde hoffentlich die Zeit erledigen. Und wahrscheinlich unzählige Stunden teurer Nachhilfeunterricht, sobald Seth wieder zur Schule ging. Wann immer das auch sein würde. Noch eine Frage, auf die ich keine Antwort wusste, denn wir hatten Juni und die Sommerferien starteten oftmals erst im Juli.
Andererseits war das von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden und wenn Seth gerade erst seine Mutter verloren hatte, war er wahrscheinlich für den Rest des Schuljahres vom Unterricht freigestellt. Vor allem, da sein Vater plante, mit ihm nach Kanada umzusiedeln.
Ich beobachtete Seth noch ein paar Minuten, doch er lernte wirklich schnell, und als ich mir sicher war, dass ich nicht im nächsten Moment einen Kopfsprung vom Steg machen musste, um ihn vor dem Ertrinken zu retten, sah ich mich nach seinem Vater um, der uns schmunzelnd beobachtete.
»Was?«, fragte ich und bedankte mich mit einem Nicken, als er zu mir kam und mir eine Wasserflasche reichte.
»Sie gehen gut mit ihm um.«
Ich zuckte die Schultern und trank einen Schluck. »Ich habe nichts gegen Kinder.«
»Wollen Sie irgendwann welche?«
»Nein«, antwortete ich, denn Kinder standen definitiv nicht auf meinem Lebensplan. Richards war sichtlich überrascht und ich warf einen prüfenden Blick auf Seth, der von irgendwoher eine Seerose hatte, die er gerade ganz genau betrachtete. »Seth? Das ist eine Seerose.«
»Danke«, rief er und das brachte mich wieder einmal zum Grinsen. Bis mir auffiel, dass die Gelegenheit, mit Richards ein paar Dinge zu klären, gerade mehr als günstig war.
»Wie ist seine Mutter gestorben?«, fragte ich daher und als der Doc daraufhin heftig zusammenzuckte, begriff ich, dass ich mit der Frage mitten in ein Wespennest gestochen hatte.
»Wie kommen Sie darauf, dass sie …?«
Er verstummte und mied meinen Blick, was mir so einiges über ihn verriet. Unter anderem, dass ich auf meinen Instinkt von Anfang an hätte hören sollen. Die Sache war mehr als faul, aber die Einsicht kam jetzt zu spät, denn ich hatte sein Geld genommen, also würde ich ihn und Seth nach Kanada bringen. Außerdem konnte der Junge nichts dafür, dass sein Vater ein Lügner war.
»Versuchen wir es mal anders … Ich spekuliere, Sie hören zu und am Ende sagen Sie mir, ob ich richtig liege.«
»Mister Markson ...«
»Tom.«
»Tom, Sie können nicht … Das ist nicht so einfach.«
Ja, das war mir mittlerweile auch klar, es änderte nur nichts daran, dass ich Antworten wollte, und ich wollte sie jetzt. »Seth spricht zu schlecht für einen Jungen seines Alters. Noch dazu ist er entschieden zu höflich für einen Zwölfjährigen. Ich will ihm nicht unterstellen, dumm zu sein, im Gegenteil, dafür lernt er zu schnell. Aber er sieht Pflanzen und Tiere an, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen, und Sie werfen ihm manchmal Blicke zu, als könnten Sie nicht glauben, dass es ihn gibt.«
Richards seufzte leise, richtete den Blick auf seinen Sohn und dann sackten seine Schultern etwas herab. »Es stimmt. Bis vor ein paar Monaten wusste ich nicht mal, dass Seth existiert. Er ist an einem Ort aufgewachsen, der so abgeschottet ist, dass er vieles überhaupt nicht kennt. Aber ich möchte, dass sich das ändert. Darum unternehmen wir diese Reise. Ich möchte, dass er die Welt kennenlernt, denn ein Kind sollte jeden Tag spielen, durch die Gegend toben und lauthals lachen dürfen. Ich will, dass er endlich ein normaler Junge sein darf.«
Wahrscheinlich hatte Seth sein ganzes, bisheriges Leben in einem Internat oder irgendeiner anderen, privaten Einrichtung verbracht, in die man nur dann einen Fuß setzen durfte, wenn man steinreich war. Und als, aus welchem Grund auch immer, die mütterliche Geldquelle versiegt war, hatte man Seths Vater ausfindig gemacht und ihm den Jungen aufs Auge gedrückt.
»Und seine Mutter?«, fragte ich, doch da presste Richards die Lippen zusammen und schwieg. Aha, definitiv ein wunder Punkt. Ich entschied, es dabei zu belassen. Zumindest vorerst. »Was wollen Sie eigentlich tun, sobald Sie mit Seth in Kanada angekommen sind?«
Jetzt sah Richards mich an. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. So weit gehen meine Planungen nicht. Ich bin immer noch dabei, mich daran zu gewöhnen, auf einmal Vater eines Sohnes zu sein.«
Das konnte ich verstehen. Würde bei mir plötzlich ein Kind vor der Tür stehen, das ich angeblich gezeugt hatte …
Nein, es gab Dinge, über die dachte ich besser nicht mal im Traum nach. Ich hatte nie Kinder gewollt und würde auch nie welche haben. Es sei denn, wir Männer entwickelten in naher Zukunft die Fähigkeit welche auszutragen. Aber das war reine Utopie und für alles andere gab es Kondome.
Ich würde auf keinen Fall so verrückt sein, mir ein Kind ans Bein zu binden. Nicht bei meinem unsteten Leben und all den anderen Problemen, die ich mit mir herumschleppte.
Kapitel 2
Seth
Diese Erde war so anders und gleichzeitig doch so vertraut. Das Licht, die Farben, die Gerüche, die Geräusche – ich kannte all das und doch nichts davon.
Ich träumte von Dingen, die es auf der Erde nicht gab und von denen ich doch wusste, dass sie existierten. Nur eben nicht hier. Ich war nicht von dieser Welt und dennoch gehörte ich auf eine gewisse Weise dazu. Durch jene Teile von mir, die Robert mir im Labor gegeben hatte. Das starke Tier, das ich von Tag zu Tag mehr in meinen Adern, meinen Knochen und in meinen Sehnen fühlen konnte. Der Mensch, den Robert von sich selbst an mich weitergegeben hatte. Und dies war der Teil, der mein Leben hier überhaupt erst möglich machte.
Aber da gab es auch noch diesen dritten Teil in mir, der so vollkommen anders war als das, was auf der Erde als »normal« galt. Jener dritte Teil, der langsam erwachte und der mir, ginge es nach einigen Menschen im Labor, den Tod bringen sollte.
»Seth? Brauchst du noch lange?«
»Nein, Dad.«
»Vergiss das Zähne putzen nicht.«
»Ja, Dad.«
Robert lachte nebenan leise und ich lächelte in den Spiegel, grinste dieses Gesicht an, das nicht meines war, aber irgendwie auch doch. Es gab so vieles von Robert in diesem Gesicht, doch ich musste immer gut hinsehen, wenn ich es betrachten wollte. Ich hatte seine Nase und seine Ohren, aber nicht seine Augen. Die waren anders. Nicht nur in der Farbe. Sie lagen auch ganz anders als in Roberts Gesicht.
Im Labor hatte einer der übrigen Wissenschaftler einmal zu Robert gesagt, ich hätte die Augen eines widerlichen Raubtiers und man sollte mich besser vergasen. Das verstand ich nicht, hatte aber auch nicht danach fragen wollen, denn Robert war nach diesen Worten sehr wütend geworden.
Kurz darauf hatten wir das Labor überstürzt verlassen und seither war er für mich Dad.
Dad, Vater, Papa.
Robert hatte mir diese Wörter erklärt und mir auch gesagt, warum ich sie benutzen musste, solange Tom bei uns war oder andere Menschen in der Nähe. Wir durften nicht auffallen, um unsere Flucht nicht zu gefährden. Und wir durften vor allem nicht erwischt werden, weil sonst mein Leben in Gefahr war.
Dieses Leben, das so seltsam für mich war und gleichzeitig so schön. Die Erde war voll mit erstaunlichen Wundern, die ich unbedingt alle entdecken wollte. So wie das angenehm kühle Wasser heute Nachmittag im See, der Duft dieser Seerose oder der eklige Geruch von den Autos, die vor dem Hotel standen.
Toms anziehender Geruch.
Ich schürzte nachdenklich meine Lippen. Woher war dieser Gedanke jetzt gekommen? Ich hatte ihn nicht zum ersten Mal, seit Robert mir Tom vorgestellt hatte, und jedes Mal drängte es mich nur noch stärker in seine Richtung, um näher zu diesem erdigen, ruhigen und ganz wunderbaren Duft nach Kraft und Schutz zu kommen.
Ich musste Tom Markson für mich haben. Und zwar schon sehr bald. Warum ich das wollte, dafür hatte ich absolut keine Erklärung. Ich wusste nicht mal, was es überhaupt bedeutete, jemanden für sich haben zu wollen.
Aber eines wusste ich sicher, nämlich, dass er Mein war.
Mein ganz allein.
Niemand sonst durfte ihn haben. Niemals.
»Seth?«
Mein Blick wanderte zum Spiegel und ich entdeckte Robert an der Tür stehen, der mich neugierig ansah. »Ja?«, fragte ich und da trat er näher, strich mit einer Hand über meine Wange.
»Deine Augen sind ganz dunkel. Fast schon schwarz. Hast du wieder an Tom gedacht?«
Er wusste von meinem inneren Drang Tom betreffend, aber auch er hatte keine Erklärung dafür. Robert vermutete, dass es an dem dritten Teil in mir lag. Dass der außerirdische Teil, tief in meinen Genen, Tom haben wollte. Wozu auch immer. Robert wusste so viele Dinge über diese faszinierende Welt, aber was mich anging, war er oftmals noch ratloser als ich selbst. Aber das war in Ordnung für mich, denn ich wusste, dass er mir nichts Böses wollte. Trotz der Tests und Untersuchungen, die ich immer weniger mochte, war Robert das, was er immer als »guten Mann« betitelte. Und Tom war auch ein guter Mann.
Ganz im Gegensatz zu Colonel Jared Trusk aus dem Labor, dem ich auf keinen Fall in die Hände fallen durfte, und der mit Sicherheit längst auf der Suche nach uns war.
»Darf ich?«, fragte Robert und ich konnte sein Unbehagen so stark aus diesen beiden Worten heraushören, dass mir schon klar war, was er wollte, bevor er mir die Spritze zeigte.
»Nicht mehr lange«, sagte ich und hielt ihm den Arm hin, damit er mir Blut abnehmen konnte. Das tat er regelmäßig, um meine Entwicklung zu überwachen, wie er es nannte.
»Was meinst du damit, nicht mehr lange?«, wollte Robert von mir wissen und ich runzelte überlegend die Stirn, aber es war mehr eine Art inneres Gefühl gewesen, das ich dringend in Worte hatte fassen müssen.
»Ich weiß es nicht.«
Robert nickte und machte sich ans Werk. Er agierte schnell und sicher, ich merkte den Stich der Nadel kaum noch, und als er fertig war, bedankte er sich, wie er es immer tat.
Er war der einzige Mensch im Labor gewesen, der sich vom Tag meiner Geburt an immer freundlich und anständig mir gegenüber benommen hatte. Die anderen hatten Angst vor mir gehabt oder waren einfach gemein gewesen, weil ich für sie nur ein Subjekt war, das sie bis zur allerletzten Zelle ausbeuten wollten. Robert hatte mich niemals so gesehen und daher hatte ich keine Sekunde gezögert, als er im letzten Monat plötzlich mitten in der Nacht in meinen gläsernen Käfig gekommen war und gesagt hatte, dass wir sofort gehen müssten.
Und hier waren wir nun.
An einem Ort, den man als Hotel bezeichnete, irgendwo in der Mitte der USA, weit weg von der Anlage im Osten, wo ich geboren worden war. Wirklich sicher würden wir jedoch erst in einem Land namens Kanada sein, aber bis dorthin lag noch ein weiter Weg vor uns.
Robert schmunzelte, als ich gähnte. »Ab ins Bett mit dir. Es ist schon spät.«
»Kommst du auch?«, fragte ich, weil ich seit ein paar Tagen in den Nächten ständig fror und Roberts Körperwärme machte diese innere Kälte ein wenig erträglicher.
»Ich erledige die Schnelltests und dusche danach, dann bin ich wärmer für dich«, antwortete er und strich mir lächelnd durchs Haar. »Ich liebe dich, Seth, und ich hoffe, dass du eines Tages verstehst, was diese Worte bedeuten und wie wichtig sie für uns Menschen sind.«
Kapitel 3
Tom
Mein Brummschädel fiel Richards beim Frühstück am nächsten Morgen schnell auf, aber er sagte nichts dazu, denn er hatte genug damit zu tun, Seth auf seinem Stuhl zu halten, der unbedingt noch eine Runde schwimmen gehen wollte, ehe wir unseren Mietwagen vollluden und uns in Richtung Norden auf den Weg machten.
Schließlich gab er sich den ständigen Bitten seines Sohnes geschlagen und ich war insgeheim heilfroh darüber, denn mit meinem Restalkohol im Blut konnte ich mich nie und nimmer hinters Steuer setzen, das wäre zu gefährlich gewesen. Aber ich wollte auf gar keinen Fall Richards fahren lassen und den Unterhalter für Seth spielen müssen, das würden meine armen Nerven heute nicht durchhalten.
Kaffee. Ich brauchte Kaffee. Und zwar jede Menge davon und so schwarz wie nur möglich. Dazu etwas Vernünftiges zu essen und danach war ich startklar. Hoffentlich.
Richards schien davon allerdings nicht überzeugt zu sein, denn nach dem Frühstück wurde ich doch zum Aufpasser von Seth verdonnert, damit sein Vater in Ruhe unser Zeug packen und auschecken konnte. Wie gut, dass ich es aus der Armeezeit gewohnt war, direkt nach dem Aufstehen meinen Kram in aller Eile zusammenzupacken. So würde Richards nur eine volle Reisetasche auf dem Bett vorfinden, die keinerlei Verdacht erregte, da ich mein Messer bereits an meinem Knöchel unter der Hose und die Waffe nicht sichtbar unter der dünnen Jacke bei mir trug.
Seth kletterte mithilfe der seitlich angebrachten Leiter auf den Steg und setzte sich neben mich. Ich reichte ihm wortlos ein Handtuch zum Abtrocknen und widmete mich dann mit Inbrunst meiner dritten Tasse von einem umwerfenden Kaffee, der, gemeinsam mit den Schmerztabletten, die man netterweise an der Rezeption für mich gehabt hatte, langsam den Kampf gegen die Kopfschmerzen gewann. Ich hatte es gestern Abend wirklich übertrieben und war dementsprechend mit mir und meinem Elend beschäftigt, sodass mir erst recht spät auffiel, dass Seth die ganze Zeit schwieg.
»Alles in Ordnung, Kleiner?«, fragte ich, als mir Seths Ruhe schließlich unheimlich wurde.
»Du riechst komisch.«
Mist. Vielleicht hätte ich mir die Zähne doch lieber zweimal putzen sollen. Oder das nächste Mal rechtzeitig daran denken, neue Pfefferminzbonbons zu kaufen. Mein Vorrat war nämlich schon seit letzter Woche aufgebraucht und ich hatte einfach nicht daran gedacht, mir vor dem Aufbruch mit Richards und seinem Jungen ein paar neue Tüten zu besorgen.
»Hey, ich war vorhin duschen«, versuchte ich es mit einem Scherz, der allerdings mächtig nach hinten losging, denn statt zu lachen, runzelte Seth nachdenklich die Stirn.
»Du bist sauber, aber du riechst trotzdem komisch.«
Er roch dafür umso besser. Was mich vollkommen entsetzte und schockiert ein Stück von Seth abrücken ließ, als mir abrupt klar wurde, was ich da gerade gedacht hatte.
Hatte ich mir letzte Nacht aus Versehen den Verstand weg gesoffen? Das war ein Kind, um Himmels willen! Ein netter, zwölfjähriger Bengel, der mit großer Wahrscheinlichkeit meine Fahne gerochen hatte und damit hoffentlich nichts anfangen konnte. Und ich saß neben ihm auf einem zwei Meter breiten Holzsteg und dachte darüber nach, wie gut er roch?
»Du solltest dich lieber anziehen, wir wollen bald los«, war schlussendlich alles, was mir einfiel, um ihn loszuwerden, und Gott sei Dank funktionierte es, denn Seth stand auf und strich mir kurz über die Schulter, bevor er mich alleinließ.
Und was sollte das nun wieder?
Ich rieb mir schaudernd über die von ihm berührte Stelle. Mein Magen rebellierte auf einmal und mir wurde so übel wie schon lange nicht mehr. Zu viel zu saufen war eine Sache. Ich hatte mich daran gewöhnt und wusste im Allgemeinen, wie viel ich vertrug. Gut, gestern Abend war ein Fehler gewesen, aber ich hatte einfach nicht die Augen schließen können, ohne plötzlich wieder im Sudan zu sein, und war am Ende runter an die zum Hotel gehörende Bar gegangen, um mir eine Flasche Jack Daniels zu besorgen.
Wie gesagt, das Trinken war eine Sache, die zwar ein Fehler war und mich irgendwann umbringen würde, aber ich hatte es wenigstens unter Kontrolle.
Doch das eben entzog sich meiner Kontrolle ganz gewaltig und es ging eindeutig zu weit. Ich durfte auf gar keinen Fall so über ein Kind denken. Ich hatte während meiner Dienstzeit in der Armee Männer getötet, die Kinder auf diese widerwärtige Weise ansahen, und ich hatte dabei nicht den leisesten Hauch eines schlechten Gewissens gehabt.
»Schluss mit der Sauferei«, murmelte ich zu mir selbst und erhob mich kopfschüttelnd, was ich besser gelassen hätte, denn mein Brummschädel reagierte darauf mit einer neuen Welle an Schmerzen. »Scheiße«, schimpfte ich und machte mich auf den Weg ins Hotel. Es wurde Zeit, dass wir hier verschwanden, und wenn ich großes Glück hatte, nahm Seth den Beifahrersitz in Beschlag, sodass ich noch ein paar Stunden schlafen konnte. »Ein toller Bodyguard bist du«, schalt ich mich leise und trug die Tasse ins Restaurant, wo ich sie bekommen hatte.
Auf dem Rückweg zum Auto traf ich mit Seth zusammen, der einen Rucksack bei sich hatte und mir einen dermaßen missbilligenden Blick zuwarf, dass ich eine Gänsehaut bekam. »Was?«, blaffte ich ihn unbeherrscht an und machte dann, dass ich nach draußen kam, als Seth mich merklich irritiert ansah. »Ich fahre!« Richards, der am Wagen wartete, war der nächste, der meine schlechte Laune zu spüren bekam, aber was dann passierte, damit hätte ich nie im Leben gerechnet.
»Du fährst nicht«, knurrte auf einmal Seth hinter mir und ich drehte mich verblüfft zu ihm um. Sein bedrohlicher Blick ließ mich zusammenzucken, wie einen jungen Rekruten vor seinem laut herum brüllenden Ausbilder am ersten Tag in der Grundausbildung. »Dad fährt uns. Du sitzt hinten, bis du nicht mehr stinkst.«
»Sie haben meinen Sohn gehört«, erklärte Richards trocken und stieg ins Auto. Seth folgte ihm und kurz darauf stand ich wie ein Vollidiot allein neben dem Wagen.
Na wunderbar. Tag drei meines angeblich leichten Auftrags und ich hatte es mir mit meinen Auftraggebern, Seth zählte ich jetzt einfach mal dazu, soeben vollends verscherzt.
Das war ein neuer Negativrekord.
Sogar für mich.
Eine kleine Hand strich sanft über meine Wange. Ich lehnte mich seufzend in die Berührung und dämmerte wieder weg, als die Finger blieben, wo sie waren. Das fühlte sich wirklich gut an. Schön. Behaglich. Warm. Ich war zufrieden.
»Lass ihn schlafen, Seth.«
»Er riecht wieder gut.«
»Das kann ich mir vorstellen. Lass ihn trotzdem schlafen, er braucht die Erholung. Ich bringe ihm für unterwegs etwas mit. Was möchtest du essen?«
»Einen Burger und diese … Moment … Pommes? Mit dem weißen Zeug drauf, das mag ich.«
Ich hörte Richards lachen, aber es klang seltsam gedämpft, wie durch Watte. Scheinbar war ich wirklich noch nicht wach. Eher wie in einer Art von Halbschlaf. Seltsam. Hatte ich so was schon mal erlebt? Ich konnte mich nicht daran erinnern.
»Mayonnaise. Bekommst du, aber nur wenn du auch einen Salat dazu isst.«
»Was ist da drin?«
»Überraschung.«
»Robert!«
Wieder dieses Lachen, während mein schlaftrunkenes Hirn sich erstaunt fragte, warum Seth seinen Vater beim Vornamen nannte. Aber irgendwie erschien mir eine Antwort darauf nicht wichtig. Jedenfalls nicht wichtig genug, um jetzt die Augen zu öffnen und aufzuwachen.
Der Burger und die Pommes, die Richards mir mitgebracht hatte, waren längst kalt, als ich sie am Nachmittag förmlich in mich hineinschlang, nachdem ich mit einem heftig knurrenden Magen aufgewacht war.
Sehr zur Belustigung von Seth, der mir einen enttäuschten Blick zuwarf, als er in einer Tank- und Toilettenpause bei mir auftauchte und ich sofort vor ihm zurückwich. Es war unfair ihm gegenüber, aber ich konnte einfach nicht vergessen, was ich am Morgen über ihn gedacht hatte, und ich wollte so weit wie nur irgendwie möglich von ihm fernbleiben. Was natürlich völliger Blödsinn war, immerhin sollte ich auf Seth und seinen Vater aufpassen. Aber ich konnte wenigstens den Versuch von Anstand wahren und mich ab jetzt ganz professionell geben.
Ich hielt bis zum späten Abend durch.
Wir hatten eben erst in einem Motel am Rand einer kleinen Ortschaft, deren Name ein echter Zungenbrecher war, für diese Nacht Halt gemacht, als ich beim Öffnen der Reisetasche ein leichtes Zittern in meiner rechten Hand bemerkte.
Ich erkannte es nicht mal sofort, weil es überhaupt nicht die übliche Zeit war. Nicht nach meinem Absturz gestern. Normal waren ein paar Tage, mindestens drei, bis die obligatorischen Biere vor dem Schlafengehen nicht mehr reichten. Das musste an dem ganzen Stress liegen. Und daran, dass ich von Richards und seinem Sohn ertappt worden war. Dem Sohn, an den ich in einer Art und Weise dachte, für die andere Perverse von mir eine Kugel in den Kopf kassiert hatten. Kein Wunder, dass ich mit den Nerven am Ende war.
Nachdem ich die Hand zur Faust geballt und ein paar Mal hörbar durchgeatmet hatte, war das Zittern verschwunden und ich ging unter die Dusche. Fest entschlossen mir später zum Abendessen ein Bier zu gönnen. Aber nicht mehr. Ich hatte das Ganze unter Kontrolle und ich würde mir nicht noch einmal so einen Fauxpas erlauben wie heute Morgen.
Allerdings geraten derartige Entschlüsse verdammt schnell ins Wanken, wenn man in einem Diner gegenüber vom Motel knapp eine Stunde damit beschäftigt ist, eindringlichen Blicken auszuweichen, für die »subtil« nun eindeutig nicht das richtige Wort war. Seth beobachtete mich die ganze Zeit. Während wir bestellten, Smalltalk trieben und dabei auf das Essen warteten, schweigend aßen. Er beobachtete mich sogar, während er sich von Richards erklären ließ, was Pfannkuchen waren und wieso man die hier nur zum Frühstück bekam. Am Ende hätte ich am liebsten erleichtert eine Faust in die Höhe gereckt, als Richards für uns bezahlte, damit wir gehen konnten.
Ich war derart fertig mit den Nerven, dass mich mein erster Gang nach unserer Rückkehr zum Motel zur Rezeption führte, um herauszufinden, ob und wo es eine Bar gab. Selbst wenn es in solchen Kleinstädten keine Geschäfte gab, Alkohol bekam man immer irgendwo. Ich hatte auch hier Glück und nach den ersten zwei Bier, die ich gleich auf dem Rückweg trank, wurde ich ruhig genug, um nachdenken zu können.
Was stimmte mit dem Jungen nicht? Ja, er war nett, höflich, schien im Grunde recht intelligent zu sein, dafür, dass er bisher förmlich hinterm Mond gelebt hatte, aber all das täuschte nicht darüber hinweg, dass er mir langsam unheimlich wurde.
Doch gleichzeitig zog es mich zu Seth hin.
Du lieber Himmel. Schluss damit!
Kopfschüttelnd trank ich einen weiteren Schluck Bier und ließ meinen Blick dabei prüfend die einzige Hauptstraße dieses Ortes entlangwandern. Es war alles ruhig. Nicht mal ein Auto war noch unterwegs, dabei zeigte der Himmel gerade mal die ersten Anzeichen seiner typischen Abendfärbung. Man merkte eindeutig, dass dieser Ort vom Trubel einer größeren Stadt wie Denver so weit entfernt war, wie der Mond von der Erde.
Ich sah in die entgegengesetzte Richtung, wo mich dieselbe Langeweile erwartete. Lange konnte ich hier nicht mehr sitzen ohne aufzufallen. Ein Bier trinkender Motelgast auf einer Bank vor besagtem Motel, das war in Ordnung. Aber mein letztes Bier war fast leer und ein Fremder, der nichts tat, außer abends in regelmäßigen Abständen die Straße zu beobachten, das wäre verdächtig. Besonders in verschlafenen Orten wie diesen.
Eine Hand erschien überraschend in meinem Blickfeld und nahm mir die Flasche weg.
»Hey!«
»Es gibt weitaus bessere Wege, um etwas gegen anhaltende Schlafstörungen zu tun. Ich habe einen Söldner engagiert und keinen Säufer.« Richards setzte sich zu mir und stellte das Bier außerhalb meiner Reichweite neben sich auf die Bank. »Soll ich für Seth und mich jemand anderen finden?«
Seine Frage war berechtigt und sie hatte kommen müssen, nach meinem Auftreten von heute Morgen.
---ENDE DER LESEPROBE---
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























