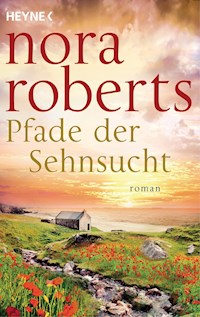
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: O'Dwyer-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Als Iona nach Irland kam, wurde sie vom magischen Zirkel um den O’Dwyer-Clan herzlich aufgenommen und fand in Boyle ihre große Liebe. Ihr Cousin Connor O’Dwyer hat die Frau fürs Leben noch nicht gefunden, doch auf wundersame Weise fühlt er sich plötzlich zur leidenschaftlichen Meara hingezogen. Das Glück wird getrübt, als Cabhan, der blutrünstige Feind des Clans, Meara benutzt um sie alle zu vernichten. Hält der Kreis der Freunde dieser Herausforderung stand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Zum Buch
Iona fand in Spuren der Hoffnung, dem ersten Teil der O’Dwyer-Trilogie, in Irlands mystischem County Mayo ihre Bestimmung. Nun lebt sie mit ihrem Verlobten Boyle auf dem idyllischen Pferdehof und widmet sich ganz dem Reiten – und der Magie. Iona, ihre Cousine Branna und ihr Cousin Connor O’Dwyer stehen mit ihren Vorfahren aus dem dreizehnten Jahrhundert in enger Verbindung. Damals hatten die drei Geschwister Brannaugh, Eamon und Teagan ihre Eltern an den grausamen Cabhan verloren und wären ihm beinahe selbst zum Opfer gefallen. Nun taucht der jahrhundertealte Feind wieder auf und bedroht die O’Dwyers und ihre Freunde. Zu fünft bilden sie einen magischen Zirkel, doch um den Feind besiegen zu können, brauchen sie eine sechste im Bunde. Dies soll Meara Quinn sein, die der Familie schon lange in tiefer Freundschaft verbunden ist. Mit einem Mal sieht Connor die bodenständige Pferdenärrin mit anderen Augen: In ihr lodert ein Feuer der Leidenschaft und schon bald ist er ihr völlig verfallen. Doch genau diese Sinnlichkeit und Kraft sind es, die auch Cabhan begehrt. Als die Zeit gekommen ist, stehen die sechs Freunde Cabhan gegenüber. Um seinem über Jahrhunderte aufgestauten Hass zu begegnen, braucht es ihre ganze Kraft – und keiner wagt vorherzusagen, wie der Kampf ausgehen wird.
Zur Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1981. Inzwischen zählt sie zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von 400 Millionen Exemplaren überschritten. Mehr als 175 Titel waren auf der New-York-Times-Bestsellerliste, und ihre Bücher erobern auch in Deutschland immer wieder die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland.
Mehr Informationen über die Autorin und ihr Werk finden sich am Ende des Romans.
Besuchen Sie die Autorin auf www.noraroberts.com
NORA ROBERTS
PFADEDER SEHNSUCHT
Roman
Aus dem Amerikanischen von Katrin Marburger
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe SHADOW SPELL, BOOK TWO OF THE
COUSINS O’DWYER TRILOGY erschien 2014 bei The Berkeley
Publishing Group, Penguin Group (USA) LLC, New York
Vollständige deutsche Erstausgabe 12/2014
Copyright © 2014 by Nora Roberts
Published by Arrangement with Eleanor Wilder
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: t. mutzenbach design
Covermotiv: BlueJai, Konstanttin, Stock for you, Rihardzz, ANP / shutterstock.com
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-13934-6V002
www.heyne.de
Für meinen eigenen Zirkel,
meine Familie und Freunde
Künftige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Thomas Campbell
Die Schmuckstücke eines Hauses sind die Freunde,
die darin verkehren.
Ralph Waldo Emerson
1
Herbst 1268
Nebelfetzen stiegen wie Atemhauch in trägem Wirbel vom Wasser auf, während Eamon in seinem kleinen Boot den Fluss entlangruderte. Die aus der Nachtruhe erwachende Sonne verströmte ein bleiches, kühles Licht und ließ die Vögel ihren morgendlichen Chor anstimmen. Eamon hörte das Krähen des Hahns, arrogant und wichtigtuerisch, und das Blöken von Schafen, die sich über die grünen Wiesen fraßen.
Lauter vertraute Geräusche, Klänge, die ihn seit fünf Jahren jedenMorgenbegrüßten.
Sein Zuhause war dies jedoch nicht. Ganz gleich, wie einladend, wie vertraut alles war, sein Zuhause würde es nie sein.
Und nach seinem Zuhause sehnte er sich. So groß war sein Heimweh, dass ihm davon die Knochen wehtaten wie einem alten Mann bei feuchtem Wetter, und sein Herz blutete wie das eines verschmähten Liebhabers.
Zudem schwelte unter all dem Sehnen und Wünschen, dem Schmerz, dem Bluten, beständig ein Zorn, der von Zeit zu Zeit aufwallte und ihm in der Kehle brannte wie ein heftiger Durst.
In manchen Nächten träumte er von zu Hause, von der Hütte im Wald, wo er jeden Baum, jede Windung der Pfade kannte. Und in manchen Nächten waren diese Träume so wirklich wie das Leben, sodass er das Torffeuer und den süßen Duft der Binsen seines Betts riechen konnte, zwischen die seine Mutter für einen guten Schlaf und schöne Träume Lavendel gemischt hatte.
Er konnte ihre Stimme hören, ihr leises Singen unter dem Schlafboden, wo sie Zaubertränke und Kräutertees mischte.
»Dunkle Hexe« hatten sie seine Mutter genannt – respektvoll, denn sie war mächtig und stark, freundlich und gut. Und so erwachte Eamon in manchen Nächten, wenn er von zu Hause träumte und seine Mutter von unten singen hörte, mit Tränen auf den Wangen.
Die er hastig wegwischte. Er war jetzt ein Mann, volle zehn Jahre alt, das Familienoberhaupt, wie sein Vater es vor ihm gewesen war.
Tränen waren Weiberkram.
Außerdem musste er auf seine Schwestern aufpassen, erinnerte er sich und ließ das Boot leicht dahintreiben, während er die Ruder in die Dollen legte und die Angelschnur ins Wasser hängte. Brannaugh war vielleicht die Älteste, doch er war der Mann in der Familie. Er hatte einen Schwur geleistet, Brannaugh und Teagan zu beschützen, und das würde er auch tun. Er hatte das Schwert ihres Großvaters geerbt. Er würde es benutzen, wenn die Zeit dazu gekommen war.
Und sie würde kommen.
Denn da waren noch andere Träume – Träume, die ihm Angst machten statt Kummer. Träume von Cabhan, dem schwarzen Zauberer. Sie bildeten eisige Klumpen der Furcht in seinem Bauch, die trotz des glühenden Zorns gefroren. Es war eine Furcht, die den kleinen Jungen in ihm nach der Mutter rufen lassen wollte.
Doch er konnte es sich nicht erlauben, Angst zu haben. Seine Mutter war fort, hatte sich geopfert, um ihn und seine Schwestern zu retten, wenige Stunden nachdem Cabhan ihren Vater getötet hatte.
Den Vater vor seinem inneren Auge zu sehen gelang ihm kaum noch, zu oft brauchte er die Hilfe des Feuers, um das Bild zu finden – das Bild des großen, stolzen Daithi, des Cennfine, des Clanchefsmit dem hellen Haar, der so gerne gelacht hatte. Doch er brauchte nur die Augen zu schließen, um seine Mutter zu sehen – bleich wie der nahende Tod stand sie vor der Hütte im Wald an jenem nebligen Morgen, während er mit seinen Schwestern davonritt, Kummer im Herzen, junge, brennende Macht im Blut.
Seit jenem Morgen war er kein Junge mehr, sondern einer der drei, der dunklen Hexen, durch Blut und Schwur dazu bestimmt, das zu vernichten, was selbst seine Mutter nicht zu zerstören vermocht hatte.
Ein Teil von ihm brannte darauf, zu beginnen und diese Zeit in Galway zu beenden, auf dem Hof ihrer Cousine, wo morgens der Hahn krähte und die Schafe auf den Wiesen blökten. Der Mann und der Hexer in ihm sehnten sich danach, dass diese Zeit vorüberging, sehnten sich nach der Kraft, das Schwert des Großvaters zu schwingen, ohne dass sein Arm unter dem Gewicht zitterte. Nach der Zeit, in der er seine Macht ganz ausschöpfen und die Hexenkunst ausüben konnte, die ihm durch Blut und Recht zustand. Der Zeit, in der er Cabhans Blut vergießen und es schwarz und brennend über den Boden strömen würde.
Doch in seinen Träumen war er ein kleiner Junge, unerprobt und schwach, verfolgt von dem Wolf, in den Cabhan sich verwandelte, dem Wolf mit dem roten Stein der schwarzen Macht, der an der Kehle schimmerte. Und es war sein eigenes Blut und das seiner Schwestern, das warm und rot über den Boden rann.
Nach den schlimmsten Träumen ging er morgens zum Fluss, ruderte hinaus, um zu angeln, allein zu sein, auch wenn er an den meisten Tagen die Gesellschaft im Cottage brauchte, die Stimmen, die Düfte aus der Küche.
Doch nach den Blutträumen musste er fort – und niemand tadelte ihn dafür, dass er nicht beim Melken half, auch nicht beim Ausmisten oder Füttern, nicht an jenen Morgen.
Und so saß er im Boot, ein schmächtiger Junge von zehn Jahren mit einem braunen, vom Schlaf verwuschelten Haarschopf und den wilden blauen Augen seines Vaters, der strahlenden, in ihm aufkeimenden Macht seiner Mutter.
Er konnte zuhören, wie der Tag um ihn herum erwachte, geduldig darauf warten, dass ein Fisch anbiss, und den Haferkuchen essen, den er aus der Küche seiner Cousine mitgenommen hatte.
Und er konnte wieder zu sich selbst finden.
Der Fluss, die Stille, das sanfte Schaukeln des Bootes erinnerten ihn an den letzten glücklichen Tag, den er mit seiner Mutter und den Schwestern erlebt hatte.
Sie hatte gut ausgesehen, nachdem sie den ganzen Winter über so blass und erschöpft gewesen war. Sie alle hatten die Tage bis Bealtaine und bis zur Rückkehr seines Vaters gezählt. Dann würden sie ums Feuer sitzen, hatte Eamon sich vorgestellt, Kuchen essen und mit Honig gesüßten Kräutertee trinken, während sie den Geschichten lauschten, die der Vater von den Raubzügen und der Jagd erzählte.
Sie würden ein Festmahl halten, und seiner Mutter würde es wieder gut gehen.
So hatte er geglaubt, an jenem Tag auf dem Fluss, an dem sie geangelt und gelacht hatten, und alle hatten daran gedacht, wie bald der Vater zu Hause sein würde.
Doch er war nie gekommen, denn Cabhan hatte seine dunkle Zauberkraft verwendet, um Daithi den Tapferen zu töten. Und Sorcha, die Dunkle Hexe … Auch wenn sie Cabhan zu Asche verbrannt hatte, war es ihm irgendwie gelungen, sie zu töten und weiterzuexistieren.
Das wusste Eamon durch die Träume, das Kribbeln, das ihm den Rücken hinunterlief. Und er sah in den Augen seiner Schwestern, dass es die Wahrheit war.
Ihm blieb nur die Erinnerung an jenen strahlenden Frühlingstag auf dem Fluss. Selbst als es an seiner Angelschnur zerrte, wanderten seine Gedanken dorthin zurück, und er sah sich als Fünfjährigen, der einen glänzenden Fisch aus dem dunklen Wasser zog.
Er spürte heute den gleichen Stolz wie damals.
»Ailish wird sich freuen.«
Seine Mutter lächelte ihm zu, als er den Fisch in den Eimer mit Wasser gleiten ließ, um ihn frisch zu halten.
Sie kam zu ihm, weil er sie so brauchte, und spendete ihm Trost. Er steckte einen neuen Köder auf seinen Haken, während die Sonne wärmer wurde und die Nebelfinger aufzulösen begann.
»Wir brauchen mehr als einen.«
Das hatte sie gesagt, erinnerte er sich, an jenem längst vergangenen Tag.
»Also fängst du mehr als einen.«
»Mir wäre es lieber, ich würde in meinem eigenen Fluss mehr als einen fangen.«
»Das wirst du eines Tages. Eines Tages kehrst du nach Hause zurück, mo chroi, mein Herz. Eines Tages werden deine Nachkommen in unserem Fluss angeln und durch unseren Wald laufen. Das verspreche ich dir.«
Die Tränen wollten ihm kommen, verwischten sein Bild der Mutter, sodass es vor seinen Augen verschwamm. Er bezwang sie mit seinem Willen, denn er wollte die Mutter klar sehen.
Das dunkle Haar, das ihr offen bis zur Taille herabfiel, die dunklen Augen, in denen die Liebe lebte. Und die Kraft, die sie ausstrahlte. Selbst jetzt, da sie nur eine Vision war, spürte er ihre Macht.
»Warum konntest du ihn nicht zerstören, Ma? Warum konntest du nicht am Leben bleiben?«
»Es sollte nicht sein. Mein Liebling, mein Junge, mein Herz, wenn ich dich und deine Schwestern hätte verschonen können, hätte ich dafür mehr als mein Leben gegeben.«
»Du hast mehr gegeben. Du hast uns deine Macht gegeben, beinahe alles davon. Wenn du sie behalten hättest …«
»Für mich war es an der Zeit, und es war euer Geburtsrecht. Ich bin damit zufrieden, glaube mir das.« Im dünner werdenden Nebel glühte sie, eingefasst von einem Silberstreif. »Ich bin immer in dir, Eamon der Getreue. Ich bin in deinem Blut, deinem Herzen, deinem Geist. Du bist nicht allein.«
»Du fehlst mir.«
Er spürte ihre Lippen auf der Wange, ihre Wärme, ihren Duft, der ihn einhüllte. Und für diesen Moment, nur für diesen Moment, konnte er wieder Kind sein.
»Ich werde tapfer und stark sein, das schwöre ich. Ich beschütze Brannaugh und Teagan.«
»Ihr beschützt einander. Ihr seid die drei. Gemeinsam seid ihr mächtiger, als ich es jemals war.«
»Werde ich Cabhan töten?« Denn das war sein stärkster, sein dunkelster Wunsch. »Werde ich ihn vernichten?«
»Das vermag ich nicht zu sagen – nur, dass er dir niemals nehmen kann, was du bist. Was du bist, was du besitzt, kann nur gegeben werden, so wie ich es dir gegeben habe. Cabhan trägt meinen Fluch und das Zeichen davon. All seine Nachkommen werden dieses Zeichen tragen, genau wie deine Nachkommen das Licht tragen werden. Mein Blut, Eamon.« Sie kehrte die Handfläche nach oben, sodass eine feine Blutspur sichtbar wurde. »Und deins.«
Er spürte den kurzen Schmerz, sah die Wunde quer über seiner Handfläche und vereinte sie mit der seiner Mutter.
»Das Blut der drei, die Sorcha entstammen, wird ihn niederstrecken, auch wenn es tausend Jahre dauert. Vertrau auf das, was in dir steckt. Es ist genug.«
Sie küsste ihn noch einmal, lächelte. »Du hast mehr als einen.«
Das Zerren an seiner Angelschnur riss ihn aus der Vision.
Ja, er hatte mehr als einen.
Er würde tapfer sein, dachte er, während er den zappelnden Fisch aus dem Fluss zog. Er würde stark sein. Und eines Tages stark genug.
Er betrachtete seine Hand – es war kein Kratzer mehr darin zu sehen, doch er verstand. Er trug Sorchas Blut und ihre Gabe in sich. Beides würde er eines Tages an seine Söhne und Töchter weitergeben. Wenn es ihm nicht vergönnt war, Cabhan zu vernichten, würden seine Nachkommen es tun.
Doch er hoffte bei allen Göttern, dass es ihm selbst gelingen würde.
Jetzt hatte er erst einmal den Fisch. Es war gut, ein Mann zu sein, dachte er, zu jagen und zu fischen, für Nahrung zu sorgen. Seiner Cousine und ihrem Mann für die Unterkunft und die Fürsorge etwas zurückzugeben.
Seit er ein Mann war, hatte er gelernt, Geduld zu haben. Er fing noch vier Fische, bevor er zurück ans Ufer ruderte. Dort vertäute er das Boot und zog die Fische auf eine Schnur auf.
Einen Moment lang stand er da und schaute aufs Wasser hinaus, das nun voll von der Sonne beschienen wurde. Er dachte an seine Mutter, den Klang ihrer Stimme, den Duft ihres Haars. Ihre Worte würden ihn immer begleiten.
Er würde durch den kleinen Wald zurückgehen. Kein großer Wald wie zu Hause, aber trotzdem schön, dachte er.
Und er würde Ailish den Fisch bringen, am Feuer einen Kräutertee trinken. Dann würde er bei den letzten Erntearbeiten helfen.
Als er sich gerade auf den Rückweg zum Cottage und dem kleinen Bauernhof machte, hörte er den hellen, scharfen Schrei. Lächelnd griff er in seine Umhängetasche und holte seinen Lederhandschuh heraus. Er brauchte ihn nur anzuziehen, den Arm zu heben, und schon stürzte Roibeard aus den Wolken herab, die Flügel zur Landung ausgebreitet.
»Guten Morgen.« Eamon schaute in die goldbraunen Augen, spürte die innige Verbindung zwischen ihm und dem Habicht, seinem Schutztier, seinem Freund. Er berührte das Zauberamulett um seinen Hals, das die Mutter mithilfe von Blutmagie zu seinem Schutz gehext hatte. Es war mit dem Bild des Habichts versehen.
»Ein schöner Tag, oder? Hell und kühl. Die Ernte ist beinahe eingebracht, und bald haben wir unsere Feier«, fuhr Eamon fort, während er mit dem Habicht auf dem Arm weiterging. »Die Tagundnachtgleiche, das weißt du ja, in der die Nacht den Tag bezwingt, so wie Gronw Pebr einst Lleu Llaw Gyffes bezwang. Wir feiern die Geburt Mabons, Sohn von Modron, der Muttergöttin der Erde. Da gibt es sicherlich Honigkuchen. Ich sorge dafür, dass du was abbekommst.«
Der Habicht rieb den Kopf an Eamons Wange, zärtlich wie ein Kätzchen.
»Ich hatte wieder den Traum von Cabhan. Von zu Hause und Ma, nachdem sie uns nahezu ihre gesamte Macht gegeben und uns fortgeschickt hat, damit wir in Sicherheit sind. Ich sehe es, Roibeard. Wie sie Cabhan mit einem Kuss vergiftet hat, wie sie ihn verbrannt hat, wie sie alles benutzte, was sie hatte, um ihn zu vernichten. Er hat ihr das Leben genommen, und doch … Ich habe gesehen, wie sich die Asche regte, zu der sie ihn gemacht hat. Es regte sich etwas darin, etwas Böses, und ich habe auch das rote Glühen seiner Macht gesehen.«
Eamon hielt einen Augenblick inne, ließ seine Macht aufsteigen, öffnete sich ihr. Er spürte das klopfende Herz eines Kaninchens, das ins Dickicht flüchtete, den Hunger eines Vogelkükens, das auf seine Mutter und sein Frühstück wartete.
Er spürte seine Schwestern, die Schafe, die Pferde.
Und keine Bedrohung.
»Er hat uns nicht gefunden. Das würde ich spüren. Du würdest es sehen und es mir sagen. Aber er hält Ausschau, er ist auf der Jagd, und er wartet, denn auch das spüre ich.«
Die kühnen blauen Augen verdunkelten sich, der weiche Mund des Jungen verhärtete sich zu dem eines Mannes. »Ich werde mich nicht ewig verstecken. Eines Tages, beim Blut von Sorcha und Daithi, gehe ich auf die Jagd.«
Eamon hob einen Arm, griff eine Handvoll Luft, wirbelte sie herum, warf sie – behutsam – zu einem Baum hinüber. Äste schwankten, und Vögel, die im Baum saßen, flatterten auf.
»Ich werde immer stärker, oder?«, murmelte er und ging weiter zum Cottage, um Ailish mit den Fischen zu erfreuen.
Brannaugh erledigte ihre Pflichten wie jeden Tag. Wie sie seit fünf Jahren jeden Tag alles tat, was von ihr verlangt wurde. Sie kochte, sie putzte, sie kümmerte sich um die Kleinen, denn Ailish schien immer ein Baby an der Brust oder im Bauch zu haben. Sie half, die Felder zu bestellen und die Ernte einzubringen.
Gute, ehrliche Arbeit, natürlich, und auf ihre Art auch befriedigend. Niemand könnte freundlicher sein als ihre Cousine Ailish und deren Mann. Beide waren brave, zuverlässige Menschen, erdverbunden, und sie hatten den drei Waisenkindern mehr als nur eine Unterkunft gegeben.
Sie hatten ihnen eine Familie geboten, und ein kostbareres Geschenk existierte nicht.
Und hatte ihre Mutter das nicht gewusst? Sonst hätte sie ihre drei Kinder niemals zu Ailish geschickt. Selbst in ihrer dunkelsten Stunde hätte Sorcha ihre geliebten Kinder niemandem anvertraut, der nicht gütig und voller Liebe war.
Doch mit zwölf Jahren war Brannaugh kein Kind mehr. Und was in ihr emporstieg, wuchs, erwachte – umso stärker, seit sie im vergangenen Jahr mit dem Unterricht begonnen hatte –, erhob seinen Anspruch.
So viel in sich zurückzuhalten und die Augen von dem immer heller werdenden Licht abzuwenden, das wurde mit jedem Tag schwerer und schmerzlicher. Doch sie war Ailish Respekt schuldig, und ihre Cousine fürchtete sich vor Zauberei und Hexenkraft – selbst vor der eigenen.
Brannaugh hatte getan, was ihre Mutter an jenem schrecklichen Morgen von ihr verlangt hatte. Sie war mit ihrem Bruder und ihrer Schwester in den Süden geritten, fort von ihrem Zuhause in Mayo. Sie hatte sich abseits der Straße gehalten, und sie hatte ihren Kummer in ihrem Herzen eingeschlossen, wo nur sie allein sein Wehklagen hörte.
In diesem Herzen lebte auch das Verlangen, Rache zu üben und die Macht in ihr anzunehmen und so zu schulen und zu verfeinern, dass sie Cabhan vernichten konnte, ein für alle Mal.
Ailish hingegen wollte nur ihren Mann, ihre Kinder, ihren Hof. Warum auch nicht? Sie hatte ein Recht auf ihr Zuhause, auf ihr Leben und ihr Land, die beschauliche Ruhe ihrer Welt. Hatte sie das nicht aufs Spiel gesetzt, indem sie Sorchas Nachkommen bei sich aufnahm? Aufnahm, was Cabhan begehrte – wonach er auf der Jagd war?
Sie verdiente Dankbarkeit, Pflichttreue und Respekt.
Doch was in Brannaugh lebendig war, verlangte nach Freiheit. Es war an der Zeit, Entscheidungen zu treffen.
Sie hatte gesehen, wie ihr Bruder mit dem Fisch und mit seinem Habicht vom Fluss zurückkam. Sie spürte, wie er seine Macht außer Sichtweite des Cottages erprobte – und das tat er oft. Genau wie Teagan, ihre Schwester. Ailish, die über die Marmelade plapperte, die sie heute kochen würden, merkte nichts davon. Ihre Cousine blockte das meiste ab, das sie in sich hatte, und nutzte nur das bisschen, das sie brauchte, damit die Marmelade süßer wurde oder die Hennen größere Eier legten. Brannaugh konnte das nicht begreifen.
Sie dagegen sagte sich, die Sache sei es wert, Opfer zu bringen, zu warten, bis man mehr fand, mehr lernte, mehr war. Ihre Geschwister waren hier in Sicherheit – wie es ihre Mutter gewünscht hatte. Teagan, deren Kummer so groß gewesen war, dass man tagelang, wochenlang nicht an sie herangekommen war, lachte und spielte. Sie erledigte fröhlich ihre Pflichten, versorgte die Tiere, ritt wie eine Kriegerin auf ihrem großen grauen Alastar.
Vielleicht weinte sie manchmal nachts im Schlaf, doch Brannaugh brauchte sie nur an sich zu ziehen, um sie zu beruhigen.
Außer wenn die Träume von Cabhan kamen. Sie kamen zu Teagan, zu Eamon, zu ihr selbst. Häufiger in letzter Zeit und so klar, dass sie neuerdings den Klang seiner Stimme noch hören konnte, nachdem sie erwacht war.
Es war an der Zeit, Entscheidungen zu treffen. Dieses Warten, dieses Schutzsuchen musste zu Ende gehen, so oder so.
Am Abend bürstete sie Kartoffeln, die frisch geerntet und ganz zart waren. Sie rührte den Eintopf um, der auf dem Feuer köchelte, und klopfte mit dem Fuß den Takt, während der Mann ihrer Cousine auf seiner kleinen Harfe Musik machte.
Das Cottage – warm und gemütlich, ein unbeschwerter Ort, der erfüllt war von angenehmen Gerüchen, fröhlichen Stimmen und Ailishs Lachen, als sie sich ihren Jüngsten auf die Hüfte setzte, um mit ihm ein Tänzchen zu machen.
Familie, dachte Brannaugh erneut. Wohlgenährt, gut versorgt in einem warmen, gemütlichen Cottage mit Kräutern, die in der Küche trockneten, und mit rotwangigen Babys.
Eigentlich hätte ihr das genügen müssen. Wie sehr sie wünschte, es wäre so.
Sie fing Eamons Blick auf, aus den Augen, die ebenso kühn und blau waren wie die des Vaters, und spürte, wie seine Macht sie anstupste. Er sah zu viel, dachte sie. Viel zu viel, wenn sie nicht daran dachte, ihn abzublocken.
Sie knuffte ihn ein wenig zurück – eine kleine Warnung, sich um seinen eigenen Kram zu kümmern. Und wie Schwestern nun einmal sind, lächelte sie, als er zusammenzuckte.
Nach dem Abendessen waren Töpfe zu spülen, Kinder ins Bett zu stecken. Mabh, mit sieben Jahren die Älteste, beschwerte sich wie immer, sie sei überhaupt nicht müde. Seamus kuschelte sich sofort ins Bett und hatte schon sein Traumlächeln auf dem Gesicht. Die Zwillinge, die Brannaugh auf die Welt zu bringen geholfen hatte, schnatterten miteinander wie die Gänschen. Die kleine Brighid steckte sich den Daumen – ihren Tröster – in den Mund, und das Baby schlief schon, bevor die Mutter es hinlegte.
Brannaugh fragte sich, ob Ailish wusste, dass sowohl sie selbst als auch das Baby ohne Hexenkraft nicht mehr am Leben wären. Die Geburt war so schmerzhaft, so ungut gewesen, dass beide ohne Brannaughs Macht, ihr Heilen, ihr Sehen, ihr Handeln verblutet wären.
Auch wenn sie nie darüber sprach, glaubte Brannaugh, dass Ailish es wusste.
Ailish richtete sich auf, eine Hand im Rücken, die andere über dem nächsten Baby in ihrem Bauch. »Gute Nacht und süße Träume euch allen. Brannaugh, würdest du noch einen Tee mit mir trinken? Ich könnte etwas von deinem Beruhigungstee gebrauchen, denn der Kleine hier tritt mich heute Abend wie wild.«
»Klar, ich mache dir einen.« Und wie immer würde sie den Zauber für Gesundheit und eine leichte Geburt mit hineingeben. »Er ist wohlauf und gesund, der Kleine, und ich schätze, er wird allein so groß und schwer sein wie die Zwillinge zusammen.«
»Es ist ein Junge, ganz bestimmt«, sagte Ailish, als sie vom Dachboden herunterkletterten, wo die Schlafplätze waren. »Das spüre ich. Bisher habe ich mich noch nie geirrt.«
»Diesmal auch nicht. Du könntest dich ein bisschen öfter ausruhen, Ailish.«
»Eine Frau mit sechs Kindern und einem weiteren unterwegs kommt nicht viel zum Ausruhen. Mit mir ist alles in Ordnung.« Ailish heftete den Blick auf Brannaugh, um Bestätigung zu finden.
»Das ist es gewiss – trotzdem würde dir mehr Ruhe guttun.«
»Du bist mir eine große Hilfe und Stütze, Brannaugh.«
»Das will ich hoffen.«
Da war irgendetwas, dachte Brannaugh, während sie den Tee zubereitete. Sie spürte die Nervosität ihrer Cousine, die sich auf sie übertrug.
»Nun da die Ernte eingebracht ist, kannst du dich dem Nähen widmen. Auch diese Arbeit muss getan werden, und sie ist nicht so anstrengend für dich. Ich kann mich ums Kochen kümmern. Teagan und Mabh helfen mir, und ich sage dir, Mabh kann schon richtig gut kochen.«
»Ja, das kann sie allerdings. Ich bin so stolz auf sie.«
»Wenn die Mädchen das Kochen übernehmen, können Eamon und ich deinem Mann bei der Jagd helfen. Ich weiß, dir wäre es lieber, ich würde keinen Bogen zur Hand nehmen, aber ist es nicht klüger, wenn jeder das tut, was er gut kann?«
Ailishs Blick schweifte für einen Moment ab.
Ja, dachte Brannaugh, sie weiß es, und mehr noch, es lastet schwer auf ihr, dass sie von uns verlangt, nicht die zu sein, die wir sind.
»Ich habe deine Mutter geliebt.«
»Oh, und sie dich auch.«
»In den letzten Jahren haben wir uns nur selten gesehen. Dennoch hat sie mir Botschaften gesandt, auf ihre Art. In der Nacht, als Mabh geboren wurde, war die kleine Decke, die sie im Schlaf immer noch in der Hand hält, plötzlich da. Sie lag einfach da auf der Wiege, die Bardan für die Kleine gemacht hatte.«
»Wenn sie von dir gesprochen hat, war es immer voller Liebe.«
»Sie hat euch zu mir geschickt. Dich, Eamon und Teagan. Sie kam zu mir, im Traum, und bat mich, euch ein Zuhause zu geben.«
»Das hast du mir nie erzählt«, murmelte Brannaugh, brachte ihrer Cousine den Kräutertee und setzte sich zu ihr ans Torffeuer.
»Zwei Tage bevor ihr kamt, hat sie mich darum gebeten.«
Brannaugh hielt die Hände fest gefaltet im Schoß über dem Rock, der so grau war wie ihre Augen, und starrte ins Feuer. »Wir haben acht Tage gebraucht, um herzukommen. Ihr Geist ist zu dir gekommen. Ich wünschte, ich könnte sie noch einmal sehen, aber ich sehe sie nur im Traum.«
»Sie ist bei dir. Ich sehe sie in dir. In Eamon, in Teagan, aber am meisten in dir. Ihre Kraft und Schönheit. Ihre leidenschaftliche Liebe zur Familie. Du bist jetzt alt genug, Brannaugh. Alt genug, um allmählich daran zu denken, eine Familie zu gründen.«
»Ich habe eine Familie.«
»Eine eigene Familie, wie es deine Mutter getan hat. Ein Zuhause, Liebes, einen Mann, der das Land für dich bestellt, eigene Kinder.«
Ailish trank ihren Tee, während Brannaugh schwieg. »Fial ist ein feiner Mann, ein zuverlässiger. Er war gut zu seiner Frau, als sie noch lebte, das kann ich dir sagen. Er braucht eine Frau, eine Mutter für seine Kinder. Er hat ein schönes Haus, viel größer als unseres. Er hätte dir etwas zu bieten, und sein Haus würde auch Eamon und Teagan offenstehen.«
»Wie könnte ich Fial heiraten? Er ist …« Alt, war ihr erster Gedanke, doch dann wurde ihr bewusst, dass er sicher nicht älter war als Bardan.
»Er würde dir ein gutes Leben bieten, auch deinen Geschwistern.« Ailish griff zu ihrer Näharbeit, um ihre Hände zu beschäftigen. »Ich würde nie zu dir davon sprechen, wenn ich nicht glaubte, dass er dich freundlich und liebevoll behandeln würde, immer. Er sieht gut aus, Brannaugh, und er hat anständige Manieren. Wirst du einmal mit ihm spazieren gehen?«
»Ich … Ailish, wenn ich an Fial denke, dann nicht so.«
»Vielleicht tust du es, wenn du mal mit ihm spazieren gehst.« Bei diesen Worten lächelte Ailish, als wüsste sie ein Geheimnis. »Eine Frau braucht einen Mann, der für sie sorgt, sie beschützt, ihr Kinder schenkt. Einen netten Mann mit einem guten Haus, einem anziehenden Gesicht …«
»Hast du Bardan geheiratet, weil er nett war?«
»Wäre er es nicht gewesen, hätte ich ihn nicht geheiratet. Denk einfach mal darüber nach. Wir sagen ihm, wir warten bis nach der Tagundnachtgleiche, bevor er mit dir darüber spricht. Überleg es dir. Wirst du das tun?«
»Das werde ich.« Brannaugh erhob sich. »Weiß er, was ich bin?«
Ailish senkte den müden Blick. »Du bist die älteste Tochter meiner Cousine.«
»Weiß er, was ich bin, Ailish?«
Jetzt regte es sich in ihr, das, was sie unterdrückte, was sie zurückhielt. Der Stolz in ihr weckte es auf. Und das Licht, das auf ihrem Gesicht spielte, kam nicht nur vom Flackern des Feuers.
»Ich bin die älteste Tochter der Dunklen Hexe von Mayo. Und bevor sie ihr Leben opferte, hat sie ihre Macht geopfert, sie hat sie an mich weitergegeben, an Eamon, an Teagan. Die drei sind wir. Dunkle Hexen hier.«
»Du bist ein Kind …«
»Ein Kind, wenn du von der Magie sprichst, von der Hexenkraft. Aber eine Frau, wenn es darum geht, dass ich Fial heiraten soll.«
Das stimmte, und eine heiße Röte stieg Ailish in die Wangen. »Brannaugh, Liebes, warst du denn in den letzten Jahren hier nicht zufrieden?«
»Doch. Und sehr dankbar.«
»Denen, die vom selben Blut sind, gibt man, ohne Dank zu erwarten.«
»Ja. Denen, die vom selben Blut sind, gibt man.«
Ailish legte ihre Näharbeit wieder beiseite und ergriff Brannaughs Hände. »Du wärst in Sicherheit, du, die Tochter meiner Cousine. Und du wärst zufrieden. Du würdest, das weiß ich, geliebt. Kannst du noch mehr verlangen?«
»Ich bin mehr«, erwiderte Brannaugh ruhig und stieg hinauf auf den Schlafboden.
Doch der Schlaf kam nicht. Brannaugh lag still neben Teagan und wartete darauf, dass das Gemurmel zwischen Ailish und Bardan verstummte. Sie sprachen sicherlich von dieser Heiratsangelegenheit, dieser guten, so vernünftigen Partie. Sie würden sich einreden, ihr Widerstreben wäre nur die Nervosität eines jungen Mädchens.
Genau wie sie sich einredeten, sie, Eamon und Teagan wären Kinder wie alle anderen.
Leise stand sie auf, zog ihre weichen Stiefel an, ihr Schultertuch. Sie brauchte frische Luft. Frische Luft, die Nacht, den Mond.
Lautlos kletterte sie vom Schlafboden hinunter und schob die Tür auf.
Kathel, ihr Hund, der am Feuer schlief, rollte sich auseinander und tappte, ohne zu zögern oder sich zu wundern, vor ihr hinaus.
Jetzt konnte sie durchatmen, mit der kühlen Nachtluft auf den Wangen, in der Stille, die sich wie eine beruhigende Hand auf den Aufruhr in ihrem Inneren legte. Hier war sie frei, solange sie dies bewahren konnte.
Sie und ihr treuer Hund schlüpften wie Schatten zwischen die Bäume. Sie hörte das Plätschern des Flusses, das Seufzen des Windes in den Bäumen, sie roch die Erde und den würzigen Duft des Torfrauchs, der aus dem Schornstein des Cottage aufstieg.
Sie konnte den Kreis ziehen, versuchen, den Geist ihrer Mutter heraufzubeschwören. Sie brauchte die Mutter heute Nacht. Fünf Jahre lang hatte sie nicht geweint, sich nicht eine einzige Träne gestattet. Jetzt wollte sie nur auf dem Boden sitzen, den Kopf an die Brust der Mutter lehnen und weinen.
Sie legte eine Hand auf das Amulett um ihren Hals – das Bildnis des Hundes, das ihre Mutter mit Liebe, mit Hexenkraft, mit Blut gezaubert hatte.
Blieb sie ihrem Blut treu, dem, was in ihr lebte? Nahm sie ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Leidenschaften an? Oder schob sie all das beiseite wie ein Spielzeug, für das sie zu groß geworden war, und tat sie, was ihrem Bruder und ihrer Schwester eine sichere Zukunft garantierte?
»Mutter«, murmelte sie, »was soll ich tun? Was erwartest du von mir? Du hast dein Leben für uns gegeben. Kann ich weniger tun?«
Sie spürte, wie ihre Macht von ihr ausging, sich mit der anderen vereinte, es war wie ein Verschränken von Fingern. Sie wirbelte herum und starrte die Schatten an. Mit wild klopfendem Herzen dachte sie: Ma!
Doch es war Eamon, der da ins Mondlicht trat, Teagans Hand in seiner.
Ihre Enttäuschung schnitt wie eine scharfe Klinge durch ihre Stimme. »Ihr solltet im Bett sein. Was fällt euch ein, mitten in der Nacht im Wald herumzulaufen?«
»Das machst du doch auch«, versetzte Eamon patzig.
»Ich bin ja auch die Älteste.«
»Und ich bin das Familienoberhaupt.«
»Der mickrige Stängel zwischen deinen Beinen macht dich nicht zum Familienoberhaupt.«
Teagan kicherte, dann stürzte sie auf ihre Schwester zu und warf die Arme um sie. »Nicht böse sein. Wir mussten doch kommen, du brauchtest uns. Du warst in meinem Traum. Du hast geweint.«
»Ich weine nicht.«
»Hier drin.« Teagan legte eine Hand auf Brannaughs Herz. Ihre tiefen dunklen Augen blickten die Schwester forschend an. »Warum bist du traurig?«
»Ich bin nicht traurig. Ich bin nur rausgegangen, um nachzudenken. Um allein zu sein und nachzudenken.«
»Du denkst zu laut«, brummelte Eamon, der wegen des »mickrigen Stängels« gekränkt war.
»Und du solltest wissen, dass man nicht die Gedanken anderer Leute belauscht.«
»Was kann ich dafür, wenn du sie so rausposaunst?«
»Hört auf. Wir streiten uns nicht.« Teagan war vielleicht die Kleinste von ihnen, doch sie wusste, was sie wollte. »Wir streiten uns nicht«, wiederholte sie. »Brannaugh ist traurig, Eamon ist wie einer, der auf glühenden Kohlen sitzt, und ich … ich fühle mich so, wie wenn ich zu viel Pudding gegessen habe.«
»Bist du krank?« Brannaughs Zorn verflog. Sie sah Teagan in die Augen.
»Nicht so. Irgendwas ist … nicht im Lot. Das spüre ich. Du auch, glaube ich. Du spürst es auch. Deshalb streiten wir uns nicht. Wir sind eine Familie.« Ohne Brannaughs Hand loszulassen, nahm Teagan auch Eamon bei der Hand. »Sag uns, Schwester, warum du traurig bist.«
»Ich … will einen Kreis ziehen. Ich will das Licht in mir spüren. Ich will einen Kreis ziehen und mit euch in seinem Licht sitzen. Mit euch beiden.«
»Das machen wir fast nie«, sagte Teagan. »Weil Ailish es nicht mag.«
»Sie hat uns aufgenommen. In ihrem Haus sind wir ihr Respekt schuldig. Aber jetzt sind wir nicht in ihrem Haus, und sie muss es nicht erfahren. Ich brauche das Licht. Ich muss in unserem Kreis mit euch reden, wo uns niemand hören kann.«
»Ich ziehe den Kreis. Ich übe«, erklärte Teagan. »Wenn Alastar und ich ausreiten, übe ich.«
Mit einem Seufzer strich Brannaugh ihrer Schwester durch das blonde Haar. »Das machst du gut. Zieh den Kreis, deirfiúr bheag, kleine Schwester.«
2
Brannaugh sah zu, wie ihre Schwester Licht und Feuer aus dem Inneren zog und der Göttin dankte, während sie den Ring formte. Einen Ring, der groß genug war, dass auch Kathel mit hineinpasste, dachte Brannaugh amüsiert und dankbar.
»Das hast du gut gemacht. Ich hätte dir mehr beibringen sollen, aber ich …«
»Du hast Ailishs Wunsch respektiert.«
»Und«, warf Eamon ein, »du hattest Angst, dass Cabhan es merken könnte, wenn wir unsere Macht zu oft und zu stark gebrauchen. Dann würde er kommen.«
»Ja.« Brannaugh setzte sich auf den Boden und schlang einen Arm um Kathel. »Mutter wollte, dass wir in Sicherheit sind. Sie hat alles für uns aufgegeben. Ihre Macht, ihr Leben. Sie glaubte, sie würde ihn vernichten, und wir würden in Sicherheit sein. Sie konnte nicht wissen, mit welcher dunklen Macht er einen Pakt schließen würde, und dass diese ihn aus der Asche erheben würde.«
»Aber schwächer.«
Brannaugh sah Eamon an. »Ja, schwächer. Zuerst. Er … frisst Macht, glaube ich. Er findet andere, saugt sie aus, wird dadurch stärker. Mutter wollte, dass wir in Sicherheit sind.« Brannaugh atmete tief durch. »Fial möchte mich heiraten.«
Eamon bekam den Mund nicht mehr zu. »Fial? Aber der ist alt!«
»Nicht älter als Bardan.«
»Sehr alt!«
Brannaugh lachte, spürte, wie die Enge in ihrer Brust ein wenig nachließ. »Männer wollen junge Frauen, wie es scheint. Damit sie ihnen viele Kinder gebären können und sie dann immer noch mit ihnen ins Bett gehen und für sie kochen wollen.«
»Du heiratest Fial nicht«, sagte Teagan bestimmt.
»Er ist nett und nicht hässlich. Sein Haus und sein Hof sind größer als Ailishs und Bardans. Ihr wärt beide dort willkommen.«
»Du heiratest Fial nicht«, wiederholte Teagan. »Du liebst ihn nicht.«
»Ich suche keine Liebe und brauche sie auch nicht.«
»Das solltest du aber. Selbst wenn du die Augen verschließt, wird sie dich finden. Vergisst du etwa die Liebe zwischen unserer Mutter und unserem Vater?«
»Gewiss nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich so etwas für mich finde. Du vielleicht, eines Tages. So hübsch wie du bist und so klug.«
»O ja, das werde ich.« Teagan nickte weise. »Genau wie du und Eamon. Und dann geben wir weiter, was wir sind, was wir haben – an unsere Nachkommen. Unsere Mutter wollte das so. Sie wollte, dass wir leben.«
»Leben würden wir, und zwar nicht schlecht, wenn ich Fial heirate. Ich bin die Älteste«, erinnerte Brannaugh die Geschwister. »Die Entscheidung liegt bei mir.«
»Sie hat mir aufgetragen, dich zu beschützen.« Eamon verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich verbiete es dir.«
»Wir streiten uns nicht.« Teagan packte beide wieder bei der Hand und drückte fest zu. Flammen schimmerten durch ihre verschränkten Finger. »Und um mich muss sich niemand kümmern. Ich bin kein Baby mehr, Brannaugh, ich bin so alt wie du, als wir von zu Hause fortgegangen sind. Du wirst nicht heiraten, damit ich ein Zuhause habe. Du wirst nicht verleugnen, was du bist, und deine Macht missachten. Du bist nicht Ailish, sondern Brannaugh, Tochter von Sorcha und Daithi. Du bist eine dunkle Hexe und wirst es immer sein.«
»Eines Tages vernichten wir ihn«, schwor Eamon. »Eines Tages rächen wir unseren Vater, unsere Mutter, und wir vernichten selbst die Asche, zu der wir ihn verbrennen. Unsere Mutter hat mir gesagt, dass wir das tun, oder dass unsere Nachkommen es tun, und wenn es noch tausend Jahre dauert.«
»Sie hat es dir gesagt?«
»Heute Morgen. Sie kam zu mir, als ich am Fluss war, im Nebel, in der Stille. Dort finde ich sie, wenn ich sie brauche.«
»Zu mir kommt sie nur im Traum.« Die Tränen, die Brannaugh nicht vergießen wollte, schnürten ihr die Kehle zu.
»Du hältst so fest zurück, was du bist.« Teagan strich der Schwester übers Haar, um sie zu beruhigen. »Um Ailish nicht zu verärgern und um uns zu schützen. Vielleicht erlaubst du ihr nur im Traum, zu dir zu kommen.«
»Zu dir kommt sie auch?«, murmelte Brannaugh. »Nicht nur im Traum?«
»Manchmal, wenn ich auf Alastar reite, wenn wir tief im Wald sind und ich mich ruhig halte, dann kommt sie. Sie singt für mich, so wie früher, als ich klein war. Und es war unsere Mutter, die mir gesagt hat, dass wir einmal Liebe finden und Kinder haben. Und dass wir Cabhan besiegen, durch unser Blut.«
»Soll ich also Fial heiraten, ihm das Kind, das Blut schenken, das Cabhan ein Ende macht?«
»Nein!« Kleine Flammen flackerten an Teagans Fingerspitzen, bevor sie sich daran erinnerte, sich zu beherrschen. »Darin ist keine Liebe. Zuerst kommt die Liebe, dann das Kind. In dieser Reihenfolge.«
»Das ist nicht der einzige Weg.«
»Es ist unser Weg.« Eamon ergriff erneut Brannaughs Hand. »Diesen Weg gehen wir. Wir werden sein, wozu wir bestimmt sind, tun, was wir tun müssen. Wenn wir es nicht versuchen, war alles, was sie für uns geopfert haben, umsonst. Sie wären umsonst gestorben. Willst du das?«
»Nein. Nein, ich will ihn töten. Ich will sein Blut, seinen Tod.« Aufgewühlt vergrub Brannaugh das Gesicht an Kathels Hals, suchte Trost in seiner Wärme. »Ich glaube, ein Teil von mir würde sterben, wenn ich mich von dem abkehren würde, was ich bin. Aber alles in mir würde sterben, wenn ich wüsste, dass eine meiner Entscheidungen euch Unglück bringt.«
»Wir entscheiden, wir alle«, sagte Eamon. »Drei und doch eins. Wir haben diese Zeit gebraucht. Unsere Mutter hat uns hierhergeschickt, damit wir diese Zeit haben. Jetzt sind wir keine Kinder mehr. Ich glaube, wir waren schon keine Kinder mehr, als wir an jenem Morgen von zu Hause fortritten und wussten, dass wir sie nie mehr wiedersehen würden.«
»Wir hatten Macht.« Brannaugh atmete tief durch und richtete sich auf. Auch wenn Eamon jünger war und noch dazu ein Junge, hatte er recht. »Sie hat uns noch mehr davon gegeben. Ich habe euch beide gebeten, die Macht ruhen zu lassen.«
»Es war richtig, uns darum zu bitten – auch wenn wir sie hin und wieder aufgeweckt haben«, fügte Eamon mit einem Lächeln hinzu. »Wir brauchten die Zeit hier, aber nun geht sie allmählich zu Ende. Das spüre ich.«
»Genau wie ich«, murmelte Brannaugh. »Deshalb habe ich mich gefragt, ob das für mich Fial bedeutet. Aber nein, ihr habt recht, alle beide. Ich bin nicht für einen Bauernhof bestimmt. Nicht für Küchenzaubereien und Spiele im Haus. Wir schauen nach, hier im Kreis. Wir schauen nach, dann werden wir sehen. Und wissen.«
»Zusammen?« Bei der Frage glühte Teagans Gesicht vor Freude, und Brannaugh wurde klar, dass sie sich selbst und ihre Geschwister zu lange zurückgehalten hatte.
»Zusammen.« Brannaugh legte die hohlen Hände aneinander, ließ die Macht aufsteigen, herauskommen. Dann ließ sie die Hände fallen wie herabstürzendes Wasser und machte so das Feuer. Und dieses Feuermachen, die erste Kunst, die sie gelernt hatte, die Reinheit der Magie durchströmten sie. Es war, als würde sie zum ersten Mal seit fünf Jahren richtig durchatmen.
»Jetzt hast du mehr«, stellte Teagan fest.
»Ja. Es hat gewartet. Ich habe gewartet. Wir haben gewartet. Aber das ist jetzt vorbei. Durch die Flamme und den Rauch spüren wir Cabhan auf, sehen, wo er sich versteckt hält. Du siehst tiefer«, sagte Brannaugh zu Eamon, »aber sei vorsichtig. Wenn er merkt, dass wir ihn beobachten, dann beobachtet er uns auch.«
»Ich weiß, was ich tue. Wir können durchs Feuer gehen, durch die Luft fliegen, über Wasser und Land, bis zu ihm.« Eamon legte die Hand auf das kleine Schwert an seiner Seite. »Wir können ihn töten.«
»Dazu braucht es mehr als dein Schwert. Trotz all ihrer Macht konnte unsere Mutter ihn nicht zerstören. Dazu braucht es mehr, und wir werden auch mehr finden. Zur rechten Zeit. Vorerst schauen wir nur.«
»Wir können fliegen. Alastar und ich. Wir …« Teagan brach ab, als Brannaugh sie scharf ansah. »Eines Tages ist es … einfach so passiert.«
»Wir sind, was wir sind.« Brannaugh schüttelte den Kopf. »Das hätte ich nie vergessen dürfen. Jetzt schauen wir. Durch Feuer und Rauch soll es glücken, wir beschwören unsere Macht, geschützt vor Blicken. Zu suchen, zu finden, seine Augen wir blenden, ihn, der hat vergossen unser Blut. Nun erhebt sich unsere Macht wie eine Flut. Wir sind die drei allein. Wie wir es wollen, so möge es sein.«
Sie fassten einander fest an den Händen, vereinten ihr Licht.
Flammen wichen zur Seite, der Rauch verzog sich.
Und dort war Cabhan. Er trank Wein aus einem silbernen Becher. Das dunkle Haar fiel ihm auf die Schultern, schimmerte im Schein der Talglichter.
Brannaugh sah Steinmauern, von kostbaren Wandteppichen bedeckt, ein Bett mit Vorhängen aus tiefblauem Samt.
Er lebt nicht schlecht, dachte sie. Er hatte Annehmlichkeiten und Reichtümer gefunden – das überraschte sie nicht. Und er würde seine Macht nutzen, zu seiner Bereicherung, zu seinem persönlichen Lustgewinn, um zu töten. Zu allem, was seinen Absichten diente.
Nun trat eine Frau ins Zimmer. Sie trug kostbare Kleider, und ihr Haar war schwarz wie die Nacht. In seinem Bann, dachte Brannaugh, dem blinden Ausdruck in ihren Augen nach zu urteilen. Und doch … mit einer gewissen Macht, dachte Brannaugh. Die darum kämpfte, die Fesseln zu sprengen, die sie banden.
Cabhan sprach kein Wort, schnippte nur mit der Hand in Richtung Bett. Die Frau ging darauf zu, entkleidete sich, stand einen Augenblick da, und ihre Haut schimmerte im Licht weiß wie der Mondschein.
Hinter jenen blinden Augen sah Brannaugh den tobenden Krieg, sah, wie die Frau erbittert darum kämpfte, sich zu befreien. Zuzuschlagen.
Eamons Konzentration geriet für einen Moment ins Wanken. Er hatte noch nie eine erwachsene Frau ganz nackt gesehen, schon gar keine mit so großen Brüsten. Wie seine Schwestern spürte auch er diese eingesperrte Macht – sie war wie ein weißer Vogel in einer schwarzen Kiste. Doch all die nackte Haut, diese sanften, üppigen Brüste, dieses faszinierende Dreieck aus Haaren zwischen ihren Beinen …
Ob es sich so anfühlte wie das Haar auf ihrem Kopf? Eamon wünschte sich sehnlichst, sie anzufassen, nur dort, um es herauszufinden.
Plötzlich reckte Cabhan den Kopf wie ein Wolf, der Witterung aufnimmt. Er sprang so rasch auf, dass der silberne Becher umkippte und sich Wein daraus ergoss, rot wie Blut.
Brannaugh drückte Eamons Finger so fest, dass es wehtat. Auch wenn er aufjaulte und rot anlief wie die Glut, gelang es ihm, sich wieder zu konzentrieren.
Doch für einen Moment, einen schrecklichen Moment, schienen Cabhans Augen direkt in seine zu schauen.
Dann ging er zu der Frau. Er packte ihre Brüste, drückte und knetete sie. Schmerz zuckte über ihr Gesicht, doch sie schrie nicht auf.
Sie konnte nicht.
Cabhan kniff in ihre Brustwarzen, verdrehte sie, bis ihr die Tränen über die Wangen rannen, bis blaue Flecken die weiße Haut verunstalteten. Er schlug sie, stieß sie rücklings aufs Bett. Blut rann aus ihrem Mundwinkel, doch sie starrte ihn nur an.
Mit einem Ruck aus dem Handgelenk war er nackt, und sein Glied ragte steif empor. Es schien zu leuchten, aber nicht von Licht, sondern von Dunkel. Eamon spürte, dass es wie Eis war – kalt, schneidend und grausam. Nun rammte er es in die Frau hinein wie einen Spieß, während ihr Tränen über die Wangen strömten und Blut aus dem Mund rann.
Irgendetwas in Eamon barst vor Empörung – ein heftiger, intuitiver Zorn darüber, eine Frau so behandelt zu sehen. Beinahe wäre er durch das Feuer, den Rauch gestürzt, doch Brannaugh umklammerte seine Hand fest.
Während Cabhan die Frau vergewaltigte – denn etwas anderes war das nicht –, konnte Eamon seine Gedanken spüren. Gedanken an Sorcha und die grausame Begierde nach ihr, die er nie gestillt hatte. Gedanken an … Brannaugh. Daran, wie er das da mit ihr machen würde und noch mehr. Schlimmeres. Wie er ihr Schmerz zufügen würde, bevor er ihre Macht an sich riss. Wie er ihr das Leben nahm.
Rasch löschte Brannaugh das Feuer und beendete damit abrupt die Vision. Ebenso rasch packte sie Eamon an beiden Armen. »Ich habe gesagt, wir sind nicht bereit. Glaubst du, ich merke nicht, wie du dich sammelst, um zu gehen?«
»Er hat ihr wehgetan. Er hat ihre Macht genommen, ihren Körper, gegen ihren Willen.«
»Er hätte dich beinahe gefunden – er hat gespürt, wie etwas hereinkommen wollte.«
»Allein für seine Gedanken würde ich ihn umbringen. Niemals berührt er dich so wie sie.«
»Er wollte ihr wehtun.« Teagans Stimme war jetzt die eines Kindes. »Aber er hat an unsere Mutter gedacht, nicht an die Frau. Und dann hat er an dich gedacht.«
»Seine Gedanken können mir nicht wehtun.« Doch sie hatten Brannaugh erschüttert, tief in ihrem Inneren. »Er tut mir – oder euch – niemals das Gleiche an wie dieser armen Frau.«
»Hätten wir ihr helfen können?«
»Ach, Teagan, ich weiß es nicht.«
»Wir haben es nicht versucht.« Eamons Worte peitschten durch die Luft. »Du hast mich hier festgehalten.«
»Um dein Leben nicht zu gefährden und unseres und unser Ziel. Glaubst du, ich empfinde nicht dasselbe wie du?« Selbst ihre geheime Furcht ertrank in einer eisigen Welle des Zorns. »Dass es mir nicht tausend Stiche versetzt hat, untätig zuzuschauen? Cabhan hat Macht. Nicht so wie früher, sondern anders. Nicht mehr, sondern weniger, und doch anders. Ich weiß nicht, wie wir ihn bekämpfen sollen. Noch nicht. Wir wissen es nicht, Eamon, aber wir müssen es wissen.«
»Er kommt. Nicht heute Nacht, nicht morgen, aber er kommt. Er weiß, dass du …«
Eamon errötete wieder, wandte den Blick ab.
»Er weiß, dass ich Kinder bekommen kann«, beendete Brannaugh den Satz. »Er glaubt, er würde einen Sohn von mir bekommen. Das wird niemals geschehen. Aber er kommt. Das spüre ich auch.«
»Dann müssen wir gehen.« Teagan lehnte den Kopf an Kathels Flanke. »Wir dürfen ihn nie hierherbringen.«
»Wir müssen gehen«, stimmte Brannaugh ihr zu. »Und wir müssen sein, was wir sind.«
»Wohin gehen wir?«
»Nach Süden.« Brannaugh schaute Eamon an, um Bestätigung zu finden.
»Ja, nach Süden, denn er ist immer noch im Norden. Er bleibt in Mayo.«
»Wir finden einen Platz, und dort lernen und finden wir mehr. Und eines Tages gehen wir nach Hause.«
Brannaugh stand auf, fasste ihre Geschwister erneut bei den Händen, ließ die Macht von einem zum anderen aufkeimen. »Ich schwöre bei unserem Blut, dass wir nach Hause zurückkehren.«
»Ich schwöre bei unserem Blut«, sagte Eamon, »dass wir oder unsere Nachkommen einst sogar die Gedanken an Cabhan vernichten.«
»Ich schwöre bei unserem Blut«, sagte Teagan, »dass wir die drei sind und es immer bleiben.«
»Jetzt schließen wir den Kreis, aber wir schließen nie wieder aus, was wir sind, was wir haben, was uns gegeben wurde.« Brannaugh ließ die Hände der anderen los. »Wir brechen morgen auf.«
Mit verweinten Augen sah Ailish zu, wie Brannaugh ihr Schultertuch einpackte. »Ich bitte dich, bleibt hier! Denk doch an Teagan. Sie ist noch ein Kind.«
»Sie ist so alt, wie ich es war, als wir zu dir kamen.«
»Da warst du ein Kind«, sagte Ailish.
»Ich war mehr. Wir sind mehr, und wir müssen sein, was wir sind.«
»Ich habe dich erschreckt, als ich von Fial gesprochen habe. Du kannst aber nicht denken, dass wir dich zu einer Heirat zwingen würden.«
»O nein!« Jetzt drehte Brannaugh sich um und ergriff die Hände ihrer Cousine. »Das würdet ihr nie tun. Wir verlassen euch nicht wegen Fial, Ailish.«
Brannaugh wandte sich wieder ab und packte ihre letzten Sachen ein.
»Eure Mutter würde nicht wollen, dass ihr das tut.«
»Unsere Mutter würde wollen, dass wir zu Hause sind, glücklich und in Sicherheit, zusammen mit ihr und unserem Vater. Aber das sollte nicht sein. Meine Mutter hat ihr Leben für uns gegeben und ihre Macht. Und jetzt hat sie auch ihre Bestimmung an uns weitergegeben. Wir müssen unser Leben leben, unsere Macht annehmen, unsere Bestimmung erfüllen.«
»Wohin geht ihr?«
»Nach Clare, denke ich. Vorerst, denn wir kommen zurück. Und dann gehen wir nach Hause. Das spüre ich, so wahr ich lebe. Cabhan wird nicht hierherkommen.«
Brannaugh wandte sich wieder um und sah ihrer Cousine in die Augen, die eigenen Augen wie Rauch. »Er kommt nicht her oder fügt dir oder einem der deinen ein Leid zu. Das schwöre ich dir beim Blut meiner Mutter.«
»Wie kannst du das wissen?«
»Ich bin eine der drei. Ich bin eine Dunkle Hexe aus Mayo, die erste Tochter von Sorcha. Cabhan kommt nicht her oder fügt dir oder einem der deinen ein Leid zu. Ihr seid euer Leben lang geschützt. Dafür habe ich gesorgt. Ich würde euch nicht ungeschützt zurücklassen.«
»Brannaugh …«
»Du machst dir Sorgen.« Brannaugh legte die Hände auf die ihrer Cousine, die auf deren kugelrundem Bauch ruhten. »Habe ich dir nicht gesagt, dein Sohn ist wohlauf und gesund? Die Geburt wird leicht und schnell dazu. Auch das kann ich dir versprechen. Aber …«
»Was hast du? Du musst es mir sagen.«
»So sehr du mich liebst, du fürchtest dich immer noch vor dem, was ich habe. Aber du musst jetzt auf mich hören. Dein Sohn, der bald geboren wird, muss der letzte sein. Er wird gesund sein, und die Geburt wird gut verlaufen. Aber die nächste würde das nicht. Wenn es eine nächste gibt, überlebst du sie nicht.«
»Ich … Das kannst du nicht wissen! Ich kann von meinem Mann nicht verlangen, auf das eheliche Bett zu verzichten. Oder von mir selbst.«
»Du kannst von deinen Kindern nicht verlangen, auf ihre Mutter zu verzichten. Das ist ein grausamer Kummer, Ailish.«
»Gott wird entscheiden.«
»Gott hat dir bald sieben Kinder geschenkt, aber der Preis für ein weiteres ist dein Leben und das des Kindes dazu. Bei meiner Liebe, höre auf mich.«
Brannaugh zog ein Fläschchen aus ihrer Tasche. »Das habe ich für dich gemacht. Nur für dich. Bewahre es gut auf. Jeden Monat einmal, am ersten Tag, an dem du deinen Fluss hast, trinkst du davon – nur einen kleinen Schluck. Dann empfängst du kein Kind, selbst dann nicht, wenn du den letzten Schluck getrunken hast, weil es dann vorbei ist. Du wirst leben. Deine Kinder behalten ihre Mutter. Du lebst so lange, dass du noch ihre Kinder wiegen wirst.«
Ailish legte die Hände auf ihren gewölbten Bauch. »Ich werde unfruchtbar sein.«
»Du wirst deinen Kindern – und deren Kindern – etwas vorsingen. Du wirst mit deinem Mann das Bett teilen, in Freuden. Du wirst dich an den kostbaren Leben erfreuen, die du zur Welt gebracht hast. Die Entscheidung liegt bei dir, Ailish.«
Brannaugh schloss für einen Moment die Augen. Als sie sie wieder aufschlug, wurden sie dunkel. »Du wirst ihn Lughaidh nennen. Er wird schön von Angesicht und Haar sein, mit blauen Augen. Ein starker Junge, stets zum Lächeln bereit, mit der Stimme eines Engels. Eines Tages wird er auf Reisen gehen, umherziehen und mit seiner Stimme seinen Lebensunterhalt verdienen. Er verliebt sich in eine Bauerntochter und kommt mit ihr zu euch zurück, um das Land zu bestellen. Und dann hörst du seine Stimme quer über die Felder, denn er wird immer fröhlich sein.« Brannaugh ließ die Vision enden. »Ich habe gesehen, was sein könnte. Du musst entscheiden.«
»Lughaidh ist der Name, den ich für ihn ausgewählt habe«, murmelte Ailish. »Davon habe ich dir nie erzählt, auch sonst niemandem.« Nun nahm sie die Flasche. »Ich werde auf dich hören.«
Mit zusammengepressten Lippen griff Ailish in ihre Tasche, holte einen kleinen Beutel heraus. Sie drückte ihn Brannaugh in die Hand. »Nimm das.«
»Deine Münzen nehme ich dir nicht.«
»Du nimmst sie.« Jetzt flossen die Tränen, strömten über Ailishs Wangen wie Regentropfen. »Glaubst du, ich wüsste nicht, dass du mich und Conall bei der Geburt gerettet hast? Und selbst jetzt denkst du noch an mich und die meinen. Du hast mir Freude geschenkt. Du hast Sorcha zu mir gebracht, als sie mir fehlte, denn in dir habe ich sie Tag für Tag gesehen. Du nimmst die Münzen, und schwöre mir, dass ihr in Sicherheit sein werdet und eines Tages zurückkommt. Ihr alle, denn ihr seid mein, so wie ich die eure bin.«
Brannaugh verstand, und so ließ sie den Geldbeutel in ihre Rocktasche gleiten. Dann küsste sie Ailish auf beide Wangen. »Ich schwöre es.«
Draußen tat Eamon sein Bestes, um seine Cousins und Cousinen zum Lachen zu bringen. Sie baten ihn natürlich, nicht fortzugehen, fragten, warum er müsse, versuchten, mit ihm zu verhandeln. Also erfand er Geschichten von den großen Abenteuern, die er erleben würde, Drachen würde er töten und verzauberte Frösche fangen. Er sah, wie Teagan mit der weinenden Mabh umherging, der Kleinen eine Flickenpuppe schenkte, die sie selbst gemacht hatte.
Er wünschte, Brannaugh würde sich beeilen, denn das Abschiednehmen war eine Qual. Alastar stand bereit. Eamon hatte entschieden, dass seine Schwestern reiten würden, er selbst würde laufen – schließlich war er das Familienoberhaupt.
Er duldete keine Widerrede.
Bardan kam aus dem kleinen Stall und führte Slaine heraus – Old Slaine war sie jetzt, denn die Zuchtstute hatte ihre Blütezeit hinter sich. Doch sie war ein gutmütiges Tier.
»Die Zeit, Fohlen zu bekommen, ist für sie vorbei«, sagte Bardan auf seine bedächtige Art. »Aber sie ist ein braves Mädchen, und sie wird dir gute Dienste tun.«
»Oh, aber ich kann sie euch nicht wegnehmen. Ihr braucht …«
»Ein Mann braucht ein Pferd.« Bardan legte Eamon die schwielige Hand auf die Schulter. »Du hast auf dem Hof gearbeitet wie ein Mann, also nimmst du sie. Ich würde euch auch Moon für Brannaugh geben, wenn ich ihn entbehren könnte, aber Old Slaine nehmt ihr.«
»Ich bin dir mehr als dankbar, für Slaine und für alles andere. Ich verspreche dir, sie zu behandeln wie eine Königin.«
Für einen Moment gestattete Eamon sich, einfach nur ein kleiner Junge zu sein, und fiel seinem Cousin um den Hals, jenem Mann, der ihm sein halbes Leben lang ein Vater gewesen war. »Wir kommen wieder.«
»Das will ich doch sehr hoffen.«
Als alles vorüber war, alle Abschiedsworte, die Gute-Reise-Wünsche, die Tränen, schwang Eamon sich auf die Stute, Schwert und Scheide seines Großvaters fest an den Sattel geschnallt.
Brannaugh saß hinter Teagan auf und beugte sich hinunter, um Ailish einen letzten Kuss zu geben.
Dann ritten sie fort von dem Hof, der fünf Jahre lang ihr Zuhause gewesen war, von ihrer Familie, gen Süden, ins Unbekannte.
Eamon schaute noch einmal zurück, winkte, als die anderen winkten, stellte fest, dass ihm der Abschied mehr zusetzte, als er erwartet hatte. Dann rief Roibeard oben am Himmel, zog ein paar Kreise, bevor er pfeilgerade in Richtung Süden flog.
Dies war ihre Bestimmung, entschied Eamon. Es war an der Zeit.
Er verlangsamte das Tempo ein wenig und legte den Kopf schräg, um Teagan anzusehen. »Und, wie findet unsere Slaine all das?«
Teagan schaute zu der Stute hinunter, legte gleichfalls den Kopf schräg. »Oh, für sie ist es ein großes Abenteuer, das steht fest, und dabei dachte sie, dass sie nie wieder eins erleben würde. Sie ist stolz und dankbar. Sie wird dir treu sein bis ans Ende ihrer Tage und ihr Bestes für dich geben.«
»Und ich gebe mein Bestes für sie. Wir reiten bis nach Mittag durch. Dann machen wir eine Pause, um die Pferde ausruhen zu lassen und die ersten Haferkekse zu essen, die Ailish uns eingepackt hat.«
»Aha, machen wir das so?«, fragte Brannaugh.
Eamon reckte das Kinn in die Luft. »Du bist die Älteste, aber ich hab den Stängel, auch wenn du ihn noch so mickrig findest – was er überhaupt nicht ist. Roibeard zeigt den Weg, und wir folgen.«
Brannaugh hob den Blick und beobachtete den Flug des Habichts. Dann schaute sie hinunter zu Kathel, der neben Alastar hertänzelte, als könnte er den ganzen Tag und die Nacht durchlaufen.
»Dein Schutztier, meins und Teagans. Ja, wir folgen ihm. Ailish hat mir etwas Geld geschenkt, aber das geben wir erst aus, wenn es unbedingt sein muss. Wir verdienen unser eigenes Geld.«
»Und wie sollen wir das machen?«
»Indem wir sind, was wir sind.« Brannaugh hob die Hand, kehrte die Handfläche nach oben, ließ einen kleinen Feuerball darauf erscheinen und wieder verschwinden. »Unsere Mutter hat ihrer Gabe gedient, sich um uns gekümmert und um ihre Hütte. Also können wir sicher ebenso unserer Gabe dienen, uns um uns selbst kümmern und einen Platz finden, um beides zu tun.«
»Clare soll ziemlich wild sein, hab ich gehört«, gab Teagan zu bedenken.
»Wo könnte es für solche, wie wir es sind, besser sein als in der Wildnis?« Die schiere Freude darüber, frei zu sein, wuchs mit jedem Schritt. »Wir haben das Buch unserer Mutter, und wir studieren es, wir lernen. Wir machen Zaubertränke und heilen. Heiler sind immer willkommen, hat sie mir gesagt.«
»Wenn Cabhan kommt, brauchen wir aber mehr als Heilkunst und Zaubertränke.«
»Das ist richtig«, sagte Brannaugh zu ihrem Bruder. »Deshalb lernen wir. Wir waren fünf Jahre lang in Sicherheit auf dem Hof. Wenn unsere Schutztiere uns nach Clare führen, wie es den Anschein hat, verbringen wir vielleicht die nächsten fünf Jahre dort. Zeit genug, um zu lernen, zu planen. Wenn wir nach Hause zurückkehren, werden wir stärker sein, als Cabhan es wissen kann.«
Sie ritten bis nach Mittag und in den Regen hinein. Sanft und stetig fiel er aus einem düster verhangenen Himmel. Sie ließen die Pferde ausruhen, tränkten sie, teilten sich Haferkekse, auch Kathel bekam welche ab. Der Regen brachte den Wind, als sie ihre Reise fortsetzten, vorbei an einem kleinen Gehöft. Rauch stieg aus dem Schornstein des Häuschens und verbreitete den Duft von brennendem Torf. Drinnen würden sie vielleicht willkommen geheißen, Tee bekommen und einen Platz am Feuer. Drinnen, wo es warm und trocken war.
Doch Kathel tänzelte weiter, Roibeard zog seine Kreise, und Alastar verlangsamte seine Gangart kein bisschen. Dann erstarb selbst die Dämmerung, und der Tag neigte sich zur Nacht.
»Slaine wird müde«, murmelte Teagan. »Sie wird uns nicht darum bitten anzuhalten, aber ihre Kräfte lassen nach. Ihr tun die Knochen weh. Können wir sie nicht ein bisschen ausruhen lassen, ein trockenes Plätzchen finden und …«
»Da!« Eamon zeigte voraus. Neben dem matschigen Pfad stand etwas, das einst eine Kultstätte gewesen sein mochte. Geplündert und bis auf die rußigen Steine niedergebrannt von Männern, die es nicht lassen konnten zu zerstören, was die von ihnen Besiegten erbaut hatten.
Roibeard kreiste darüber und stieß seine Rufe aus, und Kathel sprang voraus.
»Dort bleiben wir für die Nacht. Wir machen Feuer, die Tiere können ausruhen und wir auch.«
Brannaugh nickte ihrem Bruder zu. »Die Wände stehen noch – die meisten jedenfalls. Sie dürften den Wind abhalten, und den Rest machen wir. Der Tag ist bald zu Ende. Wir schulden Modron und Mabon, der von ihr kam, unseren Dank.«





























