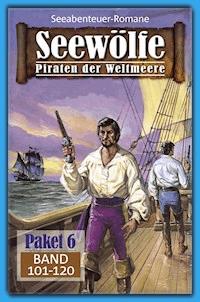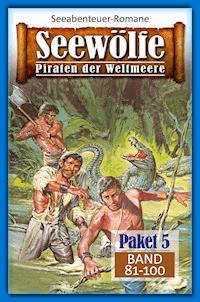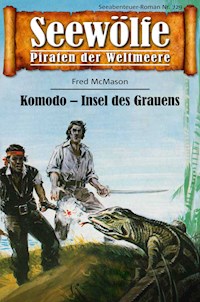Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Was von der Galeone übriggeblieben war, sah aus wie ein Gerippe. Die Beplankung fehlte, nur die Querspanten ragten aus den Seiten hervor, so daß man rundum durch das Wrack sehen konnte. Aber nicht das war es, was die vier Seewölfe verharren ließ, nein, es war der Hauch des Todes, der über dieser Stätte lag. Auf dem Kielschwein des Wracks und an den Querspanten hockten ausgeblichene, menschliche Gerippe, als warteten sie darauf, von jemandem abgeholt zu werden. Es waren mehr als ein Dutzend Skelette, die in der Sonne bleichten und dieser Stätte des Todes eine unheimliche Ausstrahlung verliehen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2569
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2016 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-501-9Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 221
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 222
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 223
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 224
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 225
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 226
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 227
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Nr. 228
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 229
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Fußnoten
Nr. 230
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Fußnoten
Nr. 231
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Nr. 232
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 233
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 234
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 235
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 236
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Nr. 237
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 238
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 239
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 240
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Noch vor wenigen Augenblicken hatten die Strahlen der Sonne das Wasser versilbert. Doch jetzt zog plötzlich finsteres Gewölk auf, das dunkle Schatten auf die Wasserfläche warf.
Und dann brach das Tropengewitter in all seiner Gewalt los.
Wo gerade noch die Sonne erbarmungslos gebrannt und feuchte, dampfende Hitze das Atmen erschwert hatte, da tobten nun die entfesselten Elemente. Das Grollen des Donners erinnerte an die trommelnden Hufschläge eines riesigen Reiterheeres und das Krachen und Bersten der Einschläge an das Gebrüll der Culverinen bei einem gewaltigen Seegefecht.
Zuckende Blitze vergossen grelle Lichtströme und schienen das schwarze Himmelsgewölbe in tausend Fetzen zerreißen zu wollen. Eine prasselnde, wolkenbruchartige Regenflut folgte und hüllte das Inferno in einen grauen, nassen Schleier.
Die „Isabella VIII.“, eine schlanke, dreimastige Galeone von etwa zweihundertfünfzig Tonnen Größe, wirkte im Toben der Elemente wie ein Gespensterschiff – groß, dunkel und geheimnisvoll.
Erst als das heftige Tropengewitter mit der gleichen Schnelligkeit, mit der es heraufgezogen war, aufhörte, schälte sich der schnelle Rahsegler, der vom besten Schiffsbauer Englands erbaut worden war, aus der düsteren und dampfenden Atmosphäre. Er glitt hinein in das gleißende Licht der Sonne, das die Gewitterwolken rasch wieder auflöste, so, als sei überhaupt nichts geschehen.
Man schrieb den 8. März im Jahre des Herrn 1591. Die „Isabella“ segelte mit Backstagsbrise auf Nordwestkurs dem Äquator entgegen. Seit sie Parnaiba an der Atlantikküste des südamerikanischen Kontinents verlassen hatte, lief sie ihren Kurs stets in Sichtweite der Küste.
Der Himmel strahlte bereits wieder im gewohnten Blau, und nur die mächtigen Wolken, die drüben an der Küste über den endlosen Urwäldern dampften, erinnerten an den Ausbruch der Naturgewalten.
An Bord der „Isabella“ war es drückend heiß und schwül. Auch der Gewitterregen hatte keine Abkühlung gebracht. Die Hitze flimmerte und veranlaßte einen Teil der Crew, still und untätig vor sich hin zu dösen. Nur vereinzelt wurde das gleichförmige Rauschen des Wassers unterbrochen durch das Geschrei der Aluates, der Brüllaffen, das aus dem Dschungel herübertönte.
Das feuchte, schweißtreibende Klima erzeugte eine gedrückte Stimmung unter den Seewölfen. Auch Philip Hasard Killigrew, dem Kapitän der „Isabella“, standen kleine Schweißperlen auf der Stirn, als er neben Ben Brighton an der Schmuckbalustrade des Achterkastells stand und seine eisblauen Augen prüfend über die Decks wandern ließ.
Das kurze, heftige Tropengewitter war für ihn und seine Mannschaft nichts Neues gewesen. Sie hatten den südamerikanischen Dschungel und seine Launen und Tücken bereits kennengelernt und wußten im großen und ganzen, wie sie sich in dieser kochenden und brodelnden Hölle zu verhalten hatten.
Einigen schien jedoch die Hitze nur wenig zuzusetzen. Unermüdlich waren sie in Bewegung, um wenigstens die notwendigsten Handgriffe zu erledigen. So auch Philip und Hasard, die beiden zehnjährigen Zwillingssöhne des Seewolfs, die beide damit beschäftigt waren, eine Schlagpütz Seewasser nach der anderen übers Schanzkleid zu hieven, um die Decksplanken zu schrubben. Die vorausgegangene kurze Regenflut konnte die regelmäßige, gründliche Reinigung natürlich nicht ersetzen.
Den beiden schien die Arbeit Spaß zu bereiten, und sie schwitzten auch nicht so sehr wie Bob Grey, Matt Davies, Jeff Bowie und Luke Morgan, die noch auf der Kuhl beschäftigt waren und von Zeit zu Zeit nicht gerade schmeichelhafte Bemerkungen über die brütende Hitze von sich gaben. Der Kutscher werkte noch in der Kombüse herum und Bill, der Moses, hockte als Ausguck im Großmars und ließ seine flinken Augen tastend über die Wasserfläche bis zur Küste hinüberwandern.
Ferris Tucker, der rothaarige Riese mit dem Kreuz, so breit wie ein Rahsegel, der Schiffszimmermann der „Isabella“, hatte sich auf dem Backbordniedergang zur Kuhl niedergelassen und war damit beschäftigt, seine gefürchtete Axt zu schärfen, die nicht nur als Werkzeug, sondern auch als Waffe berüchtigt war.
Batuti, der schwarze Mann aus Gambia, hockte daneben und sah ihm interessiert zu.
Die übrigen Männer der Crew, darunter Smoky, Blacky, Gary Andrews und Old Donegal Daniel O’Flynn, hielten sich mit Ausnahme von Pete Ballie, der am Ruder stand, an der vorderen Schmuckbalustrade der Back auf.
„Die Stille trügt, ich spüre es“, sagte Old Donegal Daniel O’Flynn und setzte mit Nachdruck seine Beinprothese auf die Planken. „Der Tag wird nicht so ruhig weiterverlaufen.“
„Was heißt hier Stille?“ brummte Smoky, ein Rauhbein, das noch unter Francis Drake als Decksältester gefahren war. „Reicht dir das ständige Gebrüll der Affen nicht? Oder“, setzte er mit einem Grinsen hinzu, „hast du vielleicht während des Gewitters eine Windbraut oder gar einen Wassermann gesehen?“
Die Männer sahen sich an, und der eine oder andere konnte sich ein Augenzwinkern nicht verkneifen. Sie kannten schließlich die Ahnungen von Old O’Flynn, aber sie wußten auch, daß er manchmal recht behielt.
Old O’Flynn wurde ärgerlich und legte das von vielen Stürmen gezeichnete Gesicht in Falten.
„Spottet nur“, sagte er. „Eines Tages werdet ihr es schon noch selber merken, daß es zwischen Himmel und Erde Dinge gibt, von denen sich der Mensch nichts träumen läßt …“
„Amen!“ unterbrach Dan O’Flynn und erntete dafür einen mißbilligenden Blick seines Vaters.
Doch auch dem alten O’Flynn schien bei dieser Wahnsinnshitze der Sinn nicht unbedingt nach einem handfesten Streit zu stehen. Er stützte seine Hände auf die Balustrade und blickte mit kritischen Augen zur Küste hinüber.
Ed Carberry, der Profos der „Isabella“, ein bulliger Riese mit einem gewaltigen Rammkinn und zernarbtem Gesicht, hatte sich gerade eine Muck Wasser geholt und ließ sich damit auf einer Taurolle nieder, die auf der Kuhl lag. Bäche von Schweiß liefen über sein kantiges Gesicht, als er die Muck neben sich abstellte und zunächst einmal – ziemlich erfolglos – versuchte, sich den Schweiß vom Gesicht zu wischen.
„In der Hölle kann’s nicht heißer sein“, murmelte er. „Und des Teufels Großmutter scheint heute eine besonders heiße und dampfende Suppe zu kochen.“
Der Profos gab es bald auf, den Schweiß loszuwerden, und wollte nach der Muck mit dem brühwarmen Wasser greifen, das bei dieser Affenhitze mehr und mehr zum lebenserhaltenden Element wurde.
Aber die Muck war weg.
Verdutzt wischte sich Ed Carberry über die Augen. Verdammt, gerade eben hatte er die Muck doch hier rechts neben sich gestellt. Sie konnte sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Oder sollte ihm die Hitze schon ans Hirn gegangen sein? Verflixt und zugenäht, bis jetzt hatte er noch immer seine sieben Sinne beisammen gehabt. Hier und sonst nirgends hatte er die Muck mit dem Wasser hingestellt.
Ed Carberry schickte einen mißtrauischen Blick zu den Zwillingen hinüber. Die beiden „Rübenschweinchen“, wie er sie oft zu nennen pflegte, holten jedoch eifrig die Leinen ein, die am jeweiligen Bügel ihrer Schlagpütz angespleißt waren, und schienen im Moment am Profos der „Isabella“ keinerlei Interesse zu haben. Außerdem waren sie auch zu weit von ihm entfernt, um ihm einen Schabernack spielen zu können.
Aber wo war die Muck?
Ha – endlich merkte Ed Carberry, wer ihn auf den Arm nehmen wollte. Es konnte nur Luke Morgan gewesen sein, der kleine, dunkelblonde Kerl mit der Messernarbe über der Stirn, der als „Hitzkopf“ der Mannschaft galt. Luke Morgan befand sich im Moment keine drei Yards von ihm entfernt.
Ed Carberry blieb auf seiner Taurolle sitzen und streckte Luke Morgan fordernd die Hand entgegen.
„Ich habe, verdammt noch mal, einen gewaltigen Brand in der Kehle“, sagte er.
„Na und?“ gab Luke Morgan zurück. „Glaubst du vielleicht, uns geht es anders, Ed? Es soll verschiedene Flüssigkeiten geben, die da Abhilfe schaffen.“
Hinter der Stirn des Profos braute sich ein Gewitter zusammen. Sein Blick verfinsterte sich und seine rechte Hand war noch immer Luke Morgan entgegengestreckt.
„Eben deshalb“, sagte Ed Carberry mit Donnerstimme, „möchte ich sofort meine Muck Wasser wiederhaben. Oder glaubst du schwindsüchtige Kakerlake vielleicht, daß du mich leimen kannst? Und wehe dir, es fehlt auch nur ein einziger Schluck.“
Luke Morgan hatte runde Augen.
„Jetzt ist es soweit“, stieß er hervor. „Ich meine, es ist die Hitze, Mister Carberry“, fügte er noch hinzu und begann zu grinsen. „Ich habe die letzte Stunde noch keine Muck mit Wasser gesehen. Sicher hast du zu große Schlucke genommen und dabei die Muck ganz einfach mit runtergeschluckt.“
„Jetzt hört euch diese neunschwänzige Bilgenratte an!“ brüllte der Profos und erhob sich. Seine wütenden Augen kündigten Luke Morgan nicht gerade einen Feiertag an. „Ich werde jetzt bis drei zählen“, sagte er mit einem gefährlichen Knurren in der Stimme. „Hörst du? Genau bis drei, und wenn dann meine Muck nicht hier ist, werde ich dir die Haut in Streifen von deinem karierten Affenarsch ziehen. Aber schön langsam und mit …“
Weiter gelangte der Profos nicht.
Er bemerkte einen dunklen Schatten, der von oben sauste, dicht an ihm vorbeiflog und mit einem lauten Scheppern auf die Planken knallte.
Es war seine Muck. Und sie war leer.
Während die Männer, die mit Luke Morgan auf der Kuhl beschäftigt waren, in lautes Gelächter ausbrachen, fuhr Ed Carberry herum und richtete für einen Moment sprachlos den Blick nach oben. Dort sah er gerade noch Arwenack, den Schimpansen, der laut keckernd die Wanten hochturnte. Und schlagartig wurde ihm klar, was mit seiner Muck geschehen war.
„Lausiges Affenvieh!“ brüllte der Profos und schwang drohend die Fäuste. „Wenn du dich noch einmal hier unten blicken läßt, werde ich die größte Muck aus der Kombüse holen und dich, verdammt noch eins, darin ersäufen, und danach werde ich dir ein dickes Ende über deinen Affenarsch ziehen, daß dir Hören und Sehen vergeht!“
„Du hast dich in der Reihenfolge vertan, Mister Carberry!“ rief Hasard junior, der wie sein Zwillingsbruder die Schlagpütz auf die Planken gestellt hatte und interessiert dem sich anbahnenden Schauspiel gefolgt war.
„Jawohl, Mister Carberry, Sir“, ließ sich nun Philip junior vernehmen und nickte grinsend. „Zuerst das Ende und dann die Muck, anders herum geht es nicht.“
Der Profos, dem die Hitze erneut Schweißbäche übers Gesicht rinnen ließ, fuhr wie von einer Tarantel gestochen herum.
„Was? Wie?“ brüllte er. „Natürlich wird die Reihenfolge geändert. Und als erstes werde ich das Ende euch Rübenschweinchen über den Achtersteven ziehen, und zwar so, daß ihr sämtliche Engelschöre auf einmal singen hört!“
Noch während die beiden Bürschchen sich anschickten, den günstigsten Kurs für eine rasche Flucht festzulegen und der Profos drohend wie ein Racheengel auf sie zurückte, folgte die Erlösung. Zwar nicht vom Himmel, aber doch von oben.
„Deck!“ rief Bill, der Moses, aus dem Großmars. „Ich sehe ein Wrack an Backbord!“
„Wo siehst du ein Wrack?“ fragte Ben Brighton zurück, der zusammen mit dem Seewolf die Vorgänge auf der Kuhl beobachtet hatte.
„Drüben, weit in der Bucht, die wie ein riesiger Fluß aussieht. Direkt vor dem Dschungel!“
Bills Stimme klang aufgeregt. Und auch jene Männer, die bisher an der Schmuckbalustrade der Back gedöst hatten, schienen plötzlich aus ihrer Lethargie zu erwachen. Selbst der Profos vergaß für einen Augenblick sein erzieherisches Vorhaben an den beiden „Rübenschweinchen“ und dem Schimpansen Arwenack. Auch er trat ans Backbordschanzkleid und schaute angestrengt zur Bucht hinüber.
Über das faltige Gesicht des alten O’Flynn zog ein selbstzufriedenes Grinsen.
„Ein Wrack“, murmelte er zu sich selbst. „Habe ich nicht gleich gesagt, daß etwas in der Luft liegt? Ein Wrack hat selten etwas Gutes zu bedeuten.“
2.
Philip Hasard Killigrew, der Seewolf, stand nach wie vor an seinem Platz. Er hatte das Spektiv ans Auge gesetzt und suchte auf die Meldung Bills hin konzentriert die Küste ab.
„Kannst du etwas sehen?“ fragte Ben Brighton, sein Stellvertreter und der erste Offizier der „Isabella“.
„Hm“, sagte der Seewolf, und sein Gesicht nahm einen ernsten Ausdruck an. „Es scheint eine Galeone zu sein oder vielmehr das, was von ihr übrig ist. Ich kann nur ein Gerippe erkennen. Es scheint dicht vor dem Dschungel auf dem Trockenen zu liegen. Unmittelbar daneben kann ich die Mündung eines kleinen Flusses erkennen.“
„Das Gerippe einer Galeone?“ sinnierte Ben Brighton. „Was hat das nun wieder zu bedeuten?“
„Wir werden versuchen, es festzustellen“, erwiderte Hasard und nahm das Spektiv von den Augen. „Ja, wir werden uns dieses merkwürdige Wrack einmal ansehen.“
Gleich darauf gab er dem Rudergänger Pete Ballie den Befehl, nach Backbord abzufallen und ein Stück tiefer in die Baja de Marajo, in der mehrere größere und kleinere Urwaldflüsse zusammenströmten, zu steuern.
Je weiter sie sich der Küste näherten, desto lauter drangen die Geräusche des Dschungels zu ihnen herüber. Zwischen das anhaltende Geschrei der Brüllaffen, die gewöhnlich zu dieser Jahreszeit durch die Früchte der ChontaPalme fett und träge geworden waren, mischte sich das laute Kreischen von Vögeln.
Die Männer an Bord der „Isabella“ schirmten die Augen mit der flachen Hand ab und versuchten, die Konturen der wracken Galeone zu erkennen.
Selbst Sir John, der karmesinrote Aracanga-Papagei, der einst dem Profos, Ed Carberry, am Amazons zugeflogen war und seitdem die „Isabella“ auf ihren Fahrten durch die Weltmeere begleitete, lief aufgeregt auf seinem Lieblingsplatz, der Vormarsrah, hin und her. Wahrscheinlich hatte das vielstimmige Urwaldkonzert, das pausenlos zum Schiff herüberdröhnte, heimatliche Gefühle in ihm geweckt, was ihn jedoch nicht daran hinderte, einige saftige Flüche vom Stapel zu lassen, die er von seinem Herrn und Meister gelernt hatte.
Endlich war es soweit.
Die „Isabella“ hatte sich dem Wrack bis auf zwei Kabellängen genähert. Nachdem Smoky, der Decksälteste, bereits zweimal Tiefe gelotet hatte, gab der Seewolf den Befehl, die Segel aufzugeien und zu ankern.
Der Anker faßte sofort Grund, denn die „Isabella“ lag in relativ flachem Wasser. Sie befand sich in Sichtweite der wracken Galeone, die direkt auf einer Sandbank lag. Diese zog sich von der Bucht her ein Stück in das Mündungsgebiet eines kleineren Flusses hinein und ging dann in den Dschungel über.
„Sieht nicht gerade aus, als ob da noch was zu reparieren wäre“, stellte Ferris Tucker, der Schiffszimmermann, mit sachkundiger Miene fest. „Weiß der Teufel, wie lange das Wrack schon dort drüben liegt und was mit seiner Besatzung geschehen ist.“
„Ja, weiß der Teufel“, wiederholte der alte O’Flynn, der den Platz neben Ferris Tucker eingenommen hatte. „Und das mitten in der grünen Hölle, wo hinter jedem Baumstamm eine Bestie lauert. Ob das wohl Spanier waren? Oder vielleicht Portugiesen?“
Dan O’Flynn, der die schärfsten Augen an Bord hatte, war zu Bill in den Ausguck aufgeentert. Seine erregte Stimme unterbrach plötzlich die Mutmaßungen der Männer an Deck.
„Skelette!“ rief er. „Ich bin mir zwar nicht absolut sicher, aber ich glaube, es sind Skelette an Bord. Und nicht gerade wenige. Ja doch, ich sehe es jetzt deutlicher. Es sind Skelette!“
Mit einem Blick, in dem die Zukunft der nächsten tausend Jahre verborgen lag, sah der alte O’Flynn den Profos an, der neben ihn getreten war.
„Skelette“, murmelte er mit ungläubigem Gesicht. „Was denn für Skelette?“
„Von Toten natürlich, du Stint“, sagte Ed Carberry. „Oder hast du schon einmal lebendige Skelette gesehen, was, wie?“
Old O’Flynn winkte beleidigt ab. „Du willst mich wohl für dumm verkaufen, was? Ich meine natürlich, ob die Skelette vielleicht von den Dons sind, wenn das in deinen Ochsenschädel hineingehen sollte, den du rein aus Versehen auf deinen Schultern trägst.“ Wie zur Bekräftigung seiner Worte stieß er mit dem Holzbein gegen das Schanzkleid.
Bevor der Profos zu einer passenden Erwiderung Luft holen konnt, wurde er vom Seewolf unterbrochen.
„Ein Wrack mit vielen Skeletten, das ergibt auf Anhieb keinen rechten Sinn“, stellte Hasard fest. „Wir sehen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Fiert das Beiboot ab, wir pullen rüber.“
Erwartungsvoll sahen ihn die Männer an, jeder in der Hoffnung, daß er mit von der Partie sein würde. Doch da räumte der Kapitän der „Isabella“ schon mit der Ungewißheit auf und nannte die Namen.
„Du, Ed“, sagte er zu dem bulligen Profos, „und ihr, Dan und Ferris, ihr begleitet mich. Al, gib die Waffen aus.“
„Aye, Sir“, sagte Al Conroy, der stämmige, schwarzhaarige Stückmeister der „Isabella“.
Wenig später erschien er mit den Waffen. Ed Carberry erhielt eine Muskete, Dan O’Flynn und Ferris Tucker wurden mit je einer Pistole bewaffnet, und Hasard nahm seine Radschloßpistole mit. Ferris Tucker hatte zusätzlich seine frisch geschärfte Zimmermannsaxt in den breiten Ledergürtel geschoben.
Das Beiboot war inzwischen abgefiert worden, und die vier Seewölfe pullten los – auf das geheimnisvolle Wrack zu, auf dem der Tod zu hausen schien. Die Sandbank, auf der es lag, mündete direkt in dem Mangrovendickicht, hinter dem tausend tödliche Gefahren lauern konnten. Hasard und seine Männer kannten die grüne Hölle und wußten, daß man ständig auf der Hut sein mußte, wenn man nicht irgendwelche böse Überraschungen erleben wollte.
Ungehindert erreichten sie die Sandbank. Hasard, Ed Carberry und Ferris Tucker sprangen in das flache, blaugrüne Wasser, um das Boot auf den Sand zu ziehen.
Nur Dan saß noch auf der achteren Ducht und versuchte fluchend seine Pistole hochzuzerren, die sich in der Gräting verklemmt hatte. Endlich gelang es ihm. Er wollte gerade aufstehen, um den anderen zu folgen, da ließ ihn ein lauter Warnschrei heftig zusammenfahren.
Für einen Moment saß Dan O’Flynn wie erstarrt im Boot. Was er sah, ließ ihm trotz der brütenden Hitze fast das Blut in den Adern gefrieren. Sein Blick heftete sich auf das dichte Mangrovengestrüpp, das sich weiter hinten zu einem immergrünen, verfilzten Wald verdichtete. Die Mangroven wucherten wie Unkraut, weil ihre zahlreichen Luftwurzeln die Feuchtigkeit aus der ohnehin dampfenden Luft sogen und somit für ein ständiges Wachstum sorgten.
Aus dem Dickicht, das bis in das seichte Brackwasser der Flußmündung wucherte, schoß ein dunkler Schatten hervor und bewegte sich unheimlich schnell über den schmalen Streifen der Sandbank.
Es war ein riesiger Mohrenkaiman.
Dieses gefährliche Raubtier, das es sogar versteht, die blaugrüne Farbe des Wassers anzunehmen, das es durchschwimmt, gehört zu den größten Alligatoren des Amazonasgebietes und greift in seiner Gefräßigkeit alles an, was sich bewegt.
Hasard hatte den dunklen Schatten, der sich aus dem Mangrovengestrüpp gelöst hatte, als erster bemerkt und den Warnruf ausgestoßen. Aber noch bevor die Männer recht begriffen, was geschah, war der Kaiman schon heran und griff sofort Ed Carberry an.
Mit einem häßlichen Geräusch riß das gewaltige Tier, das aussah wie ein Koloß aus grauer Vorzeit, den Rachen auf und ließ eine Unzahl langer und scharfer Zähne erkennen.
Der Profos der „Isabella“, dem absolut keine Zeit mehr verblieb, einen seiner von Herzen kommenden Flüche vom Stapel zu lassen, sprang geistesgegenwärtig zur Seite. Und das war sein Glück. Nur so gelang es ihm buchstäblich im letzten Moment, dem tödlichen Angriff auszuweichen. Die mächtigen Kiefer des Mohrenkaimans schnappten ins Leere.
Doch das Ausweichmanöver Ed Carberrys war nur eine Momentlösung. Der Körper der Panzerechse schwang blitzartig herum und konzentrierte sich erneut auf sein Angriffsziel. Für einen Augenblick war selbst das kantige Gesicht des Profos aschgrau geworden, denn die Bestie hatte einen regelrechten Überraschungsangriff gestartet.
Philip Hasard Killigrew erlangte als erster seine Fassung zurück. Blitzschnell riß er seine Radschloßpistole hoch und feuerte einen Schuß auf das Reptil ab. Doch das Tier bewegte sich im selben Moment, und so ging der Schuß daneben. Die Kugel fuhr, eine kleine Fontäne hochwirbelnd, in den Sand.
Hasard gab nicht auf. Sofort krachte ein zweiter Schuß aus dem Lauf der Radschloßpistole – und diesmal traf die Kugel. Irgendwo bohrte sie sich in den mächtigen Schuppenpanzer des Kaimans.
Aber die erwartete Wirkung blieb aus. Im Gegenteil, die Echse wurde nur noch rasender, und keine Macht der Welt schien sie in diesem Zustand noch an ihrem tödlichen Vorhaben hindern zu können.
Ed Carberry war bis jetzt keine Zeit verblieben, die Muskete in Anschlag zu bringen. Er war voll damit beschäftigt, dem abermals zuschnappenden Rachen des Tieres auszuweichen.
Auch Dan O’Flynn, der mittlerweile das Boot verlassen hatte, riß nun die Pistole hoch und visierte den Kopf des Kaimans an.
Aber die Waffe funktionierte nicht.
Ein eisiger Schreck fuhr ihm durch sämtliche Glieder. Das Pulver mußte feucht geworden sein, als sich die Pistole in der Gräting verklemmt hatte. So war sie zu einem nutzlosen Instrument geworden, unbrauchbarer als ein Stein. Zähneknirschend warf er die Pistole mit einem Schwung ins Boot hinüber und riß gleichzeitig sein Entermesser aus dem Gürtel.
Ed Carberry hatte gerade einen weiteren Haken geschlagen, der selbst einem Akrobaten zur Ehre gereicht hätte.
Aber da geschah es.
Der rechte Fuß rutschte ihm in dem lockeren Sand unter dem Körper weg, und der Profos stürzte der Länge nach auf die Sandbank. Die Muskete löste sich bei dem Sturz aus seiner Hand und flog in den Dreck.
Jetzt brauchte der Profos der „Isabella“ einen guten Schutzengel.
Natürlich hatten die Männer, die auf der „Isabella“ zurückgeblieben waren, bemerkt, daß irgend etwas dort drüben auf der Sandbank nicht stimmte.
Angespannt standen sie am Backbordschanzkleid der Galeone, die zwei Kabellängen von der Sandbank entfernt, im flachen Wasser vor Anker gegangen war. Die Schüsse aus Hasards Radschloßpistole hatten sie sofort aufgeschreckt.
„Ein Krokodil“, sagte Ben Brighton, der mit flinken Fingern an der Optik des Spektivs hantierte. „Ein Krokodil scheint überraschend unseren Profos angegriffen zu haben.“
„Ist es nur eins?“ fragte Al Conroy, der Stückmeister, zurück.
„Scheint so. Ich kann nur eins erkennen. Aber hoffentlich tauchen nicht noch mehr dieser Biester aus dem Mangrovendickicht auf. Es ist sicherlich nicht das einzige, das sich dort aufhält.“
Auch Philip und Hasard, die beiden Sprößlinge des Seewolfs, blickten gespannt zum Ufer hinüber, und man merkte ihnen an, daß ihnen die Abenteuerlust unter der Haut prikkelte.
„Mister Brighton, Sir“, ließ sich Hasard junior vernehmen. „Können wir nicht ein Boot klarmachen – ich meine, können wir nicht …“
„Das ist gut von dir gemeint, Hasard.“ Ben Brighton lächelte. Er hatte während der Abwesenheit des Seewolfs das Kommando an Bord und setzte den Kieker ab. „Aber es würde unseren Leuten dort drüben nichts bringen. Mit einem Krokodil kann man nicht lange kämpfen. Bis wir ein Boot abgefiert haben und dort drüben sind, ist der Kampf längst entschieden, auch wenn wir uns noch so sehr in die Riemen legen.“
„Aber – aber Krokodile sind doch sehr gefährlich, nicht wahr?“
„Natürlich. Hoffen wir, daß es deinem Vater und den anderen Männern gelingt, mit diesem Biest fertig zu werden. Sie haben schon ganz andere Situationen gemeistert, meinst du nicht auch?“
„Natürlich, Sir. Gibt es hier nicht auch die gefürchtete Anaconda? Ich meine diese riesige Würgeschlange?“
Ben Brighton nickte und lächelte über die Wißbegierde der Zwillinge.
„Ja“, sagte er dann. „Die gibt es hier auch, dazu noch die gefräßigen Piranhas, Zitteraale, Lamantine und natürlich auch Ameisenbären, Tapire, Wasserschweine, Affen und Faultiere. Aber die riesigen Mohrenkaimane sind wohl noch mit die gefährlichsten aller Tiere, die es hier gibt.“
Wieder setzte Ben Brighton das Spektiv ans Auge und blickte zur Sandbank hinüber. Und im selben Augenblick stieß er einen erschreckten Laut aus.
„Ed Carberry“, sagte er, und sein Gesicht wurde sehr ernst. „Mein Gott, wenn das nur gutgeht …“
Noch während der Kapitän der „Isabella“ geschickt reagierte und auf die Muskete zuhechtete, die dem Profos entfallen war, schnellte Ferris Tucker vor. Er hatte inzwischen seine riesige Zimmermannsaxt aus dem Gürtel gerissen und sprang den Kaiman von der Seite her an.
Blitzartig schoß das Tier herum und war somit für einen Moment von Ed Carberry abgelenkt, der sich gerade vom Boden hochstemmen wollte. Im selben Augenblick blitzte die stählerne Axt im grellen Licht der Sonne und traf wuchtig den Schädel der Echse.
Das Tier stieß einen brüllenden Laut aus und begann wie verrückt zu toben.
Sein neuer Feind hieß jetzt Ferris Tucker.
Bevor der breitschultrige Schiffszimmermann der „Isabella“ noch einmal die Axt einsetzen konnte, erwischte ihn ein gewaltiger Schwanzschlag des Reptils und schleuderte ihn mehrere Yards über die Sandbank weg. Für einen Augenblick hatte er das Gefühl, als wären ihm sämtliche Knochen im Leib zerschmettert worden. Doch Ferris Tucker war ein harter Brocken. So schnell brachte man ihn nicht aus dem Gefecht.
Sofort raffte er sich wieder auf – und das keinen Atemzug zu spät, denn der Mohrenkaiman, der sich wohl seiner bereits angeschlagenen Beute sicher fühlte, folgte ihm sandaufwirbelnd. In dem Moment, in dem Ferris Tucker die Axt hochreißen wollte, riß die Bestie den Rachen auf. So verblieb dem rothaarigen Mann nicht mehr die Zeit, die Axt wie geplant einzusetzen.
Bevor er zurückwich, warf er dem Kaiman in letzter Verzweiflung die große Axt in das aufgesperrte Maul.
Sofort klappten die Kiefer zusammen, ein Krachen und Knirschen ertönte, und der kräftige Stiel der Axt bestand nur noch aus zertrümmerten Holzresten.
„Das gibt es doch nicht!“ entfuhr es den Lippen Ferris Tuckers. Ungläubig starrte er auf das wütende Krokodil.
Inzwischen hatte der Seewolf das Tier anvisiert, und die Muskete krachte, bevor es wieder auf sein jetzt wehrloses Opfer losgehen konnte. Die Kugel fuhr in den Schädel des Kaimans, durch dessen Körper plötzlich ein kurzes Zucken ging. Er klappte die mächtigen Kiefer auf und wieder zu. Für einen weiteren Augenblick rührte er sich nicht, dann fuhr er herum und kroch in das nahe Brackwasser der Flußmündung zurück.
Die Seewölfe atmeten auf. Die Situation war verdammt gefährlich gewesen, aber sie hatten gemeinsam den Kampf auf Leben und Tod gewonnen.
Deutlich sahen sie eine Blutspur im Sand, als das verwundete Tier in das blaugrüne Wasser eintauchte.
„Das war knapp, Leute“, sagte Hasard, „verdammt knapp sogar.“
Auch dem Profos stand noch der Schrecken in seinem zernarbten Gesicht.
„Und ich habe mich schon im Rachen dieses Krokodils gesehen“, sagte er, und fast konnte man einen ehrfürchtigen Gesichtsausdruck bei ihm erkennen.
Dan O’Flynn, der sich nach wie vor darüber ärgerte, daß seine Pistole im entscheidenden Augenblick versagt hatte, konnte sich eine Bemerkung nicht verkneifen. „Da hätte sich das Vieh aber schön den Magen an dir verdorben, sicherlich wäre es hinterher jämmerlich eingegangen.“
Noch bevor der Profos antworten konnte, ließ ihn, wie auch die drei anderen Männer, ein plötzliches Rauschen im Wasser herumfahren.
Ganz in der Nähe der Stelle, an der der Kaiman ins Wasser geglitten war, brodelte und kochte es plötzlich. Augenblicklich wurde den Seewölfen klar, was sich dort abspielte. Es erfüllte sich das Gesetz des Regenwaldes: fressen und gefressen werden.
Piranhas, jene kleinen stumpfgesichtigen Fische mit den rasiermesserscharfen Zähnen, hatten Blut gewittert. Ganz plötzlich waren sie da, wie aus dem Nichts herbeigezaubert. Das Wasser wurde aufgewühlt und färbte sich stellenweise rot vom Blut des Kaimans, von dem nach Minuten nicht mehr als das Skelett übrigbleiben würde.
Das Reptil schlug wild um sich, als der riesige Schwarm der kleinen silbrigen Fische mit ihren scherenartigen Gebissen Stücke aus seinem Fleisch heraussägte. Aber die Kraft des Mohrenkaimans erlahmte schnell. Bald war das grausige Schauspiel vorbei, das die vier Männer auf der Sandbank wie gebannt beobachtet hatten.
Jetzt konnten sie sich wieder lebhaft vorstellen, wie Jeff Bowie, der zur Besatzung der „Isabella“ gehörte, zu seiner Hakenprothese an der linken Hand gekommen war. Piranhas hatten ihm die Hand vor Jahren zerfleischt. Der gute Jeff konnte noch von Glück sagen, daß es bei der Hand geblieben war.
Nachdem die Seewölfe ihre Schußwaffen nachgeladen hatten, konnten sie sich nun endlich dem Wrack der Galeone zuwenden, das hinter ihnen auf der Sandbank lag, und zwar dort, wo der Landstreifen fast nahtlos in den Mangrovendschungel überging.
3.
Der Anblick, der sich ihren Augen bot, war grausig und ließ selbst hartgesottenen Männern wie Philip Hasard Killigrew, Ed Carberry, Ferris Tucker und Dan O’Flynn eine Gänsehaut über den Nacken kriechen. Der Kampf mit dem Mohrenkaiman hatte ihre Aufmerksamkeit so sehr beansprucht, daß ihnen erst jetzt die Unheimlichkeit und Rätselhaftigkeit des Wracks bewußt wurde.
Was von der Galeone übriggeblieben war, war nur ein Gerippe. Die Beplankung fehlte ganz, und nur die Querspanten ragten nach allen Seiten hervor, so daß man rundum durch das Wrack blicken konnte.
Aber nicht das war es, was die vier Männer von der „Isabella“ für einen Augenblick verstummen ließ, sondern der Hauch des Todes, der über dieser Stätte lag.
Auf dem Kielschwein des Wracks und an den Querspanten hockten ausgebleichte, menschliche Gerippe, als warteten sie darauf, von jemandem abgeholt zu werden. Es waren mehr als ein Dutzend Skelette, die in der Sonne bleichten und dieser Stätte des Todes eine unheimliche Ausstrahlung verliehen – trotz des Lebens im Hintergrund, trotz der vielfältigen Stimmen, die aus dem Dschungeldickicht herüberdrangen. Stumm und aus leeren Augenhöhlen schienen die Toten den Männern entgegenzublicken – eine starre, unbewegliche Gesellschaft, die wie zu einer Versammlung oder einem Palaver in der wracken Galeone beisammenhockte.
Hasard löste sich als erster aus dem Bann, der von dieser Stätte ausging.
„Eine recht merkwürdige Besatzung“, sagte er mit nachdenklichem Gesicht. „Eigentlich ist es unmöglich, daß es sich bei diesen Skeletten um die Besatzung der Galeone handelt. Wie das Wrack aussieht, ist es uralt und muß demnach schon recht lange hier liegen. Ob es ein Sturm hierhergeworfen hat, oder ob es hier angetrieben worden ist – es kann sich unmöglich um die Besatzung handeln, denn die Männer hätten sich bestimmt nicht in dieser versammlungsmäßigen Ordnung zum Sterben auf das Kielschwein gesetzt.“
„Wahrscheinlich nicht“, sagte Dan O’Flynn und legte die Stirn in Falten. „Aber könnte sie nicht eine Seuche hingerafft haben? Ich meine natürlich, nachdem das Schiff hier angetrieben wurde. Es gibt doch genug Krankheiten, die schon ganze Schiffsbesatzungen ausgelöscht haben.“
Hasard schüttelte den Kopf. „Das glaube ich nicht, Dan. Wir haben zwar schon miterlebt, was Krankheiten wie Skorbut oder das berüchtigte Wechselfieber alles anrichten können, aber in diesem Fall glaube ich nicht an so etwas. Wie die Männer hier sitzen, müßten sie im Fall einer Seuche alle auf einmal gestorben sein. Und das ist sehr unwahrscheinlich.“
„So ist es“, ließ sich nun Ed Carberry vernehmen. „Das würde bedeuten, daß sich immer der Nächste, der mit dem Sterben an der Reihe war, zu den bereits Toten auf das Kielschwein gesetzt hätte, um die Schar zu vergrößern. Nein, Sir, so was gibt es nicht.“
„Warum eigentlich nicht?“ bohrte Dan O’Flynn weiter. „Wenn einer gestorben ist, kann er doch von den noch Lebenden einfach zu den Toten gesetzt worden sein.“
„Theoretisch schon“, sagte Hasard. „Aber praktisch wohl kaum. Die Überlebenden hätten mit Sicherheit die Toten begraben oder der See übergeben, statt sie in das Wrack zu setzen. Wenn man bedenkt, wie schnell in diesen feuchten und heißen Gegenden der Zerfall einer Leiche eintritt, hätten sie sich damit erst recht Seuchen auf den Hals geladen. Der Gedanke dürfte also nicht haltbar sein, Dan.“
Der junge O’Flynn wußte darauf im Moment keine Antwort. Was Hasard da sagte, klang logisch und war nicht von der Hand zu weisen.
Ferris Tucker, der bis jetzt schweigsam und mit fachmännischem Blick die kläglichen Überreste der Galeone gemustert hatte, räusperte sich und fuhr sich nachdenklich durch den dichten roten Haarschopf.
„Eure Überlegungen mögen ja alle mehr oder weniger richtig sein“, sagte er. „Aber es gibt noch eine weitere Version. Nehmen wir einmal an, es handelt sich bei diesen Gerippen um Schiffbrüchige. Könnten sie hier nicht von irgendwelchen Buschmännern oder Indianern überfallen worden sein? Vielleicht hat man sie mit den berüchtigten Giftpfeilen aus dem Hinterhalt getötet und dann die Leichen einfach in das Schiff gesetzt. Das wäre doch auch eine Möglichkeit.“
„Ho!“ rief der Profos. „Unser Holzwurm ist ganz schön schlau. Und ich fresse die dickste Taurolle, wenn es nicht so ist, wie er eben gesagt hat.“
„Na, dann guten Appetit, Ed“, erwiderte Hasard lächelnd. „Meiner Meinung nach kannst du gleich damit beginnen. Schau dir doch mal die Gerippe etwas näher an. Fällt dir da nichts auf?“
Verdutzt trat der Profos näher und tastete die Skelette mit den Augen ab.
„Nun ja“, sagte er dann mit wesentlich leiserer Stimme. „Die Kerle scheinen alle ein wenig klein geraten. Zumindest kleiner als wir. Aber wenn es Dons waren, dann ist es ja kein Wunder. Habe ich nicht schon immer gesagt, daß es Zwerge sind?“
„Nun bleib aber sachlich, Ed“, sagte Hasard. „Es gibt in jedem Volk kleine und große Menschen oder doch zumindest solche, die kleiner und solche, die etwas größer geraten sind. Aber sehen die hier nicht fast alle gleich groß aus?“
„Genaugenommen schon“, erwiderte Ed Carberry unbehaglich und schnitt ein Gesicht, als habe er sich soeben vorgestellt, wie der Kutscher in seiner Kombüse die größte Taurolle für ihn garkochte. „Meinst du …“
Der Kapitän der „Isabella“ nickte. „Ja, es sieht ganz danach aus, als handele es sich um die Gerippe einer kleineren Rasse. Vielleicht um Buschmänner oder Indianer. Nur fragt mich nicht, wie die in das Wrack gelangt sind. Einen tieferen Sinn kann ich auch in dieser Theorie nicht erkennen.“
Die Männer blickten sich an, und ihren braungebrannten, wettergegerbten Gesichtern war deutlich anzusehen, wie es hinter ihren Stirnen arbeitete. Aber niemand schien zur Zeit eine Patentlösung für das Rätsel zu finden, vor dem sie standen. So gingen sie daran, die nähere Umgebung des Wracks abzusuchen.
„Was mag nur mit der Beplankung geschehen sein?“ fragte Dan O’Flynn den Schiffszimmermann.
Doch auch Ferris Tucker zuckte mit den Schultern.
„Wir wissen nicht, in welchem Zustand das Wrack hier angetrieben worden ist“, sagte er. „Was noch übriggeblieben war, kann nach langer Zeit verrottet sein. Aber natürlich kann es auch von Indianern weggetragen worden sein. Eigentlich sieht es mir mehr nach dieser Möglichkeit aus.“
„Du meinst, es gibt hier in der Nähe Indianer oder Buschmänner?“ Dan hatte sich plötzlich kerzengerade aufgerichtet, als erwarte er jeden Moment einen Angriff aus dem Hinterhalt.
„Weiter landeinwärts mit Sicherheit“, erwiderte Ferris Tucker. „Hasard kann schon recht haben mit seinen Überlegungen, auch wenn wir im Moment noch keinen Sinn darin sehen.“
Noch während die Männer von der „Isabella“ die Schiffsreste untersuchten, stieg die Flut und setzte die Sandbank allmählich unter Wasser. Der Wasserspiegel erhöhte sich jedoch nur um zwei Handbreit, so daß das Wrack der Galeone an seinem Platz liegenblieb.
Gleichzeitig waren einige dunkle Wolken aufgezogen, die sich plötzlich schleusenartig öffneten. Ein kurzer, aber warmer Regenschauer prasselte nieder und hüllte die Umgebung in einen trüben, grauen Schleier. Die Männer konnten kaum noch die Konturen der „Isabella“ erkennen. Kaum hatte der Regen mit der in den Tropen üblichen Plötzlichkeit wieder aufgehört, begann bereits die Dämmerung hereinzubrechen.
„Schluß für heute!“ rief Hasard und winkte seinen Männern zu. „Es wird bald dunkel sein. Ich denke, es ist besser, wenn wir jetzt zurückpullen. Es dürfte keinen großen Spaß bereiten, in der Dunkelheit von Kaimanen angegriffen zu werden. Wir können uns morgen früh die Umgebung des Wracks noch einmal näher ansehen. Vielleicht finden wir dann des Rätsels Lösung.“
Wenig später saßen die vier Männer im Beiboot und pullten zur „Isabella“ zurück, begleitet von den Geräuschen und Stimmen, die unablässig aus dem dichten Dschungel drangen.
Dan O’Flynn drehte sich noch einmal um und warf einen Blick auf das Wrack, als habe er erwartet, daß sich die stumme Gesellschaft der Toten von ihren Plätzen erhebe.
Die dickbauchige Galeone, deren Name „Esmeralda“ kaum noch zu erkennen war, steuerte eine kleine, versteckte Bucht an. Ihr Kapitän, Alfredo Fernandez, hatte auch allen Grund, vorsichtig zu sein, denn seit zwei Jahren wurde er wegen blutiger Überfälle auf spanische Handelsfahrer von den eigenen Landsleuten gejagt.
Die „Esmeralda“, die auf Nordwestkurs an der südamerikanischen Atlantikküste entlanggesegelt war, fiel auf Befehl ihres Kapitäns nach Backbord ab und lief in die Bucht ein. Die Segel wurden aufgegeit. Mit der restlichen Fahrt trieb die Galeone nahe an eine langgestreckte Sandbank heran, hinter der der Dschungel wie eine grüne Mauer emporwucherte.
„Fallen Anker!“ brüllte Alfredo Fernandez.
Gleich darauf klatschte der Buganker in das blaugrüne Wasser der Bucht.
Fernandez sah man seinen Beruf nicht auf den ersten Blick an, zumindest im Gegensatz zu seinen Männern. Er liebte es, sich wie ein reicher spanischer Kaufmann zu kleiden. Sein hageres Gesicht mit der scharfkantigen Nase und das glatte, zurückgekämmte Haar verliehen ihm tatsächlich das Aussehen eines Edelmanns.
Aber der bunt zusammengewürfelte Haufen, der an Bord der „Esmeralda“ fuhr, kennzeichnete die Galeone als das, was sie tatsächlich war: ein Piratenschiff.
Seit mehr als zwei Jahren war Fernandez mit der „Esmeralda“ unterwegs, um Beute zu schlagen, wo er sie traf. Seit dieser Zeit war er der Kapitän des Schiffes, das vorher seine Aufgabe als Handelsfahrer erfüllt hatte.
Fernandez hatte damals unter Kapitän Pedro Morena als erster Offizier gedient. Morena war ein beispielloser Geizkragen gewesen, dessen Tun und Denken nur von dem Gedanken an einen möglichst hohen Profit beherrscht worden war. Die Besatzung seines Schiffes hatte er wie Tiere behandelt – wie rechtlose, unnütze Sklaven, die kaum zu essen, aber viel zu arbeiten hatten.
Aber nicht nur das war es gewesen, was Alfredo Fernandez dazu veranlaßt hatte, eine Meuterei anzuzetteln. Ihm war schließlich gleichgültig, ob die Besatzung satt zu essen hatte oder nicht. Als Offizier war er von diesem Problem ohnehin nicht berührt worden.
Was ihn dazu getrieben hatte, Pedro Morena ein Messer in die Brust zu stoßen, war die Gier nach Macht, Ansehen und Reichtum gewesen. Deshalb hatte er zugestoßen, als sich die Gelegenheit geboten hatte und er sich der Unterstützung einiger Getreuer sicher gewesen war.
Innerhalb kürzester Zeit war aus der „Esmeralda“ ein Piratenschiff geworden, das hinterhältig auf fette Beute lauerte.
In letzter Zeit hatte er vorwiegend in der Karibischen See unter den Eingeborenen geraubt, gemordet und geplündert. Dazwischen hatte er sich mit spanischen oder portugiesischen Kauffahrern angelegt. Zuweilen sogar mit kleineren spanischen Schiffen, die im Auftrage Seiner Allerkatholischsten Majestät, König Philip II., unterwegs waren, um das, was sie bei den Eingeborenen des südamerikanischen Kontinents geplündert hatten, in die Heimathäfen zu bringen.
Natürlich war das alles nicht spurlos an der „Esmeralda“ vorübergegangen. Einige Schäden waren jetzt noch deutlich am Rumpf und an den Aufbauten zu erkennen, zumal sie nur flüchtig ausgebessert worden waren.
Aber auch die Besatzung des Piratenschiffes sah teilweise aus, als würde sie nur noch durch Flicken zusammengehalten. Dieser Schein trog jedoch, auch wenn es sich überwiegend um verwahrlost aussehende Gestalten der verschiedensten Nationalitäten handelte. Diese Männer waren zäh wie Piranhas, und man konnte ihnen auf eine Seemeile Entfernung ansehen, daß ihnen das Messer locker im Gürtel saß.
Nur drei Männer der Mannschaft stammten noch aus der Zeit, in der die „Esmeralda“ ein Handelsschiff gewesen war und unter dem Befehl des geizigen Pedro Morena gestanden hatte. Die sechs übrigen waren nicht mehr am Leben. Vier davon hatten bei blutigen Enterkämpfen das Zeitliche gesegnet, und zwei hatte Alfredo Fernandez, der die Galeone mit eiserner Hand regierte, kurzerhand an der Großmarsrah aufknüpfen lassen, als der leise Verdacht entstanden war, daß sie auf eigene Faust agieren wollten, und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie dies ihr Kapitän einst getan hatte.
Einer der Männer, die mit Alfredo Fernandez noch unter Pedro Morena gefahren waren, war Alfonso Casal, damals Steuermann der „Esmeralda“.
Der kleine, aber sehr kräftige und gefährlich aussehende Mann, war Fernandez sklavisch ergeben. Es war schwer zu erkennen, ob aus Bewunderung oder ganz einfach aus dem Druck heraus, unter dem er sich befand. Ihm gegenüber vermochte sich Fernandez mitunter als sehr großzügig zu erweisen, wahrscheinlich in dem berechnenden Bestreben, sich wenigstens die absolute Loyalität einiger weniger Männer zu erkaufen.
Alfredo Fernandez winkte Alfonso, der jetzt die Position des Zuchtmeisters innehatte und zeitweilig auch als Steuermann fungierte, zu sich aufs Achterdeck.
„Du weißt, um was es geht, Alfonso“, sagte er kurz. „Wir müssen unsere Lebensmittelvorräte ergänzen, und zwar möglichst um Früchte und Frischfleisch. Wir können nicht riskieren, die halbe Besatzung durch Skorbut zu verlieren. Das würde die Kampfkraft unseres Schiffes zu sehr schwächen.“
„Natürlich, Señor Capitán“, sagte Alfonso. „Das ist völlig klar. Ich dachte mir das schon, als Sie Befehl gaben, diese Bucht anzulaufen. Wie viele Männer soll ich an Land schikken?“
„Ich denke, es genügen sechs. Wir lassen ihnen einen ganzen Tag Zeit. Es ist noch kurz nach Tagesbeginn. Bis zum Einbruch der Dunkelheit können Sie einiges heranschaffen und im Boot lagern. Dort drüben im Dschungel und etwas weiter landeinwärts gibt es genug Früchte und auch jagdbares Wild. Sie sollen zusehen, daß sie auch einen oder zwei Tapire erwischen, die sind im Fleisch besonders ergiebig.“
„Selbstverständlich, Señor Capitán“, erwiderte Alfonso Casal. Aus seinem Verhalten Alfredo Fernandez gegenüber hätte man schließen können, daß es sich bei diesem nicht um einen Piratenkapitän, sondern um einen echten spanischen Grande handele.
„Die Kerle sollen sich gut bewaffnen“, fuhr Fernandez fort. „Wir werden sie bei Einbruch der Dunkelheit wieder an Bord nehmen. Inzwischen werden wir hier die Zeit nicht nutzlos vertrödeln, sondern einige Meilen weiter nordwestlich die große Bucht anlaufen, die Baja de Marajo genannt wird. Dort sind mehrere große und kleine Flußmündungen, und wir können einige Fässer Süßwasser aufnehmen. Vielleicht schließen wir sogar die Bekanntschaft anderer Reisender, wer weiß!“
Alfonso Casal, der Profos der „Esmeralda“ grinste unverschämt. Er wußte, was sein Kapitän damit meinte. Die Besatzung mußte schließlich auf Trab gehalten werden, denn in den letzten sieben Tagen hatten die Männer genug gefaulenzt. Es wurde Zeit, daß sie mal wieder auf Vordermann gebracht wurden. Und an Spaniern und Portugiesen gab es in dieser Gegend keinen allzugroßen Mangel.
Augenblicke später war die Stimme Alfonsos bis in den letzten Winkel der „Esmeralda“ zu vernehmen.
„Los, hopp, hopp, ihr faulen Säcke! In den letzten Tagen habt ihr euch lange genug als nutzlose Fresser amüsiert. Jetzt geht’s mal wieder an die Arbeit. Fiert das Beiboot ab, nehmt genügend Waffen mit und seht zu, daß ihr was Brauchbares auftreibt. Bei Einbruch der Dunkelheit werdet ihr wieder an Bord genommen. Miguel, du hast die Verantwortung. Entfach den fünf anderen mal ein wenig Feuer unter das verlängerte Rückgrat.“
Die fünf dafür vorgesehenen Männer unter der Führung von Miguel Camaro, einem vierschrötigen, brutalen Typ, der bereits sein halbes Leben auf Piratenschiffen verbracht hatte, verließen wenig später die „Esmeralda“ und pullten zur Sandbank hinüber.
Sie waren bis an die Zähne bewaffnet mit Musketen, Pistolen, Buschmessern und Säbeln. Und sie verstanden auch, mit diesen Waffen umzugehen, denn sie gingen nicht das erste Mal an Land, um im Dschungel die Lebensmittelvorräte ihres Schiffes zu ergänzen.
Zuweilen war es ihnen sogar gelungen, andere die Hauptarbeit für sich tun zu lassen, indem sie kleinere Ansiedlungen von Indianern und Buschmännern überfallen und das mitgenommen hatten, was die Eingeborenen gesammelt und erjagt hatten.
Kaum hatte der Landtrupp das Beiboot auf die Sandbank gezogen, da hörten sie wieder das Gebrüll Alfonso Casals, der den Rest der Mannschaft auf Trab brachte.
Sie kannten ihren Kapitän und auch seinen Profos. Sie wußten und hatten auch schon am eigenen Leibe erfahren, daß es für gewöhnlich besser war, sich nach diesen Männern zu richten, zumal es im Endeffekt immer wieder genug Beute für alle gab. Aber auch die neunschwänzige Katze an Bord der „Esmeralda“ hatte bisher wahrhaftig nicht als Zierstück gedient.
Es dauerte nicht lange, und die „Esmeralda“ hatte die kleine, verschwiegene Bucht wieder verlassen und ihren ursprünglichen Kurs aufgenommen. Eine leichte Brise aus Südost trieb sie auf die breite Baja de Marajo zu, in die sie bald darauf hineinsegelte.
Alfredo Fernandez, der gerade über eine alte, zerknitterte Seekarte gebeugt war, fuhr hoch, als der Mann im Ausguck plötzlich losbrüllte.
„Deck!“ schrie er. „Señor Capitán! Ich sehe ein Schiff Backbord voraus.“
„Was ist es für ein Schiff?“ rief der Kapitän zurück. „Los, verdammt, du Dreckskerl, reiß deine Augen auf!“ Gleichzeitig griff er nach dem Spektiv, um die Optik entsprechend einzustellen.
„Noch schlecht zu erkennen“, antwortete der Mann im Großmars, „scheint aber eine Galeone zu sein.“
„Halte die Augen weiterhin offen“, befahl Alfredo Fernandez und rief augenblicklich seinen Profos, Alfonso Casal, zu sich aufs Achterdeck.
Eigentlich war Casal viel mehr als nur der Profos und zeitweilige Steuermann. Er war für Fernandez das Mädchen für alles. Nicht zuletzt deshalb, weil der Kapitän diesem Mann wenigstens halbwegs trauen konnte.
Fernandez hatte gerade den Kieker ans Auge gesetzt, als Alfonso das Achterdeck betrat.
„Es ist eine Galeone“, sagte er. „Ein Dreimaster, sehr groß und schlank gebaut. Die Nationalität ist noch nicht zu erkennen. Wahrscheinlich ein Spanier, vermute ich wenigstens. Wenn ich das richtig sehe, ankert das Schiff in der Nähe eines merkwürdigen Wracks, das am Ufer liegt. Entweder hat den Kapitän die Neugier dorthin getrieben, oder aber sie sind ebenfalls scharf auf Vorräte und Trinkwasser.“
„Sehr schön, Señor Capitán“, sagte Alfonso Casal, und in seine kleinen, schwarzen Schweinsäuglein trat ein gefährliches Glitzern. „Wollen wir wieder ein bißchen Abwechslung in die Mannschaft bringen?“
Alfredo Fernandez nahm das Spektiv vom Bug und grinste Alfonso an.
„Warum nicht?“ sagte er. „Bestimmt hat diese Galeone einiges in ihren Frachträumen, für das wir gute Verwendung haben. Also, gehen wir ans Werk. Schließlich wollen wir nicht dem lieben Gott den Tag stehlen. Sollte uns das Schiff einigermaßen unversehrt ins Netz gehen, könnten wir – wer weiß – vielleicht noch etwas damit anfangen. Es ist ein stolzes Schiff und gut gebaut. Scheint ein schneller Segler zu sein.“
„Das will nichts heißen, Señor Capitán.“ Alfonso dienerte. „Wir haben schon andere Brocken geschafft. Ich muß gestehen, es juckt mir schon in den Händen.“
„Mir auch, Alfonso“, sagte Alfredo Fernandez mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck. „Außerdem sind wir in der besseren Ausgangsposition und haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Das Schiff scheint im flachen Wasser vor Anker zu liegen und dürfte damit weit weniger manövrierfähig sein als wir. Auf was warten wir noch?“
Fernandez, der Piratenkapitän, rollte die Seekarte zusammen. Gleich darauf brachte er mit Unterstützung seines Profos hektisches Leben in seine Mannschaft, die sich lebhaft ausmalen konnte, was die plötzlichen Aktivitäten zu bedeuten hatten.
Wenig später klirrten Waffen, und nackte Fußsohlen trampelten über das Deck. Jeder Handgriff, den die verwegenen Gestalten taten, saß am richtigen Platz. Sie waren Piraten und verstanden schließlich ihr Handwerk.
In kurzer Zeit war die dickbauchige, aber immer wieder überraschend wendige „Esmeralda“ klar zum Angriff.
4.
Die Nacht hatte wenigstens einen Hauch von Abkühlung gebracht, und der neue Tag war mit einer leichten, wohltuenden Brise heraufgezogen. Wie ein glutroter Ball war die Sonne hinter der Kimm aufgetaucht. Schon wenig später hatte sie wieder damit begonnen, die Luft über der Baja de Marajo aufzuheizen.
Die „Isabella VIII.“ schwoite noch immer gemächlich an der Ankertrosse – zwei Kabellängen von der Flußmündung entfernt, an der das Wrack, mit dem sie gestern auf höchst ungemütliche Art Bekanntschaft geschlossen hatten, auf einer Sandbank lag.
In den Nachtstunden hatte sich manch einer der Männer an Bord, wenn er sich nicht gerade mit den lästigen Moskitos herumgeschlagen hatte, den Kopf über die Bedeutung der menschlichen Skelette zerbrochen, die dort drüben in den traurigen Schiffsresten auf dem Kielschwein hockten. Aber auch die Nacht hatte dieses Geheimnis nicht entwirren können, und so beschäftigte das ungelöste Rätsel nach wie vor die Mannschaft der „Isabella“.
Noch während des kräftigen Frühstücks, das der Kutscher zubereitet hatte, war das Wrack Mittelpunkt der Gespräche.
„Ein Wrack bedeutet nichts Gutes, Skelette schon gar nicht“, murmelte der alte O’Flynn. „Habe ich nicht gestern erst gesagt, daß es zwischen Himmel und Erde …“
„… Dinge gibt, die uns ganz fürchterlich auf den Magen schlagen, wenn man darauf wie auf zähem Stiefelleder herumkauen muß“, unterbrach ihn der Profos und warf dem Kutscher einen schrägen Blick zu, als könnte der etwas dafür, daß das Brot infolge des feuchten Klimas etwas zäh geworden war. Im selben Atemzug vollzog er mit einem klatschenden Geräusch die Hinrichtung zweier Moskitos, weil sie es gewagt hatten, sich auf seinem linken Unterarm niederzulassen.
Während der Kutscher vorzog, die Bemerkung des Profosses mit Mißachtung zu strafen, konnten sich einige ein Grinsen nicht verkneifen. Stenmark, der Schwede, mußte dabei den Mund wohl um einige Zoll zu weit verzogen haben. Jedenfalls verschluckte er sich und begann heftig zu husten.
„Ho, jetzt grassiert auch noch die Schwindsucht an Bord“, kommentierte der Profos und hieb dem blonden Stenmark seine Pranke in gutgemeinter Weise so kräftig auf den Rücken, daß dieser beinahe mit der Nase in die Muck getaucht wäre, die er krampfhaft in der linken Hand hielt. Auf jeden Fall war der Hustenanfall sofort vorüber, und die Männer begannen schallend zu lachen.
Old O’Flynn, dessen Rede so jäh unterbrochen worden war, wollte gerade wieder die Stimme erheben, aber da sorgte sein Sohn Dan, der den Moses Bill im Ausguck abgelöst hatte, dafür, daß er eine weitere tiefsinnige Bemerkung verschlucken mußte.
„Deck!“ rief Dan aus dem Großmars. „Eine Galeone, dick wie eine Seekuh, segelt in die Bucht!“
Die Männer horchten auf, und der Seewolf griff sofort zum Spektiv.
„Ist es ein Don?“ fragte Ben Brighton.
„Ich weiß nicht“, erwiderte Hasard. „Das Schiff ist noch etwas zu weit weg. Ein Name oder eine Flagge ist noch nicht zu sehen. Aber es hält direkt auf uns zu. Man muß uns natürlich ebenfalls gesehen haben.“
Auch Ben Brighton hatte inzwischen zum Kieker gegriffen.
„Die Galeone sieht zwar nicht unbedingt nach einem Piratenschiff aus, aber das muß nichts heißen“, stellte er dann fest. „Allerdings rechne ich eher damit, daß es ein Spanier ist.“
Hasard nickte. „Wir stellen uns auf jeden Fall auf eine Begegnung ein, um keine unliebsame Überraschung zu erleben. Hievt den Anker ein und setzt die Segel!“ brüllte er dann von Achterdeck. „Und klar Schiff zum Gefecht!“
Hasard wollte so rasch wie möglich aus dem flachen Wasser heraus, in dem die „Isabella“ vor Anker gegangen war, denn hier wäre das Schiff im Ernstfall wenig manövrierfähig.
Augenblicklich geriet Leben unter die Männer an Bord. Aber kein Handgriff und kein Schritt, die getan wurden, waren unnütz. Jeder wußte, was er zu tun hatte. Alles, was die Männer bis zum Augenblick noch bewegt hatte, war in diesem Moment zur Nebensache geworden. Niemand interessierte sich noch für das Wrack, das dort drüben auf der Sandbank lag, und niemand dachte noch über die rätselhaften Skelette nach.
Was im Moment zählte, war die Galeone, die hinter ihnen aufgetaucht war und von der man zunächst annahm, daß es sich um ein spanisches oder portugiesisches Schiff handele. Diese beiden Nationalitäten waren in dieser Gegend jedenfalls am häufigsten anzutreffen.
Pete Ballie, der Rudergänger, stand bereits im Ruderhaus, um die „Isabella“ so schnell wie möglich aus den flachen Gewässern herauszusteuern.
Der Waffen- und Stückmeister, Al Conroy, gab gerade den Befehl, die Stückpforten zu öffnen. Bill, der Moses, half dem Kutscher, die Kupferbecken mit den glühenden Holzkohlen aus der Kombüse zu holen und verteilte sie sofort auf die Geschütze.
Die beiden „Rübenschweinchen“, die Söhne des Seewolfs, die sich längst zu brauchbaren Schiffsjungen entwickelt hatten, waren eifrig damit beschäftigt, Sand auf der Kuhl auszustreuen, um den Füßen der Männer festen Halt auf den Decksplanken zu geben.
Während sich der Seewolf mit seinem Radschloß-Drehling und dem Schnapphahn-Revolverstutzen bewaffnete, um notfalls zahlreiche Schüsse zur Verfügung zu haben, besetzten Ben Brighton, Ed Carberry, der Kutscher und Old O’Flynn die Drehbassen.
Ferris Tucker, der rothaarige Schiffszimmermann, wandte sich der von ihm erfundenen Schleudervorrichtung zu, die dem Abfeuern der verheerenden Flaschenbomben diente, und Batuti und Big Old Shane, der ehemalige Schmied der Feste Arwenack, spannten ihre Bogen, um damit notfalls ihre gefürchteten Brand- und Pulverpfeile auf den Gegner abzuschießen.
Auch die übrigen Männer waren auf Stationen: Smoky, Blacky, Gary Andrews, Matt Davies, Dan O’Flynn, Jeff Bowie, Sam Roskill, Bob Grey, Luke Morgan, Will Thorne und Stenmark.
Die Siebzehnpfünderculverinen waren längst ausgerannt, als die „Isabella“, die den letzten Fetzen Tuch gesetzt hatte, auf die dickbauchige Galeone zurauschte.
Ben Brighton setzte für einen Augenblick das Spektiv ab.
„Sie sind ebenfalls klar zum Gefecht!“ rief er. „Ihre Stückpforten sind hochgezogen, aber sie geben sich nicht zu erkennen.“
„Ist auch nicht mehr nötig“, erwiderte der Seewolf. „Schau dir mal die Kerle an Bord etwas genauer an. Ich fresse ein Pulverfaß, wenn das keine Piraten sind! Ed“, setzte er dann mit lauter Stimme hinzu, „begrüße die Schnapphähne mit einem Warnschuß!“
„Aye, aye, Sir!“ brüllte der Profos zurück. „Wir werden ihnen die Haut in Streifen von ihren karierten Affenärschen ziehen!“
Aber bevor er den Befehl des Seewolfs ausführen konnte, begann die Geschütze des Piratenschiffes Feuer und Eisen zu spucken.
Die Sonne stand hoch am Himmel und hatte den Dschungel rasch in einen kochenden, dampfenden Kessel verwandelt. Das Atmen wurde den sechs Männern, die von der „Esmeralda“ an Land gesetzt worden waren, um die Lebensmittelvorräte zu ergänzen, zur Qual. Aber sie waren rauhe Burschen, die bereits einiges gewohnt waren. Die meisten von ihnen hielten sich nicht das erste Mal im Dschungel auf und wußten, wie man sich hier zu verhalten und vor was man sich in acht zu nehmen hatte.
Schon seit einigen Stunden war der kleine, schwer bewaffnete Trupp unter der Führung des breitschultrigen Miguel Camaro unterwegs. Die verwegen aussehenden Männer hatten auch schon Erfolg gehabt. Sie hatten bereits ein kleines Wasserschwein erbeutet und es zusammen mit Maniok, Bananen und anderen Früchten zum Beiboot gebracht und dort mit einem Stück Segeltuch abgedeckt. Dann waren sie wieder in den Dschungel marschiert.
War zwischen ihrem Kapitän, Alfredo Fernandez, und dem Profos nicht von einem oder zwei Tapiren die Rede gewesen? Sie wollten jedenfalls, soweit das möglich war, die Wünsche des Kapitäns befolgen, denn manchmal war er unberechenbar und brutal. Aber sie wußten auch seine Großzügigkeit zu schätzen, wenn fette Beute erworben worden war.
Schwitzend bahnten sich die Männer einen Weg durch den stellenweise sehr dichten Dschungel. Oft mußten sie mit den großen Buschmessern einen Pfad durch das dichte Gestrüpp hauen, um voranzugelangen.
Die Schläge ihrer Buschmesser gingen zumeist in dem Geschrei der Affen und Vögel unter. Schon mehrmals waren sie erschreckt zusammengefahren, als sich plötzlich ein Schwarm bunter Papageien über ihnen aus dem Geäst eines Baumes erhoben und laut kreischend davongeflattert war.
Man mußte schon auf der Hut sein, in dieser tiefen, unerforschten Wildnis, in der tödliche Gefahren hinter jedem Baum und jedem Strauch lauern konnten. Tausend Stimmen aus den verschiedensten Richtungen übertönten ein rechtzeitiges Wahrnehmen etwaiger Gefahren.
„Können wir nicht mal eine Pause einlegen, Miguel?“ fragte José, ein kleiner, drahtiger Mann mit schwarzem Bart und einer breiten Narbe über dem linken Auge. „Verdammt, wir sind doch keine Sklaven! In dieser ekelhaften Hitze löst man sich ja fast auf. Dazu noch diese elenden Stechmücken.“
„Wir haben unseren Auftrag noch nicht erfüllt“, erwiderte Miguel Camaro. „Wir brauchen noch wenigstens ein bis zwei Tapire, sonst wird der Alte wild. Ausruhen könnt ihr hinterher an Bord, wenn’s dort gerade nichts Besseres zu tun gibt.“
„Aber wir haben doch noch mehr als einen halben Tag vor uns.“
„Mag sein“, sagte Miguel unnachgiebig. „Aber die Beute dürfte nicht gerade leicht zu transportieren sein. Sie bis zu unserem Boot zu schaffen, wird wesentlich länger dauern, als nur ein Fußmarsch durch den Busch. Ganz davon abgesehen, daß wir bis jetzt noch gar nichts erbeutet haben. Auch das kann noch eine Weile dauern. Sollten wir vorzeitig bei unserem Boot sein, ich meine, noch vor der ‚Esmeralda‘, dann können wir uns immer noch auf die faule Haut legen. Aber erst ist die Arbeit dran!“
Die Männer schnitten mürrische Gesichter und zogen es vor, den Mund zu halten.
Nach einer Weile ließ sich Miguel Camaro wieder vernehmen. „Wenn wir nicht auf Indianer stoßen, müssen wir die Arbeit selber erledigen. Hier in der Nähe haben wir das Wasserschwein erwischt. Also muß sich irgendwo in dieser Gegend auch Wasser befinden. Dort werden wir auch auf Tapire stoßen, denn die halten sich ja meist in Wassernähe auf. Am besten, wir teilen uns hier in zwei kleine Gruppen. Wer zuerst auf Wasser stößt, gibt zwei Musketenschüsse ab.“
Doch die Männer kamen nicht mehr dazu, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ein lautes Rascheln und Knacken im Gehölz, ein Trampeln und Rumoren ließ sie plötzlich zusammenfahren.
Die Geräusche mußten ganz aus der Nähe stammen.
Sofort verstummte das Gespräch der Piraten. Mit hastigen Griffen brachten sie ihre Musketen in Anschlag.
„Kein Wort mehr“, sagte Miguel mit leiser Stimme. „Mir nach!“
Rasch folgten die Männer ihrem Anführer durch das Unterholz, bis sich nach wenigen Schritten eine große, nur mit niedrigen Büschen und Sträuchern bewachsene Lichtung vor ihnen auftat. Nur vereinzelt ragte der Stamm einer Chonta-Palme in den Himmel. Zu ihrer Rechten fiel die Lichtung etwas ab, bis hin zu einem breiten Urwaldbach, der sich weiter hinten, irgendwo im Dickicht, verlor.
Aber nicht das war es, was die sechs Piraten von der „Esmeralda“ wie angewurzelt stehenbleiben ließ. Es war vielmehr das Geschehen, das sich vor ihren Augen auf der Lichtung abspielte.
Zwei merkwürdige Tiere liefen durch das Gestrüpp. Die Körper waren plump und außerdem hatten die Tiere lange und bewegliche Schnauzen und zierliche Füße an dünnen Beinen. Sie waren nicht viel größer als Schweine und rannten in panischer Angst durch das Gestrüpp.
Es waren unverkennbar Tapire, jene Dschungelbewohner, hinter denen die Männer der „Esmeralda“ her waren. Die beiden Tapire hatten die Richtung auf den breiten Urwaldbach eingeschlagen, weil sie meist, wenn sie eine drohende Gefahr bemerkten, dem Wasser zustrebten.
Und jetzt sahen die Piraten auch, was die beiden Tapire so in Panik versetzt hatte. Es waren fünf kleine, braune Gestalten mit langen blauschwarzen Haaren, die außer einer dünnen Schnur um den Leib nackt waren und von zwei Seiten auf die fliehenden Tiere zustürmten. In ihren Händen trugen sie lange Bambusrohre.
„Halt!“ zischte Miguel Camaro. „Das sind Indianer, und die kleinen, braunen Kerle sind hinter den Tapiren her. Seid vorsichtig! Die langen Bambusdinger, die sie in den Händen haben, sind nicht so harmlos, wie sie aussehen. Es sind Blasrohre, mit denen sie ihre vergifteten Pfeile abschießen. Wenn ein solcher Pfeil auch nur die Haut ritzt, muß das Opfer qualvoll sterben.“
„Warum erzählst du das, Miguel?“ flüsterte der kleine José. „Hältst du uns für blöd? Wir sind doch nicht das erste Mal im Dschungel, und mit Indianern hatten wir schon einige Male zu tun. Meinst du, wir wissen nicht, wie gefährlich diese Waffe ist?“
„Sei still jetzt!“ erwiderte Miguel mit zornigem Gesicht. „Sancho und Ibrahim, der Türke, sind das erste Mal mit uns auf Jagd. Es schadet nicht, wenn sie rechtzeitig erfahren, daß sie vorsichtig sein müssen.“
Die beiden Tapire begannen Haken zu schlagen. Aber auch die fünf braunhäutigen Indianer waren flink wie Katzen. Sie verstanden es, die Tapire einzukreisen und rückten so immer näher an sie heran. Der erste stoppte bereits seine Schritte und hob das gefährliche Blasrohr an den Mund. Es war bestimmt länger als zwei Yards.
Da zerschnitt die Stimme Miguels die Stille. „Los, José, leg die Muskete an! Du zielst auf das erste Tier und ich auf das zweite. Die kaufen wir uns rechtzeitig. Ihr anderen behaltet die Indianer im Auge. Schießt nicht auf die Tiere, sondern spart euch die Kugeln für die kleinen, braunen Teufel auf. Feuer, José!“
Zwei Schüsse krachten. Das Tier, das sich Miguel Camaro vorgenommen hatte, bäumte sich kurz auf und ging zu Boden. Der andere Tapir jedoch rannte unbeirrt weiter und hatte schon fast das Wasser erreicht.
„Verdammt!“ zischte Miguel Camaro. „Warum hast du nicht besser gezielt? Hast du keine Augen im Kopf? Oder hast du vielleicht Schiß vor den Indianern?“
José sagte nichts, warf aber Miguel einen bösen Blick zu. Für einen Streit oder auch nur einen kurzen Wortwechsel wäre jetzt auch keine Zeit gewesen.