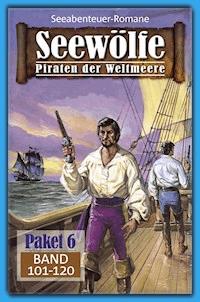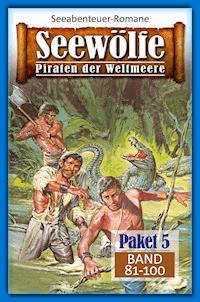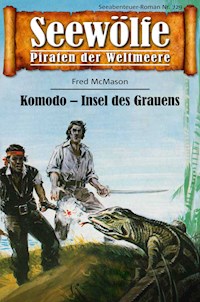Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Irgendwo zwischen Formosa und den Batan-Inseln schlug der Gott des Windes und der Wellen zu. Zuerst schralte der Wind und schickte seine Vorläufer aus Nordosten - pfeifende Böen, die bereits das Verhängnis ahnen ließen. Die See wurde kabbelig. Die "Isabella" begann in der See zu schwanken und zu taumeln. Das Wetter verschlechterte sich von Minute zu Minute. Es wurde zunehmend kälter. Dann heulte ein fast eisiger Wind durch die Wanten und Pardunen, wie er schneidender auch im Nordatlantik nicht hätte sein können. Die Galeone wurde geschüttelt und tauchte in immer tiefere Wogentäler. Ja, so kündete er sich an - "Taifung", der "Große Wind", wie ihn die Chinesen nannten, und die See war sein Schlachtfeld...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2598
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2015 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-496-8Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 121
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 122
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Fußnote
Nr. 123
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 124
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 125
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 126
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 127
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 128
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Nr. 129
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 130
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 131
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 132
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 133
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 134
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 135
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Nr. 136
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 137
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 138
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 139
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 140
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Carberry blieb so unvermittelt stehen, daß Ferris Tucker, der sich hinter ihm durch die Dunkelheit tastete, gegen seinen Rücken prallte und ihm beinahe auf die Hacken trat.
Der rothaarige Schiffszimmermann stieß einen Fluch aus und zischte: „Kannst du nicht vorher Bescheid sagen, wenn du bremst?“ Er verspürte den Drang, dem Profos kräftig in die Rippen zu boxen, bezwang sich aber. Schließlich brachte es ihm nichts ein, im Gegenteil, es schadete der Sache. Zweifellos würde Carberry brüllen, und wenn er brüllte, scheuchte er nicht nur die Tierwelt von Formosa auf, sondern versetzte möglicherweise auch die, die draußen auf See lauerten, in Alarmzustand.
Carberry hatte Tuckers Protest kaum wahrgenommen.
Er stand da und kratzte sich an seinem Rammkinn – was sich etwa so anhörte, als marschierten einige hundert große, tropische Exemplare der Waldameise durch das Dickicht, das die Männer umgab.
Carberry murmelte: „Augenblick mal…“
Ferris schnitt eine Grimasse. Allem Anschein nach dachte der Profos nach, aber es war nicht immer gewährleistet, daß auch etwas Gutes dabei heraussprang.
Smoky war nun ebenfalls aufgerückt und wisperte: „He, was ist denn los da vorn? Geht’s nicht weiter?“
„Verfranzt haben wir uns.“ Carberrys dumpfes Organ rief Vergleir che mit dem Knurren eines stämmigen Hofhundes wach.
„Verlaufen?“ flüsterte Ferris Tukker. „Verdammt, wir hätten doch einen Kompaß mitnehmen sollen – bei der Finsternis. Aber wir hätten ihn erst im Ruderhaus abmontieren müssen, und das hätte zuviel Zeit gekostet. Licht können wir auch nicht anzünden. Jeder Feuerschein ist verräterisch. Sag mal, bist du ganz sicher, Ed?“
„Ja. Meine Nase sagt’s mir, daß wir hier falsch sind. Mein Spürsinn.“
Hasard und Sun Lo, die vor ihnen schritten, waren inzwischen stehengeblieben und kehrten jetzt vorsichtig zu ihnen zurück. Sun Lo hatte vernommen, daß gesprochen wurde. Der Seewolf-übersetzte ihm verhalten ins Spanische, was Edwin Carberry da soeben von sich gegeben hatte.
Sun Lo lächelte in der Dunkelheit.
„Diesmal irrst du dich, Narbenmann“, sagte er auf spanisch. „Dank deines Papageis hast du die Felsentreppe zum Kloster gefunden. Aber heute nacht fehlt dir der gefiederte Kamerad, und du hast nicht die ausgeprägten Instinkte eines Tieres.“
Er sprach wirklich pures Kastilisch – und die portugiesische Sprache beherrschte er auch. Carberry mit seinem grausamen auswärtigen Kauderwelsch hätte da vor Neid erblassen können.
Im Moment war der Profos eher wütend. Er hätte dem Mönch gern seine Meinung gesagt, aber es sprach zuviel dagegen. Erstens war so etwas in einer Situation wie dieser nicht angebracht, zweitens hatte Carberry keine Lust, mühselig auf spanisch zu radebrechen. Sein geliebter Cornwall-Dialekt wäre ihm da lieber gewesen, aber den verstand Sun Lo ja bekanntlich nicht. Also schwieg der Profos.
Ferris, Tucker, Smoky, Dan O’Flynn und Blacky drängten sich auf einer winzigen Schneise hinter Carberrys breitem Kreuz.
„Was ist nun?“ raunte Dan ungeduldig.
Carberry ließ sich nun doch zu einer Äußerung hinreißen. „Weiter, ihr Rüsselbären. Bis wir im Busch oder Sumpf steckenbleiben.“
Mißmutig stapfte er weiter. Hasard gab zu den Einwänden seines Zuchtmeisters keinen Kommentar ab, er wußte ja, daß dies Carberrys typische Art war. An Land fühlte er sich bei weitem noch nicht so sicher wie auf See, dies war nicht sein Element. Hier roch es feucht und faulig, und die Umgebung verströmte Feindseligkeit und Tücke.
Sun Lo, der weise alte Abt des Konfuzianer-Klosters von Formosa, führte die sechs Männer der „Isabella“ unbeirrt weiter durch das Dikkicht. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nichts schien ihn erschüttern zu können. Die dreihundert Haupt- und dreitausend Nebenregeln der Lehre, die er seinen Schülern verkündete, waren nicht nur Theorie, sondern auch angewandte Verhaltensphilosophie. Ruhe und Geduld waren Meilensteine auf dem Weg zu einem glücklichen, vollkommenen Leben. Diese und andere goldene Regeln hatte Sun Lo auch Hasard und seiner Crew auseinandergesetzt.
Vor gut drei Stunden hatte Sun Lo sich hoch oben, auf dem Dach der großen Insel, in eine Sänfte gesetzt. Dann hatten seine Schüler ihn die zweitausend in den Gneisfelsen gehauenen Stufen hinuntergetragen, der Dämmerung entgegen. Mit seiner zahlenmäßig starken Abordnung hatte der Abt sich an Bord der „Isabella VIII.“ begeben, um auch Ben Brighton und die anderen Besatzungsmitglieder zu begrüßen, die er noch nicht kannte.
Jetzt bahnte sich der alte Mann mit erstaunlicher Behendigkeit einen Weg durch die Finsternis und die schlüpfrige Feuchtigkeit des wuchernden Gesträuchs. Er selbst wollte diese Führung zu einem erfolgreichen Ende bringen und hatte es sich nicht nehmen lassen, dem Seewolf Unterstützung zu leisten. Für einen Abt war das schon recht ungewöhnlich. Aber übertriebene Förmlichkeiten, falsches Prestigeempfinden und Überheblichkeit waren dem alten Mann fremd. Hasard erinnerte sich noch, was er am Vormittag zu ihm gesagt hatte: Es gebe nur ganz wenige Dinge, die unter der Würde eines Menschen seien – Verrat und brutale Gewalt zählten dazu.
Seinem Gemüt nach war Sun Lo rein und edel. Und niemand schien die Insel besser als er zu kennen. Nicht einmal seine Mönche, die Männer, die in der vergangenen Nacht Hasard und einige andere von der „Isabella“ überfallen hatten, wußten in diesem so undurchdringlich wirkenden Dickicht besser Bescheid als er, Sun Lo.
Die knochigen, langgliedrigen Finger teilten Blätter und Zweige, ohne einen Laut zu verursachen. Sun Los Schritte waren auf dem morastigen Untergrund nicht zu vernehmen.
Er verharrte und bückte sich.
„Dort“, raunte er Hasard zu. „Dort liegt das Schiff. Ich habe es gewußt.“
Hasard kauerte sich neben ihn hin. Er spähte durch eine Lücke im Blättervorhang, die Sun Los Hände geschaffen hatten. Ferris, Ed, Smoky, Dan und Blacky hatten sich ebenfalls gebückt und versuchten, über die Schulter des Seewolfs hinweg etwas zu erkennen.
Sie zählten zu seinen besten Männern. Und vor allen Dingen waren sie den ganzen Tag über mit im Tempel der Großen Vollendung dabeigewesen und hatten an dem Unterricht teilgenommen, den Sun Lo seinen Besuchern und neuen Verbündeten im Praktizieren waffenloser Kampfmethoden gegeben hatte. Das war wesentlich. Zumindest in dieser Nacht.
Drüben, jenseits eines schmalen Uferstreifens, leuchtete über dem matt schimmernden Wasserspiegel die große Hecklaterne der Galeone.
Ein schönes Schiff war das, wahrscheinlich ein 300-Tonner, der vor nicht allzu langer Zeit vom Stapel gelaufen war. Gut in Schuß war er, und die Armierung schien imposant zu sein. Nur einen winzigen Nachteil hatte dieser Dreimaster: Er gehörte der Gegenseite.
Hasard hatte die Galeone wiedererkannt. Sie gehörte zu dem Verband, mit dem die Seewölfe sich nördlich von Formosa hatten schlagen müssen. Zuerst hatten Hasard und seine Männer die „Sao Fernao“ versenken müssen, deren Kapitän ihnen eine höllische Falle gestellt hatte. Dann, auf offener See, hatte es das Gefecht mit weiteren vier Schiffen gegeben. Das Flaggschiff, an dessen Namen sich der Seewolf jetzt erinnerte, war gesunken – die „Bartolomeu Diaz“. Danach hatte das Feuer der „Isabella“ eine dritte Kriegsgaleone vernichtet. Wie sie geheißen hatte, war den Seewölfen nicht bekannt.
Zwei Galeonen waren völlig intakt geblieben, weil sie wegen zu großen Abstandes nicht in den Kampf hatten eingreifen können. Hasard hatte sie beide abgehängt, aber jetzt war das eine Schiff wieder da.
Ihr Kapitän und ihre Mannschaft waren erschienen, um dem verhaßten Feind endlich den Garaus zu bereiten. Und sie konnten es schaffen. Noch war die „Isabella“ arg angekratzt. In diesem ramponierten Zustand hielt sie. kein Gefecht durch. Die Crew war teils verletzt, teils ziemlich ausgelaugt. Erwischte der Portugiese die Seewölfe in ihrem Versteck in der Flußmündung, war es aus.
Hasard konnte mit dem reparaturbedürftigen Schiff aber auch nicht auslaufen. Selbt wenn er sich vor dem Portugiesen davongepirscht hätte, wäre er aller Wahrscheinlichkeit nicht sehr weit gelangt.
Da gab es nur eins. Er mußte handeln, bevor der Gegner ihn entdeckt hatte, bevor auch die zweite Galeone zur Stelle war. Er mußte diesen vergeltungssüchtigen Dons zuvorkommen.
Jetzt.
Nach ihrer Rückkehr an Bord der „Isabella“ hatte Ben Brighton den Kutscher als Späher vorschicken wollen. Der Kutscher war schon vorher Wache an der Nordküste gegangen und hatte den Portugiesen entdeckt. Bob Grey hatte die Hiobsnachricht dann in die Berge hinaufgebracht, Bill, der Schiffsjunge, hatte den Seewolf unterrichtet.
Sun Lo hatte zu Hasard gesagt: „Laß deinen Feldscher hier an Bord bleiben. Er ist auf einsamem Posten zu sehr gefährdet. Wir finden die Galeone auch so wieder.“
Das bewahrheitete sich jetzt, und Ed Carberry biß sich auf die Unterlippe, als er die feindliche Galeone wie eine schwimmende Burg daliegen sah.
„Ich bewundere Eure Fähigkeiten“, murmelte Hasard. „Ihr habt ein ausgezeichnetes Orientierungsvermögen, Sun Lo.“
„Das ist Übungssache“, entgegnete der alte Mann. „Außerdem bin ich seit fast einem Menschenalter auf dieser Insel. Das dürft Ihr nicht vergessen.“
„Trotzdem.“ Hasard richtete seinen Blick wieder auf die Galeone. Der Kapitän hatte die Segel aufgeien lassen, das Schiff dümpelte nur noch dahin. Offenbar hatte der Mann vor, hier, an einer nicht sehr tiefen und einigermaßen geschützten Stelle, vor Anker zu gehen.
Das traf sich gut.
„Was plant Ihr?“ fragte Sun Lo gedämpft.
„Ich will den Portugiesen einen Höflichkeitsbesuch abstatten.“
„Tötet sie nicht, Seewolf.“
„Das habe ich nicht vor. Solange sie nicht zu den Feuerwaffen greifen.“
„Ich habe die Messer gesehen, die Ihr und Eure Freunde in den Gurten stekken habt.“
„Die sind nur für den äußersten Notfall gedacht“, sagte Hasard ernst.
„Ihr wißt, daß ich mehr als eine gerechtfertigte Verteidigung nicht verantworten kann“, raunte der alte Abt.
Hasard nickte. „Ich werde Euch nicht enttäuschen.“
„Es ist wohl besser, ich begleite Euch. Ich bin ein guter Schwimmer.“
Verblüfft wandte sich Hasard dem klugen Mann zu. „Das bezweifle ich nicht. Aber das kann ich nun wieder nicht verantworten. Nein, wirklich nicht, Sun Lo. Ihr braucht nicht zu versuchen, Euch trotzdem durchzusetzen.“
Sun Lo konnte Hasards eisblaue Augen funkeln sehen. Er begriff, daß sein Ansinnen wirklich nicht die glorreichste Idee war.
„Gut“, erwiderte er deshalb. „Was soll ich also tun? Hier warten?“
„Kehrt zum Schiff zurück“, raunte Hasard. „Wenn alles schiefgeht, gebe ich von der Galeone der Portugiesen aus ein Alarmzeichen. Ben Brighton wird dann auf Gedeih und Verderb doch mit der ‚Isabella‘ auslaufen und uns zu Hilfe kommen. Ich will aber nicht, daß Ihr dann noch hier im Dikkicht steckt.“
„Sondern?“
„Ich will, daß Ihr in dem Fall mit Euren Männern in die Berge zurückkehrt und Euch aus allem heraushaltet. Das hier ist einzig und allein unsere Sache“, sagte der Seewolf. Er schickte sich an, das Gebüsch zu verlassen.
Die Anker rauschten an ihren Trossen aus, die Spills auf Vor- und Achterdeck der Galeone wirbelten. Bug- und Heckanker klatschten ins ruhige Wasser und senkten sich dem Grund entgegen.
Capitán Nuno Goncalves stand am Steuerbordschanzkleid des Achterdecks und blickte zum Ufer hinüber. Er verschränkte die Arme vor der Brust, beobachtete und dachte nach.
Das Dickicht und der Inselwald hatten hundert Stimmen, Zikaden zirpten, Frösche quakten beleidigt, die Nachtvögel lösten sich in einem faszinierenden Konzert ab. Bewegungen, vielleicht sogar von Menschen, vermochte Goncalves jedoch nicht festzustellen.
Und irgendwo die Umrisse einer großen Galeone mit überhohen Masten zu erkennen – das wäre denn doch zu schön gewesen. Ein Traum, der so nicht in Erfüllung ging.
Am Abend hatte Nuno Goncalves die Küste von Formosa erreicht, am Abend noch hatte er nach dem gehaßten Feind geforscht. Ohne Erfolg.
„Die Frage ist“, murmelte er jetzt, „sind die Hundesöhne wirklich auf dieser Insel zu finden?“
Der erste Offizier und der Batelero, der Bootsmann, waren zu ihm ans Schanzkleid getreten.
„Ich bin davon überzeugt“, meinte der Erste, ein schneidiger junger Mann, der nach dem Anschluß Portugals an Spanien die Kadettenschule in Cadiz besucht und rasch Karriere gemacht hatte. „Die kleineren Inseln im Norden haben wir fast alle abgesucht. Ohne Ergebnis. Aber ‚E1 Lobo del Mar‘ muß sich irgendwohin verholen, um sein Schiff instandzusetzen. Bestimmt hat er auch Verletzte an Bord, die Ruhe und Erholung brauchen.“
Der Bootsmann war nicht ganz überzeugt. „Diese Teufel sind zu allem fähig. Auch dazu, einfach an der Insel vorbeizusegeln.“
Goncalves schüttelte den Kopf. „Nein, das glaube ich nun doch nicht. Morgen früh landen wir auf Formosa. Wir kämmen jeden Fuß Land ab – und wenn der Bastard hier ist, dann finden wir ihn auch, das schwöre ich euch.“
Der Bootsmann blieb skeptisch. „Vergeßt nicht, daß auf der Insel der verrückte Abt mit seinen schlagenden Mönchen haust, Kapitän. Mit dem kriegen wir auch Schwierigkeiten.“
Der Erste lachte auf. „Soll das heißen, daß du Angst hast?“
„Viele vor uns haben versucht, eine Kolonie auf der Insel einzurichten. Sie sind gescheitert. Alle.“
Nuno Goncalves nickte. „Stimmt, aber die ‚Bahia Blanca‘ wird uns bald erreicht haben, und vielleicht treffen auch die ‚Sao Fernao‘ und die ‚Santa Luzia‘ ein. Dann haben wir die nötige Stärke, um ein erfolgreiches Landunternehmen durchzuführen.“
„Die ‚Sao Fernao‘ und die ‚Santa Luzia‘ hätten sich nie so weit vom Verband absetzen dürfen“, versetzte der erste Offizier. „Ich habe das immer für einen Fehler gehalten.“
Goncalves wandte den Kopf und fixierte ihn. „Die ‚Bahia Blanca‘ ist zurückgeblieben, um die Schiffbrüchigen des Gefechts an Bord zu nehmen. Der Comandante gehört zu den Überlebenden. Wenn du willst, kannst du ihm. deine Kritik vortragen. Er wird davon sehr erbaut sein.“
„So habe ich das nicht gemeint“, sagte der Erste abschwächend. „Bitte verzeiht mir, Kapitän.“
„Genehmigt.“ Goncalves’ Stimme klang weniger schroff, als er das erwiderte. „Folgt mir, wir gehen in meine Kammer und beschäftigen uns noch einmal eingehend mit den Karten. Morgen früh will ich sicher sein, daß jeder unserer Schritte sorgsam vorbereitet und festgelegt ist. Wir dürfen keinen Fehler begehen. Keinen einzigen.“
Sie wandten sich vom Schanzkleid ab, schritten über das Achterdeck und stiegen auf die Kuhl hinunter. Goncalves gab dem Profos ein paar Anweisungen, die das Einteilen der Deckswachen für die Nacht betrafen, dann ging er vor dem Ersten und dem Bootsmann her auf das Achterdecksschott zu.
Genau in diesem Augenblick regte sich am Ufer doch etwas, aber es war Nuno Goncalves’ ausgesprochenes Pech und ein unverzeihliches Vergehen seines Ausgucks, davon nichts zu bemerken.
2.
Dans scharfe Augen hatten sich auch diesmal nicht trügen lassen. Er hatte die Gestalten auf dem Achterdeck der Galeone auch ohne ein Spektiv beobachten können, und weder er noch Hasard und die anderen vier hatten sich vom Fleck gerührt, bevor die Männer nicht vom Schanzkleid verschwunden waren.
Jetzt glitt der Seewolf über den schmalen Sandstreifen und erreichte das Flachwasser. Er schlich hinein und duckte sich so tief wie möglich.
Carberry, Ferris Tucker, Smoky, Blacky und Dan folgten seinem Beispiel. Sie alle waren nur mit kurzen Hosen bekleidet, die Messer steckten in den Gurten. Es war die einzige Möglichkeit, zur Galeone hinüberzutauchen, nur auf diesem Weg erreichten sie ungesehen das Schiff. Ein Boot wäre unweigerlich von dem feindlichen Ausguck entdeckt worden, und sei es noch so klein.
Im Dickicht verweilte ein regloser, ernst dreinblickender Sun Lo.
„Ich wünsche euch viel Erfolg“, flüsterte er. „Der Allgeist verleihe euch die Macht, es ohne Blutvergießen zu vollbringen.“
Der Seewolf und seine fünf Männer waren ganz ins Seewasser eingetaucht und begannen zu schwimmen. Ihre Köpfe waren undeutliche, zerlaufende Male in den schwärzlichen Fluten. Wenig später waren sie nicht einmal mehr als Schemen zu erkennen – die Männer waren getaucht und bewegten sich unter Wasser auf die Galeone zu.
Sun Lo drehte sich um und verließ seinen Posten.
Nein, niemals würde er gegen Philip Hasard Killigrews Anweisung handeln. Dazu war er nicht fähig. Der Seewolf hatte ihm auferlegt, zur „Isabella VIII.“ zurückzukehren. Und das tat Sun Lo nun auch.
Nur in einem Punkt verhielt er sich anders, als der Seewolf es von ihm annahm. Er mußte lächeln, als er daran dachte.
„Meine Schüler warten auf mich“, sagte er in seiner weichen, melodiösen Sprache. „Es gibt in dieser Nacht noch eine Menge zu tun für uns.“
Hasard und seine Männer nahmen in diesem Moment ihre Köpfe wieder aus dem Wasser und achteten darauf, sowenig Geräusche wie möglich zu verursachen. Sie schöpften Luft, es gurgelte nur ein bißchen im Wasser, dann waren sie wieder unter der Oberfläche verschwunden.
Als sie zum zweitenmal aufstiegen und ihre Lungen vollpumpten, befanden sie sich unter dem Heck der Galeone. Wuchtig ragte der breite Spiegel über ihnen auf. Die Galerie und der darüber befindliche Teil des Schiffes waren reichlich mit Schnitzwerk verziert. Die Spanier und Portugiesen hatten einen unerschütterlichen Hang dazu, ihre Schiffe so auszustatten.
Im Mondlicht konnte der Seewolf die Schriftzüge am Heck erkennen. „Sao Paolo“ hieß die Galeone. Sie hatte ein mächtiges Steuerruder aus schönstem Pinienholz, das zum Hochklettern einlud.
Hasard grinste. Er wies auf das riesig wirkende Ruderblatt, glitt darauf zu und traf Anstalten, sich daran emporzuziehen.
Carberry hatte unausgesetzt nach oben geschaut und warnte seinen Kapitän in diesem Moment durch einen Wink. Er selbst ließ sich unter Wasser sinken. Dan, Blacky, Smoky und Ferris taten das gleiche. Hasard fand gerade noch die Zeit, sich in dem Winkel in Sicherheit zu bringen, den das Ruderblatt mit dem Heck des Schiffes bildete. Hier verharrte er mit angehaltenem Atem.
Oben – unsichtbar für den Seewolf – war eine Gestalt erschienen, und zwar ganz achtern auf dem erhöhten Teil des Hecks. Es handelte sich um eine der Deckswachen, die der portugiesische Profos auf Goncalves’ Geheiß hin eingeteilt hatte.
Dieser Mann warf einen knappen, prüfenden Blick aufs Wasser hinunter, bemerkte die kleinen Wellenringe jedoch nicht, die die fünf Männer der „Isabella“ hinterlassen hatten. Auch Hasard entdeckte er nicht, denn der befand sich unterhalb der Heckgalerie für ihn im toten Blickfeld.
Folglich zog sich der Wachtposten wieder zurück. Er setzte seinen Rundgang fort, ohne im geringsten beunruhigt zu sein.
Hasard sah die Freunde neben sich auftauchen. Durch eine Gebärde gab er ihnen zu verstehen, sie sollten sich still verhalten. Er legte sich behutsam auf den Rücken und schob sich auf dem Wasser mit dem Kopf zuvorderst am Ruder der Galeone entlang.
Auf diese Weise erlangte er den Ausblick auf die gesamte Heckpartie. Er überzeugte sich, daß die Deckswache ihnen tatsächlich nicht mehr zum Verhängnis werden konnte, und verharrte fast eine Minute lang in seiner Lage.
Dann klomm er endlich am Ruder empor. Ohne jegliche Hilfsmittel wie Enterhaken oder Taue erreichte er die Hennegatsöffnung, stellte die Füße hinein und stemmte sich hoch. Er streckte die Hände nach oben und konnte die Verzierungen der Heckgalerie berühren.
Ferris enterte hinter ihm das Steuerruder der „Sao Paolo“. Hasard wartete sein Erscheinen noch ab, dann bückte er sich ein wenig, stieß sich schwungvoll ab und klammerte sich an der Galerie fest.
Es gelang ihm, sich hochzuhieven und über die Balustrade zu klettern. Leise wie eine Raubkatze setzte er auf und blickte wie gebannt auf die Bleiglasfenster des Achterschiffes. Dahinter glomm der rötliche, dämmrige Schein von Öllampen. Der Seewolf registrierte die Bewegung von Gestalten.
Hasard kauerte wie festgenagelt da.
Bei dem Raum konnte es sich nur um die Kapitänskammer handeln. Demzufolge waren die Männer, die sich gerade darin aufhielten, entweder der portugiesische Capitán mit ein oder zwei Besatzungsmitgliedern oder ein paar Offiziere.
Wenn sie jetzt auf die Galerie hinaustraten, sah es für den Seewolf und seine Begleiter übel aus.
Waren die Portugiesen schnell, dann konnten sie Hasard mit Leichtigkeit überwältigen und die fünf anderen vom Ruder wegschießen. Ferris, Blacky, Smoky, Ed und Dan befanden sich im Moment auf dem Präsentierteller.
Hasard wagte kaum zu atmen.
Ferris’ Rotschopf erschien hinter der Handleiste der Balustrade, es folgten Kopf, Oberkörper, Bauchpartie – und die Beine. Ferris sank neben Hasard auf alle viere und verhielt sich genauso mucksmäuschenstill.
Wenig später waren auch der Profos und die drei anderen eingetroffen. Hasard pirschte sich an das eine Bleiglasfenster des Hecks heran, schob sich langsam hoch und schaute in die Kapitänskammer. Ihm war jetzt, da er die Männer hinter sich wußte, bedeutend wohler zumute.
Etwas verschwommen erkannte er die Gestalten der Portugiesen im Schein der Öllampe. Der Vorteil war, daß er im Dunkeln stand, sie ihn also nicht sehen konnten. Er hingegen verfolgte ziemlich genau, was sie taten, und konnte sie jetzt auch sprechen hören.
Sie hatten sich über Land- oder Seekarten gebeugt, die sie auf dem Pult des Capitáns ausgebreitet hatten.
„… wäre es das beste, bis zur Flußmündung zu segeln und dort zu beginnen“, sagte der eine gerade.
„Si, Senhor“, antwortete sein Gegenüber, ein augenscheinlich junger und schlanker, beinah schlaksiger Mann. „Hoch am Wind liegend können wir uns vielleicht sogar ein Stück den Fluß aufwärts arbeiten.“
„Falls die Wassertiefe es zuläßt“, wandte der dritte ein.
„Immer Bedenken, was, Bootsmann?“ sagte der Schlanke zu dem Mann.
„Die kriegt man im Laufe der Jahre.“
„Es bleibt dabei“, sagte nun der erste Sprecher – der Kapitän der „Sao Paolo“. „Gleich im Morgengrauen laufen wir die Flußmündung an. Sie wird unser Ausgangspunkt und unsere Orientierungshilfe sein. Ich denke, von dort aus können wir ausgezeichnet operieren.“
Übergangslos wandte er sich vom Pult ab und schritt auf die Tür zu, die auf die Heckgalerie führte.
Hasard zog sich sofort von dem Fenster zurück. Er hatte genug gehört. Seine Befürchtungen waren keineswegs übertrieben gewesen. Die Portugiesen waren drauf und dran, eine Falle zuschnappen zu lassen, aus der es kein Entweichen mehr gab. Nur die Dunkelheit hatte ihre Aktion unterbrochen. Die Nacht war der traute Verbündete der Seewölfe.
Hasard hockte sich so hinter die Tür, daß sie zu ihm hin aufschwingen und ihn verdecken mußte. Er sah zu seinen Männern. Eine Absprache war nicht nötig, nicht einmal ein Winken oder Zeichengeben. Ihr gemeinsames Handeln war in vielen Einsätzen erprobt, jede Bewegung, jede Positionsnahme gleichsam zur Routine eingeschliffen, wenngleich jedes Unternehmen seine ureigenen Abläufe hatte und von ihnen verlangte, daß sie sich blitzschnell darauf einzustellen wußten.
Eben das war es. Sie waren schnell. Ungemein schnell.
Dan und Blacky nahmen die jweils äußerste Ecke der Galerie an Back- und Steuerbord ein. Carberry, Smoky und Ferris Tucker kauerten sprungbereit vor der Balustrade und schienen in diesen Sekunden in sich zusammenzukriechen, um so gut wie möglich mit der Finsternis zu verwachsen.
„Genießen wir einen Moment die frische Luft“, sagte der Capitán. „Bootsmann, bring die Karaffe mit, wir wollen auf eine erfolgreiche Sache anstoßen. Ein Glas Rotwein, das ist jetzt genau das richtige.“
Ja, dachte der Seewolf, ich finde auch, das ist ein großartiger Einfall.
Die Tür öffnete sich. Sie prallte fast gegen ihn. Kaltblütig und voll Berechnung hockte er da. Als die Gestalt des portugiesischen Kapitäns die Deckung der Tür verließ und neben ihm erschien, schoß Hasard hoch.
Ungefähr zur selben Zeit schritt Lucio do Velho auf einem kleinen, unbedeutenden Eiland rund hundert Meilen nördlich von Formosa auf einem Plateau vor seinen Untergebenen auf und ab. Er hatte die Hände hinter dem Rücken ineinandergelegt und gab sich den Anschein eines Mannes, der in tiefschürfende Erwägungen verstrickt war. Dies war eine seiner beliebtesten Posen, wie die Mimik überhaupt sein ein und alles war.
Drei Männer waren sein Publikum.
Drei – dabei hatte seine Mannschaft aus fast vier Dutzend erfahrenen Seeleuten und Soldaten bestanden.
Die Insel war felsig und unwirtlich. Ihre Entdecker hatten ihr seinerzeit nicht einmal einen Namen gegeben, und auch do Velho hielt es für absolut unwichtig, sie jetzt nachträglich zu taufen.
Auf dem Eiland gab es keine Eingeborenen, keine Tiere und kaum Pflanzen. Ein Fleckchen Erde, vielleicht zwölf, dreizehn Quadratmeilen groß, schroff, karstig, ohne natürliche Attraktionen. Das Plateau stellte den höchsten Punkt dar, es lag vielleicht vierzig Fuß über dem Meeresspiegel, möglicherweise auch ein bißchen mehr.
In der Nähe gab es ein kleines Wasserloch, die einzige Quelle der Insel. Das Trinkwasser war genießbar. Während der letzten, unendlich erscheinenden Stunden hatten die vier Männer sich wiederholt vor das Loch gelegt und das Naß in sich hineingeschlürft.
Dieses Wasser – es war zum Leben zuwenig und zum Sterben zuviel.
Do Velho bemühte sich trotzdem, seiner Miene einen Anstrich der Zuversicht zu geben. Er blieb stehen, wandte sich abrupt den drei Männern zu und sagte: „Und ich erkläre euch, wir schaffen es trotzdem. Wir halten durch. Wir sind zäh und lassen uns nicht unterkriegen.“
Carlos, ein untersetzter Mann mit großflächigem Gesicht, schaute auf. „Wir haben keinen Proviant, Capitán, vergeßt das nicht. Es gibt nichts zu essen auf der Insel, nicht einmal Wurzeln, die man ausgraben kann.“
„Und wenn es jagdbares Wild gäbe, könnten wir es nicht erlegen“, warf Ignazio ein. Seine Stirn war gefurcht, seine Augenbrauen fast drohend zusammengezogen. Er stammte aus Porto, ein muskulöser Mann, groß, breitschultrig, mit einem einfältigen Gemüt. „Wir haben eine Pistole“, fuhr er fort. „Und die ist nicht mehr brauchbar, obwohl wir das Pulver getrocknet haben, nachdem wir an Land geschwommen sind. Das Seewasser hat das Schloß ruiniert.“
„Egal“, erwiderte do Velho wegwerfend. „Wir sind darauf nicht angewiesen. Wißt ihr, wie lange ein Mensch durchhalten kann, wenn er genügend Trinkwasser hat? Bis zu zwei Wochen.“
Der vierte Mann meldete sich nun zu Wort. Sein hageres Gesicht drückte offene Wut aus. Bislang hatte er sich mühsam bezähmt, aber jetzt konnte er nicht mehr an sich halten. Sein Name war Vicente, er war einer der Stückmeister an Bord des nun zerstörten, versenkten Schiffes gewesen.
„Capitán“, stieß er hervor. „Eine Woche, habt Ihr doch wohl sagen wollen. Aber welche Bedeutung hat das für uns? Schon morgen können wir uns vor Schwäche nicht mehr auf den Beinen halten. Übermorgen kriechen wir wie todwunde Tiere auf allen vieren. Am fünften Tag schleppen wir uns mit letzter Kraft ans Wasserloch, am sechsten und siebten dämmern wir dem Tod entgegen, am achten werden wir vielleicht endlich von diesem – diesem grausamen Schicksal erlöst.“
Er sprang auf. „Wir können nicht einmal das Pulver zünden und Feuer entfachen! Nur dasitzen können wir, abwarten, bis der Tod sich zu uns auf die Insel schleicht, sich neben uns hockt und auf den ersten lauert, den er entführen kann. Oder? Oder was gedenkt Ihr zu tun, Capitán?“
Do Velho lächelte ihn an. „Du hast eine blumige Art, dich auszudrücken, Vicente. Eine Schule hättest du besuchen sollen. Vielleicht wärest du fürs Theater besser geeignet gewesen als für die Seefahrt. Vielleicht hättest du auch einen guten Priester abgegeben. Ja, das wäre möglich.“
Diese Worte warfen den hageren Mann endgültig aus der Fassung. Zornbebend stand er da. „Hier gibt es noch jemanden, der seine Aufgabe verfehlt hat. So verrückt daherzureden, das kann doch nicht dein Ernst sein, do Velho. Oder doch – es ist dein Ernst. Du hast uns von Anfang an verschaukelt, es ist deine Schuld, daß unsere Kameraden über die Klinge gesprungen sind. Du bist …“
„Hör auf“, versuchte Carlos ihm das Wort abzuschneiden. „Das hat doch auch keinen Zweck.“
„… ein Versager!“ schrie Vicente. „Jawohl, ein Versager!“
Lucio do Velho stand mit leicht abgewinkelten Beinen und stemmte jetzt beide Fäuste in die Hüften. „Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, mich zu duzen?“ sagte er nicht besonders laut. „Da muß ein Mißverständnis vorliegen. Vicente, ich fordere dich auf …“
„Ja!“ brüllte der hagere Mann. „Ein Mißverständnis! Und was für eins! Studiert hat er, unser Senhor Capitán, und ein gebildeter Mann ist er. Kluge, raffinierte Leute müssen her, um die Kolonien unseres Weltreichs zu schützen und Kerle wie den Seewolf zu hetzen. Die alte Garde von dummen Hunden reicht da nicht mehr aus. Aber er ist auf den Arsch gefallen, unser schlauer, studierter Capitán, und jetzt steht er da und weiß nicht weiter.“
Do Velhos Gesicht war eine bleiche Maske unter dem Mondlicht geworden. „Schluß jetzt. Das geht zu weit. Nimm zurück, was du eben gesagt hast, Bastard. Es ist deine einzige Chance.“ Seine Stimme klang völlig verändert.
„Vicente!“ rief Ignazio. „Tu, was der Capitán sagt.“ Er war ebenfalls aufgestanden und trat auf den Kameraden zu.
Vicente zückte seinen Säbel und sprang ein Stück auf dem Plateau zurück. „Bleib mir vom Leib! Ich steche dich nieder, wenn du mir zu nahe kommst!“
„Du bist ja wahnsinnig!“ schrie Carlos. Etwas wankend erhob er sich.
Vicente richtete den Säbel auf Lucio do Velho. „Capitán, auch ich gewähre dir eine letzte Chance. Ich wiederhole meine Frage. Was gedenkst du zu unserer Rettung zu tun?“
Do Velho verengte die Augen zu Schlitzen. Kalt taxierte er den Abstand zwischen sich und dem Aufgebrachten und seine Möglichkeiten. So gesehen, konnte Vicente jeden Augenblick vorstürmen, an Carlos und Ignazio vorbei, und ihm, do Velho, den Säbel in die Brust stechen, ehe er überhaupt die Hand am Degengriff hatte.
„Ich werde es dir sagen“, erklärte do Velho deshalb.
„Na los!“ rief Vicente. „Aber ich will keine Durchhalteparolen oder nichtssagende Phrasen hören.“
Do Velho wies mit der Linken zur Bucht im Südwesten. „Unsere Galeone liegt auf dem Grund der Bucht, aber die Maststangen ragen aus dem Wasser, das heißt, die Wassertiefe ist nicht allzu groß. Einer von uns oder zwei könnten hinabtauchen und in den Schiffsräumen nach Proviant forschen.“
Vicente lachte höhnisch. „Sehr gut. Hast du vergessen, daß wir das schon getan haben? Ein guter Taucher kommt mit seinem Luftvorrat an die Kombüse oder an die Speisekammer heran, aber wenn er drin ist – spätestens dann – säuft er jämmerlich ab. Außerdem sind die Schotten dicht. Bei dem Wasserdruck sind sie nicht zu öffnen. Ich bin dreimal hinuntergetaucht, du elender Hurensohn, aber ich habe aufgeben müssen.“
„Ich, äh, war nicht dabei“, erwiderte do Velho. „Ich habe zu der Zeit die Insel erkundet.“
„Ja. Gedrückt hast du dich.“
Do Velho ließ die Arme baumeln. „Du wirst bereuen, was du gesagt hast. Ungestraft beschimpft und bedroht man keinen Kapitän oder Offizier.“
„Weitere Vorschläge!“ fuhr Vicente ihn an.
Der Mann aus Porto wollte sich an Vicente heranschleichen, aber Carlos hielt ihn zurück. Ignazio war ein diensteifriger Typ und der sturen Borddisziplin bedingungslos unterworfen. Für ihn zählte nur, was der Capitán sagte und tat. Er dachte nicht daran, daß Vicente der eindeutig Überlegene war und er Lucio do Velho innerhalb der nächsten Sekunden wahrscheinlich abservieren würde. Es lohnte sich also nicht, sich mit Vicente anzulegen.
Do Velho entging es nicht, wie Carlos den Mann aus Porto bremste. Do Velho schaute zu Carlos, aber der wich seinem Blick aus.
„Hör zu“, erklärte der Capitán jetzt. „Ich bin bereit, ein neues Experiment zu beginnen. Allein. Ich tauche. Wenn ich uns nichts Eßbares besorgen kann, werde ich zumindest eins der Beiboote aus den Zurrings lösen und an die Oberfläche befördern. Ich tue es noch heute nacht, wenn du willst, Vicente.“
Vicente grinste höhnisch. „Was für hervorragende Vorschläge! Aber völlig unbrauchbar. Ich habe auch das probiert, die Boote haben sich jedoch verkeilt und sind teils beschädigt, teils unter Kanonentrümmern begraben.“
„Wenigstens eins muß zu verwenden sein“, beharrte do Velho auf seiner Meinung. „Wir müßten nur alle vier tauchen.“
„Das könnte dir so passen.“
„Es ist ein ehrliches Angebot, Vicente.“
„Nein!“ brüllte der erregte Mann. „Du willst uns nur erledigen, unter Wasser! Sonst hättest du doch längst versucht, an ein Boot heranzukommen! Aber du weißt, das es sinnlos ist!“
Do Velho sprach eindringlich, fast bittend. „Überlege doch. Wir haben auf eins unserer Schiffe gewartet. Ich habe es gar nicht für nötig befunden, viel zu unternehmen. Früher oder später muß jemand erscheinen, der uns hier wegholt.“
„Ach? Unser Verband etwa?“
„Ja …“
„Der Verband ist vom Seewolf zum Teufel gejagt worden“, sagte Vicente wild. „Vorletzte Nacht. Oder hast du auch das Donnern der Kanonen schon wieder vergessen?“
„Keineswegs. Nur ist auch ein Killigrew nicht in der Lage, sich vier Schiffe vom Hals zu schaffen. Und vier sind es gewesen, die von Formosa herübergesegelt sind, wie wir es schon vorher vereinbart hatten: die ‚Bartolomeu Diaz‘, die ‚Vasco da Gama‘, die ‚Sao Paolo‘ und die ‚Bahia Blanca‘. Im Morgengrauen haben sie die ‚Isabella‘ gestellt und vernichtet.“
„So? Warum sind sie dann anschließend nicht herübergesegelt, um uns aufzulesen?“
Do Velho antwortete: „Der Comandante da Odemira weiß nicht, wo wir stecken. Er hat die abfackelnden Masten der ‚Sao Fernao‘ nicht mehr sehen können. Das ist unser Pech. Jetzt müssen wir das Ende der langwierigen Suche abwarten. Aber wir können nicht nur mit dem Hauptverband rechnen, sondern auch mit der ‚Santa Luzia‘, unserem sechsten Schiff, das vor vier Tagen nach Nordosten abgelaufen ist, um die Nansei-Shoto-Inseln auf Feindbewegungen hin zu untersuchen.“
„Wir können also ganz sorglos sein?“ fragte Vicente lauernd.
„Ja, unbedingt.“
„Du bist ein Lügner“, zischte der Stückmeister. „Ich hab’s immer gewußt. Wir müssen hier verrecken, aber ich will dich zuerst sterben sehen, bevor es uns erwischt. Ich töte dich, du Hurensohn.“
Er wollte einen Ausfall zu do Velho hin unternehmen, doch dieser griff sich plötzlich an die Brust und sank zusammen.
„Dios“, stöhnte er immer wieder. „Mein Gott, was ist nur – Himmel, warum helft ihr mir nicht?“
„Das Herz“, murmelte Ignazio.
„Nein!“ stieß Carlos hervor. „Er ist ein großartiger Simulant, aber uns legt er nicht mehr herein. Ich übernehme die Sache.“ Bevor Vicente eingreifen konnte, hatte er sein Messer gezückt und stürzte sich auf den Kapitän.
Do Velho war auf die linke Körperseite gesackt und krümmte sich. Carlos hatte ihn erreicht – da zuckte er wie eine große, kräftige Schlange, schwang wieder hoch und knallte dem Mann beide Fäuste gegen den Kopf.
Carlos verlor sein Messer. Vicente stieß einen wilden Schrei aus und rückte mit erhobenem Säbel vor, aber Lucio do Velho, der Gerissene, versetzte Carlos einen Stoß und beförderte ihn auf den Stückmeister der „Sao Fernao“ zu.
Carlos prallte gegen Vicente. Vicente wimmelte den untersetzten Mann ab und trat an ihm vorbei. Diese kurze Verzögerung hatte do Velho gereicht. Er hatte seinen Degen gezückt und stellte sich dem Untergebenen, der sein Todfeind geworden war.
Carlos hatte Mühe, sich vom Plateau aufzurappeln.
Ignazio, der Mann aus Porto, stand wie vom Donner gerührt und schien nicht zu begreifen.
Vicente drosch mit dem Säbel auf den Kapitän ein. Er wollte ihm den Schädel spalten, eine blutige Kerbe in die Schulter hauen, die Klinge im Herzen des Widersachers versenken, aber nichts davon klappte. Geschickt wehrte do Velho jede Attacke ab. Er baute eine Verteidigung auf, studierte Vicentes Kampftaktik, fand seine Fehler heraus – und duckte sich in einem Augenblick, den er für den geeigneten hielt.
Vicente dachte, der Kapitän wolle einem Streich ausweichen.
Er hatte sich getäuscht.
Do Velho stand flach über den Boden gekauert, sein Kopf, Arm, Oberkörper waren eine Einheit, die plötzlich nach vorn schoß. Die Degenklinge traf Vicente. Vicente zog den Säbel erfolglos über do Velhos Kopf hinweg. Er hatte sich zu spät auf die neue Situation und auf das Verhalten des Gegners eingestellt.
Vicente spürte ein Stechen im Unterleib, als Lucio do Velho seine Waffe bereits wieder an sich gerissen hatte. Wallende Nebel senkten sich über den Stückmeister Vicente. Er verlor die Kontrolle über sich, die Schmerzen packten ihn, rüttelten an seinem Leib und zwangen ihn zu Boden.
Carlos stand und wollte sich erneut auf den Kapitän stürzen, aber in diesem Moment handelte Ignazio. Plötzlich hatte Carlos ein Messer zwischen den Schulterblättern stekken. Er röchelte, taumelte und schaute ungläubig drein. Zwei, drei stolpernde Schritte tat er noch auf Lucio do Velho zu, dann fiel auch er.
Auf dem Bauch blieb er liegen. Sein Gesicht war nach unten gewandt.
Vicente lag gekrümmt und hatte seinen Säbel aus der Hand verloren. Das Leben war ein Atemhauch, der aus seinem Körper entfloh und vom Wind davongetragen wurde.
Ignazio stand mit baumelnden Armen und starrte seinen Kapitän an.
„Ausgezeichnet“, sagte do Velho kühl. „Ich werde dafür sorgen, daß du eine Belobigung erhältst, mein Freund. Du hast dich vorbildlich verhalten.“
Er sah an dem Mann aus Porto vorbei und schien etwas entdeckt zu haben. Plötzlich steckte er den Degen weg und lief über das Plateau.
„Da!“ rief er. „Ich hab’s ja gesagt! Da kommt ein Schiff!“
Ignazio wandte den Kopf. Im ersten Augenblick hielt er das, was do Velho von sich gegeben hatte, für ein Hirngespinst. Dann entdeckte auch er das Licht in der Ferne.
„Aus Nordosten nähert sich das Schiff“, murmelte Ignazio. „Wenn das die ‚Santa Luzia‘ ist und die Mannschaft unser Rufen hört, sind wir wirklich gerettet.“
Lucio do Velho lief bis zum Nordufer der Insel, verharrte auf dem Kap und blickte dem Segler entgegen. Er hielt auf das Eiland zu. Do Velho gestand vor sich selbst, daß er mit einem solchen Ereignis auch nicht mehr gerechnet hatte.
3.
Nuno Goncalves sah die Gestalt neben sich hochschnellen, und fast gleichzeitig stellte er fest, daß sich in der Dunkelheit vor ihm noch mehr ungebetene Gäste eingefunden hatten. Schemen, die vor der Balustrade kauerten. Selten war die Heckgalerie der „Sao Paolo“ derart belebt gewesen.
Ein Schlag traf Goncalves, ehe er schreien, handeln oder kämpfen konnte. Dieser Hieb, auf seine rechte Flanke gezielt, war so hart, daß er nach Steuerbord katapultiert wurde. Er flog Dan O’Flynn entgegen, und der ließ seinen rechten Fuß hochzukken, wie Sun Lo es ihn gelehrt hatte.
Ein Ruck, der Goncalves’ Körper durchlief, ein erstickter Laut, ein Fallgeräusch, und der portugiesische Kriegsschiff-Kapitän lag ausgestreckt vor Dan auf den Planken.
Ergötzen konnte Dan sich an diesem Anblick allerdings nicht, er mußte den anderen nach. Carberry, Smoky und Ferris Tucker waren wie die Teufel in die Kapitänskammer gestürmt. Hasard wirbelte herum und lief ihnen nach, Blakky schloß sich ihm an.
Der erste Offizier der „Sao Paolo“ hatte seinen Kapitän wie durch Spuk aus dem Rechteck der Türöffnung verschwinden sehen. Sofort hatte er die Hand auf den Griff seiner wertvollen Radschloßpistole fallen lassen. Im Grunde war das die richtige Reaktion, und man mußte es dem schlanken, schneidigen Mann lassen: Er hatte das Rüstzeug eines vollwertigen Kapitäns.
Der Bootsmann klappte den Mund auf und stand für eine Weile ratlos da.
Ein Klotz aus Muskeln, Narben, Häßlichkeit und englischen Flüchen raste auf den ersten Offizier zu. Der zückte die Pistole, um ein Loch in diesen Berg zu brennen, aber Carberry war schneller. Im Eifer des Gefechts vergaß er Sun Lo, die Klosterschüler und den ganzen Kram, den er da oben im Bergkloster vernommen hatte. Er knallte dem Gegner eine brettharte Linke auf den Waffenarm, so daß die Pistole durch den Raum segelte und zu Boden polterte. Die rechte Faust rammte er ihm unters Kinn – nach guter alter Cornwall-Art und wie’s ihm spontan einfiel.
Smoky und Ferris schlüpften an dem zusammenbrechenden Ersten vorbei und erreichten den Bootsmann. Sie nahmen neben ihm Aufstellung, keilten ihn ein, und Ferris raunte dem Entsetzten auf spanisch zu: „Ruhig bleiben. Ich an deiner Stelle würde nichts von dem versuchen, was du vielleicht vorhast.“
Der Bootsmann hatte bereits die Karaffe mit dem Vinho tinto in der linken Hand, wie Nuno Goncalves es ihm befohlen hatte. Seine rechte Hand umspannte einen gläsernen Kelch, den er soeben einem dunkel lackierten Schrank aus kostbarstem Nußbaumholz entnommen hatte.
Ferris nahm ihm die Karaffe ab. Smoky fing das Glas auf, als der Bootsmann es einfach fallen ließ.
„Na, na“, sagte Hasards Schiffszimmermann. „Wir wollen doch nicht, daß hier was kaputtgeht.“
Der Bootsmann stürzte mit einem Aufschrei auf Hasard zu. Blacky und Dan befanden sich hinter dem Seewolf, brauchten aber nicht mehr einzugreifen, weil Hasard den Anrükkenden mit einem einzigen Schlag fällte.
Der Bootsmann hätte gern wie am Spieß geschrien und um sich geprügelt. Statt dessen legte er sich sanft auf den Boden der Kammer.
„Donnerkiel“, sagte Carberry. „Das war ein Hieb, Sir.“
„Waffenloser Kampf“, erwiderte der Seewolf leise. „Langsam kriege ich Geschmack daran.“
„Sun Lo sollte uns sehen“, flüsterte Dan.
Hasard huschte zur Tür, die auf den Gang des Achterkastells führte. Er lauschte, wandte sich dann wieder um und raunte: „Kommt. Noch rührt sich nichts, aber vielleicht ist der Ruf des Burschen an Oberdeck doch vernommen worden.“
Hasard öffnete die Tür und zog den Schlüssel ab, der von innen steckte. Er zwängte sich als erster durch den Spalt in den stockfinsteren Gang. Nichts, das irgendwie Gefahr verkünden konnte, ließ sich im Achterdeck vernehmen. Hasard schlich weiter.
Dan O’Flynn löschte das Licht in der Kammer, damit sie den Schein nicht im Rücken hatten. Blacky, Smoky, Carberry und Tucker waren an ihm vorbei. Er verließ als letzter die Kammer.
Auf dem Gang dachte der Profos: Hölle, es ist nicht leicht, sich so ganz ohne Anhaltspunkte im Dunkeln voranzubewegen, aber, hol’s der Henker, wir haben langsam ja schon Übung darin.
Kurze Zeit darauf hatten sie den Gang hinter sich gebracht. Dan als letzter des kleinen Trupps hatte die Kapitänskammertür von außen zugeschlossen – damit die drei ohnmächtigen Gegner ihnen nicht in den Rücken fallen konnten, wenn sie vorzeitig erwachten.
Hasard drückte das Schott, das auf die Kuhl mündete, vorsichtig auf, aber er konnte es doch nicht verhindern, daß die Eisenangeln ein leises Knarren von sich gaben.
Er verharrte.
Über ihm, an der Schmuckbalustrade, die den vorderen Querabschluß des Achterdecks bildete, standen zwei der vier Deckswachen dicht nebeneinander.
„Hast du das gehört?“ sagte der eine. „Dann habe ich mich eben also doch nicht getäuscht. Erst ein Schrei – jetzt ein deutliches Knarren.“
„Das wird der Capitán sein“, meinte der andere.
„Nein, unmöglich. Warum sollte der schreien?“
„Vielleicht hat er den Ersten angebrüllt.“
„Ich glaub’s einfach nicht. Woher kam das Knarren?“
„Vom Schott“, antwortete der zweite Posten trocken. „Es steht halb offen und wird vom Wind bewegt.“
„Du meinst, alles sei in Ordnung?“
„Ja. Was soll denn schon passieren?“
Eben, was soll schon passieren, dachte auch der erste Posten. Er sann für eine Weile nach, dann gab er sich einen Ruck und sagte: „Trotzdem. Ich gehe kurz ’runter und sehe nach.“
Der andere zuckte mit den Schultern.
Der erste Posten stieg den Backbordniedergang zur Kuhl hinunter, wandte sich nach rechts und sah gerade noch, daß das Schott zum Achterkastell tatsächlich halb offen war. Er wollte sich darüber wundern, denn noch vor ein paar Minuten hatte er es fest verschlossen gesehen. Aber zu solchen oder ähnlichen Überlegungen blieb ihm keine Zeit.
Jemand sprang ihn an.
Hasard hatte das Achterkastell auf leisen Sohlen verlassen und neben dem Backbordniedergang gekauert. Ein Hieb mit der Handkante gegen die Nakkenpartie des Postens genügte, und der Mann sank vor der Hütte zusammen, ohne auch nur den leisesten Laut von sich zu geben.
Ein wenig Licht von der Hecklaterne drang bis auf die Kuhl, aber dicht vor der Querwand der Hütte herrschte schwärzeste Finsternis. Hasard ließ sich neben dem Bewußtlosen nieder, hockte völlig reglos da und wartete ab.
Wenig später verließ auch die zweite Wache das Achterdeck. „He, wo steckst du?“ rief der Mann.
Von der Back meldete sich ein dritter Mann. Er trat an die Querbalustrade über der Kuhl, und fast gleichzeitig erschien neben ihm eine weitere Gestalt. „Was ist los? Warum rufst du?“
„Sirio meint, was gehört zu haben“, brummte der zweite Posten. Er hatte die Stufen des Backbordniedergangs hinter sich gebracht und blieb ganz nah vor Hasard stehen. „Möchte wissen, was der hat. Ich sage euch, er sieht Gespenster.“
Hasard spähte zum Vordeck hinüber. Weitere Wachtposten konnte er nicht entdecken. Vier waren es also. Es galt, die beiden auf der Back außer Gefecht zu setzen, ohne daß sie den Rest der Mannschaft wachtrommeln konnten.
Sirios Kumpan beugte sich ein wenig vor. Offenbar versuchte er zu erkennen, was sich im Dunkel vor der Poop tat.
Hasard hatte Sirios Stimme vorher deutlich genug vernommen, er konnte sie ohne Schwierigkeiten nachahmen.
„Aqui, eis“, raunte er auf portugiesisch. „Hier, hier ist …“
Der andere rückte näher. „Que, onde – was, wo?“ fragte er.
„Dies hier“, zischte der Seewolf. Er knallte dem Posten die Faust gegen die Schläfe, fing ihn auf und zog ihn zu sich herunter. Sanft ließ er ihn auf die Planken gleiten, dann erhob er sich und ging über die Kuhl.
Carberry, Smoky, Blacky, Ferris und Dan hatten das Achterkastell der Galeone verlassen und kauerten sprungbereit. Sie hielten den Atem an, denn was der Seewolf in diesem Augenblick vorführte, war wirklich das Ausmaß der Verwegenheit.
Für zwei oder drei Sekunden glaubten die beiden Posten auf der Back vielleicht noch daran, den zweiten Wachmann vor sich zu haben. Sie hatten nicht erkennen können, was sich vor der Hütte abgespielt hatte. Sie hatten Sirios Partner nur verschwinden und dann sofort wieder eine Gestalt auftauchen sehen.
Jetzt sperrten sie die Münder auf.
Hasard nutzte das Überraschungsmoment eiskalt aus. Er duckte sich, sprintete los, hetzte über die Planken und steuerte genau auf das Vorkastell zu. Kurz davor stieß er sich ab.
Er federte genau in dem Moment auf die zwei Deckswachen zu, in dem diese die Pistolen zückten. Einer der beiden stieß einen keuchenden Laut des Entsetzens aus.
Hasard packte zu und kriegte sie an den Hemdaufschlägen zu fassen. Ehe sie sich wehren konnten, rammte er ihre Köpfe zusammen. Ihr ausgesprochenes Pech war, daß sie keine Helme trugen. Sie stöhnten auf und sackten zusammen. Der Seewolf klammerte sich an der Handleiste der Querbalustrade fest, zog sich endgültig hoch und rutschte über die hölzerne Barriere weg auf das Vordeck.
Der eine Posten war ohnmächtig zusammengesunken. Der andere fing sich wieder, richtete seine Pistole auf Hasard und spannte den Hahn. In seinen Augen loderte es, Haß verzerrte sein Gesicht.
„El Lobo del Mar“, stieß er hervor.
Hasard schwang auf ihn zu. Sein rechter Fuß zuckte hoch, es funktionierte auch diesmal, Sun Lo war ein hervorragender Lehrmeister. Die Pistole löste sich aus der Hand des Portugiesen, wirbelte durch die Luft und flog außenbords.
Hasard setzte nach und packte den Arm des Gegners. Der Posten hatte plötzlich das Gefühl, sein Schultergelenk würde ausgekugelt werden. Er verlor den Boden unter den Füßen, hob sich unter Hasards Griff ein Stück durch die Luft und krachte schwer gegen die Schmuckbalustrade. Besinnungslos blieb auch er liegen.
Hasard blickte sich um und entdeckte die Musketen der beiden Männer. Er griff sie, eilte zur Kuhl und warf sie von oben aus seinen wartenden Männern zu.
Carberry fing die eine Muskete auf, Dan schnappte sich die andere. Sie grinsten, nickten sich zu und stiegen als erste ins Vorschiff hinunter. Dort befand sich das Mannschaftslogis, dort mußte die entscheidende Auseinandersetzung stattfinden.
Unten, auf dem dunklen Gang, taumelte dem Profos der „Isabella“ ein schlaftrunkener Mensch entgegen. Offenbar hatte er etwas von dem vernommen, was sich auf Oberdeck getan hatte – jetzt wollte er nach dem Rechten schauen. Vielleicht war er der Decksälteste. Oder gar der Profos. Wer auch immer – Ed Carberry fällte ihn mit einem wilden Hieb. Der Sturz des Portugiesen verursachte einigen Lärm: Poltern, Rumpeln, das Schlagen von Stulpenstiefeln auf den Planken.
So wurde der eine oder andere Schläfer wach.
Überall regte sich Leben, mürrische Stimmen fragten, was los sei und ob man nicht Ruhe geben könne.
Carberry tastete sich in einen Raum vor. Er vernahm Schnarchen, Atmen, Husten. Er stupste Dan O’Flynn an, der dicht neben ihm war. Sie flankierten die Tür, lehnten sich mit dem Rücken gegen die Wand und hoben die Musketen.
Jemand schlug Feuerstein und Feuerstahl gegeneinander. Ein Funke entstand, dann glomm ein Talglicht auf. Verwirrte Mienen, liegende und halb aufgerichtete Gestalten, mindestens zwanzig an der Zahl – jawohl, sie standen im Mannschaftslogis.
„Hoch die Flossen“, sagte Carberry in holprigem Portugiesisch. „Unternehmt keinen Quatsch, ihr Bastardos, oder wir marschieren hier durchs Schiff, daß es nur so raucht. Also, schön brav sein.“
Smoky, Blacky und Ferris Tucker hatten sich inzwischen auf die übrigen Schlafräume des Vordecks verteilt. Es gab ein paar Kammern, in denen der Feldscher und ein paar andere Leute ihrer zweifellos verdienten Nachtruhe nachgingen. Für sie gab es ein höchst unerfreuliches Erwachen.
Hasard nahm sich im Alleingang ein paar Offiziere vor, die sich gerade anschickten, das Achterkastell zu verlassen. Er hätte sich eher um sie kümmern können, aber es war ihm das Wichtigste gewesen, zuerst die Deckswachen auszuschalten.
„Zwei Kerle“, sagte im Mannschaftslogis soeben einer der Portugiesen. „Und sie haben nur zwei Schuß. Überwältigen wir diese Hunde.“
Dan blickte zum Profos. „Ed – ohne Waffengewalt, hat der Seewolf gesagt.“
„Glaubst du, ich bin taub?“
„Nein, ich wollte dich bloß noch mal daran erinnern“, sagte Dan grinsend.
Die ersten Portugiesen sprangen aus ihren Kojen. Zweifellos hatten sie bereits eine Ahnung, wer ihre Gegner waren, und sie wollten sich auf Teufel komm raus Lorbeeren verdienen. Denn auf die Ergreifung des Seewolfes und seiner Crew war eine Belohnung ausgesetzt, eine Kopfprämie, deren Höhe Philipp II. von Spanien höchstpersönlich festgelegt hatte.
Carberry drehte seine Muskete um und benutzte sie als eine Art Dreschflegel. Den Hahn der Waffe hatte er gar nicht erst gespannt, sie konnte also nicht losgehen. Er mähte vier, fünf Angreifer nieder, dann ließ er die Muskete los und fing an, „durch das Schiff zu marschieren“, wie er angekündigt hatte.
Wenig später tobte der Kampf sowohl im Vor- als auch im Achterschiff.
Hasard und seine Männer teilten großzügig Schläge und Tritte aus, sie bedienten sich wieder der Methoden, die Sun Lo ihnen beigebracht hatte. Der Seewolf hatte allein vier Mann gegen sich, aber dank der einzigartigen Verteidigungsweise hielt er sie sich vom Leib.
Hasard trat einem wutschnaubenden Offizier unters Kinn, setzte mit der Faust nach und schickte ihn mit einem Schlag zu Boden. Den Hieb eines anderen Gegners blockte er mit der Handkante ab, dann packte er zu und verdrehte dem Mann den Arm, daß er quer durch den Gang des Achterkastells flog und ein paar Yards weiter hart auf den Planken landete.
Er tauchte unter einem sirrenden Degen weg, ließ wieder seinen Fuß hochschnellen und entwaffnete den Gegner. Konzentriert schlug und trat er abwechselnd, paßte aber auf, keinen der Angreifer durch zu harte Abwehr lebensgefährlich zu verletzen.
Einen derart ausdauernden Faustkampf hatte der Seewolf bisher noch nicht ausgetragen. Und nie hatten sich die Männer der „Sao Paolo“ einer so wehrhaften kleinen Streitmacht gegenübergesehen, nie hatte man sie im Kampf auf Deck dermaßen in Verlegenheit gebracht.
Ein einziger Tag im Bergkloster von Formosa hatte nicht ausgereicht, um Hasard und seine Männer in alle Geheimnisse der mysteriösen Kampfweise einzuweihen. Sun Lo hatte ihnen aber versichert, daß sie die Grundzüge der waffenlosen Verteidigung recht gut verinnerlicht und in die Praxis umgesetzt hätten.
Was aber Sun Los Mönche zu vollbringen vermochten, war sehr viel erstaunlicher. Hasard hatte auf dem Hof vor dem Tempel der Großen Vollendung gesehen, wie ein Schüler mit der bloßen Faust einen Stapel von zwölf gebrannten Tonziegeln zertrümmert hatte. Er war dabeigewesen, wie zolldicke Bretter mit der Handkante gespalten worden waren. Weiter gab es Konzentrations- und Meditationsübungen, die den Mönchen neue Erkenntnisse eröffnen sollten, die sie immer wieder an die Basis der Gewaltlosigkeit erinnerten, auf der ihre Lehre eigentlich beruhte. Die Mittel, mit denen man sich gegen eine Invasion wandte, wurden durch den Zweck geheiligt, sie erwuchsen aus der Not. Aber Sun Lo wies immer wieder darauf hin, daß er keine hirnlosen Kraftprotze fördern wolle.
Sun Lo hatte Hasard erzählt, daß er manchmal mit den Klosterschülern zum Fluß hinuntersteige und sie dort lernten, wie man auf dünnen, schmalen Brettern über das Wasser laufe. Sie konnten mit Nagelschuhen Mauern hochrennen, über Kohlen und Glasscherben gehen und noch viele andere erstaunliche Demonstrationen vollführen.
Dies alles gehörte zu den harten, entbehrungsvollen Prüfungen, die Sun Lo allen Männern abverlangte, die letztlich die Straße der Weisheit beschreiten wollten.
Ganze Welten schienen die verschiedenen Mentalitäten der Völker zu trennen, und für einen Europäer war es schwer, diese Art größter Selbstbeherrschung und harten Trainings zu verstehen. Hasard glaubte aber, etwas von dem, was Sun Lo ihm auseinandergesetzt hatte, begriffen zu haben.
Er hechtete auf den letzten Widersacher zu, packte ihn und riß ihn mit sich zu Boden. Mit einem Hieb seiner rechten Handkante entledigte er ihn seiner Pistole. Sie wälzten sich auf dem Gang, überrollten sich, balgten sich, bis Hasard einen der Tricks anwandte, die er von Sun Lo gelernt hatte.
Der Offizier löste sich von Hasard und prallte gegen die Gangwand zurück. Heftig schlug sein Hinterkopf gegen das harte Edelkastanienholz. Er sank mit einem Stöhnen an der Wand zu Boden.
Hasard beschloß, die Angelegenheit zum Abschluß zu bringen. Er hob die eine Pistole auf, lief nach achtern und riegelte die Tür der Kapitänskammer auf.
Der Bootsmann rappelte sich gerade benommen auf, wie der Seewolf im Mondlicht erkennen konnte. Er wollte nach einer Waffe greifen, aber Hasard stoppte ihn.
„Auf die Galerie“, herrschte er ihn an. „Wird’s bald, oder muß ich nachhelfen?“
Nein, daran war dem Bootsmann nicht gelegen. Er stolperte durch die immer noch offene Tür auf die Heckgalerie hinaus. Unterwegs strauchelte er fast über die liegende Gestalt des Ersten. Er stieß ihm die Stiefelspitze in die Körperseite, turnte über ihn weg und hielt sich mühsam in der Balance.
Der erste Offizier, offensichtlich durch den Tritt aufgerüttelt, kam nun auch zu sich.
Hasard scheuchte auch ihn nach achtern hinaus. Er nahm die Karaffe voll Wein mit, trat zu dem Kapitän Nuno Goncalves und leerte den edlen Vinho tinto über dessen Haupt aus. Die Wirkung trat augenblicklich ein. Der Kapitän hob den Kopf, schüttelte ihn und prustete. Verdattert schaute er sich um – und blickte in die Mündung der auf ihn gerichteten Pistole.
„Freundchen“, sagte der Seewolf, „ich habe nur einen Wunsch, und den wirst du mir erfüllen.“
„Seewolf“, zischte Goncalves. „Fahr zur Hölle!“
„Später vielleicht“, sagte Hasard kalt. „Erst springst du.“
Der Mann sah ihn ungläubig an.
„Richtig verstanden“, sagte Hasard. „Du jumpst ins Wasser. Du und deine beiden Figuren. Ich sage das nicht noch mal.“
Goncalves erhob sich unter dem zwingenden Blick des Seewolfs. Er trat zu dem Ersten und zu dem Bootsmann, kletterte auf die Balustrade der Galerie, sah noch einmal voll Haß zu dem Gegner – dann ließ er sich in die Tiefe fallen.
Hasard zielte auf die beiden anderen, und auch die hatten es plötzlich sehr eilig, von Bord der „Sao Paolo“ zu gelangen.
4.
Die Partie im Vordeck war ebenfalls entschieden. Carberry, Smoky, Blacky, Ferris und Dan scheuchten gut zwei Dutzend Portugiesen aufs Oberdeck und zwangen sie, die Beiboote abzufieren. Verstört und mit fliegenden Fingern nestelten die Besiegten die Laschings der Boote los, hievten sie hoch, beförderten sie an den Galgen außenbords und fierten sie ungewöhnlich schnell ab.
„Ein Zugeständnis“, sagte der Profos unwillig. „Ihr Saubande, wenn es nach mir gegangen wäre, hättet ihr nicht eine einzige müde Jolle gekriegst. Dann wärt ihr alle baden gegangen.“
Ferris lachte und wies nach Backbord. „Einige scheinen deine Gedanken gelesen zu haben, Ed. Hörst du das?“
Ja, Carberry vernahm es jetzt auch. Da war ein Plätschern, ein Aufwühlen des Seewassers jenseits der Bordwand der Galeone. Überrascht hob er die Augenbrauen. Er vergewisserte sich, daß die Kameraden die Portugiesen auch allein bewachen konnten, drehte sich um und trat ans Schanzkleid.
Im Meer schwammen zehn oder zwölf Männer, der Profos bereitete sich nicht erst die Mühe, sie genau zu zählen. Nichts schien diese Burschen mehr zu interessieren, als soviel Distanz wie irgend möglich zwischen sich und die Galeone zu legen.
Carberry grinste. „Ausgekniffen, was? Das große Sausen gekriegt, wie? Ho, das haben wir gern. Feigheit vor dem Feind und Fahnenflucht – deswegen könnte euer Kapitän, dieses Rübenschwein, euch glatt vors Kriegsgericht stellen.“
Er wandte sich um und sah den Seewolf, der gerade vier Männer aus dem Achterkastell auf die Kuhl trieb. Reichlich verunstaltet sahen die Dons aus, und ihre Mienen drückten allen Jammer der Welt aus.
„Sir!“ rief Carberry. „Einen Teil des Haufens haben wir glatt in die Flucht geschlagen.“
„Um so besser, Ed.“
„Sollen wir die Hundesöhne jetzt in die Boote abentern lassen?“
„Natürlich, was denn sonst?“
Smoky schaute zu Carberry und lachte. „Willst du dich von den Dons verabschieden?“
Der Narbenmann schnitt eine Grimasse. „Ja, es tut mir richtig leid, daß sie abhauen. Hatte mich schon an sie gewöhnt.“
„Ab durch die Mitte“, sagte Blacky zu den Portugiesen. Er beherrschte ihre Sprache gut, hundertmal besser als Carberry. Sie verstanden ihn denn auch sofort und drängten sich vor den Jakobsleitern, die Carberry hatte ausbringen lassen. Sie konnten gar nicht schnell genug in ihre Boote steigen.
„Ferris und Dan“, sagte der Seewolf. „Ihr durchsucht jetzt die Schiffsräume. Wenn ihr etwas findet, das wir mitnehmen können-bitte. Aber laßt Pulver und Munition liegen, wir haben noch genug Vorrat an Bord.“
„Aye, Sir“, erwiderte Ferris. Er drehte um, Dan folgte ihm, und sie verschwanden unter Deck.
Etwas später hatten die Portugiesen mit den Booten von der Bordwand abgelegt. Ferris und Dan kehrten zu Hasard zurück und zeigten ein paar besonders wertvolle, reich verzierte Pistolen vor, die sie entdeckt hatten.
„Die stammen aus einer Kammer des Achterdecks“, erklärte Dan O’Flynn. „Ich fände es schade, wenn wir die hierlassen würden. Ich weiß, wir nehmen kein Boot, wir schwimmen an Land zurück, um keine Spuren zu hinterlassen. Aber ich könnte die Dinger auf einem Plankenstück festzurren, damit sie nicht naß werden.“
„Meinetwegen“, entgegnete Hasard. Er blickte Ferris an. „Und was hast du gefunden?“
„Werkzeuge, Sir.“ Ferris grinste von einem Ohr zum anderen.
„Auch einen Bohrer?“
„Na klar, Sir.“
„Was stehst du dann noch herum? Du weißt ja, was du zu tun hast.“
Ferris Tucker verließ wieder das Oberdeck. Er stieg tief in den Schiffsbauch der stolzen, schönen „Sao Paolo“ hinunter und begab sich mit den Beutewerkzeugen an eine Arbeit, die er nicht zum erstenmal ausübte. Er wußte, wo die besten Stellen waren, um den Bohrer anzusetzen, und wie viele Löcher erforderlich waren, um das Kriegsschiff in relativ kurzer Zeit auf den Grund der See zu befördern.
Schon nach kurzer Zeit lief er wieder zur Kuhl hoch. Die Werkzeuge hatte er im untersten Schiffsraum zurückgelassen.
„Wir können das Schiff jetzt verlassen“, meldete er seinem Kapitän.
Hasard warf noch einen Blick nach Backbord und sah den Booten nach. Es waren drei, zwei große und eine kleinere Jolle. Das am weitesten nach Westen versetzt dahingleitende Boot wurde in diesem Moment von seinen Insassen gestoppt. Sie hatten den Kapitän, den ersten Offizier und den Bootsmann entdeckt, hielten auf sie zu und nahmen sie an Bord.
Hasard grinste.
Natürlich durften sie es nicht bemerken, wie die Seewölfe jetzt heimlich die „Sao Paolo“ verließen. Die Portugiesen mußten denken, daß ihre Gegner das Schiff besetzt hielten, ja, daß sie sogar die Geschütze luden und sich auf einen Gegenschlag vorbereiteten.
Wenn der Capitán und seine Mannen bemerkten, daß man sie getäuscht hatte, würde es bereits zu spät sein. Dann konnten sie nicht mehr an Bord der Galeone zurückkehren, die Lecks nicht mehr stopfen und das Wasser in die See zurückpumpen — ausgeschlossen.
Hasard gab seinen Männern einen Wink.
Sie begaben sich ans Steuerbordschanzkleid und enterten an einer der Jakobsleitern ab. Unten ließen sie sich ins Wasser gleiten, und Dan schob das Stück Holz, auf dem er die wertvollen Pistolen befestigt hatte, vor sich her.
Tatsächlich gelang es ihm, die Waffen unversehrt an Land zu befördern. Schweigend schwammen die sechs Männer nebeneinander her, und als sie das Ufer erreicht hatten, vergewisserten sie sich zunächst, daß sie von den Portugiesen auch nicht gesehen werden konnten.
Aber die „Sao Paolo“ lag zwischen ihnen und dem davonziehenden Feind, und die Schatten der Nacht schlossen einen Vorhang zwischen den Gegnern.