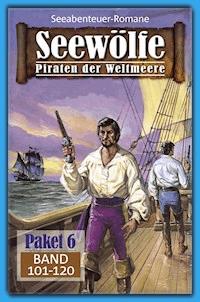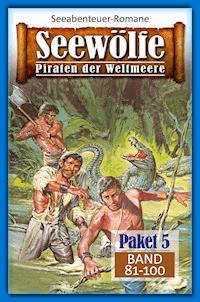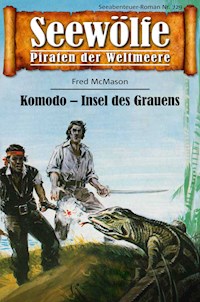Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Auch an diesem Morgen gab es für jeden nur einen knapp bemessenen Schluck Wasser. Sie konnten sich bestenfalls damit die Lippen anfeuchten. Zu mehr langte es nicht. Sie hatten das Gefühl, zu Mumien auszutrocknen. Die meisten suchten gleich unter dem Sonnensegel Schutz. Smoky, Ferris, Old Shane und Batuti schütteten Seewasser auf die Planken. Aber das verdampfte schon innerhalb kurzer Zeit. Danach waren die Planken wieder knochentrocken. Sie mußten Land und Wasser finden. Ständig wurde Ausschau gehalten. Die Augen wurden dabei so überanstrengt, daß man Trugbilder sah. Noch vor Mittag erschien wieder die Stadt mit den goldenen Türmen am flirrenden Horizont...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2019 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-95439-947-5Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Fred McMason
Fata Morgana
Die goldene Stadt ist zum Greifen nahe – doch immer verschwindet sie …
Die goldene Stadt war zum Greifen nahe – aber immer wieder verschwand sie in den Lüften …
„Wasser“, sagte der Schwede Stenmark heiser, „da vorn ist eine Oase, und das bedeutet Wasser, Smoky.“
„Ja, Wasser“, keuchte Smoky. „Für einen großen Schluck Wasser würde ich alle Schätze dieser Welt hergeben.“
Sie waren eins der Vorauskommandos, die in dem wüstenähnlichen Küstenstreifen nach Wasser suchen sollten. Jetzt schien sich ihre Hoffnung zu erfüllen. Nicht weit vor ihnen, nur noch hinter zwei riesigen Sanddünen halb verborgen, waren Dattelpalmen zu erkennen. Kein noch so winziger Luftbauch bewegte ihre Wedel. Von dem wolkenlosen Himmel brannte eine sengende trockene Hitze. Die Luft war so heiß, daß sie sich kaum noch in die gequälten Lungen ziehen ließ.
Beide Männer waren erschöpft, halb verdurstet, am Ende ihrer Kräfte. Jetzt mobilisierten sie alles, was sie noch hatten, boten ihre allerletzten Reserven auf. Mit heiseren Hurrarufen erkletterten sie die Düne, und dann sahen sie unter sich die Oase im gelben Sand liegen. Erst jetzt fiel ihnen auf, daß die Palmwedel vergilbt waren. Auch Büsche und Gräser waren verdorrt. Es gab kein Wasser mehr in der Oase. Sie war verlassen …
Die Hauptpersonen des Romans:
Old O’Flynn – Der alte Haudegen geht nachts im Sturm über Bord, ohne daß es jemand merkt.
Ben Brighton – Der Erste Offizier muß seinem Kapitän melden, daß sie kein Trinkwasser mehr haben.
Philip Hasard Killigrew – Der Seewolf steht vor schweren Entscheidungen, und jede kann die falsche sein.
Edwin Carberry – Der Profos braucht eine Menge Selbstbeherrschung, als er ein kleines Atoll besichtigt.
Der Kutscher – Als kluger Mann versucht er eine Erklärung für die Erscheinung einer Fata Morgana zu finden.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
1.
Die Nacht vom dreizehnten Februar 1597 begann mit wilder, stürmischer See im Arabischen Meer.
Diese nächtliche Sturmfahrt hatte böse Folgen. Als Resultat davon wurden die Trinkwasserfässer zerschlagen – und Old O’Flynn ging über Bord.
Dabei begann es ganz harmlos.
Smoky, Paddy Rogers und Old O’Flynn unterhielten sich über den „Magier“, dem sie auf den Leim gegangen waren und der sich schließlich als Sklavenhändler entpuppt hatte. Sie faselten immer noch von der „schönen fluoreszierenden gläsernen Kugel“, mit der das ganze Unheil begonnen hatte. Geendet hatte es damit, daß alle drei – und auch andere – auf einer Schebecke gelandet waren, sich später aber hatten befreien können. Den Magier hatte Old Donegal dabei über die Klinge springen lassen.
Jetzt lag Sokotra längst hinter ihnen, und die Galeone „Santa Barbara“ segelte auf Nordkurs dem arabischen Festland entgegen. Sie folgte somit jenen geheimnisvollen Seekarten, die die Zwillinge auf den Seychellen an Bord eines alten Wracks gefunden hatten.
Der Chamsin wehte aus Nordwest, von der Küste des Roten Meeres, dem ehemaligen Reich der Königin von Saba. Er stieß aus der breiten Sandebene, der Tihama, jener Wüste heran, die zu den heißesten Gebieten der Erde gehört. Er wirbelte Sand und Staub mühelos über den Hadramaut hinweg ins Arabische Meer und wühlte es auf. Dieser Wind war heiß und trocken, aber eben mit Sand und Staub und Dreck durchsetzt.
Gegen Abend hatte sich der Chamsin in ein fauchendes und brüllendes Ungeheuer verwandelt. Der Himmel war dämmrig. Verwirbelungen in Form von gewaltigen und mitunter trichterförmig zulaufenden Sandwehen türmten sich auf. In langen Staubfahnen jagten sie über das Meer und verfinsterten den Himmel.
Himmlische arabische Heerscharen jagten unter tosendem Gebrüll durch die Lüfte, wilde Reiter, die fauchend zuschlugen.
Die „Santa Barbara“ nahm das anfangs gelassen hin. Sie tanzte nur ein bißchen verspielt auf den Wellen, tauchte den Bug sanft ein, wiegte sich hin und her und seufzte dabei leise und verhalten, wenn sie ihre Glieder streckte.
„Heute kriegen wir’s wieder mal knüppeldick“, prophezeite Old O’Flynn. „An Deck bekommt man kaum noch Luft. Der verdammte Sand und Staubdreck verkleistert einem ja die Futterluke. Da sollen sich die Emirs mit dem Scheiß rumärgern. Ich enter ab und verhole mich in die Koje, wenn’s genehm ist.“
„Es ist genehm“, gestattete Smoky. „Hau dich nur auf die Matte, Donegal.“
Die riesige Gestalt Edwin Carberrys tauchte neben Smoky auf.
„Wer will hier schon wieder wen hauen?“ fragte er. Er knirschte dabei ein bißchen mit den Zähnen, der Profos, weil sich zwischen seine Beißerchen Sand geschoben hatte. Eine ganze Düne, wie er behauptete.
„Hier haut überhaupt niemand“, sagte Smoky. „Donegal will sich auf die Matte hauen, um dem Sandsturm zu entgehen.“
„Ah, so ist das“, murmelte Carberry. Er blickte in den immer finsterer werdenden Himmel, verzog das Gesicht und spie angewidert über Bord, weil er immer noch Sand zwischen den Zähnen spürte.
Smoky wischte sich demonstrativ über das Gesicht.
„Riesenferkel“, knurrte er. „Kennst du nicht mehr den alten ‚Isabella‘-Bordpsalm sieben? Wer gegen den Wind pißt, kriegt nasse Hosen. Den hat Shane aus der Taufe gehoben.“
„Weiß ich“, sagte Carberry unbeeindruckt. „Hab’ ich ja auch nicht getan. Ich werde mich hüten.“
„Dann laß gefälligst deine verdammte Spuckerei.“
„Davon kriegst du keine nassen Hosen“, versicherte Carberry. „Nur wenn du … Aber das kennst du ja. Bordpsalm sieben und so.“
Sie mußten die Gesichter nach Lee wenden, denn wieder jagte der Chamsin eine üble Sand- und Dreckwolke heran. Sie fuhr fauchend und brüllend in die Segel und überschüttete die Männer mit einem Hagel allerfeinster Sandkörnchen.
„Mistzeug, verdammtes“, knurrte Old O’Flynn verärgert. „Wenn das noch lange anhält, sitzen wir fest. Ende der Fahnenstange, die Reise ist dann beendet.“
„Weshalb sollen wir denn festsitzen?“ fragte Smoky. Er kniff die Augen zusammen und musterte Old Donegal, der sich ans Schanzkleid gelehnt hatte und im Auf und Ab der Wellen die Bewegungen der Galeone mitvollzog.
„Ist doch klar“, sagte der gallig. „Wenn noch mehr Sand ins Wasser geweht wird, wird das Meer immer dicker. Erst wie Suppe, dann wie Brabbel, danach wie Brei, und dann stecken wir in dicker Pampe und können nicht mehr vor und zurück. Aus den Wellen werden schließlich Dünen, in denen wir festsitzen.“
„Ach, du lieber Moses“, stöhnte Carberry. „Hat die Welt so was schon mal gehört? So viel Sand gibt’s gar nicht, daß damit das Meer zugeweht wird.“
„Klar gibt’s so viel Sand!“ brüllte Old O’Flynn. „Man sieht ja nur die oberste Schicht, aber darunter ist noch viel mehr.“
„Beim Wasser ist das genau so“, meinte Smoky. „Oben sieht man nur ein bißchen, aber darunter ist noch eine ganze Menge.“
„Ihr seid ja bescheuert“, sagte Carberry und tippte mit dem Finger an die Stirn. „Alle beide seid ihr bekloppt.“
„Gibt’s Wanderdünen, oder gibt’s die nicht?“ erkundigte sich Old O’Flynn hinterhältig.
„Na sicher, die gibt es schon.“
„Und sie sehen wie Wellen aus, nicht?“
„So ungefähr.“
„Nein, genauso“, giftete der Alte. „Wer sagt dir denn, daß die Wanderdünen früher nicht mal richtige Wellen waren, die nur der Sand zugeweht hat?“
„Mein Verstand sagt mir das.“
„Ha! Der hat dir schon recht üble Streiche gespielt. Frag doch den Kutscher, der wird es genau wissen.“
Immer wenn sie mit ihrem Latein am Ende waren, mußte der geplagte Kutscher herhalten, der über alles Bescheid wußte. Und dann sollte er die Probleme der anderen lösen – sehr geistreiche Probleme übrigens, die es in sich hatten.
Der Kutscher hörte sich den Stuß eine Weile schweigend an. Dann schüttelte er fassungslos den Kopf. Er zog ein bißchen das Genick ein, weil mit dem Sandsturm auch gleichzeitig die ersten kleinen Brecher überkamen.
„Der Wind weht zwar riesige Berge zusammen“, sagte er dann, „aber leider keine logischen Gedanken. Dieser Chamsin bläst durch die leeren Grotten gewisser Hirnzellen, die sich langsam wieder auffüllen, aber leider nur mit Sand, was den sogenannten Gehirnrindenverfall hervorruft. Da kann ich nur sagen: Sapientia prima stultitia caruisse.“
„Ist das schlimm?“ fragte Old Donegal verunsichert.
„Nicht unbedingt, jedenfalls nicht körperlich. Es bedeutet nur soviel wie: Aller Weisheit Beginn ist es, der Torheit ledig zu sein.“
„Und wer hat nun recht?“ wollte Old Donegal wissen. „Du legst hier immer ein paar kluge Sprüche auf Stapel, und dann verziehst du dich wieder. Gibt es jetzt Dünen, die früher mal richtige Wellen waren, oder nicht? Kann das Meer davon zugeschüttet werden?“
„Weder das eine noch das andere. Lediglich eure Hohlköpfe können zugeweht werden, wenn ihr die Mäuler so weit aufreißt.“
„Das ist doch die Höhe!“ empörte sich der Profos. „Natürlich habe ich recht, da hätten wir diesen Meisenarsch gar nicht erst zu fragen brauchen.“
„Der hat auch nicht alle Weisheit der Welt gepachtet!“ Old Donegal winkte lässig ab. „Ich weiß, daß es sich so verhält, und damit basta und paletti. Hab ich alles in meinen jungen Jahren auf der ‚Empress‘ selbst erlebt. Da sind wir im Sandsturm durchs Meer gefahren, und am anderen Morgen lagen wir in einer Oase. Mitten im Brunnen drin. Die Araber staunten nur so, als ihnen die Kokosnüsse von den Palmen fielen.“
„Da gibt’s keine Kokospalmen“, sagte Smoky, „du meinst wahrscheinlich Dattelpalmen.“
„Na ja, die Nüsse waren ziemlich klein.“
„Und wie seid ihr da wieder herausgelangt?“
„Mit der nächsten Flut. Da stand die Oase zum Glück unter Wasser. Aber unten drunter war alles voller Sand.“
„Genau wie im Meer“, meinte Smoky.
Der Profos sah dem kommentarlos davonhumpelnden Alten mit zusammengekniffenen Lippen nach.
„Glaubst du den Scheiß etwa, Smoky?“
„Na ja, man muß bei dem alten Burschen immer ein paar Abstriche machen. Manchmal übertreibt er ein wenig.“
„Davon ist kein Wort wahr!“ wetterte Carberry. „Der wollte uns nur ganz saftig verschaukeln.“
Old O’Flynn aber verholte in seine Kammer. Um den heraufziehenden Sturm scherte er sich den Teufel. So ein Stürmchen hatte ihn noch nie sonderlich gejuckt. Er ging zum Schapp und holte eine Buddel hervor, die er im Licht der flackernden Laterne erst einmal ausgiebig betrachtete. Dann schnalzte er mit der Zunge und gurgelte das kristallklare Zeug genüßlich weg.
Es handelte sich dabei um Wasser aus dem Quell der ewigen Jugend. Diesen Jungbrunnen hatten seine Enkelchen, die Zwillinge Hasard und Philip, auf den Seychellen entdeckt. Old O’Flynn hatte sich dementsprechend kräftig damit eingedeckt. Weil er felsenfest davon überzeugt war, das Zeug würde ihm seine Jugend zurückgeben, trank er Unmengen davon. Und nach jedem Schluck spürte er neue Kräfte in sich.
Ha, das war ein Wässerchen! Es schmeckte zwar schon ein wenig schal, doch das tat der Sache nicht den geringsten Abbruch. Daher spülte er auch immer mit einem kräftigen Schluck Rum nach. Das gab dann genau die richtige Würze.
Er legte sich auf die Koje, grinste zufrieden und beschloß, von Great Abaco, dem Stützpunkt, seiner Snugglemouse Mary und dem Söhnchen zu träumen, das sich inzwischen sicher schon zu einem prachtvollen Young O’Flynn entwickelt haben mußte.
Draußen heulte und pfiff der Chamsin sein grausiges Lied.
Old O’Flynn ließ ihn pfeifen und pfiff ihm selbst was. Innerhalb kurzer Zeit war er eingeschlafen.
Inzwischen ging es an Deck hoch her. Damit war allerdings keine fröhliche Stimmung gemeint.
Die „Lady Barbara“ hatte jetzt ernstlich zu kämpfen. Das Vorgeplänkel war vorbei. Jetzt taten sich langsam, aber sicher die Tore zum Vorhof der Hölle auf. Vielleicht stand sogar noch ein direkter Besuch hinter dem Vorhof bevor. Es sah ganz danach aus.
Die Lady wurde bockig, als sie gegen Wellen anknüppelte, die immer größer und wilder wurden. Sie reckte die Nase hoch aus dem Wasser, als wollte sie sich orientieren, was weiter vorne los sei.
Da war eine ganze Menge los. Schwarze, wildrollende Dünenkämme fegten heran und türmten sich auf. Mittlerweile war es pechschwarz geworden. Der Himmel war verdunkelt, es schien kein Mond, und es blinkte auch kein Sternlein.
Am Ruder standen Don Juan de Alcazar und Pete Ballie. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um das Schiff auf Kurs zu halten.
Inzwischen waren bis auf die Sturmsegel alle Tücher weggenommen und zusätzlich Mann- und Strecktaue gespannt worden, damit nicht jemand unversehens über Bord ging.
Sie hielten Nordkurs, denn weit voraus befand sich nach den Karten die arabische Küste.
„Alle Mann nach unten, die nicht unbedingt an Deck gebraucht werden“, brüllte Hasard. „Wenn Not am Mann ist, lasse ich euch schon hochpurren. Es ist unsinnig, hier an Deck herumzustehen. Wir werden ohnehin bald vor Topp und Takel lenzen müssen.“
„Ist ja wahr“, meinte Smoky. „Wir fressen nur Sand und Staub und schlucken dreckiges Salzwasser. Da gehen wir lieber ein bißchen zum Klönen nach unten. Wir lösen uns dann bald ab, damit die anderen auch mal Ruhe haben.“
„Ein vernünftiger Gedanke“, sagte Hasard. Er mußte bereits aus voller Kehle brüllen, um verstanden zu werden. Der tobende und fauchende Chamsin fetzte ihm die Worte von den Lippen, und das überkommende Wasser, das sich mit wildem Zischen über die Decks ergoß, tat ein übriges.
Viele Arwenacks gingen unter Deck. Aber da war es fast noch schlimmer als oben, denn jetzt spielte die Lady total verrückt. Sie rollte und stampfte wild in der See und mußte Breitseiten aus Wasser nehmen, die sie hart krängen ließen.
Wer sich unter Deck nicht schleunigst einen festen Halt verschaffte, der flog von einer Seite zur anderen und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten.
„Das ist kein harmloses Wüstenwindchen mehr, das ist ein ausgewachsener Orkan, der über uns wegzieht“, sagte Blacky. Er hatte sich an der Back mit Händen und Füßen so verhakt, daß die pausenlosen Roller ihn nicht umwarfen. Die anderen Arwenacks verschafften sich auf ähnliche Weise festen Halt.
An Würfeln oder Kartenspielen war unter diesen Umständen nicht zu denken. Selbst aus dem Klönen wurde nicht viel, denn hier unten toste und brüllte es ebenfalls mit vehementer Gewalt. Die Lady schien koppheister zu gehen. Genauso gebärdete sie sich.
Als der Profos einmal das Schott öffnete, um nachzusehen, fand er sich übergangslos in einer brüllenden Hölle aus Schaum und gischtendem Wasser wieder. Die Wellenberge waren nur undeutlich zu erkennen. Dafür waren sie besser zu spüren.
Auf und ab ging es in einem wahren Höllentempo. Die Lady wurde von einer Seite zur anderen geworfen. Nur ihrem hervorragenden Metazentrum war es zu verdanken, daß sie sich wieder aufrichtete und nicht kenterte.
Brecher schlugen immer wieder über ihr zusammen und überfluteten die Decks bis weit nach achtern. Der Profos sah die Hand vor den Augen nicht mehr. Als er das Schott wieder schließen wollte, donnerte es ein heranfegender Brecher mit aller Gewalt zu. Ein Schwall Salzwasser begleitete Edwin Carberry nach unten.
Die Gesichter der Mannen wurden immer besorgter. Sie lauschten auf das Krachen und Knacken, auf das Ächzen und Stöhnen der Planken und hörten den Anprall eines gigantischen Hammers, der das Schiff in Stücke zu schlagen drohte.
In der Luft war das schrille Heulen von Tausenden wilder Teufel zu hören, die sich mit aller Gewalt austobten.
Dann folgte übergangslos ein so harter Schlag, daß die Lady zur Seite geworfen wurde. Die Rahnocken schleiften durchs Wasser, die Krängung nach Backbord nahm weiter zu. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, ging auf Reisen und sauste mit ungeheurer Wucht durch die Räume.