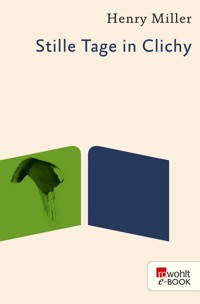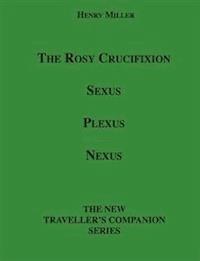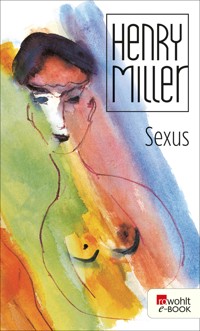
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Unbekümmert um alle moralischen und formalen Schranken und mitgerissen von der Sturzflut der Erinnerung, hat Miller in diesem «obszönsten seiner Bücher» (New York Times) ein Stück seines turbulenten Lebens aufgearbeitet: «Sexus» ist ein orgiastischer Hymnus auf die körperliche Liebe und ein befreites Leben, Zeugnis einer Aufrichtigkeit, die keine Kompromisse kennt. «Der Roman ist natürlich die schamloseste und schönste Kundmachung eines hemmungslosen, genüsslich antigesellschaftlichen Individualismus, die in diesem Jahrhundert vorgelegt wurde.» WELTWOCHE «Henry Miller: geil, obszön, diabolisch.» HAMBURGER ABENDBLATT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1003
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Henry Miller
Sexus
Roman
Deutsch von Kurt Wagenseil
Erstes Buch
1
Es muss ein Donnerstagabend gewesen sein, als ich ihr zum ersten Mal in jenem Tanzpalast begegnete. Ich ging am Morgen nach ein paar Stunden Schlaf zur Arbeit und sah aus wie ein Nachtwandler. Der Tag verging wie im Traum. Nach dem Abendessen schlief ich auf der Couch ein und erwachte, noch immer in meinen Kleidern, gegen sechs am nächsten Morgen. Ich fühlte mich erstaunlich ausgeruht, unbeschwerten Gemüts und einzig und allein von dem Gedanken besessen, dass ich sie um jeden Preis haben musste. Als ich durch den Park ging, beschäftigte mich die Überlegung, was für Blumen ich ihr mit dem Buch, das ich ihr versprochen hatte (Sherwood Andersons, ‹Winesburg, Ohio›), schenken sollte. Ich näherte mich dem dreiunddreißigsten Lebensjahr, dem Alter, in dem Christus gekreuzigt wurde. Ein ganz neues Leben lag vor mir, wenn ich nur den Mut hatte, alles zu riskieren. Aber es gab nichts zu riskieren: Ich befand mich auf der untersten Sprosse der Leiter, ein Versager in jedem Sinne des Wortes.
Es war damals ein Samstagmorgen, und für mich ist Samstag immer der beste Tag der Woche gewesen. Ich werde lebendig, wenn andere vor Müdigkeit einschlafen. Meine Woche beginnt mit dem jüdischen Ruhetag. Dass dies die große Woche meines Lebens sein würde, die sieben lange Jahre währte, ahnte ich natürlich nicht. Ich hatte nur das Gefühl, dass ein viel versprechender und ereignisreicher Tag vor mir lag. Den schicksalhaften Schritt zu tun und alles zum Teufel gehen zu lassen, hat an sich schon etwas Befreiendes: Über mögliche Folgen habe ich mir nie den Kopf zerbrochen. Sich bedingungslos der Frau auszuliefern, die man liebt, heißt, alle Fesseln abzustreifen, außer dem Verlangen, sie nicht zu verlieren – die schrecklichste aller Fesseln.
Ich verbrachte den Morgen damit, Gott und die Welt anzupumpen, schickte das Buch und die Blumen ab und setzte mich dann hin, um einen langen Brief zu schreiben, den ich durch Boten zustellen ließ. Ich schrieb, dass ich sie am Spätnachmittag anrufen würde. Um zwölf Uhr verließ ich das Büro und ging nach Hause. Ich war schrecklich ruhelos, fiebernd vor Ungeduld. Bis fünf Uhr zu warten, war eine Qual. Ich begab mich wieder in den Park. Teilnahmslos und wie blind wanderte ich über die Wiesen bis zu dem See, auf dem die Kinder ihre Boote segeln ließen. In der Ferne spielte eine Kapelle. Sie rief mir Erinnerungen an meine Kindheit ins Gedächtnis zurück, verschüttete Träume, Sehnsüchte, Gedanken der Reue. Ein leidenschaftlicher Aufruhr pulste heiß in meinen Adern. Ich dachte an gewisse große Gestalten der Vergangenheit, an alles, was sie in meinem Alter vollbracht hatten. Was immer ich erstrebt haben mochte, war bedeutungslos geworden: Ich war nur noch von dem Wunsch besessen, mich ihr völlig auszuliefern. Vor allem wollte ich ihre Stimme hören, wollte wissen, dass sie noch am Leben war, mich nicht bereits vergessen hatte. Ich wollte von nun an jeden Tag eine Münze in den Schlitz werfen können, um ihre Stimme «hallo» sagen zu hören, das und nichts anderes war das Höchste, was ich mir zu erhoffen wagte. Wenn sie bereit war, mir das zu gewähren, und es auch wirklich tat, mochte geschehen, was wolle.
Punkt fünf rief ich sie an. Eine seltsam traurige, fremdartige Stimme erklärte mir, sie sei nicht zu Hause. Ich wollte mich erkundigen, wann sie zurückkäme, aber da war die Verbindung schon unterbrochen. Der Gedanke, dass sie unerreichbar war, machte mich rasend. Ich rief meine Frau an und sagte ihr, dass ich zum Abendessen nicht nach Hause käme. Sie nahm es wie üblich angewidert zur Kenntnis, als erwarte sie ohnehin von mir nur Enttäuschungen und Vertröstungen. «Erstick dran, du Miststück», dachte ich bei mir, als ich den Hörer auflegte, «so viel steht fest: Du kannst mir tot oder lebendig gestohlen bleiben.» Ich sprang auf den nächstbesten Trolleybus, der daherkam, und ließ mich auf einen der hinteren Sitze fallen. Zwei Stunden lang fuhr ich in tiefer Trance durch die Stadt. Als ich wieder zu mir kam, hielten wir gerade vor einer arabischen Eisdiele in der Hafengegend, und ich sprang ab. Ich setzte mich dicht beim Wasser auf einen Poller und blickte zu dem summenden Stahlnetzwerk der Brooklyn-Brücke empor. Es waren noch mehrere Stunden totzuschlagen, bevor ich daran denken konnte, den Tanzpalast wieder aufzusuchen. Leeren Blickes starrte ich auf das gegenüberliegende Ufer, während meine Gedanken ziellos wie ein Schiff ohne Ruder dahintrieben.
Als ich mich schließlich aufraffte und losstolperte, kam ich mir vor wie ein Narkotisierter, dem es gelungen ist, dem Operationstisch zu entfliehen. Alles sah vertraut aus und gab doch keinen Sinn. Es dauerte Ewigkeiten, ein paar simple Eindrücke zu verarbeiten, die bei klarem Bewusstsein automatisch die Vorstellung Tisch, Stuhl, Haus, Person auslösen. Ihrer Automation beraubte Gebäude sind sogar noch trostloser als Gräber. Wenn die Maschinerie stillsteht, verbreitet sie eine Leere, die noch unheimlicher ist als der Tod. Ich war ein Gespenst, das sich in einem Vakuum bewegte. Hinsetzen, verweilen, eine Zigarette anzünden, nicht hinsetzen, nicht rauchen, denken oder nicht denken, atmen oder aufhören zu atmen – es war alles ein und dasselbe. Falle tot um, der hinter dir steigt über dich hinweg. Feuere einen Revolver ab, und ein anderer schießt auf dich. Schreie, und du weckst die Toten auf, die merkwürdigerweise auch kräftige Lungen haben. Der Verkehr geht jetzt nach Ost und West, im nächsten Augenblick wird er nach Nord und Süd gehen. Alles bewegt sich blind und gesetzmäßig fort, und niemand gelangt irgendwohin. Schlurfen und stolpern herein und heraus, hinauf und hinunter, manche scheren aus wie Fliegen, andere fallen ein wie ein Mückenschwarm. Iss im Stehen, Münzeinwurf, Hebelbedienung, fettverschmierte Fünf-Cent-Stücke, fettverschmiertes Cellophan, fettverschmierter Appetit. Wisch dir über den Mund, rülpse, stochere in den Zähnen, schieb den Hut zurück, trotte los, rutsche aus, stolpere, pfeife, knall dir eine Kugel in die Birne. Im nächsten Leben möchte ich ein Geier sein und mich von reichem Aas ernähren. Ich werde hoch oben auf den Häusern hocken und blitzschnell herabstoßen, sobald ich den Tod wittere. Jetzt pfeife ich lustig vor mich hin – in den epigastrischen Zonen herrscht Ruhe und Frieden. Hallo, Mara, wie geht’s dir? Und sie wird mir ihr rätselhaftes Lächeln schenken und mich stürmisch in ihre Arme schließen. Grelles Scheinwerferlicht wird uns inmitten der Leere in einen mystischen Kreis tauchen und uns mit drei Zentimeter Intimität umgeben.
Ich gehe die Treppe hinauf und betrete die Arena, den großen Ballsaal der käuflichen Sexadepten, den jetzt ein warmes Boudoir-Licht durchflutet. Die Phantome drehen sich in einem süßlichen Kaugummi-Dunst, Knie leicht gebeugt, Hintern gespannt, Fußknöchel im pudrigen Saphirlicht schwimmend. Zwischen Trommelschlägen höre ich unten auf der Straße die Sirene des Rettungswagens, dann die der Feuerwehr und schließlich die des Überfallkommandos. Der Walzer wird schmerzlich perforiert, kleine Schusslöcher hüpfen über die Mechanik des elektrischen Klaviers, dessen Spiel im Lärm ertrinkt, denn es steht mehrere Blocks entfernt in einem Gebäude ohne Feuerleitern. Sie ist nicht auf der Tanzfläche. Vielleicht liegt sie im Bett und liest ein Buch oder treibt es mit einem Preisboxer oder läuft wie eine Wahnsinnige über ein Stoppelfeld, hat einen Schuh verloren, den anderen noch an, von einem Mann namens Corn Cob hitzig verfolgt. Wo immer sie sein mag, ich stehe in völliger Dunkelheit – ihre Abwesenheit löscht mich aus.
Ich erkundige mich bei einem der Mädchen, ob sie weiß, wann Mara kommt. Mara? Nie von ihr gehört. Wie kann sie auch irgendetwas über irgendjemand wissen, da sie doch erst vor knapp einer Stunde ihre Arbeit hier aufgenommen hat und schwitzt wie eine Stute, die in sechs Garnituren schafwollener Unterwäsche steckt? Ob ich nicht mit ihr tanzen will – sie wird dann eines der anderen Mädchen nach dieser Mara fragen. Wir tanzen ein paar Runden, in einem Dunst von Schweiß und Rosenwasser. Das Gespräch dreht sich um Hühneraugen, entzündete Fußballen und Krampfadern. Die Musiker plieren durch den Boudoir-Nebel mit Gallertaugen, die Gesichter ein gefrorenes Grinsen. Das Mädchen dort drüben, Florrie, kann mir vielleicht etwas über meine Freundin sagen. Florrie hat einen breiten Mund und Augen wie Lapislazuli. Sie ist spröde wie eine Geranie, kommt gerade von einer Fick-Fiesta, die den ganzen Nachmittag gedauert hat. Weiß Florrie, ob Mara bald kommen wird? Sie glaubt, nicht… sie glaubt, sie wird heute Abend überhaupt nicht kommen. Wieso? Florrie glaubt, sie sei mit jemandem verabredet, am besten fragen Sie den Griechen dort drüben – der weiß alles.
Der Grieche sagt ja, Miss Mara wird kommen… ja, warten Sie nur ein bisschen. Ich warte und warte. Die Mädchen dampfen wie auf einem Schneefeld stehende schwitzende Pferde. Mitternacht. Kein Zeichen von Mara. Ich gehe langsam, widerstrebend der Tür zu. Ein junger Bursche, ein Puertoricaner, knöpft sich auf der obersten Stufe den Hosenschlitz zu.
In der Untergrundbahn prüfe ich mein Sehvermögen, lese die Reklame am anderen Ende des Wagens. Ich nehme meinen Körper ins Kreuzverhör, um festzustellen, ob ich an keinem der Gebrechen leide, deren Erbe der zivilisierte Mensch ist. Rieche ich aus dem Mund? Hämmert mein Herz? Habe ich Plattfüße? Sind meine Gelenke von Rheumatismus geschwollen? Keine Stirnhöhlenbeschwerden? Keine Paradentose? Was ist mit Verstopfung? Oder diesem Müdigkeitsgefühl nach dem Essen? Keine Migräne, kein Sodbrennen, keine Blähungen, kein Durchfall, kein Hexenschuss, keine laufende Blase, keine Hühneraugen oder entzündeten Fußballen, keine Krampfadern? Soweit ich feststellen kann, bin ich kerngesund, und doch… Mir fehlt etwas, etwas Wesentliches.
Ich bin krank vor Liebe. Todkrank. Ein paar Kopfschuppen – und ich würde krepieren wie eine vergiftete Ratte.
Mein Körper ist schwer wie Blei, als ich ins Bett falle. Ich versinke augenblicklich in die tiefste Tiefe des Traums. Dieser Körper, ein Sarkophag mit steinernen Griffen, liegt völlig bewegungslos. Der Träumende erhebt sich aus ihm wie ein Nebel und umschweift die Welt. Der Träumer versucht vergeblich, eine Form und Gestalt zu finden, die seinem ätherischen Wesen angemessen ist. Wie ein himmlischer Schneider probiert er einen Körper nach dem anderen an, aber sie passen alle nicht. Schließlich muss er in seinen eigenen Körper zurückkehren, wieder die bleierne Gussform annehmen, ein Gefangener des Fleisches werden, weitermachen in Stumpfheit, Leiden und Langeweile.
Sonntagmorgen. Ich erwache taufrisch wie ein Gänseblümchen. Die Welt liegt vor mir, unentdeckt, unbefleckt, jungfräulich wie die arktischen Zonen. Ich schlucke etwas Natron und Chlor, um die letzten bleiernen Dünste der Trägheit zu vertreiben. Ich werde geradewegs in ihre Wohnung gehen, läuten und eintreten. Hier bin ich, nimm mich – oder stich mich tot! Stich mich ins Herz, stich mich ins Hirn, stich mich in die Lunge, die Nieren, die Eingeweide, die Augen, die Ohren! Wenn nur ein Organ am Leben bleibt, bist du verloren – verdammt für immer, die Meine zu sein in dieser Welt, der nächsten und in allen kommenden Welten. Ich bin ein Desperado der Liebe, ein Skalpjäger, ein Totschläger. Ich bin unersättlich. Ich esse Haare, schmutziges Ohrenschmalz, trockene Blutklumpen, alles und jedes, was von dir stammt. Zeig mir deinen Vater mit seinen Papierdrachen, seinen Rennpferden, seinem Freibillett für die Oper: Ich werde alle in mich hineinstopfen, mit Haut und Haaren verschlingen. Wo ist der Stuhl, auf dem du sitzt, wo dein Lieblingskamm, deine Zahnbürste, deine Nagelfeile? Zeig sie her, damit ich sie auf einen Sitz verschlinge. Du hast eine Schwester, schöner als du, sagst du. Zeig sie mir – ich will ihr das Fleisch von den Knochen lecken.
Hin zum Meer, zum Marschland, wo ein kleines Haus gebaut wurde, um ein kleines Ei auszubrüten, das man, nachdem es Gestalt gewonnen hatte, Mara taufte. Dass ein dem Penis eines Mannes entschlüpfter Tropfen etwas so Überwältigendes hervorbringen konnte! Ich glaube an Gott den Vater, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, an die Heilige Jungfrau Maria, den Heiligen Geist, an Ada Cadmium, an Chromnickel, die Oxyde und Quecksilberchrome, an Wasservögel und Wasserkresse, an epileptische Anfälle, die Beulenpest, an Dewachan, an planetarische Konjunktionen, an Hühnerspuren und Speerwerfen, an Revolutionen, Aktienstürze, Kriege, Erdbeben, Zyklone, an Kali Juga und an Hula-hula. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube, weil nicht zu glauben bedeutet, dass man wie Blei wird, flach und steif daliegt, für immer untätig dahinsiecht…
Blickt man hinaus auf die Landschaft unserer Tage: Wo sind die Tiere des Feldes, die Feldfrüchte, der Dünger, die Rosen, die inmitten des Verfalls blühen? Ich sehe Eisenbahnschienen, Tankstellen, Zementblöcke, Eisenträger, hohe Schornsteine, Autofriedhöfe, Fabriken, Warenhäuser, Wohnmaschinen, unbebaute Grundstücke. Nicht einmal eine Ziege zu sehen. Ich sehe das alles klar und deutlich: Es bedeutet Trostlosigkeit, Tod, ewigen Tod. Dreißig Jahre lang habe ich das Eisenkreuz schmählicher Knechtschaft getragen, habe gedient, aber nicht geglaubt, habe gearbeitet, aber keinen Lohn empfangen, habe geruht, aber keinen Frieden gefunden. Warum sollte ich glauben, dass alles plötzlich anders wird, nur weil ich sie habe, nur weil ich liebe und geliebt werde?
Nichts wird sich ändern, nur ich werde mich ändern.
Als ich mich dem Haus nähere, sehe ich im Hinterhof eine Frau, die Wäsche aufhängt. Ihr Profil ist mir zugewandt. Es ist zweifellos das Gesicht der Frau mit der seltsamen, fremdartigen Stimme, die ich am Telefon gehört hatte. Ich will dieser Frau nicht begegnen, will nicht wissen, wer sie ist, will nicht glauben, was ich befürchte. Ich gehe um den Häuserblock herum, und als ich wieder zu der Tür komme, ist die Frau fort. Irgendwie ist auch mein Mut fort.
Zögernd drücke ich auf den Klingelknopf. Fast sofort wird die Tür aufgerissen, und die Gestalt eines großen, bedrohlich aussehenden jungen Mannes blockiert die Schwelle. Sie ist nicht da, kann nicht sagen, wann sie zurückkommt, wer sind Sie, was wollen Sie von ihr? Dann auf Wiedersehen und peng! Die Tür starrt mir ins Gesicht. Junger Mann, das werden Sie noch bitter bereuen. Eines Tages komme ich wieder mit einer Schrotflinte und schieße Ihnen die Eier weg… So also ist das! Jeder auf der Hut, jeder gewarnt, jeder auf Ausweichen und Abwimmeln abgerichtet. Miss Mara ist nie dort, wo man sie vermutet, und keiner weiß, wo man sie vermuten dürfte. Miss Mara hat sich in Luft aufgelöst: vulkanische Asche, von den Passatwinden hierhin und dorthin verweht. Niederlage und Mysterium am ersten Tag des Sabbatjahres. Trauriger Sonntag bei den Nichtjuden, den Bekannten und zufälligen Verwandten. Tod allen Christenbrüdern! Tod dem faulen Status quo!
Einige Tage vergingen ohne ein Lebenszeichen von ihr. Nachdem meine Frau schlafen gegangen war, saß ich in der Küche und schrieb endlose Briefe an sie. Wir lebten damals in einer entsetzlich ehrbaren Gegend und bewohnten Erdgeschoss und Souterrain eines trostlosen Backsteinhauses. Von Zeit zu Zeit hatte ich versucht, etwas zu schreiben, aber die trübe Stimmung, die meine Frau um sich verbreitete, war nicht zu ertragen. Nur einmal gelang es mir, ihren Bann zu brechen. Ich hatte hohes Fieber, und das seit mehreren Tagen; ich weigerte mich, einen Arzt kommen zu lassen, und lehnte jede Medizin und jede Nahrung ab. Ich lag in einem breiten Bett oben in einer Ecke des Zimmers und kämpfte gegen ein Delirium an, das einen tödlichen Ausgang zu nehmen drohte. Seit meiner Kindheit war ich nie ernstlich krank gewesen, und es war ein köstliches Erlebnis. Wenn ich zur Toilette ging, war mir, als wankte ich durch die labyrinthischen Gänge eines Ozeandampfers. In den wenigen Tagen, die das Fieber dauerte, durchlebte ich mehrere Leben. Das waren meine einzigen Ferien in der Gruft, die man «Zuhause» nennt. Der einzige andere Raum, den ich erträglich fand, war die Küche. Sie war eine Art gemütlicher Gefängniszelle – und wie ein Gefangener saß ich hier oft bis spät in die Nacht hinein und plante meine Flucht. Hier gesellte sich auch manchmal mein Freund Stanley zu mir, unkte über mein Unglück und machte jede Hoffnung mit bitteren und boshaften Sticheleien zunichte.
Hier schrieb ich die verrücktesten Briefe, die jemals zu Papier gebracht wurden. Jeder, der glaubt, vernichtet, hoffnungslos und am Ende seiner Kräfte zu sein, kann aus meinem Beispiel Mut schöpfen. Ich hatte eine kratzende Feder, eine Flasche Tinte und Papier – das waren meine einzigen Waffen. Ich schrieb alles nieder, was mir gerade einfiel, ob es Sinn hatte oder nicht. Wenn ich einen Brief eingeworfen hatte, pflegte ich nach oben zu gehen, legte mich neben meine Frau und starrte mit weit offenen Augen in die Dunkelheit, als gelte es, darin meine Zukunft zu lesen. Wenn ein Mann, so sagte ich mir wieder und wieder, wenn ein aufrichtiger und verzweifelter Mann wie ich eine Frau von ganzem Herzen liebt, wenn er bereit ist, sich die Ohren abzuschneiden und sie ihr mit der Post zu übersenden, wenn er imstande ist, sein Herzblut zu Papier zu bringen und diese Frau mit seinem Verlangen und seiner Sehnsucht zu durchdringen, und wenn er sie unablässig bestürmt, dann kann sie ihn unmöglich zurückweisen. Der unscheinbarste, der schwächste, der unwürdigste Mann muss siegen, wenn er bereit ist, seinen letzten Blutstropfen zu opfern. Keine Frau kann dem Geschenk absoluter Liebe widerstehen.
Ich ging wieder in den Tanzpalast und fand dort eine Nachricht für mich vor. Der Anblick ihrer Handschrift brachte mich völlig aus der Fassung. Ihre Mitteilung war kurz und bündig. Sie wollte mich um zwölf Uhr nachts am nächsten Tag am Times Square vor dem Drugstore treffen. Ich sollte, bitte, aufhören, ihr nach Hause zu schreiben.
Als wir uns trafen, hatte ich noch nicht einmal drei Dollar in der Tasche. Ihre Begrüßung war herzlich und unbeschwert. Keine Erwähnung meines Besuchs bei ihr zu Hause – oder der Briefe und Geschenke. Wo wollte ich gerne hingehen, fragte sie nach einigen Worten. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich vorschlagen sollte. Dass sie leibhaftig vor mir stand, mit mir sprach, mich ansah, war ein Ereignis, das ich nicht fassen konnte. «Gehen wir zu Jimmy Kelly», schlug sie vor, indem sie mir zu Hilfe kam. Sie nahm mich am Arm und ging mit mir auf ein wartendes Taxi zu. Von ihrer Gegenwart völlig überwältigt, ließ ich mich in den Rücksitz fallen. Ich machte keinen Versuch, sie zu küssen oder auch nur ihre Hand zu halten. Sie war gekommen – das war das Wesentliche. Alles andere war nebensächlich.
Wir blieben bis in die frühen Morgenstunden beisammen, aßen, tranken und tanzten. Wir redeten freimütig miteinander und verstanden uns. Ich erfuhr nicht mehr über sie, über ihr wirkliches Leben, als ich zuvor gewusst hatte, nicht etwa weil sie geheimnisvoll tat, sondern weil der Augenblick so erfüllt war und weder Vergangenheit noch Zukunft wichtig schienen.
Als die Rechnung kam, traf mich fast der Schlag.
Um Zeit zu gewinnen, bestellte ich noch etwas zu trinken. Als ich ihr gestand, dass ich nur ein paar Dollar bei mir hatte, schlug sie vor, mit einem Scheck zu bezahlen, und versicherte mir, dass man ihn ohne weiteres annehmen würde, da sie hier bekannt sei. Ich musste ihr erklären, dass ich kein Scheckbuch besaß und über nichts als mein Gehalt verfügte. Kurzum, ich deckte alle meine Karten auf.
Während ich ihr diesen traurigen Stand der Dinge beichtete, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Ich entschuldigte mich und ging zu der Telefonkabine. Ich rief das Hauptbüro der Telegraphen-Gesellschaft an und bat den Chef vom Nachtdienst, der ein Freund von mir war, mir durch Boten sofort fünfzig Dollar zu schicken. Das war eine Menge Geld, besonders da er es der Kasse entnehmen musste, und er wusste, dass nicht allzu viel Verlass auf mich war, aber ich erzählte ihm eine herzzerreißende Geschichte und versprach ihm hoch und heilig, ihm das Geld bis zum Abend zurückzugeben.
Der Bote war, wie sich herausstellte, gleichfalls ein guter Freund von mir, der alte Creighton, ein ehemaliger Prediger. Er schien ehrlich überrascht, mich zu dieser Stunde an einem solchen Ort anzutreffen. Als ich die Quittung unterschrieb, fragte er mich mit leiser Stimme, ob ich sicher sei, mit den fünfzig auszukommen. «Ich kann Ihnen auch noch etwas leihen», fügte er hinzu. «Es wäre mir ein Vergnügen, Ihnen aushelfen zu dürfen.»
«Wie viel können Sie entbehren?», fragte ich und dachte an die am Morgen vor mir liegende Aufgabe.
«Ich kann Ihnen noch weitere fünfundzwanzig geben», sagte er bereitwillig.
Ich nahm sie und dankte ihm herzlich. Ich zahlte die Rechnung, gab dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld, tauschte einen Händedruck mit dem Geschäftsführer, dem stellvertretenden Geschäftsführer, dem Rausschmeißer, dem Garderobemädchen, dem Türsteher und mit einem Bettler, der mir seine Flosse hinstreckte. Wir stiegen in ein Taxi, und als es wendete, spreizte Mara spontan die Beine und fiel über mich her. Wir fickten besinnungslos drauflos, das Taxi schwankte hin und her, unsere Zähne schlugen aufeinander, wir bissen uns in die Zunge, und der Saft floss aus ihr wie heiße Suppe. Es dämmerte bereits, und als wir über einen öffentlichen Platz auf der anderen Seite des Flusses kamen, fing ich den erstaunten Blick eines Polypen auf. «Es wird Tag, Mara», sagte ich und versuchte, mich sanft von ihr zu befreien. «Nur noch einen Augenblick!», bettelte sie, schnaufend und wild an mich geklammert – und damit entlud sie sich in einem verlängerten Orgasmus, bei dem ich dachte, sie würde mir das Glied abscheuern. Schließlich glitt sie herunter und sank in ihre Ecke, das Kleid noch immer bis über die Knie hochgeschoben. Ich beugte mich hinüber, um sie noch einmal zu umarmen, und ließ dabei meine Hand zu ihrer nassen Möse hochgleiten. Sie hing an mir wie ein Blutegel, und ihr schlüpfriger Hintern rotierte dabei in rasender Hingabe. Ich fühlte, wie der heiße Saft durch meine Finger rann. Ich hatte alle vier Finger zwischen ihren Beinen und wühlte in dem feuchten Moos, das wie elektrisiert zuckte. Sie hatte zwei, drei Orgasmen, sank dann erschöpft zurück und lächelte matt wie ein gefangenes Reh zu mir auf.
Gleich darauf holte sie ihren Spiegel hervor und begann ihr Gesicht zu pudern. Plötzlich bekam ihr Gesicht einen erschrockenen Ausdruck, und sie wandte den Kopf nach hinten. Im nächsten Augenblick kniete sie auch schon auf dem Sitz und starrte durch das Rückfenster. «Jemand folgt uns», sagte sie. «Schau nicht hinaus!» Ich fühlte mich zu schwach und zu glücklich, um mich darüber aufzuregen. Wohl etwas hysterisch, dachte ich bei mir, sagte aber nichts, beobachtete sie aufmerksam, wie sie dem Fahrer hastige, abgehackte Weisungen gab, diese oder jene Richtung einzuschlagen, schneller und schneller zu fahren. «Bitte! Bitte!», bat sie ihn, als ginge es um Leben und Tod. «Meine Dame», hörte ich ihn wie aus weiter Ferne, aus einem anderen Traumfahrzeug sagen, «ich kann nicht mehr aus der Karre herausholen… Ich habe Frau und Kind… Tut mir Leid.»
Ich nahm ihre Hand und drückte sie sanft. Sie machte eine abwehrende Geste, als wollte sie sagen: «Du weißt ja nicht… weißt ja nicht… das ist schrecklich!» Es war jetzt nicht der Moment, ihr Fragen zu stellen. Plötzlich ging mir auf, dass wir in Gefahr waren. Plötzlich konnte ich mir in meiner eigenen verrückten Art einen Vers darauf machen. Ich überlegte rasch… niemand folgt uns… das ist alles Quatsch und dummes Zeug… aber jemand ist hinter ihr her, so viel steht fest… sie hat ein Verbrechen begangen, ein schweres, und vielleicht mehr als eines… kein Wort von dem, was sie sagt, stimmt… ich bin in ein Lügengewebe verstrickt… liebe ein Ungeheuer, das herrlichste Ungeheuer, das man sich vorstellen kann… ich sollte sie jetzt, auf der Stelle, ohne ein Wort der Erklärung verlassen… sonst bin ich verloren… sie ist unergründlich, undurchdringlich… ich hätte wissen sollen, dass die einzige Frau auf der Welt, ohne die ich nicht leben kann, von Geheimnis gezeichnet ist… steig sofort aus… springe heraus… rette dich!
Ich fühlte, wie sie ihre Hand auf mein Bein legte und mich verstohlen aufrüttelte. Ihr Gesicht war entspannt, ihre weit geöffneten Augen leuchteten voller Ungeduld… «Sie sind fort», sagte sie, «nun ist alles gut.»
Nichts ist gut, dachte ich bei mir. Wir sind erst am Anfang. Mara, Mara, wohin führst du mich? Es ist schicksalhaft, ist verhängnisvoll, aber ich gehöre dir mit Leib und Seele, und du wirst mich hinführen, wohin du willst, mich bei meiner Gefängniswärterin abliefern, zerschunden, zermalmt, gebrochen. Wir sind auf ewig verdammt. Ich fühle, wie ich den Boden unter den Füßen verliere…
Nie war sie imstande, meine Gedanken zu durchdringen, weder damals noch später. Sie drang tiefer ein als in meine Gedanken: Sie las blind, als besäße sie Antennen. Sie wusste, dass es mein Schicksal war zu zerstören und dass ich auch sie am Ende zerstören würde. Sie wusste, dass sie – ganz gleich, auf welches Spiel sie aus war – in mir ihren Meister gefunden hatte. Wir waren vor dem Haus angekommen. Sie presste sich eng an mich, und so, als habe sie in sich einen Schalter, den sie beliebig andrehen konnte, richtete sie das volle weiß glühende Strahlen ihrer Liebe auf mich. Der Fahrer hatte den Wagen zum Stehen gebracht. Sie sagte ihm, er solle ein wenig weiter die Straße hinauffahren und warten. Wir standen einander gegenüber, die Hände umklammert, mit Knien, die sich berührten. Ein Feuer lief durch unsere Adern. Wir verharrten so mehrere Minuten, wie in einem uralten Ritus, die Stille nur von dem Summen des Motors unterbrochen.
«Ich rufe dich morgen an», sagte sie und beugte sich impulsiv zu einer letzten Umarmung vor. Und dann flüsterte sie mir ins Ohr: «Ich verliebe mich in den seltsamsten Menschen auf Erden. Du machst mir Angst, du bist so zärtlich. Halt mich fest… verlier nie den Glauben an mich… Mir ist fast so, als sei ich einem Gott begegnet.»
Während ich unter dem Sturm ihrer Leidenschaft erzitterte und sie umarmte, entfloh mein Geist den Fesseln der Umarmung, elektrisiert von dem winzigen Samenkorn, das sie in mich gelegt hatte. Etwas in mir, das bislang in Ketten gelegen hatte, etwas, das seit meiner Kindheit vergeblich ans Licht drängte und mich neugierig durch die Straßen hatte wandern lassen, brach sich jetzt Bahn und stieg raketengleich ins Blaue. Ein neues einzigartiges Wesen entspross mit alarmierender Geschwindigkeit meinem Kopf, diesem zwiespältigen Schädel, den ich von Geburt an mein Eigen nannte.
Nachdem ich ein, zwei Stunden geschlafen hatte, ging ich ins Büro, in dem sich bereits die Bewerber drängten. Die Telefone schrillten wie gewöhnlich. Es schien mir sinnloser denn je, dass ich mein Leben mit dem Versuch verbringen sollte, ein Dauerleck zu stopfen. Meine Vorgesetzten in der kosmokokkischen Telegraphenwelt hatten den Glauben an mich verloren – und ich den an die ganze phantastische Welt, die sie mit Drähten, Kabeln, Rollen, elektrischen Klingeln und Gott allein weiß was zusammenhielten. Das Einzige, für das ich Interesse zeigte, war der Gehaltsscheck – und der Bonus, über den so viel gesprochen wurde und der jeden Tag zu erwarten war. Ich hatte noch ein anderes, heimliches, teuflisches Interesse, nämlich meinen Groll gegen Spivak zu befriedigen, den Rationalisierungsfachmann, den man eigens aus einer anderen Stadt hatte kommen lassen, damit er mir nachspioniere. Sobald Spivak auf der Bildfläche erschien, und sei es auch im fernsten, entlegensten Stadtbüro, gab man mir einen Wink. Ganze Nächte hindurch dachte ich mir wie ein Geldschrankknacker aus, wie ich ihn zu Fall bringen und seine Entlassung herbeiführen könnte. Ich legte ein Gelübde ab, dass ich die Stellung so lange halten würde, bis ich ihn abgeschossen hatte. Es machte mir diebisches Vergnügen, ihm unter falschen Namen fingierte Botschaften zu senden, um ihn irrezuführen, ihn lächerlich zu machen und endlose Verwirrung zu stiften. Ich ließ ihm sogar von anderen Leuten Briefe schreiben, in denen ihm ein Anschlag auf sein Leben angedroht wurde. Ich veranlasste den Boten Curley, meinen Hauptkumpel, sogar dazu, ihm von Zeit zu Zeit am Telefon zu sagen, sein Haus brenne oder seine Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden – irgendetwas, womit man ihn aus der Fassung bringen oder zum Narren halten konnte. Ich hatte ein besonderes Talent für diese hinterlistige Art von Kriegführung, ein Talent, das ich seit den Tagen in dem Schneiderladen ständig weiterentwickelt hatte. Jedes Mal wenn mein Vater zu mir sagte: «Streich seinen Namen besser aus den Büchern, er zahlt ja doch nie!», legte ich das ganz so aus, wie das ein junger indianischer Krieger getan hätte, wenn der alte Häuptling ihm einen Gefangenen übergeben und gesagt hatte: «Böses Bleichgesicht, mach ihn fertig!». (Ich wusste tausend verschiedene Wege, um einem Mann die Hölle heiß zu machen, ohne dabei mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Manche Männer, die ich einfach nicht leiden mochte, plagte ich auch noch, wenn sie ihre geringfügigen Schulden längst bezahlt hatten. Ein Mann, den ich besonders verabscheute, starb an einem Schlaganfall, nachdem er einen meiner anonymen Beleidigungsbriefe erhalten hatte, der mit Katzen-, Vogel-, Hundedreck und einigen anderen Sorten von Scheiße, die wohl bekannte menschliche Spielart eingeschlossen, beschmiert war.) Spivak war daher ganz mein Fall. Ich konzentrierte meine ganze kosmokokkische Aufmerksamkeit allein darauf, ihn zu vernichten. Wenn wir uns begegneten, war ich höflich, respektvoll, scheinbar beflissen, in jeder Weise mit ihm zusammenzuarbeiten. Nie verlor ich ihm gegenüber die Geduld, obschon jedes Wort, das er sagte, mich zur Weißglut brachte. Ich tat mein Möglichstes, seiner Überheblichkeit zu schmeicheln, sein Ego aufzuwerten, sodass – wenn der Augenblick kam, die Blase aufzustechen – der Knall weit und breit zu hören sein würde.
Gegen Mittag rief Mara an. Das Gespräch musste eine Viertelstunde gedauert haben. Ich dachte schon, sie würde nie aufhängen. Sie sagte, sie habe meine Briefe noch einmal gelesen – einige oder vielmehr Teile daraus habe sie ihrer Tante vorgelesen. (Ihre Tante habe gesagt, ich müsste ein Dichter sein.) Sie sei beunruhigt wegen des Geldes, das ich mir geborgt hatte. Würde ich in der Lage sein, es ordnungsgemäß zurückzuzahlen, oder sollte sie versuchen, welches aufzutreiben? Es war seltsam, dass ich arm sein sollte – wo ich doch den reichen Mann gespielt hatte. Aber sie sei froh, dass ich arm wäre. Das nächste Mal würden wir mit dem Trolleybus irgendwohin fahren. Sie mache sich nichts aus Nachtlokalen, sie ziehe einen Spaziergang auf dem Land oder einen Bummel am Strand entlang vor. Das Buch sei wundervoll – sie habe erst heute Morgen mit dem Lesen angefangen. Warum versuchte ich eigentlich nicht, selbst zu schreiben? Sie sei überzeugt, dass ich ein großartiges Buch schreiben könnte. Sie habe Ideen für ein Buch, sie würde mir bei unserem nächsten Wiedersehen davon erzählen. Wenn ich wollte, würde sie mich mit einigen Schriftstellern bekannt machen – sie würden mir sicher nur zu gern helfen…
So schwatzte sie endlos weiter. Ich war fasziniert und gleichzeitig beunruhigt. Konnte sie das nicht alles zu Papier bringen? Aber sie schreibe selten Briefe, sagte sie. Warum – das konnte ich nicht verstehen. Ihre Beredsamkeit war erstaunlich. Sie sagte beiläufig die kompliziertesten Dinge, ließ Worte aufflammen oder glitt hinüber in eine mit Feuerwerk gepfefferte parenthetische Vorhölle – bewundernswerte sprachliche Glanzleistungen, um die sich ein erfahrener Schriftsteller vielleicht stundenlang mühen müsste. Und doch waren ihre Briefe – ich erinnere mich noch an den Schock, den ich bekam, als ich den ersten öffnete – fast kindlich.
Ihre Worte brachten jedoch eine unerwartete Wirkung zustande. Statt an diesem Abend sofort nach dem Essen aus dem Haus zu laufen, wie ich es gewöhnlich tat, lag ich auf der Couch im Dunkeln und sank in tiefe Träumerei. «Warum versuchst du nicht, selbst zu schreiben?» Das war der Satz, der mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf wollte und der immer wieder abrollte, sogar als ich meinem Freund MacGregor für die Zehn-Dollar-Note dankte, die ich ihm nach den demütigendsten Verrenkungen und Schmeicheleien abgerungen hatte.
So im Dunkeln liegend, dachte ich über mein bisheriges Leben nach und verfolgte seinen Weg zurück bis zu den Ursprüngen. Ich dachte an die so glückliche Zeit meiner Kindheit, die langen Sommertage, wenn ich an der Hand meiner Mutter über die Felder ging zu meinen kleinen Freunden Joey und Tony. Als Kind kann man unmöglich das Geheimnis der Freude erfassen, die aus einem Gefühl der Überlegenheit entsteht. Dieses doch außerordentliche Gefühl, das einen befähigt, sich aktiv zu beteiligen und sich gleichzeitig dabei zu beobachten, schien mir die natürlichste Gabe der Welt. Es war mir nicht bewusst, dass ich alles mehr genoss als andere Jungen meines Alters. Der Unterschied zwischen mir und den anderen ging mir erst auf, als ich älter wurde.
Schreiben, so überlegte ich, muss ein vom Willen unabhängiger Vorgang sein. Das Wort muss wie eine tiefe Meeresströmung aus eigenem Impuls zur Oberfläche aufsteigen. Ein Kind hat nicht das Bedürfnis zu schreiben, es ist unschuldig. Ein Mann schreibt, um das Gift loszuwerden, das sich bei ihm aufgrund seiner verfehlten Lebensweise angestaut hat. Er versucht seine Unschuld wiederzugewinnen, aber er erreicht (mit seinem Schreiben) nur, dass er die Welt mit dem Virus seiner Desillusion infiziert. Kein Mensch brächte ein Wort zu Papier, wenn er den Mut hätte, seiner Überzeugung entsprechend zu leben. Seine Inspiration wird schon an der Quelle abgelenkt. Wenn er das Verlangen hat, eine wahre, schöne und magische Welt zu schaffen, warum legt er dann Millionen Worte zwischen sich und die Realität einer solchen Welt? Warum zögert er zu handeln – es sei denn, er strebe wie andere Menschen auch nur nach Macht, Ruhm und Erfolg. «Bücher sind tote menschliche Handlungen», sagte Balzac. Doch obschon er die Wahrheit erkannte, opferte er bewusst den Engel dem Dämon, von dem er besessen war.
Ein Schriftsteller buhlt auf ebenso schmähliche Weise wie ein Politiker oder sonst ein Scharlatan um sein Publikum. Er liebt es, genau wie der Arzt die Hand am Puls zu haben, Rezepte zu verschreiben, er möchte eine Position einnehmen, anerkannt werden, den vollen Becher billiger Bewunderung bis zur Neige leeren, selbst wenn er tausend Jahre darauf warten muss. Er will keine neue Welt, die sofort errichtet werden könnte, denn er weiß, dass er sich in ihr nicht wohl fühlen würde. Er will eine unmögliche Welt, in der er ein ungekrönter Marionettenkönig ist, beherrscht von Kräften, die jenseits seiner Kontrolle liegen. Er ist es zufrieden, im Verborgenen – in der fiktiven Welt der Symbole – zu herrschen, denn schon der bloße Gedanke einer Berührung mit der schroffen und brutalen Wirklichkeit erschreckt ihn. Wohl erfasst er die Wirklichkeit besser als andere Menschen, aber er macht keine Anstrengung, der Welt diese höhere Wirklichkeit kraft eigenen Beispiels aufzuzwingen. Er begnügt sich damit, zu predigen, sich im Strudel von Desastern und Katastrophen weiterzuschleppen, ein krächzend den Tod verkündender Prophet, stets ohne Ehre, stets gesteinigt, stets gemieden von denen, die – wie ungeeignet sie für ihre Aufgabe auch sein mögen – immer bereit und willens sind, die Verantwortung für die Angelegenheiten der Welt zu übernehmen. Der wahrhaft große Schriftsteller will im Grunde nicht schreiben: Für ihn soll die Welt ein Ort sein, wo er seinen Phantasien leben kann. Das erste bebende Wort, das er zu Papier bringt, ist das Wort des verwundeten Engels: Schmerz. Der Prozess des Schreibens kommt dem Einnehmen von Rauschgift gleich. Wenn er beobachtet, wie das Werk unter seinen Händen wächst, überfällt ihn der Größenwahn. «Auch ich bin ein Eroberer – vielleicht der größte von allen! Mein Tag wird kommen. Ich werde mir die Welt untertan machen – durch die Magie der Worte…» Et cetera ad nausiam.
Der kleine Satz – Warum versuchst du nicht, selbst zu schreiben? – zog mich wie eh und je in den Sumpf einer hoffnungslosen Verwirrung. Ich wollte die Menschen bezaubern, nicht sie mir untertan machen. Ich wollte ein größeres, reicheres Leben, aber nicht auf Kosten anderer. Ich wollte den schöpferischen Geist aller Menschen auf einmal befreien, denn ohne die Unterstützung der ganzen Welt, ohne eine in der Phantasie geeinte Welt wird die Freiheit des schöpferischen Geistes zum Laster. Ich hatte nicht mehr Achtung für das Schreiben per se als für Gott per se. Niemand, kein Prinzip, keine Idee hat an sich Gültigkeit. Gültig ist nur so viel – von allem, Gott eingeschlossen – wie das, was von allen Menschen gemeinsam realisiert wird. Die Leute machen sich immer Sorgen um das Schicksal des Genies. Ich habe mir nie Sorgen um das Schicksal des Genies gemacht: Der Genius kümmert sich um das Genie in einem Menschen. Meine Sorge galt immer dem Niemand – dem Menschen, der in dem ganzen Schwindel verloren ist, dem Menschen, der so gewöhnlich, so alltäglich ist, dass man seine Gegenwart nicht einmal beachtet. Ein Genie inspiriert kein anderes. Alle Genies sind sozusagen Blutegel. Sie nähren sich aus derselben Quelle – dem Lebensblut. Das Wichtigste für das Genie ist, sich überflüssig zu machen, absorbiert zu werden von dem gemeinsamen Strom, wieder ein Fisch zu werden und nicht bloß eine Laune der Natur. Der einzige Vorteil, so überlegte ich, den das Schreiben mir bieten konnte, war, dass es die Unterschiede, die mich von meinem Mitmenschen trennten, forträumte. Ich wollte bestimmt nicht ein Künstler in dem Sinne werden, dass ich mich in ein ungewöhnliches, besonderes Wesen verwandelte, das außerhalb des Lebensstroms existierte.
Das Beste am Schreiben ist nicht die eigentliche Arbeit, Wort an Wort zu reihen, Ziegelstein auf Ziegelstein zu setzen, sondern die Vorarbeit, die Vorbereitungen, die, unter welchen Umständen auch immer, sei es im Traum, sei es im Wachzustand, schweigend getan werden. Kurzum, die Zeitspanne der Schwangerschaft. Kein Mensch schreibt jemals nieder, was er zu sagen beabsichtigte: Der eigentliche Schöpfungsvorgang, der die ganze Zeit andauert, ob man nun schreibt oder nicht schreibt, ist Teil des elementaren Fließens: Er hat keine Dimensionen, keine Form, nichts Zeitliches. In diesem Vorbereitungsstadium, das Schöpfung ist und nicht Geburt, fällt das, was sich verflüchtigt, nicht der Vernichtung anheim. Etwas, das bereits da war, etwas Unvergängliches wie Erinnerung oder Materie oder Gott wird heraufbeschworen, und dahinein wirft man sich wie einen Zweig in einen reißenden Strom. Worte, Sentenzen, Ideen, gleichviel wie subtil oder einfallsreich, die wahnwitzigsten Gedankenflüge der Dichtung, die tiefsten Träume, die halluzinierendsten Visionen sind nur rohe, in Leid und Trauer gemeißelte Hieroglyphen, die ein Ereignis verewigen wollen, das sich nicht übermitteln lässt. In einer klug geordneten Welt wäre es nicht nötig, den unvernünftigen Versuch zu machen, solche wundersamen Geschehnisse festzuhalten. Es hätte gar keinen Sinn, denn wenn die Menschen nur innehielten, um sich dessen bewusst zu werden, wer wäre mit der Nachahmung zufrieden, wenn das Echte auf jedermanns Wink zur Verfügung steht? Wer würde das Radio anstellen und beispielsweise Beethoven hören wollen, wenn er selbst die ekstatischen Harmonien erleben könnte, die Beethoven sich so verzweifelt aufzuzeichnen bemühte? Ein großes Kunstwerk, wenn es wirklich etwas zu sagen hat, dient dazu, uns an alles, was transzendental und nicht im Materiellen verhaftet ist, zu erinnern oder uns zumindest davon träumen zu lassen. Nämlich vom Universum. Man kann es nicht verstehen, man kann es nur akzeptieren oder verwerfen. Akzeptiert man es, so wachsen uns neue Kräfte zu; verwirft man es, verlieren wir an Kraft. Was immer es vorgibt zu sein, ist es nicht: Es ist immer etwas mehr, worüber das letzte Wort nie gesagt werden wird. Es ist alles, was wir in es hineinlegen – aus Verlangen nach dem, was wir an jedem Tag unseres Lebens verleugnen. Wenn wir uns selbst vollkommen akzeptierten, dann würde das Kunstwerk, ja die ganze Welt der Kunst, vor Unterernährung verkümmern. Jeder von uns bewegt sich mindestens einige Stunden am Tag, ohne die Füße zu regen, mit geschlossenen Augen und ausgestrecktem Körper. Die Kunst, im Wachzustand zu träumen, wird eines Tages von jedermann beherrscht werden. Und schon lange vorher werden Bücher aussterben – denn wenn die Menschen hellwach sind und träumen, werden ihre Kommunikationsfähigkeiten (untereinander und mit dem Geist, der alle bewegt) so vervollkommnet sein, dass ihnen jede Schriftstellerei wie das misstönende und heisere Gekreisch eines Idioten erscheint.
Ich durchdenke und weiß dies alles, während ich im Dunkel der Erinnerung eines Sommertages daliege, ohne die Kunst der primitivsten Hieroglyphe gemeistert oder auch nur den zaghaften Versuch gemacht zu haben, sie zu meistern. Bevor ich selbst auch nur einen Anfang damit mache, bin ich schon angewidert von den Bemühungen der anerkannten Meister. Ohne die Fähigkeit oder das Wissen zu besitzen, um auch nur eine Pforte in die Fassade des großen Bauwerks einzufügen, kritisiere und beklage ich die Baukunst selbst. Wäre ich nur ein kleiner Ziegel in der riesigen Kathedrale mit dieser antiquierten Fassade, so wäre ich unendlich glücklicher. Ich besäße Leben – das Leben des ganzen Bauwerks, wenn auch nur als ein winziger Teil von ihm. Aber ich stehe draußen, ein Barbar, der nicht einmal einen Rohentwurf, geschweige denn einen Plan von dem Gebäude zu zeichnen vermag, das er zu bewohnen träumt. Ich erträume mir eine neue, strahlend herrliche Welt, die zusammenbricht, sobald das Licht angedreht wird. Eine Welt, die entschwindet, aber nicht stirbt, denn ich brauche nur wieder unbeweglich zu werden und mit weit geöffneten Augen in die Dunkelheit zu starren – und sie erscheint wieder… Dann ist in mir eine Welt, die sich mit keiner mir bekannten Welt vergleichen lässt. Ich glaube nicht, dass sie ausschließlich mir gehört – ausschließlich ist nur mein Gesichtswinkel, insofern, als er einmalig ist. Wenn ich die Sprache meiner einmaligen Betrachtungsweise spreche, versteht mich niemand. Das gewaltigste Gebäude kann errichtet werden und doch unsichtbar bleiben. Der Gedanke daran verfolgt mich. Wozu einen unsichtbaren Tempel errichten?
Sich dem Fließen überlassen – dieses kleinen Satzes wegen. Das waren die Gedanken, denen ich mich hingab, wann immer das Wort «schreiben» aufkam. In zehn Jahren sporadischer Bemühungen hatte ich es fertig gebracht, etwa eine Million Worte zu schreiben. Man könnte ebenso gut sagen: eine Million Grashalme. Es war demütigend, auf diesen verwilderten Rasen aufmerksam zu machen. Alle meine Freunde wussten, dass es mich juckte zu schreiben. Dieses Jucken war es, das mich hin und wieder zu einem guten Gesellschafter machte. Ed Gavarni zum Beispiel, der Priester werden wollte, pflegte eigens für mich bei sich zu Hause kleine Treffen zu veranstalten, damit ich mich in der Öffentlichkeit kratzen konnte und so den Abend zu etwas wie einem Ereignis machte. Um sein Interesse an der edlen Kunst unter Beweis zu stellen, besuchte er mich von Zeit zu Zeit; dabei brachte er Sandwiches, Äpfel und Bier mit. Manchmal hatte er die Tasche voll Zigarren. Ich sollte mir den Bauch voll schlagen und Wörter hervorsprudeln. Wenn er nur einen Funken Talent gehabt hätte, wäre er nicht im Traum darauf verfallen, Priester zu werden… Dann war da Zabrowskie, die Telegraphisten-Kanone der Kosmodämonischen Telegraphen-Gesellschaft von Nordamerika: Er untersuchte immer meine Schuhe, meinen Hut, meinen Mantel, um zu sehen, ob sie in gutem Zustand waren. Er hatte keine Zeit zum Lesen, und er interessierte sich auch nicht dafür, was ich schrieb, und er glaubte nicht, dass ich es jemals damit zu etwas bringen würde, aber er hörte gerne davon. Er interessierte sich für Pferde, besonders für solche, die sich auf schlammig weicher Strecke bewährten. Mir zuzuhören, war für ihn eine harmlose Zerstreuung und ihm den Preis eines guten Mittagessens oder notfalls eines neuen Hutes wert. Es reizte mich, ihm Geschichten zu erzählen, denn es war, als spreche man mit dem Mann im Mond. Er konnte die feinsinnigsten Exkurse mit der Frage unterbrechen, ob ich lieber Erdbeertorte oder Quark zum Nachtisch haben wollte… Und dann war da Costigan, der Schlagringschwinger von Yorkville – eine andere gute Stütze und so sensibel wie eine alte Sau. Er kannte einmal einen Unterarbeiter von der Polizeigazette – das machte ihn würdig, die Gesellschaft der Auserwählten zu suchen. Er wusste Geschichten zu erzählen – Geschichten, die sich verkaufen ließen, wenn ich nur von meinem Piedestal herunterkommen und ihm ein Ohr leihen wollte. Costigan zog mich auf seltsame Weise an. Er wirkte ausgesprochen träge, eine pickelgesichtige alte Sau, über und über mit Borsten bedeckt. Er war so sanft, so zärtlich, dass man, hätte er sich als Frau verkleidet, nie auf den Gedanken gekommen wäre, er könne einen Burschen an die Wand drücken und ihm mit der Faust das Hirn aus dem Schädel hämmern. Er gehörte zu jenen hartgesottenen Burschen, die mit Fistelstimme singen und imstande sind, für eine Beerdigung eine beachtliche Kranzspende zusammenzubringen. In der Telegraphen-Gesellschaft galt er als ruhiger, verlässlicher Angestellter, dem das Interesse der Firma am Herzen lag. In seiner Freizeit war er eine Heimsuchung, Schreck und Geißel der Nachbarschaft. Er hatte eine Frau, die mit Mädchennamen Tillie Jupiter hieß, sie war wie ein Kaktus gebaut und gab reichlich dicke Milch. Ein Abend mit den beiden setzte meinen Geist in Bewegung wie ein vergifteter Pfeil.
Von solchen Freunden und Helfern in der Not muss ich an die fünfzig gehabt haben. In der ganzen Sippschaft gab es drei oder vier, die ein leises Verständnis für das hatten, was ich zu tun versuchte. Der eine, ein Komponist namens Larry Hunt, lebte in einer kleinen Stadt in Minnesota. Wir hatten ihm einmal ein Zimmer vermietet, und er hatte sich prompt in meine Frau verliebt – weil ich sie so schmählich behandelte. Aber mich hatte er sogar noch lieber als meine Frau, und so begann, nachdem er in sein Kaff zurückgekehrt war, ein Briefwechsel, der bald einen ziemlichen Umfang annahm. Er hatte gerade geschrieben, dass er zu einem kurzen Besuch nach New York käme. Ich hoffte, bei dieser Gelegenheit würde er mir meine Frau abnehmen. Vor Jahren, als unsere unselige Affäre gerade ihren Anfang genommen hatte, machte ich den Versuch, sie ihrem alten Verehrer, einem jungen Mann namens Ronald, der nördlich von New York wohnte, anzudrehen. Ronald war auch gekommen und hatte sie um ihre Hand gebeten. Ich verwende diese hochtrabende Phrase, weil er zu den Männern gehörte, die so etwas sagen können, ohne lächerlich zu wirken. Wir drei trafen uns also und aßen in einem französischen Restaurant gemeinsam zu Abend. An der Art, wie er Maude ansah, erkannte ich, dass er mehr für sie übrig und mehr mit ihr gemeinsam hatte, als das bei mir je der Fall sein würde. Ich hatte ihn schrecklich gern. Er war ein anständiger Kerl, ehrlich bis auf die Knochen, gütig, aufmerksam, der Typ, der sozusagen einen guten Ehemann abgibt. Außerdem wartete er schon seit vielen Jahren auf sie, was sie vergessen hatte, sonst hätte sie nie etwas mit einem Taugenichts wie mir angefangen, von dem sie nichts Gutes zu erwarten hatte… Etwas Seltsames geschah an jenem Abend – etwas, das sie mir nie verzeihen würde, falls sie es je erfahren sollte. Statt sie nach Hause zu bringen, begleitete ich ihren alten Verehrer in sein Hotel. Die ganze Nacht versuchte ich ihm einzureden, dass er der bessere Partner sei. Ich erzählte ihm alle möglichen hässlichen Dinge über mich – Dinge, die ich ihr und anderen angetan hätte, und ich bat und drang in ihn, er solle seine Rechte bei ihr geltend machen. Ich ging sogar so weit zu behaupten, ich wüsste, dass sie ihn liebe, sie habe es mir gegenüber zugegeben. «Sie hat mich nur genommen, weil ich zufällig gerade in greifbarer Nähe war», beteuerte ich. «In Wirklichkeit wartet sie nur darauf, dass Sie etwas unternehmen. Nehmen Sie doch Ihre Chance wahr.» Aber nein, er wollte nichts davon hören. Wir waren wie Gaston und Alphonse in der Comic-Serie. Lächerlich, pathetisch, völlig irreal. Es war eine Groteske, wie man sie noch manchmal im Film zu sehen bekommt und für die das Publikum gern sein Geld ausgibt. Jedenfalls wusste ich, wenn ich an Larry Hunts bevorstehenden Besuch dachte, dass ich es diesmal mit einer anderen Masche versuchen musste. Meine einzige Angst war, er könnte in der Zwischenzeit eine andere Frau gefunden haben. Es wäre mir nicht leicht gefallen, ihm das zu verzeihen.
Es gab einen Ort – den einzigen Ort in New York–, wo ich gerne hinging, besonders wenn ich gehobener Stimmung war, und das war das Atelier meines Freundes Ulric. Ulric war ein geiler Bock. Durch seinen Beruf kam er mit allerlei Striptease-Dohlen, Schwanz-Anheizerinnen und allen möglichen Sorten sexuell verquerer Weiber zusammen. Lieber als die berückend schönen Glamour-Schwäne, die zu ihm kamen, um sich auszuziehen, mochte ich die farbigen Mädchen, die er häufig zu wechseln schien. Es war nicht leicht, sie dazu zu bewegen, dass sie uns Modell standen. Noch schwieriger war es, sie dahin zu bringen, dass sie ein Bein über eine Armlehne legten und ein wenig lachsfarbenes Fleisch zur Schau stellten. Ulric konnte sich nicht genug tun, wollüstige Anregungen zu geben, immer dachte er sich Möglichkeiten aus, um seinen Pinsel anzusetzen, wie er sich ausdrückte. Es war für ihn eine Ablenkung von dem langweiligen Quatsch, den man ihm in Auftrag gegeben hatte. (Er wurde hoch bezahlt dafür, dass er schöne Suppenbüchsen oder Maiskolben für die Rückseiten von Zeitschriften malte.) Er hätte viel lieber Mösen gemalt – üppige, saftige Mösen, mit denen man die Badezimmerwände hätte tapezieren können, um so ein wohliges, angenehmes Gefühl in den unteren Eingeweiden zu erzeugen. Er hätte sie umsonst gemalt, wenn irgendwer für Essen und Kleingeld gesorgt hätte. Wie ich eben schon gesagt habe, hatte er eine besondere Vorliebe für schwarzes Fleisch. Wenn er das Modell schließlich in eine ausgefallene Stellung gebracht hatte – wie es sich herunterbückte, um eine Haarnadel aufzuheben, oder auf eine Leiter stieg, um einen Fleck an der Wand abzuwischen–, wurde mir Zeichenblock und Bleistift in die Hand gedrückt und ein besonders günstiger Blickwinkel empfohlen, aus dem heraus ich – unter dem Vorwand, eine menschliche Gestalt zu zeichnen (was über meine Fähigkeiten hinausging) – meine Augen an den mir dargebotenen anatomischen Teilen weiden konnte, während ich das Papier mit Vogelkäfigen, Schachbrettmustern, Ananasfrüchten und Hühnerspuren bedeckte. Nach einer kurzen Ruhepause halfen wir dem Modell mit viel Getue, wieder seine ursprüngliche Stellung einzunehmen. Dazu bedurfte es mancher delikater Manöver. So mussten beispielsweise die Hinterbacken ein wenig nach oben oder auch nach unten verschoben, ein Fuß ein wenig höher gestellt, die Beine etwas mehr gespreizt werden und so weiter. «Ich glaube, jetzt hätten wir’s, Lucy», höre ich ihn noch sagen, wenn er sie geschickt in eine obszöne Stellung hineinmanövriert hatte. «Kannst du so stehen bleiben, Lucy?» Und Lucy gab ein Niggergewimmer von sich, das bedeutete, dass sie ganz stillhalten wollte. «Wir werden dich nicht lange quälen, Lucy», setzte er dann hinzu und gab mir heimlich einen Wink. «Beobachte die Longitudinalvagination», forderte er mich auf, in einer hochgestochenen Ausdrucksweise, der Lucy mit ihren Kaninchenohren unmöglich folgen konnte. Worte wie «Vagination» waren ein angenehmes, zauberhaftes Wortgeklingel in Lucys Ohren. Als sie uns eines Tages auf der Straße begegnete, hörte ich, wie sie ihn fragte: «Keine Vaginationsübungen heute, Mr.Ulric?»
Ich hatte mit Ulric mehr gemeinsam als mit irgendeinem anderen meiner Freunde. Für mich verkörperte er Europa, seinen mildernden, zivilisierenden Einfluss. Stundenlang unterhielten wir uns über diese andere Welt, in der die Kunst eine Beziehung zum Leben hatte, wo man still in der Öffentlichkeit dasitzen, das sich bietende Schauspiel betrachten und seinen Gedanken nachhängen konnte. Würde ich jemals dorthin gelangen? Würde es nicht zu spät sein? Wovon sollte ich leben? Welche Sprache würde ich sprechen? Wenn ich es mir realistisch überlegte, schien es hoffnungslos. Nur kühne, abenteuerlustige Geister vermochten solche Träume zu verwirklichen. Ulric hatte es – für ein Jahr – durch harte Opfer zuwege gebracht. Zehn Jahre lang hatte er Dinge getan, die ihm ein Gräuel waren, um seinen Traum zu verwirklichen. Jetzt waren die Träume zu Ende, und er war wieder dort angelangt, wo er angefangen hatte. Tatsächlich war er noch schlimmer dran als früher, denn nie wieder würde er sich der Tretmühle anpassen können. Für Ulric war es ein Studienaufenthalt gewesen – ein Traum, der sich im Laufe der Jahre in Galle und Wermut verwandelte. Ich hätte nie wie Ulric handeln können. Ich könnte nie ein solches Opfer bringen, auch könnte ich mich nie mit einem bloßen Abstecher dorthin zufrieden geben, wie lang oder kurz er auch sein mochte. Es war schon immer meine Taktik, die Brücken hinter mir abzubrechen. Mein Gesicht ist stets der Zukunft zugewandt. Wenn ich einen Fehler mache, ist er verhängnisvoll. Werde ich zurückgeworfen, so falle ich bis zum Ausgangspunkt zurück. Mein einziger Schutz ist meine Elastizität. Bis jetzt bin ich immer zurückgeschnellt. Manchmal hat der Rückprall einer Zeitlupenbewegung geglichen, aber in den Augen Gottes hat Schnelligkeit keine besondere Bedeutung.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich in Ulrics Atelier mein erstes Buch beendete – das Buch über die zwölf Telegraphenboten. Ich pflegte im Zimmer seines Bruders zu arbeiten, und dort erklärte mir vor einiger Zeit kaltblütig ein Zeitschriften-Redakteur, nachdem er einige Seiten von einer unfertigen Geschichte gelesen hatte, ich verfügte über keinen Funken Talent, hätte keine blasse Ahnung vom Schreiben – kurzum, ich sei eine vollständige Niete, und das Beste, mein Lieber, ist, nicht mehr daran zu denken und zu versuchen, sich auf ehrliche Art und Weise sein Brot zu verdienen. Ein anderer Einfaltspinsel, der Verfasser eines sehr erfolgreichen Buches über Jesus, den Zimmermann, hatte mir dasselbe gesagt. Und wenn Ablehnungsschreiben etwas zu besagen haben, so bestätigten sie ganz schlicht die Kritik dieser scharfsinnigen Geister. «Wer sind schon diese Scheißer?», pflegte ich zu Ulric zu sagen. «Was gibt ihnen das Recht, mir solche Dinge an den Kopf zu werfen? Was haben sie schon anderes geleistet und bewiesen, als dass sie sich aufs Geldverdienen verstehen?»
Aber kommen wir auf meine kleinen Freunde Joey und Tony zurück. Ich lag im Dunkeln – ein kleiner Zweig, der in der Strömung japanischer Gewässer trieb. Ich kehrte zurück zu dem einfachen Abrakadabra, dem Stroh, aus dem Ziegel gemacht werden, der rohen Skizze, dem Tempel, der Fleisch und Blut annehmen und sich aller Welt kundtun musste. Ich stand auf und zündete ein mildes Licht an. Ich fühlte mich ruhig und klar, wie eine sich öffnende Lotosblume. Kein heftiges Auf-und-ab-Gehen, kein Haareausraufen. Langsam sank ich auf einen Stuhl am Tisch und begann mit einem Bleistift zu schreiben. In einfachen Worten beschrieb ich, was für ein Gefühl es war, an der Hand meiner Mutter über die sonnenbeschienenen Felder zu stapfen, was ich empfand, als Joey und Tony mir mit ausgebreiteten Armen freudestrahlend entgegenliefen. Ich setzte Ziegel auf Ziegel wie ein ehrlicher Maurer. Etwas Vertikales entstand – keine hochschießenden Grashalme, sondern etwas Strukturelles, etwas Geplantes. Ich tat mir keine Gewalt an, es zu vollenden. Ich hörte auf, als ich alles, was ich zu sagen hatte, gesagt hatte. Ruhig überlas ich noch einmal, was ich geschrieben hatte. Ich war so bewegt, dass mir die Tränen kamen. Es war nichts, was man einem Redakteur oder Lektor hätte zeigen können – es war etwas für die Schublade, wo man es aufbewahrte als Erinnerung an einen naturbedingten, Erfüllung verheißenden Prozess.
Jeden Tag töten wir unsere besten Impulse ab. Darum tut uns das Herz weh, wenn wir die von der Hand eines Meisters geschriebenen Zeilen lesen und in ihnen unsere eigenen erkennen, jene zarten Schösslinge, die wir erstickten, weil uns der Glaube an unsere eigenen Kräfte, an unser eigenes Kriterium von Wahrheit und Schönheit fehlte. Wenn ein Mensch in sich geht, wenn er verzweifelt ehrlich mit sich selbst wird, ist er imstande, tiefe Wahrheiten auszusprechen. Wir alle entspringen der gleichen Quelle. Am Ursprung der Dinge ist nichts Geheimnisvolles. Wir sind alle Teil der Schöpfung – alle Könige, alle Dichter, alle Musiker. Wir brauchen uns nur zu öffnen, nur zu entdecken, was bereits da ist.
Was mir geschah, als ich über Joey und Tony schrieb, kam einer Offenbarung gleich. Mir wurde offenbart, dass ich das ausdrücken konnte, was ich sagen wollte – wenn ich an nichts anderes dachte und mich ausschließlich darauf konzentrierte – und wenn ich willens war, die Folgen auf mich zu nehmen, die eine reine Tat immer in sich birgt.
2
Zwei oder drei Tage später traf ich Mara zum ersten Mal bei hellem Tageslicht. Ich wartete auf sie im Long-Island-Bahnhof drüben in Brooklyn. Es war gegen sechs Uhr nachmittags (Sommerzeit), die seltsame, sonnenbeleuchtete Zeit des Hauptverkehrs, die sogar in eine so düstere Gruft wie den Wartesaal der Long-Island-Bahn Leben bringt. Ich stand bei der Tür, als ich sie die unter der Hochbahn liegenden Schienen überqueren sah. Das Sonnenlicht drang in pudrig-goldenen Lichtspeeren durch die hässlichen Eisenverstrebungen. Sie trug ein Kleid aus getupftem Schweizer Musselin, das ihre volle Figur noch üppiger erscheinen ließ. Der Wind blies leicht durch ihr glänzendes schwarzes Haar, ließ es über ihr volles kalkweißes Gesicht sprühen wie Gischt gegen eine Klippe. Ich spürte, wie in diesem geschmeidig schnellen, so sicheren und flinken Schritt das Tier mit blumenhafter Grazie und zerbrechlicher Schönheit durch das Fleisch an die Oberfläche drängte. Das war ihr Tages-Ich, ein frisches, gesundes Wesen, das sich mit äußerster Einfachheit kleidete und fast wie ein Kind sprach.
Wir hatten beschlossen, den Abend am Strand zu verbringen. Ich fürchtete, es würde ihr in diesem leichten Kleid zu kalt werden, aber sie beteuerte, ihr sei nie kalt. Wir waren so schrecklich glücklich, dass die Worte nur so aus uns hervorsprudelten. Wir hatten uns im Abteil des Wagenführers aneinander gedrängt, unsere Gesichter berührten sich fast und erglühten unter den brennenden Strahlen der untergehenden Sonne. Wie verschieden war diese Fahrt über die Dächer von der einsamen, beklemmenden Fahrt an jenem Sonntagvormittag, als ich zu ihrer Wohnung fuhr! War es denkbar, dass die Welt sich innerhalb so kurzer Zeit so verändern konnte?
Diese brennende, im Westen versinkende Sonne – welch ein Symbol der Freude und Wärme! Sie entflammte unsere Herzen, erleuchtete unsere Gedanken, magnetisierte unsere Seelen. Ihre Wärme würde bis tief in die Nacht währen, würde hinter den Rundungen des Horizonts, der Nacht zum Trotz, wieder hervorkommen. In diesem lodernden Lichtschein übergab ich ihr das Manuskript zum Lesen. Ich hätte keinen geeigneteren Augenblick, keine geneigtere Kritikerin wählen können. Es war in Dunkelheit empfangen worden und wurde im Licht getauft. Während ich ihr Gesicht beobachtete, durchflutete mich ein so starkes, erhebendes Gefühl, dass mir zumute war, als habe ich ihr eine Botschaft des Schöpfers selbst ausgehändigt. Es bedurfte nicht mehr ihres Urteils, ich konnte es von ihrem Gesicht ablesen. Jahrelang bewahrte ich diese kostbare Erinnerung und ließ sie wiederaufleben in jenen düsteren Augenblicken, als ich mit allen gebrochen hatte und in einer fremden Stadt in einer einsamen Dachstube hin und her ging, die frisch geschriebenen Seiten las und verzweifelt versuchte, mir diesen Ausdruck uneingeschränkter Liebe und Bewunderung auf den Gesichtern aller meiner künftigen Leser vorzustellen. Werde ich gefragt, ob ich an einen bestimmten Leserkreis denke, wenn ich mich zum Schreiben hinsetze, sage ich nein, ich denke an keinen bestimmten, aber die Wahrheit ist, dass ich das Bild einer großen Menge vor mir habe, einer anonymen Menge, in der ich vielleicht da und dort ein freundliches Gesicht erkenne. In dieser Menge sehe ich die allmähliche, brennende Wärme sich ansammeln, die einmal ein einziges Bild war, ich sehe sie sich ausbreiten, Feuer fangen, zu einer großen Feuersbrunst werden. (Der einzige Augenblick, in dem ein Schriftsteller den ihm zustehenden Lohn empfängt, ist der, wenn jemand zu ihm kommt, brennend von dieser Flamme, die er, der Schriftsteller, in einem Augenblick der Einsamkeit entfacht hat. Ehrliche Kritik bedeutet nichts: Wonach es einen verlangt, ist rückhaltlose Leidenschaft, Feuer für Feuer.)
Versucht man, etwas zu tun, das die Kräfte, deren man sich bewusst ist, übersteigt, so ist es zwecklos, den Beifall der Freunde zu suchen. Freunde zeigen sich von der besten Seite in Augenblicken der Niederlage – wenigstens ist das meine Erfahrung. Dann lassen sie einen entweder völlig im Stich, oder sie übertreffen sich selbst. Kummer ist das große Bindeglied– Kummer und Unglück. Aber wenn du deine Kräfte erprobst, wenn du etwas Neues zu tun versuchst, wird sich auch der beste Freund womöglich als Verräter erweisen. Allein die Art, wie er dir Glück wünscht, wenn du deine phantastischen Ideen zur Sprache bringst, genügt schon, um dich zu entmutigen. Er glaubt an dich nur insoweit, als er dich kennt. Die Möglichkeit, dass du größer bist, als er glaubt, ist ihm unbehaglich, denn Freundschaft beruht auf dem, was man gemeinsam hat. Es ist geradezu ein Gesetz, dass jemand, der ein großes Abenteuer unternimmt, mit allen bisherigen Bindungen brechen muss. Er muss sich in die Wildnis begeben und, wenn er es mit sich ausgefochten hat, zurückkehren und einen Jünger wählen. Es spielt keine Rolle, wie bescheiden dessen Anlagen sind: Es kommt nur darauf an, dass er bedingungslos an dich glaubt. Wenn ein Keim sprießen soll, muss ein anderer Mensch, ein Individuum aus der Menge, Glauben bekunden. Künstler zeigen genau wie große Religionsstifter in dieser Hinsicht erstaunlichen Scharfblick. Sie suchen niemals denjenigen aus, der für ihre Absichten offensichtlich am geeignetsten wäre, sondern immer eine etwas obskure und häufig lächerliche Gestalt.
Was mich in meinen Anfängen hemmte und sich fast als Tragödie erwies, war die Tatsache, dass ich niemanden finden konnte, der an mich – sei es als Mensch oder als Schriftsteller – rückhaltlos geglaubt hätte. Da war Mara, gewiss, aber Mara war keine Freundin, ja sogar kaum eine andere Person, so eng waren wir verbunden. Ich brauchte jemanden außerhalb des Circulus vitiosus falscher Bewunderer und missgünstiger Kritikaster. Es musste schon einer aus heiterem Himmel kommen.