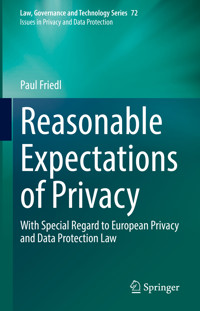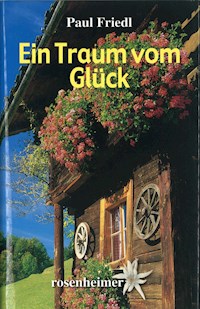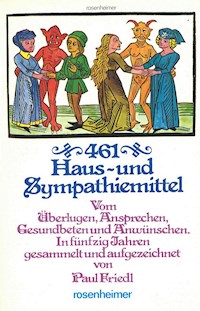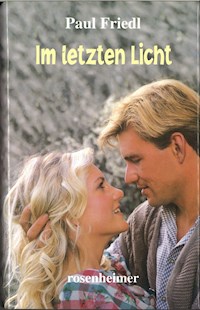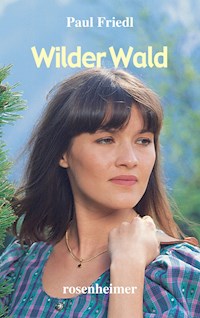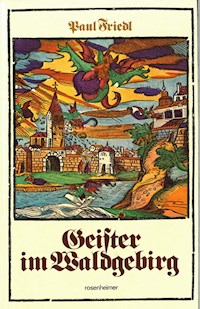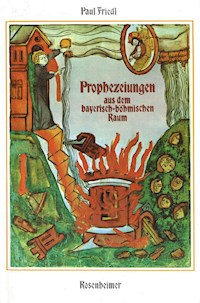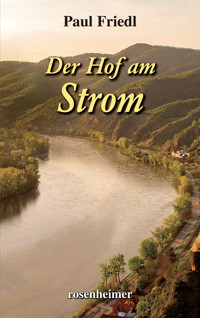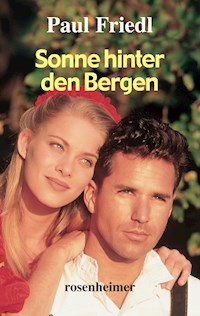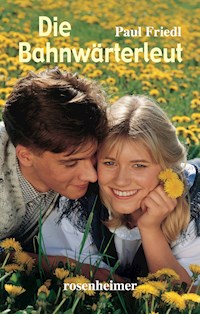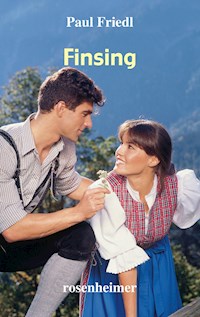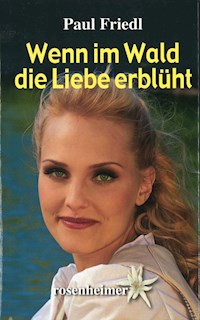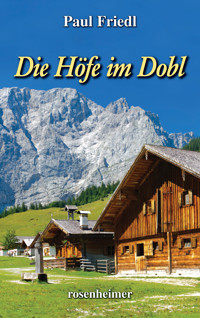16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem ein Orkan den Bayerischen Wald total verwüstet hat, kommen zahlreiche Holzarbeiter aus den benachbarten Ländern, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Das Holz muss rasch verkauft werden, und der Kampf gegen den Borkenkäfer garantiert vielen der Ärmsten Lohn und Brot. Dennoch bleiben Spannungen zwischen den Arbeitern und den Einheimischen nicht aus, und als die Tochter des Schmieds aus Eifersucht zur Brandstifterin wird, spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2006
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titelfoto: Wolfgang Ehn, Mittenwald
eISBN 978-3-475-54686-0 (epub)
Worum geht es im Buch?
Paul Friedl
Und wieder blüht der Wald
Nachdem ein Orkan den Bayerischen Wald total verwüstet hat, kommen zahlreiche Holzarbeiter aus den benachbarten Ländern, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Das Holz muss rasch verkauft werden, und der Kampf gegen den Borkenkäfer garantiert vielen der Ärmsten Lohn und Brot. Dennoch bleiben Spannungen zwischen den Arbeitern und den Einheimischen nicht aus, und als die Tochter des Schmieds aus Eifersucht zur Brandstifterin wird, spitzen sich die Ereignisse dramatisch zu.
Der meilenweite und unübersehbare alte Wald um den Rachel und den Lusen war tot. Niedergewalzt, zerschlagen, zersplittert und zu einer schrecklichen Wirrnis geworfen, hatte er sich in jener Nacht, da der große Sturm über die Waldberge brauste, zum Sterben gelegt. Im Toben und Krachen, im Heulen und Brüllen des Orkans war das Wimmern und der letzte Aufschrei der Millionen zerfetzter und entwurzelter Bäume untergegangen. Das Höllenkonzert jener Nacht lag den Waldleuten noch in den Ohren und ängstigte sie in finstern Nächten. Damals hatten sie den Schrecken kennengelernt, der einem Weltuntergang vorausgehen mußte, Augenblicke in denen Haus und Hof sich vom Boden heben wollten, die Dächer wie Federn davonflogen. Die Menschen glaubten in ein unbekanntes Nichts geschleudert zu werden.
Dann war die Stille gekommen, in der das Rufen und Jammern aufkam, und der unvergeßliche Morgen, da die Spätherbstsonne das ungeheure Leichenfeld der Bäume anleuchtete.
Der Wald war gestorben, niedergemäht von einer Riesensense.
Zwei trostlose Winter und zwei trübsinnige Sommer waren seitdem über den Bayerischen Wald gezogen, und immer noch trugen die Berge die Zeichen jener Nacht. Riesige Flächen, braun und grau, deckten die Hänge und Rücken, und der neue Frühling trug im lauen Wind den Moderduft des Waldtodes in die kleinen Täler.
Tausende von Arbeitern hatte man in das zerstörte Land geholt, aus Tirol und der Steiermark, aus Oberösterreich und dem Böhmerwald, und noch war das große Aufräumen nicht zu Ende. Die Schäden in den Dörfern und Weilern waren behoben, die gefallenen Bäume aber längst noch nicht aufgearbeitet. Der große Schrecken war überwunden, und in Dorfwirtshäusern und Waldkantinen drängten sich nach der schweren Arbeit des Tages Holzhauer, Flößer, Sägleute und Fuhrknechte, um das verdiente Geld bei geselligem Singen und Kartenspiel, bei Streiten und Raufen, oft bis in den Morgen hinein, in Bier und Kornschnaps umzusetzen. Nur wenige Einheimische machten dieses Treiben mit. Die Armut, aus der sie nie herausgekommen waren, hatte sie gelehrt, den Pfennig zu achten, und sie erkannten, daß es nicht immer so viel und so gute Verdienstmöglichkeit geben würde. Sie legten Pfennig zu Pfennig und verbargen ihr Geld in guten Verstecken. Die Zeiten waren unsicher geworden, war doch im vergangenen Sommer der zweite Baumtod gekommen und drohte zu vernichten, was der große Sturm in den eingebuchteten Tälern der Bergbäche nicht hatte werfen können. In das dörrende und faulende Holz des zerschlagenen Waldes war der Käfer eingeflogen und hatte sich so schnell verbreitet, daß das lautlose Nagen und Fressen des gefürchteten Baumtöters den letzten verbliebenen und sich wieder erholenden Waldbestand zu vernichten drohte. Im Herbst hatte man die ersten Trupps gegen den Käfer aufgeboten und erkannt, daß nur die radikale Vernichtung durch ein Massenaufgebot helfen könne.
Die Weisungen für den großen Käferkrieg und die Vorbereitungen dafür hatten die Forstleute im Winter beschäftigt. Im Frühjahr war die gesamte Bevölkerung, männlich und weiblich, vom zehnten Lebensjahr an, aufgerufen, sich bei den Forstleuten zum Käfern zu melden. Schon im vergangenen Sommer hatten einige damit ein gutes Geld gemacht, beneidet von den anderen, die man noch nicht einsetzen zu müssen glaubte, und nun sollte jedem, der wollte, das Käfergeld zugute kommen. Wer nicht schon in der Holzaufarbeitung beschäftigt war, meldete sich, alte Männer und Frauen, Mütter mit ihrer großen Kinderschar, die selbst kaum Sechsjährige als zehnjährig angaben.
Der Winter war gnädig gewesen. Die Holzfäller hatten durchgearbeitet und das aufgearbeitete Scheitholz mit den Schlitten an die Waldsträßl und die Bäche gebracht, dort zu vielen tausend Klaftern geschlichtet, und Hunderte von Holzfuhrwerkern brachten die Stämme aus dem Wald. Unzählbar waren die Rauchsäulen, die von den Waldfeuern gegen den grauen Winterhimmel stiegen, und trotzdem verblieben überall noch die Asthaufen und Rindenberge, die Brutstätten des Borkenkäfers.
Die neugebauten Sägewerke, oft nur primitive Holzschuppen mit nur einem Sägegatter, arbeiteten kreischend und ohne Unterbrechung, Tag und Nacht, werktags und sonntags. Die Bretterstöße wuchsen zu hohen Kobeln, die Fuhrleute brachten sie in langen Fahrten zu den großen Lagern der Holzhändler in Zwiesel, Grafenau und Passau.
Und immer noch warteten Hunderttausende von Blöchern im Wald, auf den Lagerplätzen und an den Bächen, abgefahren, zersägt oder abgetriftet zu werden. Droben am Rachel und an den Grenzbergen hatte man Klausen und Notschwellen errichtet, um das Wasser zu sammeln und es dann, die Stämme mitreißend, in die Läufe der Kleinen und der Großen Ohe abfließen zu lassen. Schon im Nachwinter, im März, hatte man mit dem Regen und dem Schmelzwasser Millionen von Scheitern und Prügeln die Ohe hinabgeflößt und sie über die Ilz nach Passau gebracht. Das Poltern des treibenden und sich an den Steinen stoßenden Holzes und das Rufen der Flößer hatte wochenlang das Tal von Spiegelau erfüllt. Zwei Flößer aus Kronach waren an den vereisten Bachrändern abgerutscht und im Wirbel der stoßenden und purzelnden Scheiter zu Tode gekommen, sechs andere hatte man mit erfrorenen Füßen ins Spital nach Grafenau geschafft. In Sankt Oswald begrub man fast zur selben Zeit einen Tiroler, der beim Holzziehen verunglückte, und einen Steirer, den ein fallender Baum erschlagen hatte. Zuvor hatte man einen Häuslerssohn von den Reschhäusern, der in der Waldkantine bei der Neuhütte erstochen wurde, und einen böhmischen Holzhauer, den man erfroren auf der List gefunden hatte, in Oberkreuzberg beigesetzt.
Es waren rauhe Zeiten — aber sie brachten Geld.
Und nun sollte das Geldverdienen für die Alten und für die Kinder erst kommen, wenn es zum Käfern ging. Das mußte der Herrgott so gewollt haben, als er den großen Sturm über die Wälder brausen ließ!
Dem armen Land versprach es für ein paar Jahre viel Arbeit, den kleinen Leuten sauer verdientes Geld und den Wirten, Händlern und Fuhrleuten, den Sägewerkern und sogar den Musikanten das Geldsäckel zu füllen. Über den Käfer fluchten nur die Forstleute, die anderen lobten ihn heimlich und nannten ihn ihren Brotvater, und an den Sonntagen gingen sie fleißig in die Kirche, um dem Herrgott zu danken, daß er nach dem großen Schrecken den Geldsegen gebracht hatte. Den Geldsegen, der hoffentlich noch lange anhalten würde.
Sturm und Käfer mochten für den Wald und für die, denen er gehörte, das große Unheil sein, für die anderen Waldleute waren sie es nicht. Wann hatte es jemals für die armen Leute das Brennholz umsonst gegeben? Wann hatte es in diesem weltvergessenen Waldwinkel so viele Leute gegeben und so viel Verdienst?
Aber was würde sein, wenn die Windbrüche aufgearbeitet und der Käfer ausgerottet waren? Wenn der Herrgott ein Einsehen hatte, dann konnte das Geldverdienen noch zwei, drei Jahre andauern. Darum mußte man beten und bitten. Was man dachte und betete, brauchte ja niemand zu wissen.
Am letzten Aprilsonntag pilgerten die Waldleute aus den Dörfern, Weilern und Einöden der Pfarrei zur Expositurkirche nach Oberkreuzberg. Die Sonne stand schon eine Weile über den Lusenwäldern und bleichte die Nebel aus dem Oswalder Forst und den feinen Rauch der glimmenden Feuer an den Rachelhängen. Kerzengerade stieg die Rauchsäule aus dem Kamin der Spiegelauer Glashütte in den seidenblauen Himmel. Die vergangenen Monate waren mild gewesen, und der Nachwinter blieb aus. Im Tal der Großen Ohe, die sich unterhalb Spiegelau ein felsiges Tor gegraben hatte, grünten schon die Wiesen und erwarteten die Dotterblumen mit gelben Sternen den Sonnenschein, der erst spät in diese tiefe Klamm kam. Das Rauschen des Baches hallte von den Felswänden. Auf der Pronfeldener Seite lag der zerschlagene Müllnerwald, so wie ihn der Sturm seinerzeit geworfen hatte, ein Gewirr von aufragenden, abgesprengten Fichten, die aus einem undurchdringlichen Gefilz von dörrenden Gipfeln und braunem Astwerk aufstanden, tot und faulend. Die kalte Luft aus der Klamm trug den Kirchgängern den Ruch des Moders entgegen.
Bedächtig im Gang und in der Rede, wanderten die Einheimischen in Gruppen, im heimischen Gewand, die Männer in braunen Röcken, Kleinbauern mit der Plüschweste in dunkelroten Farben und Mustern und mit Talerknöpfen, die Häusler und Waldarbeiter in dunklen Hosen und bescheidenen Joppen, die Glasmacher von der Neuhütte und von der Spiegelau im schwarzen Herrenanzug, weißem Kragen und buntem Schlips. Nicht nur die alten Leute stützten sich auf die nussernen oder eichenen Hakelstecken, auch die jungen Männer und Burschen schwangen ihre Stöcke, die sie zwar weniger zum Gehen brauchten, die ihnen aber die Sicherheit gaben, sich wehren zu können, wenn es zu einer Auseinandersetzung mit Burschen aus anderen Dörfern der Pfarrei kommen sollte. Die Frauen gingen in weiten dunklen Röcken, eingenähten Spenzern und halbseidenen Fürtüchern, und das schwarze, weit über den Rücken hängende, am Hinterkopf geknotete Kopftuch zeigte ihren Stand an, denn die ledigen Mädchen trugen Gewand und Kopftuch in helleren Farben.
Auch die Holzfäller, die Fremden, Flößer und Knechte kamen ihrer Sonntagspflicht nach, die meisten unbekümmert im pechigen Arbeitszeug, einige jedoch in der Tracht ihrer tirolischen oder steiermärkischen Heimat. So war es nun schon zwei Sommer, und nie hatte die Kirche in Oberkreuzberg und schon gar nicht die Glasmacherkapelle in Spiegelau die Kirchgänger fassen können. Es standen immer mehr Männer und Burschen außerhalb des Gotteshauses, als sich im dichtgefüllten Kirchenraum befanden.
Wer aber seiner Sonntagspflicht nicht nachkam, galt bei den Waldleuten als ein Heide und stand im Verruf.
Inmitten einer Gruppe der Einheimischen ging der hochgewachsene und kräftige Franz Hohenwarter vom Weiler List, den noch der Förster Horlacher als ersten Übersteher über die Käferer aufgestellt hatte. Fragend und horchend hatten sich ihm Männer und Frauen aus der Spiegelau angeschlossen, ein wenig unterwürfig seine Wichtigkeit anerkennend, denn er hatte die Käferer einzustellen und einzuweisen. Es war nicht gleichgültig, ob er und wen er als Käferer zu einer Partie hoch droben im Rachelwald einteilte oder herunten nahe dem Ort mit kurzem Anmarsch einwies. Stand man sich mit dem Hohenwarter gut, konnte man sich vielleicht einen stundenweiten Weg zur Arbeit ersparen und war nicht gezwungen, die ganze Woche über im Wald droben zu kampieren, weil sich der tägliche Marsch nicht lohnte.
„Wie es jetzt wird, kann ich auch noch net sagen“, meinte der Hohenwarter vorsichtig, „gestern ist der Horlacher weggezogen und der Neue gekommen.“
„Wie ist denn der Neue, kann man mit ihm reden?“ fragte die Frau des Holzhauers Sigl, und der Hohenwarter wiegte zweifelnd den Kopf.
„Will weiter nix sagen, aber so wie der Förster Horlacher ist er net, mit dem hat man reden können. Ist auch ein größeres Vieh, den sie uns da hergeschickt haben, ein Forstamtmann, ein herrischer Mensch, und einen Blick hat er, als möcht er die Leut fressen.“
„Was wird denn der Stanglherr nun tun?“ bekümmerte sich eine andere. „Die Lisl hat ihm die Wirtschaft geführt und sich um alles gekümmert. Gern wird sie auch net gegangen sein, aber wenn ihr Mann versetzt wird, muß sie halt mit.“
Und ein alter Mann mäkelte: „Der Herr hätte sich net alleweil auf seine Schwester verlassen sollen, hätte halt längst wieder heiraten müssen. Und wer wird sich jetzt um die alten und die kranken Leut in der Spiegelau annehmen? Eine Lisl gibt es nimmer.“
„Nach Miesbach haben sie ihn versetzt, den Horlacher, das ist weit hinter München. Da werden wir ihn so schnell nimmer sehen.“
„Geweint hat sie, aber was hilft es. Sie hätte ja auch einen andern heiraten können.“
Der Anstieg aus der tiefen Klamm hinauf zum Ort Langdorf, über einen steilen und steinigen Fußweg nahm ihnen den Atem und die Rede weg, und sie konnten ihren Gedanken nachhängen.
Der Langdorfer Wald war vom Sturm verschont geblieben. Das Unwetter brauste darüber hinweg, und während man die Höhe hinanstieg, konnte man glauben, es wäre nichts geschehen. Doch ein Blick zurück auf den Rachelwald erinnerte an die Katastrophe. Die Berge lagen im Morgen, als hätte man sie mit einem graubraunen grünfleckigen Tuch abgedeckt. Nur kleine Baumstreifen in den Bachtälern der Großen und Kleinen Ohe und helle Wiesenflecken um die verstreuten Dörfer und Weiler verhießen einen neuen Frühling und neues Leben.
Auf der Höhe und auf dem Weg durch Langdorf schloß sich die Gruppe erneut zusammen, und der Hohenwarter fing wieder zu reden an:
„Knott heißt er, der Neue. Daß man uns einen Amtmann hergetan hat, das hat was zu bedeuten. Der soll wahrscheinlich fest antreiben, damit der Windbruch schneller aufgearbeitet wird, und mit dem Käfer will er bald fertig werden. Die guten Zeiten, wie wir sie beim Horlacher gehabt haben, werden wohl jetzt vorbei sein.“
Am Ende der Gruppe ging der alte Weß, der Sägmeister auf der unteren Hüttensäge, mit seinem dreizehnjährigen Buben, der seinen Vater bedrängte:
„Sag dem Hohenwarter, daß er mich zum Käfern nimmt. Das Fünferl, das mir der Stanglherr in der Stunde bezahlt, ist ja kein Geld. Beim Käfern kann ich mir zwanzig Pfennig und mehr verdienen.“
„Eduard, das kann ich net. Wenn ich dich gehen lasse, jetzt wo alle davonlaufen wollen, stellt mich der Herr aus.“
„Dann gehst halt auch in den Wald. Sechzehn Stund mußt du mit dem Schinderlohn in der Säg stehen, das Dreifache kannst im Wald verdienen.“
„Du redest halt so daher. Und was ist, wenn das Käfern und das Holzaufarbeiten aus ist?“
„Ich rede selber mit dem Hohenwarter!“ trotzte der Bub und suchte in die Nähe des Überstehers zu kommen, brachte seine Bitte an und wurde abgewiesen:
„Nur wenn dein Vater damit einverstanden ist und wenn der Stanglherr nix dagegen hat. Wollen ihm sowieso auch die Hüttenleut nimmer bleiben. Alleweil dauert das Käfern net, höchstens noch diesen Sommer, und dann? Was ist, wenn euch dann der Stangl keine Arbeit mehr gibt?“
Enttäuscht blieb der Junge zurück, und die Frau des Holzhauers Sigl tröstete ihn:
„Mußt halt beten, daß dich der Vater doch noch gehen läßt und daß der Käfer noch lange bleibt. Darum beten wir ja alle.“
Die Büttnerin von der Neuhütte klopfte auf ihren Kittelsack: „Wir haben das Geld für eine Bittmesse gesammelt, und ich gehe nach der Messe zum hochwürdigen Herrn Expositus und schaffe die Messe an.“
„Ob der für so was eine heilige Messe lesen wird?“ zweifelte eine andere. „Die wollen ja alle, daß der Käfer verflucht und verdammt wird!“
Giftig mengte sich nun die Wolfin von der Spiegelauer Mühle ein: „Was ihr da redet, ist eine Sünde! Schaut uns an! Schaut unsern Wald an! Alles ist hin, und woher sollen wir das Geld zum Aufarbeiten nehmen? He? Den Käfer haben wir auch schon drin. Und das Bezirksamt in Grafenau schickt uns alleweil den Gendarm, weil wir nicht aufarbeiten lassen! He, laß aufarbeiten, wenn du die Arbeiter net zahlen kannst! Laß Käfern, wenn du kein Geld hast!“
Der Hohenwarter wandte sich nach ihr zurück: „Hast auch recht, Müllnerin. Der große Sturm ist kein Segen gewesen, und der Käfer ist es erst recht net.“
„Sind keine so guten Zeiten, wie man meinen möcht“, maulte ein alter Mann. Die anderen sahen sich nur verständnisvoll an und dachten das ihrige.
Freilich, für die Waldbesitzer war es ein Schaden, aber für die armen Leute eben doch ein Segen. Die Haus- und Grundbesitzer, die auch einen Waldteil hatten, die hatte es getroffen. Aber dafür konnten die armen Leute nichts. Jedes mußte auf sich selber schauen.
Zum alten Weß meinte die Siglin flüsternd: „Jetzt tat sie jammern, die Müllnerin! Kein Pfündl Mehl hat sie mir gegeben, wie mein Mann so lange krank gewesen ist und wir nix zu nagen und zu beißen gehabt haben. Ich soll halt fest beten, hat sie gesagt, dann wird der liebe Gott schon helfen. Wenn sich damals net der Stanglherr und das Fräulein Lisl um uns angenommen hätten, wären wir verhungert. Und jetzt sollen wir net darum beten dürfen, daß das Verdienen am Käfer noch lange anhält?“
Der Weß wiegte die Schultern: „Siglin, da sag ich net so und net so. Ich fürcht halt, daß net alles so geht, wie wir es gerne haben möchten, und andererseits bin ich froh, wenn die unruhigen Zeiten in der Spiegelau wieder ausgehen und wir die fremden Leut endlich losbringen. Ist ein Unglück gewesen, das uns der Sturm gebracht hat, das steht fest.“
„Bist du auch schon auf der Seite von den Großkopfeten?“ biß die Siglin gehässig, und der Weß quittierte:
„Mit euch Weibern kann man net reden. Da fehlt es am Verstand.“
Von der Kirche auf dem Kreuzberg kam das erste Läuten. Es klang stumpf und verloren über den Wald, der dort oben vom Sturm niedergebrochen war. Kreuz und quer lagen die entrindeten Baumleichen und bleichten in der Sonne. Die Schäden am Kirchendach waren mit Brettern geflickt. Das Turmkreuz stand schief gegen den Himmel.
„Hat net einmal mehr einen Widerhall, das Geläut, seit der Wald liegt“, stellte der Hohenwarter fest, „und mit dem Aufarbeiten vom Kirchenwald sind sie auch noch net fertig.“
„Allein um Gotteslohn will halt doch keiner arbeiten“, meinte dazu der Weß.
Die Kirche von Oberkreuzberg war dicht gefüllt, und es mochten noch an die zweihundert Leute sein, die sich auf dem Platz davor drängten und die offene Kirchentür umlageiten. Während die Frauen und Mädchen noch versuchten, im Kirchenraum einen Stehplatz zu bekommen, blieben die Männer zurück, auf der einen Seite die Einheimischen, auf der anderen die fremden Holzfäller, Flößer und Fuhrknechte. Aus ihrer Mitte ragte mancher Adlerflaum und Gamsbart auf, und ihre Sprache ging wie ein Kauderwelsch durcheinander. Die meisten von ihnen umstanden einen hochgewachsenen jungen Tiroler, der gestikulierend das Wort führte. Das hagere, lange Gesicht unter dem grünen Hut mit einem großen Gamsbart, das weiße Hemd mit dem breiten Bruststreifen des Hosenträgers, die kurze Lederhose mit den nackten Knien und der grüne Janker mit blitzenden Talerknöpfen, zog die Blicke der einheimischen Mädchen an, und sie tuschelten:
„Das ist der Domani Hans von der Partie am Föhrauer Filz, er führt da droben unterm Rachel das Kommando und hat die beste Partie. Vor dem kuschen sie alle, und er läßt auch nichts aufkommen unter seinen Leuten. Wer mit einem Rausch in das Lager kommt, wird von ihm verprügelt, und wer am Sonntag net in die Kirche geht, der fliegt. Der Horlacher hat viel auf ihn gehalten.“
„Ein sauberer Bursch, aber man hört nix, daß er es mit einer hätte. Ledig ist er noch, das hab ich schon erfragt“, schwärmte die Greipl Marl von der Neuhütte.
Dann richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Kutsche des Spiegelauer Hüttenherrn Ludwig Stangl, die über Palmberg her angefahren kam und auf dem unteren Platz hielt. Neben dem massigen und rotgesichtigen Hüttenherrn saß im graugrünen Förstergewand ein kleinerer Mann.
„Das ist der Neue“, ging es flüsternd durch die Menge, „der Forstamtmann Knott.“
„Der hat kein gutes Geschau, der raucht keinen Guten, das merkt man ihm an“, tuschelte die Siglin.
Schwerfällig stieg der Stanglherr aus der Kutsche, und mit einem lüftigen Sprung folgte ihm der Forstamtmann. Die Menge machte eine Gasse frei, um die beiden Herren zur Kirche durchzulassen, wo für sie die Betbank des Spiegelauer Hüttenherrn, gleich neben dem Altar, freigehalten war.
Verdrossen und auf niemanden achtend, schritt Ludwig Stangl der Kirche zu, die Männer, die die Hüte gezogen hatten, mit stechendem Blick musternd, den Mund verkniffen und das Kinn vorgestreckt, folgte ihm der Forstamtmann. Den an der Kirchentür stehenden und devot grüßenden Übersteher Franz Hohenwarter herrschte er an:
„Morgen punkt sechs Uhr die Partieführer der Käferer bei der Mühle! Einsagen!“
„Das ist aber ein Scharfer“, bemerkte ein Holzhauer, als der Forstamtmann in der Kirche verschwunden war. Der Hohenwarter zuckte nur mit den Schultern und murrte:
„Wird auch keine Bäume ausreißen können.“
Die Orgel setzte ein, und die Menge draußen wandte sich der Kirche zu. Das Gerede verstummte.
Ein leichter Ostwind wehte von den Grenzbergen her und spielte mit den grauen Haaren der alten Leute und mit den Kopftüchern der Frauen und Mädchen. Sie horchten auf das Geschehen im Gotteshaus und das Kreischen der Dohlen, die um das schiefe Turmkreuz flatterten. Die Aprilsonne leuchtete auf die menschenumlagerte Kirche. Unter der Höhe lagen die Häuser von Oberkreuzberg, und das Krähen der Hähne und das Muhen einer Kuh taten dem Sonntagsfrieden keinen Abbruch.
Im Kirchenschiff hatten sich Männlein und Weiblein getrennt in die Betstühle gedrängt, und es gab kein Flecklein mehr, das als Stehplatz hätte dienen können. Kleiderruch und Schnupftabakduft vermischten sich mit dem Weihrauch, und das Schnufzen, Hüsteln und Räuspern hallte vom Gewölbe zurück. Mit gesenkten Köpfen folgten die Gläubigen dem lateinischen Text der Messe, den sie nicht verstanden, sie wußten aber, wann sie sich zu erheben und zu bekreuzigen hatten, und gaben sich, in Gedanken an Gott, ihren eigenen Sorgen und Nöten hin.
Nach der Opferung war der Mesner mit dem Klingelbeutel zum Sammeln gegangen und hatte damit bei der Herrenbank begonnen. Während der Stanglherr wie immer einen Taler einwarf, suchte der Forstamtmann Knott nach einem Zweipfennigstück und murmelte ärgerlich:
„Immer und überall diese Bettelei. . .“
Der Mesner nahm sich vor, dem Herrn Expositus das nach der Messe genau zu berichten. Dann zwängte er sich mit dem klingelnden und bettelnden Glöckchen durch die Gläubigen, und die neuen roten Kupferpfennige füllten das Säckchen. Und für jeden Pfennig gab er ein geflüstertes „Vergelt’s Gott“ zum Dank. Als die alte Radlingerschusterin von der Spiegelau ein silbernes Simmerl, ein Zwanzigpfennigstück, einwarf, rumpelte ihm der Dank so laut und respektvoll heraus, daß sich die Umstehenden umsahen.
Indessen hatte der Herr Expositus das heilige Evangelium verlesen und war auf die Kanzel gegangen. In bäuerlicher Einfachheit kündete er vom Gebot des Herrn: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit aber bei den jungen Leuten die Botschaft nicht falsch verstanden werde, begann er gleich mit der Auslegung. Das heiße soviel wie: tue deinem Mitmenschen nichts Unrechtes und hilf ihm, wenn er in der Not ist, achte ihn und verdamme ihn nicht, vergelte nicht Böses mit Bösem, pflege keinen Haß und keine Mißgunst, denn der Herr sagt: Was du einem der Meinen getan hast, das hast du mir getan.
Sie hörten es nicht zum erstenmal und nahmen es mit gesenkten Köpfen hin. Als der Geistliche aber eine kleine Pause machte und mit erhobener Stimme weiterfuhr, horchten sie auf:
„Wir haben traurige Zeiten, unsere schöne Waldpfarrei ist voll Unruhe und Unfrieden. Es ist, als hätte das ungeheure Unwetter nicht nur den Wald, sondern auch die Herzen und die Gefühle der Menschen zerstört. Das Geld, das jetzt sauer verdient wird, wandert in die Wirtshäuser, die Tag und Nacht nicht leer werden. Versoffen wird, was die Familien so notwendig brauchen könnten. Andererseits wachsen Neid und Mißgunst, entstehen Feindschaften und bringen böse Früchte. Unsere Jugend verdirbt dabei, weil sie nichts anderes sieht als das Laster. Die heimliche Sünde geht um. Es ist eine Schande! Ich habe im vergangenen Jahr sieben eheliche und fünfzehn ledige Kinder getauft. Der Herr hat uns mit dem großen Sturm eine große Heimsuchung geschickt. Freilich gibt es jetzt viel Arbeit und Geld, aber glaubt ihr, daß das ewig sein wird? Das Geld ist da, und die Nächstenliebe ist fort. Nun ist auch noch der Käfer gekommen, wie die Heuschreckenplage im alten Testament. Was wird sein, wenn der Wald nicht mehr hochkommt und noch gänzlich vernichtet wird? Denkt niemand an das schreckliche Ende? Die Armut wird größer sein als vor dem Windbruch, und mancher wird sich sagen müssen: Hätte ich damals kein Luderleben geführt und das verdiente Geld zusammengetan, müßte ich jetzt nicht hungern. Schaut unsere Kirche an! Es regnet durchs Dach, das Kreuz wird herunterfallen, wenn nicht bald etwas geschieht! Und wenn ich dann in den Klingelbeutel sehe, dann finde ich nur Pfennige und ein paar Hosenknöpfe. Soll ich damit die Kirche renovieren können? Für das Wirtshaus ist Geld da, für das Gotteshaus nicht. Ich weiß, daß ihr euch wünscht, daß diese Zeit so bleiben möge, daß die Arbeit im zerschlagenen Wald anhalte und der Käfer, den der Teufel geschickt hat, euch das Geldsäcklein fülle.“
Der geistliche Herr, mit dem gesundroten und runden Bauerngesicht und dem schlohweißen buschigen Haar, mußte aussetzen, um wieder zu Atem zu kommen. Dann fuhr er fort, mit völlig veränderter Stimme, langsam und feierlich:
„Aber nun lasset uns beten und den lieben Gott bitten, daß er uns unsere Sünden vergibt, das Unheil von uns nimmt und daß er — darum wollen wir besonders bitten — den schrecklichen Käfer verschwinden läßt.“ Er bekreuzte sich und begann laut und rufend: „Herr, erbarme dich unser! Vater unser, der du bist im Himmel...“
Er wurde leiser und horchte in die überfüllte Kirche, in der nur wenige laut nachbeteten und dann allmählich verstummten, so daß nur mehr das Beten der Spiegelauer Müllerin deutlich zu hören war. Als der Herr Expositus das Gebet beendet hatte, stand er mit krebsrotem Gesicht und wütender Miene noch einen Augenblick, setzte an, als wollte er von neuem beginnen, schüttelte aber den Kopf und stieg von der Kanzel.
Geduckt kauerten die Leute in den Betstühlen und wagten nicht aufzusehen, und die Stehenden richteten die Blicke zu Boden. Für eine Weile war es mäuschenstill im Raum, dann begann ein leises Raunen und Flüstern.
„Wir wollten bitten, daß der Käfer bleibt, und er will ihn weghaben!“
„Für die Kirche sollen wir fest hergeben, aber verdienen sollen wir nix!“
„Der geistliche Herr kann leicht reden, er kommt zu seiner Geld, aber wir?“
„Hast du den Neuen gesehen? Wie ein Geier hat er sich umgeschaut! Aber der Stangl hat es verstanden, der hat sich die Hand vorgehalten.“
Der Herr Expositus hatte es eilig mit dem Messelesen, und nach dem Segen verkündete er laut und energisch:
„Am nächsten Sonntag ist um neun Uhr die heilige Messe in der Kapelle in Spiegelau — mit einer Kollekte für die Renovierung unserer Kirche.“
Dann strömten die Leute aus der Kirche, und sie verließen nur langsam den Kirchplatz. Sie nickten sich verständnisvoll zu, schmunzelten und lachten oder schüttelten die Köpfe. Ratlos stand die Büttnerin von der Neuhütte und wandte sich an den alten Weß von der Spiegelauer Hüttensäge:
„Was soll ich tun? Ich hab das Geld im Tüchel, das wir für die Messe gesammelt haben. Ich kann ihm doch net sagen, für was er die Messe lesen soll?“
„Sagst ihm halt was anderes, wird dir schon was einfallen.“
Zagend und zögernd ging die Büttnerin zur Sakristei, wo der Herr Expositus gerade mit Hilfe des Mesners das Meßgewand ablegte. Er grollte:
„So was ist mir denn noch net vorgekommen! Aber ich werde es ihnen am Sonntag hinreiben, daß ihnen die Augen tropfen! Wenn sie nimmer wissen, wie es in der Hölle ausschaut, dann werde ich ihnen das einmal schildern!“
„Das ist der Übermut, Hochwürden, da dürfen Sie schon fest aufdrehen! Und der neue Forstmann ist auch kein Guter. Einen Zweiring hat er in den Beutel getan, einen Zweiring! Wenn das die andern inne werden, dann legen sie gar nix mehr ein.“
Der Herr Expositus sah seinen Mesner scharf an: „Wie sollen sie es denn inne werden? Wenn die Leute davon was erfahren, dann bist du die längste Zeit Mesner gewesen.“
„Ich sag bestimmt nix“, versicherte der Mesner und wußte dabei, daß er es sicher seinem Weib sagen würde.
Da kam die Büttnerin in die Sakristei und sagte buckelnd und händereibend: „Hochwürden, wir von der Neuhütte möchten eine Messe aufschreiben lassen.“
Der Geistliche griff nach einem Buch, schlug es auf, tauchte die Feder in die Tinte und fragte gleichgültig: „Für wen?“
Mit rotem Kopf gickste die Büttnerin: „Für niemanden. Keine Seelenmesse — nein — eine Bittmesse.“
Er wandte sich ihr zu, während sie das Tüchl aus dem Kittelsack nahm und in vielen kleinen Münzen zwei Mark auf den Tisch zählte.
„Um was wollt ihr bitten?“
„Eine Dank- und Bittmesse halt, Hochwürden.“
„Dann schreiben wir: eine heilige Messe der Neuhüttler nach Meinung.“
Erleichtert schnaufte die Büttnerin auf. „Richtig — nach Meinung! Ich bin halt ein einfaches Weib und kann das net so sagen, aber nach Meinung — das — ja, das wollen wir!“
Dann hatte es die Büttnerin eilig, und sie lachte zufrieden, als sie wieder auf dem Kirchplatz war. Zur Greipltochter, ihrer Nachbarin, sagte sie schlau:
„Ausgefragt hätte er mich, was wir erbitten wollen, aber ich hab nix gesagt. Hab ihn drangekriegt. Erst hätten wir beten sollen, daß der Käfer schnell verschwindet, und jetzt muß er eine Messe lesen, daß der Käfer bleibt! Sag bei den andern ein: heut auf die Nacht kommen wir bei uns zusammen und halten eine kleine Andacht.“
Dann wanderten die Kirchenbesucher, soweit die Männer nicht gleich in den Wirtshäusern von Oberkreuzberg zukehrten, zurück in ihre Dörfer und Weiler unterm Rachel und redeten vom Käfern, das in der kommenden Woche beginnen sollte, und ratschlagten, was etwa dabei verdient sein könnte und welcher Partie man zugeteilt würde.
Der Stanglherr von der Spiegelau und der neue Forstamtmann Knott hatten mit den letzten die Kirche verlassen, und alle auf dem Platz noch verbliebenen Kirchgänger grüßten stumm. Vergnügt blinzelte ihnen der dicke Hüttenherr zu, während der Amtmann die Leute mit finsterem Gesicht aus seinen stechend schwarzen Augen unter halbgeschlossenen Lidern musterte. Er war fast um einen Kopf kleiner als der Stangl, trug zu seinem graugrünen Forstgewand enge Reitstiefel, und das vorgeschobene Kinn und der fast lippenlose, zu einem verbissenen Strich unter der Hakennase gepreßte Mund verrieten Hochmut und Ärger. Schweigend bestiegen sie die Kutsche, die bei den letzten Häusern unterm Kirchenberg gewartet hatte, und während der Ludwig Stangl sich mit einem zufriedenen Lächeln im feisten Gesicht in die Polster fallen ließ, setzte sich Knott steif und aufrecht hin und zischte wütend zwischen den Zähnen hervor:
„Haben Sie ja mitbekommen, Herr Stangl, was da eben in der Kirche geschehen ist? Das ist ein verschlagenes und widerspenstiges Volk, das braucht eine starke Hand! Man hat mich ja schon vor diesen Holzköpfen gewarnt, aber ich sehe, daß es schlimmer ist, als ich es mir vorgestellt habe.“
Der Stangl runzelte die Stirn. „Ganz so ist es auch wieder net. Es sind seelengute Leut, ehrlich und arbeitsam. Freilich ist auch mancher Rüpel darunter, aber das wird wieder besser, wenn einmal die fremden Arbeiter weg sind. Der Pfarrer hat ein wenig übertrieben, und da werden unsere Leut halt bockig, aber das legt sich.“
Der Widerspruch trieb dem Forstamtmann das Blut in das knochige Gesicht, und seine Augen funkelten böse. Während der Hüttenherr freundlich die Leute grüßte, die sie auf dem staubenden Sträßl überholten, das über Palmberg nach Spiegelau führte, richtete sein Begleiter den Blick in die Ferne und schien hinter der finsteren Stirn etwas auszubrüten. Scharf und herrisch sagte er schließlich:
„Ich werde diese Bande klein kriegen, darauf können Sie sich verlassen! Ich sehe, daß hier alles gründlich verdorben wurde. Der Herr Horlacher war eben nicht der richtige Mann. Er hat sich nicht durchsetzen können.“
Der Stangl sah ihn erstaunt an und antwortete mit Nachdruck: „Er hat sich durchgesetzt und ist mit den Leuten gut ausgekommen.“
„Ein Versager war er auf der ganzen Linie! Warum, glauben Sie, wurde er denn versetzt?“
Breit und selbstbewußt in die Polster gelehnt, bemerkte der Stangl ruhig: „Der Horlacher ist ein ausgezeichneter Forstmann, und er ist mein Schwager, Herr Knott!“
„Forstamtmann bitte! Herr Forstamtmann! Daß er Ihr Schwager ist, interessiert mich nicht, und das tut auch nichts zur Sache!“ gab Knott bissig zurück.
Die großen Hände auf den Knien des Hüttenherrn zuckten und ballten sich zu Fäusten. „Jedenfalls sage ich Ihnen, daß der ein guter Mensch und ein hervorragender Förster ist! Und ob Sie das auch sind, muß sich erst herausstellen!“
„Was soll das heißen?“ fuhr Knott auf.
„Das soll heißen, daß Sie wahrscheinlich das Pulver auch net erfunden haben“, entgegnete der Stangl grimmig.
Nun wurde Knott wütend. „Was erlauben Sie sich! Ich vertrete hier den König, und neben mir hat niemand etwas zu sagen! Ich verlange, daß man das respektiert!“
Der Stangl neigte sich vor und stieß den Kutscher in den Rücken.
„Halt an, Veitl!“
„Ja, Herr, was ist?“
„Dem König sein Stellvertreter möchte zu Fuß gehen!“
Er riß den Wagenschlag der offenen Kutsche auf und forderte den Forstamtmann mit einer Handbewegung zum Aussteigen auf.
Leichenblaß wurde Forstamtmann Knott und starrte, erst ungläubig, dann erstaunt und schließlich wütend den Hüttenherrn an. Dann stieg er aus und knirschte:
„Das hätte ich mir denken können, daß hier der Herr wie das Gescherr ist! Aber Sie werden noch zu Kreuz kriechen!“
Dann schritt er stolz und mit durchgedrücktem Rücken davon. Er schlug einen Fußweg ein, der durch die Wiesen abkürzend nach Spiegelau führte. Der Veitl grinste:
„Dem habt Ihr es aber gegeben, Herr!“
Vergnügt und mit einem breiten Lachen sagte Stangl: „Hast du gehört, was er gesagt hat?“
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com