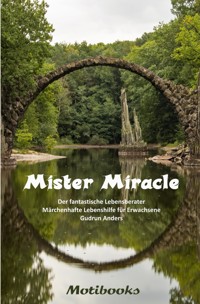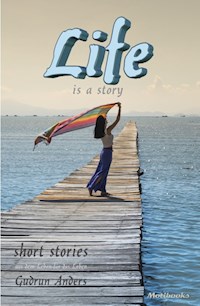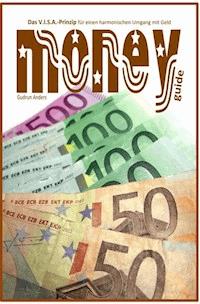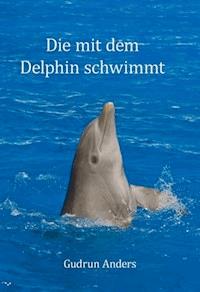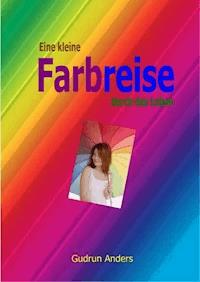Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Märchen drücken in symbolhafter Form alltägliche Konflikte des menschlichen Daseins aus. Da Märchen am Ende immer positiv ausgehen, bedeutet das auch, dass ein schwelender Konflikt in der Geschichte gelöst wird. Das Unbewusste nimmt sich der Lösung an: Der Leser ist berührt, man denkt darüber nach, man spürt instinktiv, dass man einen eigenen Konflikt so oder so ähnlich lösen könnte und lässt märchenhafte Lösungsmöglichkeiten zu, die sonst nicht dagewesen wären. So kann man sich fast spielerisch mit Sorgen und Ängsten auseinandersetzen und einen Problemlösungsprozess beginnen. Märchen verschaffen Einsichten und Erkenntnisse in den Lauf des Lebens. In diesem Buch finden Sie 101 Märchen, die sich gut für kurze Momente der Ruhe und zum Vorlesen für jung und alt eignen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gudrun Anders
101 Diamanten
Heilende Märchen für die Seele
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Der Esel mit dem kurzen Hals
Die Puppe im Garten
Die Reise des Bettelkönigs
Der Teufel und der Ring der Königin
Sterntaler und der Wanderer Kladibu
Die Prinzessin und der Höllenhund
Die Diamantenstadt
Der Besuch der Brieftaube
Die Zusammenkunft der großen Drei
Das Krokodil im Dornenbusch
Die rutschende Krone
Der Traum des Goldfischs
Das wertvolle Geschenk des Froschkönigs
Der Siegelring der Prinzessin
Aufruhr bei den Tieren des Waldes
Das geheimnisvolle Zimmer
Die kaltblütige Schwester
Die Umkehr des Schutzmannes
Die Insel der Liebe
Die Vertreibung der Poltergeister
Die Schatztruhe der Wichtelmänner
Die Heimholung des Familienwappens
Der Drache und das kleine Mädchen
Begegnung in der Wüste
Die Schlange im Kochtopf
Der Clown und das Glücksschwein
Die Befreiung des Esels
Der Rat des Unsichtbaren
Die Rutschpartie auf dem Regenbogen
Der Menschenfresser und die Zwillinge
Die verschwundene Krone
Die Rettung des Paradiesapfels
Feuer im Busch
Die Bootsfahrt des kleinen Elefanten
Der Traum der kleinen Eule
Die Verbreitung der Mittelmenschen
Der entlaufene Elefant
Der Weg des weißen Schimmels
Die Wandlung des Schlosses Lutania
Der unglückliche Schmetterling
Der Drache und das Liebesorakel
Der Traum der Glücksfee
Die Vertreibung des Löwen
Der Rosenräuber
Die kranke Königin
Die Verwandlung des Höhlenmenschen
Die vereinten Bilder
Die Erkenntnis der Waschfrau
Das Tal der Dürre
Der Bär bringt die Rettung
Die Hilfe des kleinen Sterns
Der Frosch und der Indianer
Die Erbsen im Kirchturm
Der Prinz und der Esel
Die Hilfe des Drachen Pustefix
Der große Wunsch des Froschkönigs
Die Heilung des Königssohnes
Wie aus Hanswurst ein Geschäftsmann wurde
Der Angriff des Geiers
Der Wanderer und die Hexe Globolie
Der große Traum des Bettlers
Die Hilfe des Ritters
Der Graf und der Stein der Weisen
Die mysteriöse Schatztruhe
Rettung für die Wichtelmänner
Die Entdeckung der Wunderpille
Das wunderbare Weihnachtsfest
Die Begebenheit im Palmengarten
Der Tiger im Schneesturm
Der traurige Weihnachtsmann
Im Zauberland der Schmetterlinge
Das Zotteltier bringt Unruhe
Die Bestie steht im Parkverbot
Die Lehre des Stehaufmännchens
Das Taschenabenteuer der kleinen Eule
Der Abriss des Zirkuszeltes
Mutprobe beim Vulkanausbruch
Das Glücksschwein bringt Zufriedenheit
Das Komikerpärchen in der trüben Stadt
Der Alte geht ein in die Unendlichkeit
Die Reise des Sultans
Der Heilige verändert den Tümpel
Die kleine Fee rettet die Krone
Die Mutprobe des kleinen Muck
Die Zauberkraft
Der Lebensweg der kleinen, grünen Elfe
Der Räuberhauptmann erfüllt seinen Traum
Der Gefangene im Labyrinth
Die Nacht der wundersamen Wandlung
Wie der Papagei sein Lebenslicht verschenken wollte
Wie der Seelsorger die Bestie heilte
Das Glück liegt in den Zetteln
Naydin und der rote Käfer
Die Angst der Waschfrau Liesel
Auf dem Weg zum Gipfel der Träume
Wie die kleine Brieftaube ihre Bestimmung fand
Der leere Schlitten des Weihnachtsmanns
Die Blume erfüllt die Wünsche
Der innere Reichtum des Bettlers
Als der Teddy den Blumenkohl fraß
Wie der Teddybär lebendig wurde
Impressum neobooks
Vorwort
Liebe Leserin und lieber Leser!
Ich freue mich, dass Sie zu diesem Buch gegriffen haben. Sie kennen Märchen noch und vielleicht wissen Sie, dass Märchen unserem Inneren helfen können, wieder an das Gute, das Menschliche zu glauben. Märchen bringen auch immer Lösungen mit sich, weil Konflikte bewältigt werden. Viele Menschen erinnern noch „Und wenn sie nicht gestorben sind. …“ Ja, wenn die Märchen noch nicht gestorben sind, dann leben sie weiter und helfen Kindern und Erwachsenen weiterhin daran zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Streit und Mühsal ein Ende haben können. Zuerst im Märchen und dann im Leben.
Vielleicht möchten Sie sich mit diesem Buch wieder einmal in das Reich der Phantasie entführen lassen, dass uns scheinbar doch so manches Mal abhanden gekommen ist. Das Reich der Phantasie ist aber unendlich wichtig, denn was nicht geträumt werden kann, das wird auch nicht ins Leben umgesetzt.
Die Pop-GruppePURhat es in ihrem Titel „Abenteuerland“ einmal so wundervoll ausgedrückt (Auszug aus dem Liedertext):
Der triste Himmel macht mich krank. Ein schweres graues Tuch. Das die Sinne fast erstickt. Die Gewohnheit zu Besuch. Lange nichts mehr aufgetankt. Die Batterien sind leer. In ein Labyrinth verstrickt. Ich seh` den Weg nicht mehr. Ich will weg, ich will raus. Ich will - wünsch mir was.
Und ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand. Er winkt mir zu und grinst:
Komm hier weg, komm hier raus. Komm, ich zeig dir was, Das du verlernt hast – vor lauter Verstand …
Komm mit Komm mit mir ins Abenteuerland Auf deine eigene Reise Komm mit mir ins Abenteuerland Der Eintritt kostet den Verstand Komm mit mir ins Abenteuerland Und tu`s auf deine Weise Deine Fantasie schenkt dir ein Land Das Abenteuerland
Es liegt in deiner Hand!
In Ihrer Hand liegt es nun, die in diesem Buch enthaltenen Märchen zu lesen und in Ihr Herz einfließen zu lassen. Vielleicht berühren Sie sich, vielleicht nicht. Vielleicht blitzt in Ihnen ein Erkennen auf, vielleicht in jemandem, dem Sie die Märchen vorlesen. Ich wünsche es Ihnen sehr.
Wenn Sie mehr erfahren möchten über meinen Schreib-Werdegang oder sonst etwas wissen möchten, dann schauen Sie sich in Ruhe auf meiner Webseite um, wo Sie viele Infos finden. Oder wenn Sie eine direkte Frage haben, scheuen Sie sich bitte nicht, mich anzurufen.
Ich wünsche Ihnen eine märchenhafte Zeit hier auf dieser Erde!
Ihre
Gudrun Anders
Der Esel mit dem kurzen Hals
Es war einmal ein Eselchen, der hieß Guco. Er lebte allein draußen im Wald, denn Eltern hatte er keine mehr. Zumindest meinte Guco keine zu haben. In Wahrheit gab es selbstverständlich Eltern. Wie sonst wäre Guco wohl auf die Welt gekommen? Aber das mit den Eltern war so ein Problem. Immer wollten die etwas anders als Guco und nörgelten und korrigierten und wollten, dass Guco ihr beider Ebenbild wurde. Aber Guco war von Kindesbeinen an sehr halsstarrig und wollte seinen eigenen Willen durchsetzen, wie das für Esel wohl auch so üblich ist. Guco's Vater übte sehr viel Druck auf ihn aus und sagte oft: „Wenn du nicht ... – dann ...“ oder „Noch setzt du deine Beine unter meinen Tisch ...“ und „Du hast zu gehorchen, wenn ich dir etwas sage.“
Guco konnte alle diese Sätze und Phrasen auswendig! Wie gut er sie alle kannte! So gut, dass sie ihm fast aus den Ohren wieder herauskamen. So steckte Guco seinen Kopf tief zwischen die Schultern, so wie man das macht, wenn man Angst vor Prügel hat. Zwar war Guco selten geschlagen worden, aber die seelischen Prügel, die er bezog waren tausendmal schlimmer. So wurde Guco ruhig und zog sich immer mehr in sich selbst zurück, so, wie Schnecken es tun, wenn sie sich fürchten. Sie ziehen ihren Kopf in ihr Schneckenhaus zurück. Und genauso machte es Guco auch. Fast sah es so aus, als wenn er keinen Hals mehr hatte. Auf dem Rumpf saß gleich der Kopf.
So verging Jahr um Jahr. Und obwohl eigentlich jeder Esel einen Hals hat, verschwand Gucos immer mehr und mehr, aber er gewöhnte sich daran. Als Guco älter wurde, meinte er, dieses Gerede seines Vaters nicht mehr länger mit anhören zu müssen. So zog er von dannen. Allerdings nicht sehr weit. Einen Tagesmarsch von der Höhle seiner Eltern entfernt fand er seine eigene Höhle, wo er sich verkriechen konnte. Eigentlich hatte er ja weiterwandern wollen, aber irgendetwas in seinem Inneren hielt ihn davon ab. Hatte er seine Eltern etwa doch lieber, als er sich das eingestehen wollte? Er machte hier erst mal halt. Wenn es zu schlimm werden sollte, standen ihm eben beide Wege offen. Der schnelle Weg zurück zu seinen Eltern, die ihn sicher mit offenen Armen empfangen würden und der Weg in die Ferne – in die wahre Freiheit. Aber vorerst war es noch ganz bequem so. So lebte Guco vor sich hin. Er aß, wanderte im Wald herum, putzte und schmückte seine Höhle, faulenzte und ab und zu kamen seine Freunde zu Besuch.
Eines schönen Tages, Guco lag vor seiner Tür und sonnte sich, kam ein junger Mann des Weges. „Hey, du Esel, „ setzte der Mann zum sprechen an, „kannst du mir...“ kam aber nicht weiter, denn Guco hatte sich aufgerichtet und da fiel der junge Mann in schallendes Gelächter.
„Was? Du willst ein Esel sein? Das ich nicht lache! Sieh' dich doch mal an! Ohne Hals. Den Kopf auf dem Rumpf! Ein Hanswurst bist du! Ein Nichts!“ Und er ging lachend seines Weges.
„Selber Hanswurst“, dachte sich Guco, aber etwas zu sagen traute er sich nicht. Zu oft hatte sein Vater ihm den Mund verboten und so hatte er es aufgegeben, zu sich selbst zu stehen. Sollten die anderen doch labern und lachen! Auch ich lebe. So. Und jetzt verkrieche ich mich noch mehr. Das habt ihr nun davon! Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt.
Und so gingen die Jahre dahin. Ohne es zu merken, fingen langsam die Schultern an zu schmerzen. Die Muskeln hatten sich im Laufe der Jahre sehr stark verhärtet. Und da sie von Guco immer gegen die Natur benutzt wurden, fingen sie eines Tages an zu rebellieren. Erst ganz schwach, aber dann immer stärker. Guco versuchte es mit Medizin aus Kräutern und allerlei Wundermitteln aus dem Wald – aber nichts half. Die Schmerzen blieben.
In seiner Verzweiflung rief Guco die Feen und Geister des Waldes, auf das sie ihm helfen mögen. Eine ganze Weile verhallte sein Flehen im Wind, aber eines Tages sprach die gute Fee zu ihm: „Wenn du wahrhaft Heilung willst, mein kleiner Guco, so werde ich dir den fliegenden Teppich senden. Er wird dich in deine Vergangenheit zurück bringen. Und wenn du die Stelle findest, wo du das erste Mal unnötigerweise deinen Kopf eingezogen hast, sage dem Teppich, er möge anhalten. Dann siehe auf diese Szene deines Lebens und korrigiere sie, indem du aufrecht und frohen Mutes mit erhobenem Haupt diese Situation meisterst. Dann kehre zurück in das Hier und Jetzt und vertraue darauf, dass alles gut werden wird. Willst du das machen, kleiner Guco?“
„Ja, das will ich“, erwiderte Guco und prompt tauchte wie aus dem Nichts ein fliegender Teppich auf. Guco setzte sich drauf und der Teppich verschwand mit ihm in seine Vergangenheit. Wie ein Zuschauer sah Guco seinen Lebensfilm vor sich ablaufen und er musste an manchen Stellen sogar lachen.
„Halt, lieber Teppich“, sagte Guco, als er die Szene wieder erkannte, als er zum ersten Mal die Taktik des Kopfeinklemmens und Schultern-Hochziehens ausprobierte. Sein Vater ergoss gerade einen Redeschwall über Guco. „Du bist jetzt alt genug für die Dinge, die du tust, Verantwortung zu übernehmen“, dröhnte der Vater. „Aber bleib' immer hübsch auf dem Teppich! Sonst setzt es etwas! Ich werde nicht davor zurückschrecken, meine Hand gegen dich zu erheben!“ und hob drohend die Faust in die Luft, so dass Guco fast die Luft weg blieb und er seinen Kopf einzog, weil er dachte, dass er jeden Moment grundlos von seinem Vater geschlagen wird.
Und überhaupt: da sollte er, jung, wie er war, die Verantwortung für sich und sein Handeln übernehmen und gleichzeitig drohte der Vater ihm Schläge an? Na ja, er würde wohl Recht haben, alt und weise wie er war, dachte sich Guco und zog die Schultern noch weiter an, um seinen Kopf zu schützen. So war das also damals, dachte sich Guco, der noch immer auf dem fliegenden Teppich saß und das Ganze betrachtete. Dann dachte er sich die Szene neu und der Guco von damals zog plötzlich nicht mehr die Schultern ein.
„So, mein Teppich, ich habe getan, was die gute Fee mir sagte. Bring mich bitte jetzt wieder in das Hier und Jetzt.“
Sie flogen eine ganze Weile und Guco merkte, wie sich bei der Reise durch die Zeit seine Schultern allmählich entspannten und in ihre ursprüngliche Form zurückgingen. Es war ein wenig schmerzhaft. Aber viel schmerzlicher war die Tatsache, dass sein Vater ihm so viel Leid beschert hatte und eigentlich doch nichts dafür konnte.
Wieder im Hier und Jetzt angelangt, verschwand der fliegende Teppich so leise und lautlos, wie er gekommen war. „Ja, das hast du gut gemacht, kleiner Guco“, meldete sich noch einmal die gute Fee zu Worte. „Denk' über dein Leben unter dieser geänderten Perspektive noch einmal nach. Und je mehr du erkennst und dich davon löst und die Situationen bereinigst, desto mehr wird dein Hals wieder zum Vorschein kommen und desto geringer werden deine Schmerzen.“ Und noch ehe Guco einen Dank aussprechen konnte, war die gute Fee verschwunden. Guco blieb zurück – aber nicht mehr ganz so einsam, und er hatte das Gefühl, einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht zu haben.
Die Puppe im Garten
Es war einmal eine kleine Puppe mit hübschen, braunen Augen, glänzendem Haar und einem geschmeidigen und biegsamen Körper. Hübsche Kleider hatte sie an und feine Schühchen. Auf dem Kopf trug sie eine Schleife, die in der Sonne golden glänzte. Diese Puppe war eigentlich eine Schmuse- und Kuschelpuppe, aber diese Zeiten waren lange vorbei. Jetzt lag sie hier in diesem verwilderten Garten und keiner kümmerte sich um sie. Zu diesem Garten gehört auch ein Haus. Und zu dem Haus Menschen, aber die waren lange ausgezogen. Früher, ja früher, als sie noch kuscheln durfte mit dem kleinen Mädchen, da ging es ihr gut.
Aber eines Tages blieb das kleine Mädchen einfach weg. So lag sie noch einige Zeit in dem Zimmer des kleinen Mädchens und versuchte ihrer Trauer Ausdruck zu geben. Aber Puppen können ja bekanntlich nicht weinen und so stauten sich alle Tränen in ihrem Inneren. Sie meinte manchmal daran ersticken zu müssen, aber sie tat es nicht.
Dann kamen die beiden Menschen, die das kleine Mädchen immer Mama und Papa genannt hatte und trugen alle Sachen fort. Auch die Puppe. Zunächst standen alle Sachen im Garten und wurden dann in ein großes Auto geladen. Nur die Puppe blieb zurück. Sie fiel aus einem der vielen großen Kartons heraus und niemand hat sie mehr beachtet. Die Puppe versuchte auf sich aufmerksam zu machen, aber Puppen können bekanntlich nicht sprechen. Und so blieb sie im Garten liegen.
Alle Menschen waren weg. Sie war allein. Nachts wurde es jetzt kalt, denn der Winter war nah. Und die Zeit verging. Stunde um Stunde, Tag um Tag. Die Glocken der nahen Kirchturmuhr verkündeten es. Aber unsere Puppe hatte darauf keinen Einfluss. Sie lag im Gras und starrte in den Himmel, diese endlose Weite über ihr und sie konnte sich noch nicht einmal bewegen¬ denn sie war ja nur eine Puppe. Dazu geboren, immer zu gehorchen, immer zu schweigen und keine eigene Meinung zu haben. Das sollte wohl ihr Schicksal sein. Aber sie gab nicht auf. Eigentlich wäre sie nämlich viel lieber ein Mensch gewesen. Ein Mensch mit Gefühlen, der leben und atmen konnte, der die Freiheit und die unendliche Weite des Alls genießen konnte. Ein Mensch, der Spaß haben konnte und der viel lesen, hören und lernen konnte. Es gab doch so viel zu entdecken auf der Welt! Aber sie war eben nur eine Puppe.
Die Zeit verging. Der Winter kam und bedeckte sie mit Schnee. Das schöne Kleidchen wurde schmutzig und die Haare verfilzten. Die Puppe fröstelte. Und wäre sie ein Mensch gewesen, so wäre sie sicherlich schon lange tot gewesen.
Das Frühjahr kam, und es wurde langsam wieder wärmer. Eines Tages hörte die kleine Puppe Stimmen in der Nähe des Gartens. Ganz fest klammerte sie sich an den Gedanken, dass jemand sie finden möge und wieder lieb zu ihr war. Was war denn eine Schmusepuppe wert, die im Garten im Gras lag? Das war nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe war anderen Menschen ein Gefühl der Wärme und Geborgenheit zu geben, weil viele Menschen untereinander es nämlich nicht können. Und so sind die Puppen ein Ersatz dafür.
Die Stimmen kamen näher. Ja, aber... das war doch mein Menschenkind, das da stand! „He, du, siehst du mich denn nicht? Ich bin es, deine Puppe! Ich möchte wieder zu dir! Ich möchte dir Liebe, Wärme und Geborgenheit geben! „ Das Menschenkind kam jetzt genau auf die Puppe zu. Nun sieh’ doch endlich mal auf den Boden! Nicht nur in den Himmel! Hier auf dem Boden im Dreck bin ich. Auch wenn ich derzeit keine Schönheit mehr bin, lieben kann ich noch immer! Liebe ist nicht von Äußerlichkeiten abhängig.
„Menschenkind, bitte pass doch etwas besser auf. Fast wärst du auf mich drauf getreten. Mein Kleidchen hast du schon fast berührt. Sieh' mich doch einmal an! „
Aber das Menschenkind entfernte sich schon wieder, blieb eine Weile am Baum stehen, umarmte ihn und wandte sich dann wieder ab. Was war denn das? Das Menschenkind weinte ja! Mit so einem verschleierten Blick konnte es mich ja auch nicht sehen, dachte die Puppe bei sich. Das Menschenkind putzte sich die Nase, wischte noch einmal die Augen und plötzlich fiel sein Blick auf die Puppe. Es traute seinen Augen nicht. Zögernd kam es auf die Puppe zu.
„Ja, Runa, das bist ja du!“, sagte das Menschenkind und hob die Puppe sacht hoch. So lange hab’ ich dich gesucht. Bin ich froh, dass ich dich wieder gefunden habe! Ich werde dich mit nach Hause nehmen und deine Kleidchen waschen. Jetzt sollst du es wieder gut haben!“
Viele, viele Jahre sind seitdem vergangen, aber die Puppe ist noch immer bei ihrem Menschenkind und wird wohl auch jetzt für immer dort bleiben.
Die Reise des Bettelkönigs
Es war einmal eine Wahrsagerin, die am Ufer eines breiten Flusses wohnte. Sie lebte dort einsam und zurückgezogen in einer kleinen Hütte. Die meisten ihrer Kunden kamen mit dem Boot zu ihr, denn so war es am bequemsten. Dort am Ufer konnte man schön anlegen und das Boot festmachen, damit es von der Strömung des Flusses nicht weggerissen wurde. Wollte man die Hütte der Wahrsagerin von der anderen Seite aus erreichen, so musste man lange, verschlungene Pfade durch den Wald gehen und es bestand die Gefahr, dass man sich in dem dunklen Wald verirrte.
Eines Tages war ein älterer Mann bei der Wahrsagerin und wollte etwas über seine Zukunft wissen. Dieser ältere Mann war ein getarnter König, der sich in der Kleidung eines Bettlers die Dienste der Wahrsagerin zu Nutze machen wollte ohne die Gegenleistung, Geld oder Essen, dafür zu geben. Die Wahrsagerin spürte, dass etwas mit diesem älteren Herrn nicht in Ordnung war, und ihre Zauberblume ließ plötzlich und unerwartet den Kopf hängen. Der ältere Herr beklagte sich über dieses und jenes und wollte die Wahrsagerin aushorchen und für seine Ziele ausnutzen.
„Dein Leben ist wie eine Fahrt mit dem Boot auf dem Fluss. Du hast vielerlei Möglichkeiten. Du kannst gegen den Strom rudern, aber das kostet Kraft. Andererseits brauchst du nicht rudern, wenn du mit dem Strom fließt. Du kannst es aber tun, um noch schneller zu sein. Die beste aller Möglichkeiten aber ist, sich treiben zu lassen und nur das Ruder zur Kurskorrektur zu benutzen", sprach die Wahrsagerin und sah dem Mann fest in die Augen.
„Das ist ja alles schön und gut, was du mir da erzählst, aber das weiß schon ein kleines Kind. Ich will von dir wissen, was mir die Zukunft bringt", meinte der ältere Herr, jetzt schon sichtlich etwas nervöser und aufgeregter.
„Benutze dein Boot und schärfe deine Sinne. Mehr kann ich dir nicht sagen, „ entgegnete die Wahrsagerin.
„Wenn du mir nicht helfen willst, dann lässt du es eben“, tobte der ältere Herr, „aber erwarte nicht von mir, dass ich mich erkenntlich zeige.“ Sprach’s und verließ fluchtartig das Haus der Wahrsagerin.
Kaum war der Mann wieder draußen, richtete sich die Zauberblume wieder auf. „Er ist kein guter Mensch. Er hat böse Absichten. Ich fühle mich schlecht, wenn er in der Nähe ist, „ sagte die Zauberblume zur Wahrsagerin.
„Nein, ich glaube, du irrst dich“, entgegnete diese. „Er hat sich nur getarnt. Es gibt keine bösen Menschen. Tief in seinem Innern ist jeder Mensch gut und weise. Du wirst schon sehen!“ Und die Zauberblume wurde das Gefühl nicht los, als wenn ihr noch ein interessantes Erlebnis mit diesem Mann bevorstand.
Kaum hatte sie das gedacht, klopfte es an der Tür und der ältere Mann betrat den Raum wieder. „Mein Boot ist weg“, erklärte er ganz aufgebracht. „Ist einfach ohne mich davon getrieben! Bitte helft mir! Wie komme ich jetzt wieder hier weg?“ Der Mann atmete ganz schwer.
„Ich werde dir meinen Heißluftballon leihen“, erklärte die Wahrsagerin. „Wenn du das Gesetz des Lebens auf der Reise entdeckst, so wird er dich schnurstracks nach Hause bringen. Erkennst du es aber nicht, so wird er sich einen Ort aussuchen, an dem er dich absetzt. Willst du dieses Risiko eingehen oder lieber zu Fuß durch den Wald marschieren? Sprich!“
Der König fackelte nicht lange mit seiner Antwort, denn ihm als König ziemte es nicht, zu Fuß zu gehen. Wenn ihn nun jemand trotz dieser zerlumpten Kleidung erkennen würde! Nein. Unmöglich. Er musste das Risiko mit dem Ballon eingehen und überhaupt: Es gab doch sicher einen Weg, diesen Ballon zu überlisten.
„Ich nehme den Ballon“, verkündete er voller Stolz. Einige Minuten später waren alle Vorbereitungen getroffen und der getarnte König stieg in den Ballon und schwebte los.
„So, Ballon, jetzt aber mit Volldampf zu meinem Schloss!“, sagte der König. Aber genau in diesem Moment drehte sich der Ballon in die entgegengesetzte Richtung.
Der König wurde wütend. „Du hast gefälligst zu gehorchen“, schrie er und noch einige andere Worte, die sich eigentlich nicht gehörten. Und schon gar nicht für einen König. Der Heißluftballon segelte jetzt genau über einem kleinen Fluss entlang. Am Ufer standen viele Bäume und Wälder, eine wunderschöne Landschaft in der Abendsonne. Aber all das sah der König nicht in seiner blinden Wut und Raserei. So konnte er die Gesetze des Lebens niemals entdecken! Aber der Ballon hatte Zeit und Geduld. Er flog gemächlich dahin, schüttelte sich und seinen Insassen etwas durch und ... verlor langsam und stetig Luft aus einem kleinen Loch an der Oberseite des Ballons.
Als der König das bemerkte, wollte er die Luft wieder auffüllen, aber die Ersatzflaschen waren leer. Der König bäumte sich noch einmal auf, schimpfte wie nichts Gutes und nach stundenlangem Zaudern gab er den Kampf auf, weil es keinen Sinn mehr hatte und er sich seinem Schicksal ergeben wollte.
„Ach, was soll's“, sagte er. „Sterben muss jeder einmal. Der eine eher und der andere später. Hätte ich gewusst, dass ich so früh schon sterben muss, hätte ich mehr gelebt und mehr Freude in mein Leben gelassen. So ist mein Leben nur trist und öde verlaufen. Adios, schöne Welt. Es war nett mir dir!“ Und kaum hatte er zu Ende gesprochen, bekam der Ballon wieder Auftrieb, änderte automatisch seinen Kurs und flog geradewegs zum Schloss des Königs. Dort angekommen setzte er den König auf dem obersten Plateau ab und machte sich selbst auf den Heimweg.
„Danke für alles“, rief der König ihm nach. „Sage auch Dank der Wahrsagerin, die immer gewusst hat, was für mich gut ist. Ich werde mich bei nächster Gelegenheit erkenntlich zeigen.“ Und mit einer Träne im Auge winkte er dem Ballon hinterher.
Der Teufel und der Ring der Königin
Es war einmal ein Teufel, der den starken Wunsch hatte, das wertvollste, was die Königin Rakutina des Schlosses Babur in Baburien hatte, zu besitzen. Es war ihr Zauberring, den sie immer bei sich trug. Bei Tag und Nacht und bei jeder Gelegenheit. Man sagte diesem Ring nach, dass er den Menschen, der ihn trug, verzaubern könne. Diesem Menschen würden alle Wünsche erfüllt werden. Egal, welche. Ob es Geld war oder eine Maus in der Speisekammer. Und Königin Rakutina hatte wirklich alles, was ein Mensch sich vorstellen konnte. Ein schönes Schloss, Diener um sich herum, so viel Geld, das sie gar nicht alles ausgeben konnte, einen riesengroßen Kleiderschrank, der voll beladen war, Schmuck in allen Farben und Formen und viele liebe Menschen um sich herum. Man sah es der Königin auch an. Sie strahlte, lachte den ganzen Tag und war fröhlich – und: sie steckte ihre Mitmenschen damit an! Niemals hatte man sie weinen sehen – es gab ja auch keinen Grund dazu.
Eines Tages nun wurde der Frieden auf Schloss Babur jäh unterbrochen, als die Kunde umging, man habe den Teufel im Schloss gesichtet. Sofort herrschte Unruhe und Geschäftigkeit, denn jedermann hatte Angst vor dem Teufel, der einen mit in die Hölle nehmen konnte und da wollte schließlich keiner hin. Man wollte jetzt die Königin schützen und alarmierte die Schlossarmee, die sich auch sofort auf den Weg zur Königin machte. Rumpelnd stampften sie durch die langen Flure des Schlosses und die Schwerter und Schilde klirrten, das es sich gespenstisch anhörte.
Aber die Arme kam zu spät. Der Teufel, flink, wie er war, war schon längst in die Gemächer der Königin eingedrungen und bedrohte die Königin mit einer Lanze. Die sonst immer lachende und fröhliche Königin war merklich stiller geworden. Die Gesichtszüge waren angespannt. „Sage deinen Mannen, sie sollen sofort wieder kehrt machen, oder ich durchbohre dich!“ herrschte der Teufel die Königin an. „Los, mach' schon!“
„Aber lieber Teufel“, meinte Rakutina betörend, „du hast mich doch bedroht. Es ist doch ganz verständlich, dass man um mich besorgt ist und mir deshalb meine Leibgarde schickt. Höre auf, mich zu belästigen, verlasse das Schloss und meine Mannen werden sich auch wieder zurückziehen können!“
„Nein. Ich werde das Schloss nicht ohne deinen Zauberring verlassen. Also gib' ihn schon her – oder du stirbst!“ giftete der Teufel. Aber die Königin blieb ruhig, denn sie kannte das Geheimnis des Rings.
„Also gut, Teufel. Wenn du gar so uneinsichtig bist, so werde ich dir deinen ach so sehnlichen Wunsch erfüllen. Allerdings unter einer Bedingung: Du darfst keine weiteren Fragen stellen und verlässt wortlos mein Schloss!“
„Ich sehe, meine teure Königin ist doch klüger als sie aussieht. Ich verspreche es und jetzt gib' mir den Ring!“ Die Königin nickte wortlos, hob ihre linke Hand und besah sich noch einmal den Zauberring, den sie bereits im Kindesalter von einer alten, weisen Zigeunerin erhalten hatte. Ein großer, roter Edelstein funkelte dort. Rundherum glänzten und glitzerten viele Diamanten. Die Fassung war mit vielen Verzierungen versehen und aus purem Gold. Man sah auf den ersten Blick, dass es ein sehr wertvoller Ring war.
Langsam und zögernd zog die Königin den Ring von ihrem Finger. „Hier überreiche ich dir mein Geschenk“, sprach sie und hielt es dem Teufel hin, der ihr den Ring sofort aus der Hand riss. Im gleichen Moment aber wurde der Ring zu Stein.
„Was soll das?“ brüllte der Teufel aufgebracht. „Du hast den Ring verhext. Ich will sofort das haben, was mir zusteht!“ Aber Rakutina sah ihn nur mitleidig an und erinnerte ihn an das Versprechen, das er nur wenige Minuten zuvor gegeben hatte. Die Leibgarde der Königin hatte die Gewehre im Anschlag, um Rakutina jederzeit schützen zu können. Aber der Teufel sah ein, dass er keine Chance mehr hatte. Das Gute hatte gesiegt.
„Ein Zauberring hat nur für den Wirkung, der ihn immer und ständig bei sich trägt. Der wahre Wert ist nicht der Wert des Goldes oder der Edelsteine. Den wahren Wert des Zauberringes kann man nur dann sehen, wenn der rechtmäßige Eigentümer ihn an der Hand trägt. Das ist seine Bestimmung und dann wird auch alles Gute zu dem Träger des Ringes fließen!“ sprach Rakutina und nahm den Stein wieder an sich und wog ihn in den Händen.
„Jetzt löse dein Versprechen ein und geh'!“ Widerspruchslos gehorchte der Teufel und in dem Moment, wo er zur Tür hinaus war, wurde aus dem Stein wieder der wunderschöne Zauberring, der er zuvor gewesen war. Die Leibgarde der Königin begleitete den Teufel noch zum Tor des Schlosses hinaus und er wurde auf Schloss Babur in Baburien nie wieder gesehen.
Sterntaler und der Wanderer Kladibu
Es war einmal ein armer Wanderer. Viele Jahre schon war er unterwegs, um seinen Lebensinhalt zu suchen. Aber gefunden hatte er ihn noch nicht. Viele Städte und Dörfer hatte er gesehen, viel Leid und viel Glück und viele, viele Menschen. Große und kleine, dünne und dicke, liebe und böse, junge und alte. Bei einigen hielt er es eine Weile aus und sie hatten eine schöne Zeit zusammen, aber dann zog es ihn wieder weiter.
Eines Tages wanderte er mutterseelenallein durch den tiefen, finsteren Wald und der Weg schien kein Ende zu nehmen. Die Bäume waren groß und stark und das Gestrüpp Natur belassen. Die Vögel zwitscherten, eine kleine Hasenfamilie kreuzte seinen Weg. Es war friedlich und doch war das Herz des Wanderers schwer. Es war gerade so, als ob ein dicker Stein auf seinem kleinen Herzen war und er hatte keine Ahnung, wie er ihn dort weg bekommen sollte. Und weil es eigentlich angenehm warm war, setzte er sich an einen großen Baum und ruhte sich ein wenig aus. Er machte es sich im frischen Moos bequem und schlief ein. Er träumte ganz lebendig davon, endlich am Ziel seiner Träume zu sein und meinte, eine Stimme zu hören, die ihm zuflüsterte, er möge nicht zu sehr suchen und bei dem ganzen Gesuche sein eigentliches Ziel aus den Augen verlieren. Und er hörte die Stimme so deutlich, dass er erschrak und schnell die Augen öffnete. Und da erschrak er noch mehr, denn vor ihm stand ein Mann mit langem, weißen Bart und einer Zipfelmütze auf dem Kopf. Er hatte ein strahlend blaues Gewand an auf dem tausend kleine, goldene Sterne blitzten und funkelten.
„Einen wunderschönen guten Tag, Kladibu. Ich bin der Zauberer Esra al Gudat, der Herrscher des Waldes. Ich möchte dir gern helfen, denn ich mag die Menschen und ich kenne die Antwort auf deine Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn du möchtest, sehen wir uns dein Leben einmal mit etwas Abstand an und du wirst die Antworten auf deine Fragen finden. Wenn du willst, so komm' zu mir auf meinen fliegenden Teppich,“ sprach Esra und machte eine einladende Handbewegung.
Wortlos und mechanisch gehorchte Kladibu seinen Worten und bestieg den Teppich. Kaum war er drauf, erhob er sich und Nebel bedeckte die Sicht. „Wo fliegen wir hin?“ fragte Kladibu.
„Du wirst schon sehen“, antwortete der Zauberer und lächelte. Plötzlich tauchte wie aus dem Nichts eine Lichtung vor Ihnen auf und der fliegende Teppich senkte sich langsam auf den Boden.
„So, da sind wir. Bitte denke nur und sage nichts. Gehe ruhig hin und wünsche dir, dass Sterntaler kommen möge. Ich bin mir ziemlich sicher, sie wird kommen und dir den Sinn des Lebens zeigen. Nur: dränge sie nicht und gehe behutsam mit ihr um, denn sie ist sehr verletzlich.“ Und so geheimnisvoll, wie er vorhin gekommen war, ging er auch wieder. Kladibu setzte sich mitten auf die Wiese und genoss in vollen Zügen. Er genoss den Wind, der um sein Haar spielte, den Duft der Blumen und die wärmenden Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Ach, schön ist das Leben, seufzte er, wenn ich nur meinen Lebensinhalt schon gefunden hätte. Aber wer weiß, vielleicht kann Sterntaler ihn mir zeigen oder mir sagen, wo ich ihn finden kann.
„Nein, das kann ich leider nicht“, sagte da plötzlich eine liebliche Stimme aus dem Hintergrund. Kladibu schreckte von seinem Platz hoch. „Wer ist da? Zeige dich!“ rief er, denn ein bisschen Angst hatte er schon.
„Du brauchst keine Angst vor mir zu haben“, sagte die Stimme wieder und Kladibu bemerkte, dass sie aus der Richtung des großen Baumes kam. „Hier oben bin ich, im Lebensbaum. Komm' zu mir!“
Und jetzt erst entdeckte Kladibu das wunderschöne Sternenmädchen, das dort oben im Baum saß. Es hatte dunkle Haare und noch dunklere Augen und er hatte das Gefühl, als wenn diese Augen durch ihn hindurch sehen können. Fast willenlos ging er auf diesen schönen, alten Baum zu und entdeckte, dass er ohne Schwierigkeiten zu dem Sternenmädchen gelangen konnte, kletterte also in den Wipfel und setzte sich dem Sternenmädchen gegenüber. Etwas mulmig war ihm schon.
„Ich bin Sterntaler und von der himmlischen Regierung beauftragt, fortan mit dir zu gehen, denn ich bin der Sinn deines Lebens.“
Kladibu fiel die Kinnlade herunter. Damit hatte er nun überhaupt nicht gerechnet. Erst trifft er einen Zauberer und kurz darauf den Sinn des Lebens, den er so lange gesucht hatte. Er kam aus dem Staunen nicht heraus und konnte es noch nicht richtig begreifen, was hier geschehen ist und erbat sich etwas Bedenkzeit.
„Gern“, sagte Sterntaler. „Wir haben alle Zeit der Welt. Wir sind füreinander bestimmt und werden den Rest unseres Weges auf dieser Erde jetzt gemeinsam gehen.“ Und Sterntaler erzählte aus ihrem Leben, erzählte von dem Auftrag der himmlischen Regierung, den sie hier auf Erden zu erfüllen hatte und sie sagte Kladibu, das sie sich auf die gemeinsame Zeit mit ihm freut.
Als der Abend dämmerte, hatte auch Kladibu sich in Sterntaler so sehr verliebt, dass auch er sich ein Leben ohne Sterntaler nicht mehr vorstellen konnte. So ritzten sie noch ihre Namen in den Baum des Lebens, weil das so üblich war und gingen dann gemeinsam Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen.
Die Prinzessin und der Höllenhund
Es war einmal ein Höllenhund namens Wandi. Er lebte im großen Wald draußen vor der Stadt und viele Menschen hatten Angst vor ihm. Man sagte ihm nach, dass er die Macht besitzt, jedermann, der nicht nach seiner Nase tanzte, an den Galgen zu bringen. So mieden die Leute den Wald. Aber das war nicht das Schlimmste an der Geschichte. Ohne den Wald konnte man auskommen. Die Menschen wollten aber ihren König sehen und seine wunderschöne Tochter, die am anderen Ende dieses Waldes lebten und derzeit nur in eine Richtung regieren konnten, denn zwischen ihren anderen Untertanen war der große Wald mit dem Höllenhund, den alle so sehr fürchteten.
Die Tochter des Königs, Prinzessin Anuga, hatte nun eines Nachts einen Traum. Ein Engel war ihr erschienen und hatte ihr gesagt, dass sie ihre Angst vergessen sollte, denn es gäbe nichts, rein gar nichts, worüber sie sich Sorgen machen müsste. Sie sollte die Zugbrücke, die über den breiten Schlossgraben führte, herunter lassen und ständig unten lassen, damit jedermann rein und raus konnte. Weiterhin sollte sie die Wachen dort wegnehmen und ein großes Schild an das Tor hängen mit der Aufschrift: „Jedermann ist uns gern willkommen. Bitte tretet ein.“
Alleine aber konnte die Prinzessin Anuga das nicht entscheiden, obwohl sie ja schon alt genug war. Sie brauchte die Einwilligung ihres Vaters; und sie befürchtete, dass er nie sein Einverständnis geben würde. Und so war es auch.
„Bist du verrückt geworden?“ polterte er los, als sie ihr Anliegen vorgebracht hatte. „Ich habe genug Probleme, die gelöst werden sollen und da kommst du und sagst, ich soll mein Heim auch noch für Fremde öffnen und für den stadtbekannten Höllenhund, vor dem sich jedermann fürchtet? Du bist ja nicht bei Sinnen! Geh' in dein Zimmer und komm' da nicht eher raus, bis ich es dir erlaube!“ Und dabei überschlug sich seine Stimme fast.
„Aber ich ...“ machte die Prinzessin einen neuen Versuch.
„Ruhe! Ich dulde keine Widerrede! Marsch!“ Die Stimme des Königs fing an zu zittern und er wurde kreidebleich. Die Prinzessin ging traurig in ihre Gemächer und überlegte, was sie tun konnte. Und wieder erschien ihr im Traum der Engel.
„Habe ein wenig Geduld“, sagte er. „Es wird sich alles fügen. Alles zur rechten Zeit.“
Als die Prinzessin am nächsten Morgen aufwachte, war sie voller Zuversicht und Vertrauen und machte sich auf, ihren Vater zu besuchen. Man sagte ihr, dass es ihm nicht gut ginge und er stöhnend im Bett liegen würde. Und so machte sich die Prinzessin auf zu seiner Kammer. „Ach, Anuga, mein Kind“, sagte er. „Ich fürchte, es geht mit mir zu Ende und dabei wollte ich noch so viele Dinge erledigen. Das wirst du jetzt für mich tun müssen.“ Seine Stimme war schwach und kaum zu verstehen.
„Nein, Vater, noch ist es für dich nicht Zeit zum Sterben. Du hast noch ein paar Jahre zum Leben. Also werde wieder gesund!“
„Ach, mein Kind, ich bin ein alter Mann und des Lebens überdrüssig. Ich habe vom Leben nicht viel gehabt und du sollst es besser haben als ich. Was möchtest du denn für Wünsche erfüllt haben?“
„Ich möchte, dass du die Zugbrücke öffnest, „ sagte Anuga ruhig.
„Nein, das ist mein Tod!“ schrie der König.
„Ich verstehe dich nicht, Vater. Eben erzählst du mir, du seiest des Lebens überdrüssig. Dann können wir auch die Tore öffnen!“ flehte die Prinzessin und sie war, wie so oft, dem weinen nahe. „Ich habe keine Angst vor dem Höllenhund. Er wird uns nichts tun.“
Der König überlegte noch einen Mund und sagte dann ganz leise: „Also, in Gottes Namen. Mach', was du meinst!“ Und die Prinzessin rannte los. Die Kunde, das die Zugbrücke gefallen war, verbreitete sich in Windeseile im ganzen Land und setzte die Menschen in Erstaunen. Neugierig kamen sie in Scharen, um das Wunder zu sehen. Auch dem Höllenhund blieb diese Nachricht nicht fern und auch er machte sich auf den Weg zum Schloss.
Mit großen, schweren Schritten stapfte er auf das Schloss zu. Bedrohlich sah er aus mit seinen großen Pranken, aber wenn man genau hin sah, hatte er traurige Augen. Der Höllenhund ging in das Schloss hinein und steuerte geradewegs auf die Kammer des Königs zu und öffnete die Türe. Der König und die Prinzessin erschraken.
„Mein Ende naht“, sagte der König dumpf und vergrub sich tiefer in seine Kissen. Die Prinzessin Anuga aber hatte ihre Courage nach dem kurzen Schrecken wieder gefunden und steuerte geradewegs auf den Höllenhund zu.
„Halt!“ sagte dieser. „Bitte bleib' stehen! Ich tue euch nichts zuleide. Ich möchte euch nur kurz erzählen, dass die ganzen Geschichten über mich nicht wahr sind. In Wirklichkeit bin ich etwas ganz anderes, wie ihr noch sehen werdet. Aber die Angst der Menschen hat auch ihren Blick verschleiert. Seit Jahren warte ich auf den Menschen, der keine Angst vor mir hat und mich erlösen kann. Ich glaube, ich habe diesen Menschen jetzt gefunden. Und wenn du, Anuga, mir deine Liebe zeigst, so will ich dich glücklich machen!“ Und die Augen des Höllenhundes blickten die Prinzessin bittend an. Selbst der König wurde ein wenig sentimental und überdachte seine Einstellungen. Die Prinzessin Anuga aber trat auf den Höllenhund zu, umarmte ihn und küsste ihn mitten auf die Nase. Im gleichen Moment gab es einen großen Knall und ein Blitz zischte durch den Raum. Und die Prinzessin fand sich in den Armen eines großen, starken Jünglings wieder und verliebte sich sofort in ihn – und er sich in sie. Worte waren in diesem Moment überflüssig.
„Danke“, sagte der Jüngling. „Nur Liebe kann uns erlösen. Und das ist es, was den Menschen fehlt. Wir wissen es jetzt und können dieses Wissen jetzt an alle Menschen auf der Welt weitergeben. Liebe sagt mehr als Worte!“
Der König wurde wieder gesund und das junge Paar war bald stadtbekannt als 'die Boten der Liebe'.
Die Diamantenstadt
Es war einmal eine wundersame Stadt, die bestimmt früher einmal sehr hübsch gewesen sein mochte. Aber jetzt war sie trist und leer. Keine Menschenseele weit und breit. Alle waren fort. Fort gegangen aus der öden Stadt, denn alle wollten dorthin, wo das Leben war und wo sie meinten, ihr Glück zu finden.
Eines Tages kam eine hübsche, junge Frau mit ihrem Hund in diese Stadt. Es war gerade Herbst und der Winter brach herein. Schade, dachte die junge Frau bei sich, wie lebendig mag es wohl früher hier gewesen sein? Sicher waren die Häuser bunt gewesen und Blumen haben geblüht. Jetzt blätterte die Farbe von den Häuserwänden, die Vorgärten waren verwildert und Schnee lag über der Stadt. In jeder Ritze, in jedem Winkel.
Ach, dachte die Frau, es ist kalt hier. Aber ich denke, ich muss hier bleiben. Wenn ich weiterziehe überrascht mich vielleicht ein Schneesturm. Ich werde es mir hier gemütlich machen. Sie sah sich die Häuser genau an und suchte sich zum Verweilen das schönste aus. In dem Haus war alles vorhanden, was sie so zum Leben brauchte. Kleidung, Essen, Möbel und etwas zum Lesen. Sie arbeitete einige Tage sehr hart, machte das kleine Häuschen sauber und fühlte sich dann recht wohl in ihrem neuen Heim, das wahrlich sehr gemütlich war.
Eines Abends saß sie am Fenster und im Kamin prasselte das Holz. Sie hockte warm eingepackt in eine wollene Decke in ihrem Schaukelstuhl und blickte hinaus in die Weite des Universums. Es war Vollmond und die Sterne funkelten und blitzten am Firmament. Ein Lichtstrahl brach sich an der Kirchturmspitze und schien genau auf die junge Frau zuzukommen. Plötzlich hatte sie das Gefühl, in die Kirche gehen zu müssen und ohne zu überlegen verließ sie ihren warmen Platz am Kamin und ging hinüber zur Kirche. Begleitet wurde sie von dem Funkeln der Sterne und sie wünschte sich, dass die ganze Welt voller Diamanten wäre. Das wäre ein Schauspiel! Sie ging in die Kirche hinein und traute ihren Augen nicht. Da waren lauter Diamanten! Sprachlos vor Erstaunen kniete sie nieder und dankte Gott aus tiefstem Herzen für das, was sie erleben durfte und dankte ihm dafür, dass immer noch Wunder auf dieser Welt geschehen.
„Ja, mein Kind, du hast Recht, „ sagte eine alte Stimme plötzlich, die von überall und nirgends zugleich kam, „es können noch Wunder geschehen – aber nur demjenigen, der auch an Wunder glaubt! Glaube – und dir wird nichts geschehen. Glaube – und dir passieren die wundersamsten Dinge!“ Und so, wie die Stimme gekommen war, ging sie auch wieder – aber das Glücksgefühl, das die junge Frau empfand, blieb. Ja, es wurde sogar noch stärker. Es war wie eine wunderbare Kraft, die von innen kam. Und mit jedem Diamanten, den sie betrachtete, mochte er auch noch so klein sein, vergrößerte sich dieses Gefühl.
Der Frühling kam und der Schnee schmolz. Und mit dem Frühling kamen auch die Leute zurück, die einst in dieser Stadt gelebt hatten, denn die Kunde von den Diamanten verbreitete sich schnell. Viele Menschen konnten sie gar nicht sehen und schimpften und zogen wieder weiter, aber die junge Frau blieb an diesem Ort, der ihr jetzt so gut gefiel. Und sie half den Menschen, die kamen, die Diamanten, die überall herumlagen, zu sehen und nicht nur den Staub und Dreck. Und sie lebte glücklich bis an ihr diamantenes Ende.
Der Besuch der Brieftaube
Es war einmal eine wunderschöne, strahlendweiße Brieftaube, deren Beruf es war, Briefe und kleine Geschenke von einem Ort zum anderen zu bringen. Ihr machte es sehr viel Spaß, aber glücklich war sie nicht. Tagaus, tagein flog sie durch die Lande, aber dass aufgrund der vielen Arbeit einmal etwas Außergewöhnliches passiert wäre, konnte sie nicht sagen. Ein Tag war wie der andere und so verging die Zeit wie im Fluge. Und dennoch: die Sehnsucht unseren kleinen Täubchens nach mehr Abwechslung blieb unauslöschlich in ihrem Herzen verankert.
Eines Tages nun hatte unsere kleine Brieftaube die Aufgabe, einen Brief an die von allen gefürchtete Hexe Burgel zu bringen. Wer mochte wohl der Hexe schreiben? Noch nie hatte sie einen Brief erhalten! Und jetzt bekam sie einen wunderhübschen mit vielen kleinen Verzierungen und einer hübschen Handschrift. Wusste denn der Schreiber dieses Briefes nicht, dass die Hexe böse war? Konnten böse Hexen Freunde haben?
Aber unser Brieftäublein schob alle ihre Ängste beiseite und machte sich auf in Richtung zu dem kleinen Hexenhäuschen mitten im Wald, wo es so dunkel war. Kurz vor dem Haus hielt die Taube inne. Was war das? Um das Hexenhäuschen herum wuchs eine riesige Mauer von großen Ausmaßen. ‚Wie soll ich bloß die Mauer bewältigen?‘, dachte die arme Brieftaube, der man aufgetragen hatte, immer getreulich ihre Pflicht zu tun und nicht zu murren. Und so flog sie weiter, guckte sich noch einmal um, ob es nicht irgendwo ein Türchen zum durchschlüpfen gab und machte sich dann auf den Weg nach oben. Aber je höher sie flog, umso höher wurde die Mauer rings um das Hexenhäuschen und bald musste das Täubchen aufgeben, denn höher konnte es nun wirklich nicht fliegen und Kräfte für den Abstieg brauchte es ja schließlich auch noch.
So ließ es sich langsam wieder zu Boden gleiten und blieb ziemlich sprachlos vor der riesengroßen Mauer liegen und ruhte sich erst einmal etwas aus. Aber es musste ja seine Pflicht tun und der Hexe ihren Brief bringen! Das Täubchen machte nach dem anstrengenden Flug erst mal eine Mittagspause und sammelte wieder Kräfte. Aber der Gedanke, wie es die Mauer überwinden konnte, beschäftigte es doch sehr und da es schon einmal von den Waldgeistern gehört hatte, betete unser Täubchen und bat die Geister um Rat. „Hallo“, rief es in den Wald hinein, „Waldgeister, bitte helft mir! Ich soll der Hexe Burgel einen Brief bringen, aber ich kann die Mauer nicht überwinden. Bitte sagt mir, was ich tun kann!“
„Je mehr du es unbedingt willst, desto weniger wird die Mauer fallen“, sprach eine dunkle Stimme, die direkt von oben kam. Aber zu sehen war nichts.
„Das verstehe ich nicht“, sagte unsere Taube. „Ich muss doch diesen Brief wegbringen zu der Hexe, die hinter dieser Mauer wohnt. Ich muss meine Pflicht erfüllen. Und das ist meine Pflicht. Also sagt mir, wie die Mauer fallen kann!“
„Rede nicht in diesem Ton mit uns, sonst verraten wir dir das Geheimnis nie!“ Das Täubchen sann eine Weile nach. Sie hatten Recht. So kam es bestimmt nicht weiter. Also musste es sich etwas einfallen lassen.
Eine Weile verging, ohne dass etwas geschah. „Liebe Waldgeister, ich habe es mir überlegt. Ich möchte nett sein und vielleicht ist dieser Brief für die Hexe sehr wichtig. Bitte helft mir, dass sie diese Informationen erhält. Ich werde dann jedermann erzählen, wie gut ihr mir geholfen habt und das niemand vor dem dunklen Wald und euch Angst zu haben braucht.“ Sprach es und die Mauer verwandelte sich zu einem Nebel, durch den unser Täubchen hindurch fliegen konnte. Gleich darauf sah es auch das Hexenhäuschen und bekam es mit der Angst zu tun. Was war, wenn die Hexe böse war? Oder ihr gar ein Leid zufügen wollte? Kaum hatte es das gedacht, ging die Tür auf und ein freundliches Gesicht lächelte unser Täubchen an. Es gehörte zu einer Frau, die wunderhübsch aussah und an eine Zigeunerin erinnerte. Barfuß, mit langen, pechschwarzen Haaren stand sie dort in der Tür und lächelte.
„Aber, aber.... Ich dachte immer, Hexen wären alt und grau und runzelig und haben einen Raben auf der Schulter“, stammelte das Täubchen, das gar nicht so recht wusste, was es von dieser Situation halten sollte. „Wie du siehst, bin ich anders. Und ich bin auch keine Hexe. Die Menschen halten mich dafür, weil sie die wahren Werte nicht erkennen können, sondern nur nach dem äußeren Schein gehen.“
„Ach so, „ meinte das Täubchen und verstand jetzt gar nichts mehr. „ Siehst du, es ist so: man sollte immer das tun, was einem wirklich Spaß macht. Und ich fühle mich hier in meinem Häuschen mit meinen Büchern sehr wohl. Hier kann ich in Ruhe lesen und schreiben und wenn ich will, mit den Menschen zusammen sein, die den wahren Sinn des Lebens erkannt haben. Leben ist nicht nur Pflichterfüllung. und Arbeit. Leben ist auch Spaß. Und wenn man mit dem, was einem Spaß macht auch noch für den Lebensunterhalt sorgen kann, so hat man doch die Idealform gefunden!“
„Ach, liebe Hexe“, sprach die Taube, jetzt ein wenig traurig, „wie kann ich diese Idealform finden? So lange schon bin ich auf der Suche und habe es noch nicht gefunden!“
„Öffne den Brief, den du im Schnabel hältst. Er enthält die Antwort!“
„Aber der Brief ist doch für dich bestimmt!“ entgegnete das Täubchen. „Den kann ich doch nicht so einfach aufmachen!“
„Natürlich kannst du es. Es ist ein Brief, der um die Welt geht. Auch du kannst seinen Inhalt für dich nutzen.“
Mit etwas zittrigen Flügeln öffnete das Brieftäubchen den Umschlag und da stand: „Alle Schätze liegen in dir. Nutze sie und gebe sie an andere weiter. Dann werden sie dir nutzen.“ Und in dem Moment verstand unser Täubchen, lächelte und ein paar kleine Freudentränen erschienen in seinen kleinen Äugelein. Es bedankte sich und fand seinen Weg ohne fremde Hilfe. Und es lebte lange glücklich und zufrieden ohne Pflichten – aber dafür jetzt mit Spaß!
Die Zusammenkunft der großen Drei
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da kamen der Paradiesapfel, die Wolke und das Bild in einer Hütte am Ende der Welt zusammen, um darüber zu diskutieren, wer von ihnen der Wichtigste auf dieser Welt sei. Der Paradiesapfel meinte: „Selbstverständlich bin ich das Wichtigste auf dieser Welt! Nur mit mir können die Menschenkinder überleben. Deshalb bin ich wichtig. Wäre ich nicht, so müssten die Menschen elendig verhungern. Und da ich ein Paradiesapfel bin, bin ich besonders wichtig, denn durch mich werden die Menschen auch noch an das Gute und Schöne erinnert!“
Die Wolke brummelte Unverständliches vor sich hin. „Ja, ja, das ist ja alles ganz lobenswert, was du da erzählst, aber was wäre die Menschheit ohne mich und das Wetter des Lebens? Erst mit mir wird das Leben lebenswert. Nur Menschsein und essen reicht nicht aus. Man muss auch noch mehr von der Welt sehen als nur die Äpfel zum essen. Und das ist nur in Zusammenarbeit mit mir, der Wolke, zu erreichen. Also bin ich das Wichtigste, was die Menschen haben!“ sprach die Wolke und guckte nach diesem Vortrag zufrieden vor sich hin.
„Papperlapapp! Alles nur Gerede!“ toste das Bild. „Was wäre die Welt, wenn die Menschen nichts für das geistige Auge hätten? Sozusagen Nahrung für die Seele? Die Menschenkinder müssen sich uns, die Bilder, ansehen, damit ihr Wissensdurst nach geistigen Gütern gestillt wird. Ohne uns ist die Welt farblos und grau. Erst wir machen die Welt bunt und farbenfroh, so wie sie sein soll! Deshalb sind wir Bilder das Wichtigste auf dieser Welt!“ erzählte das Bild und räkelte sich genüsslich.
Stille entstand in dem Raum in der Hütte am Ende der Welt. Jeder hing seinen Gedanken nach und keiner traute sich im Moment, etwas zu sagen. Jeder spürte, dass etwas in der Luft hing. Und richtig! Eine feste Stimme sprach plötzlich: „Das ist alles gut und schön. Aber könntet ihr hier z.B. so gemütlich diskutieren, wenn es mich, die Hütte, nicht gäbe? Ich mache euch einen Vorschlag. Sozusagen einen Kompromiss. Was würdet ihr sagen, wenn wir alle gleich wichtig sind? Das heißt: der Apfel ist genauso wichtig und genau so viel wert wie die Wolke und genau so viel Wert wie das Bild und wie ich. Jeder ist gleichwertig, denn wir können einer ohne den anderen nicht leben. Deshalb lasst uns diese Diskussion hier abbrechen und uns einfach freuen, dass wir da sind, das wir leben und das jeder dem anderen helfen kann!“
Es dauerte noch eine Weile, bis jeder der Anwesenden begriffen hatte, was die Hütte da gesagt hatte. Aber ganz allmählich nickte ein jeder bedeutungsvoll mit dem Kopf und hatte ein Lächeln auf den Lippen. Und jeder begann, sich bei dem anderen für diese Zusammenkunft zu bedanken und versprach, es den Kollegen draußen in der Welt weiter zu erzählen, wie sie das Geheimnis des friedlichen Miteinanders für immer gelöst hatten.
Das Krokodil im Dornenbusch
Es war einmal eine junge Zigeunerin, die beschlossen hatte, ihren Stamm zu verlassen, um auf eigene Faust die Welt zu erkunden. So vieles gab es hier zu sehen und zu entdecken! Ihr Stamm aber zog immer nur von einer Stadt in die andere – und das gefiel ihr nicht mehr. So irrte sie lange Zeit ziellos durch die Weltgeschichte, lernte dabei aber eine ganze Menge.
Eines Tages kam sie an einen kleinen See. Und weil sie ja genügen Zeit hatte und auch lange genug gewandert war, beschloss sie, am Ufer des Sees eine kurze Rast zu machen. So lehnte sie sich an den Baum und genoss die Aussicht auf den klaren See und die Sonne, die sich darin spiegelte. Am anderen Ufer des Sees konnte sie eine Stadt ausmachen, die weiß blitzte und in der Sonne zu schlafen schien. Rechts neben der jungen Zigeunerin war eine große Wiese und links ein wenig abseits ein Dornenbusch, der undurchdringlich schien. Aber ganz hübsch sah er eigentlich aus, denn er war über und über mit weißen Blüten übersät, die in der Mitte einen roten Blütenkelch hatten. Sie schaute eine Weile stumm auf den friedvollen Anblick, der sich ihr bot, bis ein Grunzen sie jäh aus ihren Träumen von einem Leben mit dem Prinzen Riss.
Verwirrt schaute sie sich um und entdeckte in dem Dornenbusch ein Krokodil, das ganz traurige Augen hatte, aber gar nicht böse aussah, so wie Krokodile das so oft an sich haben. Aber erschrocken war sie doch. „Bitte, tue mir nichts zu leide“, sagte die junge Zigeunerin. „Ich bin in friedlicher Absicht hier.“ Aber zur Antwort bekam sie nur ein Grunzen.
„Warum gehst du nicht in dein Element, das Wasser? Warum steckst du im Dornenbusch?“ Aber wieder bekam sie nur ein Grunzen zur Antwort.
„Na ja, wenn du nicht mit mir reden willst, dann lässt du es eben. Aber störe dann bitte nicht den Frieden und die Idylle hier. Außerdem wäre es gescheiter, du würdest in dein Reich gehen. Das Land ist für die Menschen, dort fühlen wir uns wohl. Ihr Wassergetier und die Fische – ihr gehört ins Wasser, das ist euer Reich.“ Und ohne sich noch um das Krokodil zu kümmern, nahm es seinen Rucksack und entnahm ihm einen Becher und etwas zu essen. Das Krokodil im Dornenbusch wurde nervös, zappelte mit den Beinen, schüttelte mit dem Kopf und schlug wild mit dem Schwanz umher.
„Was willst du denn?“ fragte die junge Zigeunerin Aber wieder war nur ein Grunzen die Antwort. „Vielleicht hast du Hunger? Oder Durst? Gut, ich gebe dir etwas ab. Aber du darfst mich nicht beißen, hörst du?“ Und sie reichte dem Krokodil etwas von ihrem Essen, was er gierig verschlang. Dann stellte sie ihm noch den Becher mit frischem Wasser aus dem See hin und das Krokodil schlürfte daraus.
„Wenn du mir vielleicht erklären könntest, warum du hier im Dornenbusch sitzt? Das würde mich doch stark interessieren. Warum kommst du da nicht raus?“ Wieder zappelte das Krokodil nur stark herum, aber hervor kam es nicht.
„Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen?“ fragte sie und diesmal bekam die Zigeunerin so eine Art Nicken zur Antwort. „Ich will dir gern helfen. Aber wie denn?“ Und sie blickte dem Krokodil tief in die Augen und meinte, darin plötzlich Wehmut zu entdecken. Ja! Langsam rann eine kleine Träne aus dem Auge des Krokodils und er machte das Maul auf und riss eine Blüte aus dem Dornenbusch und noch eine und noch eine. Bald war ein Meer von Blüten vor den Füßen der Zigeunerin.
„Ach, das ist schön“, sagte sie. „Du schenkst mir Blumen. Das hat noch nie jemand getan. Ich danke dir, liebes Krokodil!“ Und staunend betrachtete sie die vielen Blüten, über die sie sich freute, aber gleichzeitig taten sie ihr auch Leid. „Liebes Krokodil“, sprach sie, „hast du etwas dagegen, wenn ich die vielen Blüten auf das Wasser lege, damit sie Wasser zum Leben bekommen? Sie tun mir leid. So schön ich sie auch finde. Hier verwelken sie und wenn sie Nahrung bekommen, haben sie eine Überlebenschance.“
Das Krokodil blieb ganz ruhig. Was die Zigeunerin nicht wissen konnte, war, dass das Krokodil genau das bezweckt hatte. Die junge Zigeunerin mit dem großen Herzen für die armen Blumen legte also ganz sacht eine Blüte nach der anderen auf das Wasser und die Blüten verwandelten den See bald zu einem Blumenmeer. Stumm blickte sie noch eine Weile den Blüten hinterher. „So, liebes Krokodil. Wenn ich dir nicht mehr helfen kann, werde ich jetzt weiter meines Weges ziehen. Es war schön, dich kennengelernt zu haben!“ Sprach es und schnürte sich ihren Rucksack wieder um. „Auf Wiedersehen und mach's gut!“ Sacht tätschelte die junge Zigeunerin einmal den Kopf des Krokodils und hauchte ihm einen Kuss zu. „Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder!“ Sie drehte sich um und machte sich auf den Weg.
Allerdings ging ihr das Krokodil nicht mehr aus dem Sinn. Warum es wohl dort im Dornenbusch versteckt war? Und warum grunzte es so merkwürdig? Warum weinte es? Warum riss es die Blüten vom Dornenbusch? Die Fragen ließen sie nicht los und unmerklich verlangsamte sich ihr Schritt. Ich muss zurück, dachte sie. Ich muss dem Krokodil irgendwie helfen! Und als sie sich umdrehte, glaubte sie, ihren Augen nicht mehr zu trauen. Da stand plötzlich auf der eben noch großen, weiten Wiese ein wunderhübsches Schloss und von daher kam ein Reiter in Windeseile auf sie zu. Sprachlos und verwundert blickte sie ihm entgegen. Es war ein wunderschöner Prinz in einem blau-goldenen Anzug. „Ich glaube, ich träume“ stammelte die Zigeunerin und zwickte sich in den Arm.
„Nein, du träumst nicht“, sagte der Reiter. „Ich möchte mich bei dir bedanken, denn du hast mir das Leben und meine Freiheit geschenkt. Dank deiner Liebe zu mir und den Blüten, denen du das Leben gerettet hast. Durch diese Taten hast du ein großes Herz bewiesen und nur das konnte mich von dem bösen Fluch, der auf mir lastete, befreien. Ich danke dir dafür von Herzen und du sollst es, wenn du willst, bei mir ein Leben lang gut haben. Du musst es nur wollen!“
Selig vor Glück, endlich am Ziel ihrer Träume angelangt zu sein, ergriff die junge Zigeunerin, aus der bald eine Prinzessin werden sollte, die Hand des Prinzen und schwang sich auf sein Pferd. Gemeinsam ritten sie auf das große Schloss zu und lebten fortan glücklich und zufrieden.
Die rutschende Krone
Es war einmal ein Froschkönig, dessen Krone für seinen kleinen Kopf viel zu groß geraten war. Der Froschkönig litt sehr darunter und hatte daher das Bedürfnis, das Manko des kleinen Kopfes durch ein noch größeres Maul wettzumachen. Was ihm auch gelang, denn sein Maul wurde immer breiter und breiter – nur die Krone passte noch immer nicht richtig auf seinen Kopf.
Eines Tages hatte der Froschkönig die Idee, zum Prinzen im Schloss nahe der Stadtgrenze zu gehen, denn man munkelte, dass der Prinz einen Zaubervogel hatte. Vielleicht konnte dieser seinen Kopf größer machen, damit die Krone endlich passte? Einen Versuch war es jedenfalls wert. Und so machte er sich auf den Weg. Beim Prinzen angekommen, wurde er auch sogleich vorgelassen, denn der Prinz war allgemein als sehr gütig bekannt.
„Guten Tag, Herr Froschkönig“, sprach der Prinz bedächtig. „Was kann ich für Sie tun?“
„Lieber Prinz“, begann der Froschkönig zu sprechen, „ich bin so betrübt. Ich möchte der König meines Landes sein. Aber ein König ist man nur mit der Krone auf dem Kopf. Und wie ihr seht: Meine rutscht mir immer wieder vom Kopf, weil sie zu groß für meinen Kopf ist. Und deshalb habe ich eine Bitte. Bitte lasst mich mit dem Zaubervogel sprechen. Vielleicht weiß er einen Rat, um mir zu helfen!“
„Gut, Froschkönig, wenn es weiter nichts ist, so will ich euch diese Bitte gern erfüllen. Ihr müsst nur einfach auf diesem roten Teppich entlang laufen. Wenn die Zeit reif ist, werdet ihr dem Zaubervogel begegnen.“
„