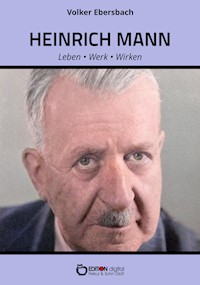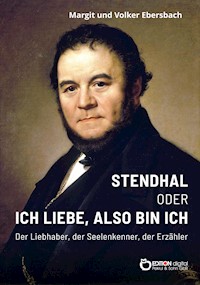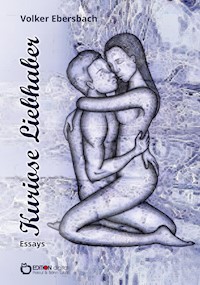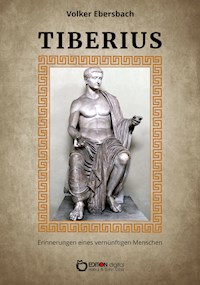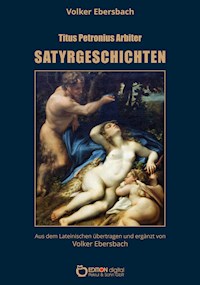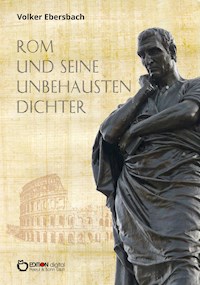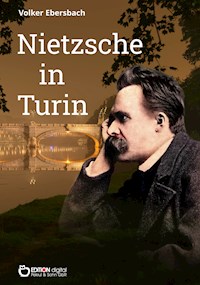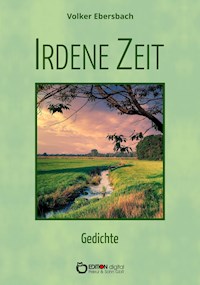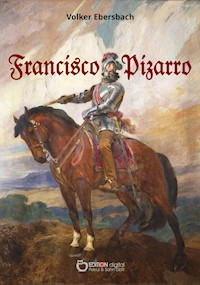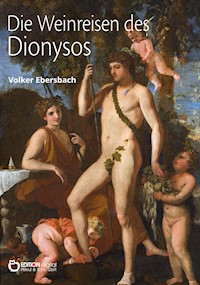8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon das Vorspiel zu diesem Band mit insgesamt acht Erzählungen macht neugierig. Darin berichtet Volker Ebersbach von „Don Quijotes Memoiren“, die allerdings rasch in Vergessenheit gerieten, als ein gewisser Miguel de Cervantes Saavedra einen ebenso meisterhaften wie weltberühmt gewordenen Roman über Don Quijote geschrieben. Das Erstaunliche an Don Quijotes eigenen Memoiren jedoch ist, dass er darin den wahren Grund für sein Leben und Kämpfen als Ritter von der traurigen Gestalt bekennt und dennoch bis an sein Lebensende über zu viel Unverständnis und falsche Interpretationen seines Handelns klagt. In den weiteren Texten mit Begebenheiten aus zwei Jahrtausenden geht es unter anderem um eine Legende aus dem alten Peru, um den Eid eines Sehers im Römischen Reich, um den Sohn des Kaziken, dem wir zuerst am 28. März 1573 begegnen und den wir am 28. Juni 1573 verlassen sowie um Adam im Paradies. Adam hat offenbar als einziger eine Schiffskatastrophe überstanden und genießt zunächst die vollkommene Einsamkeit, die er sich immer gewünscht hatte. Aber am anderen Morgen sieht er Lilith … Volker Ebersbach nimmt die jüdische Legende von Lilith, Adams erster Frau, auf und lässt vor dem Auge des Lesers mit spielerischer Leichtigkeit ein phantastisches Gebilde entstehen, in dem sich Realität und Wahn mischen. Menschheitsgeschichte als Kulturgeschichte, Bewusstseinsgeschichte, Geschichte des menschlichen Gewissens: In den teils mit bohrendem Ernst, teils mit listiger Ironie, stets kenntnisreich und einfühlsam erzählten Begebenheiten aus zwei Jahrtausenden erkundet der Autor für heute und morgen die Dimension der Humanität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Adam im Paradies
Erzählungen
ISBN 978-3-96521-574-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1988 im Verlag Neues Leben Berlin.
Für Schneewittchen
© 2020 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
VORSPIEL
Don Quijotes Memoiren
Der meisterhafte Roman von Cervantes brachte rasch die Memoiren in Vergessenheit, die Don Quijote de la Mancha im Alter selbst geschrieben hatte. Darin räumte der Ritter von der traurigen Gestalt aufs freimütigste ein, dass er gegen Windmühlen gekämpft habe, ging aber hart mit denen ins Gericht, die es sich hatten einfallen lassen, auf einem Feld, das einem beherzten Ritter wie ihm als Walstatt vorbehalten war, Windmühlen zu errichten. Auch dass er zeitweilig ein Barbierbecken als den goldenen Helm des Mambrin getragen habe, vertraute der Held seiner Lebensbeichte an, nicht ohne jedoch einen scharfen Tadel gegen diejenigen auszusprechen, die dem Barbierbecken eine der zauberischen Trophäe so ähnliche Form gegeben hätten. Nicht weniger offen äußerte sich der greise Kavalier über die wahre Gestalt seiner angebeteten Dulcinea von Toboso. Aber zugleich erging er sich in bitteren Klagen über die Verschlossenheit des weiblichen Geschlechtes gegenüber wahrer Ritterlichkeit, über die Falschheit und Undankbarkeit gerade der schönsten Damen und die fragwürdigen Sitten von Frauen, die tatsächlich dem Adel angehörten. Das Aufkommen unabsehbarer Heere aus einander völlig gleichenden Söldnern, die den Wettstreit der Trefflichsten in redlichen Zweikämpfen unmöglich machten, beschrieb er als den alleinigen Grund für die zornige Verblendung, in der er seinem Rosinante die Sporen gegeben und die Lanze gegen eine Schafherde gerichtet hatte. Nicht das leiseste Hohnlachen hinter seinem Rücken, so bekannte er, wäre ihm jemals entgangen. Vielmehr sei die leichtfertige und oberflächliche Verkennung seiner Gesinnung und seiner Taten der eigentliche Gegner gewesen, mit dem er zeitlebens die unerbittlichste Auseinandersetzung gesucht habe. Leider, bemerkte der nachdenkliche Alte, habe er vergeblich gehofft, die Feigheit, die Niedertracht und die Scheelsucht in einem entscheidenden Treffen zu stellen. Diesem um jeden Preis auszuweichen, erkenne er nun endlich als den wichtigsten Wesenszug der Untugend, weshalb sie auch so hartnäckig überlebe. Das Verhalten Sancho Pansas habe ihm allmählich die Augen darüber geöffnet, dass unversöhnliche Gegensätze fatalerweise auch keinen endgültigen Kampf miteinander austragen können. Das Werk des Todkranken schloss mit Worten der Genugtuung über seinen baldigen Abschied von einer Welt, die eine rätselhafte Gottheit so eingerichtet habe, dass ein Mensch darin, je furchtloser, edelmütiger, reiner und aufrichtiger er sich gebärde, desto sicherer der Lächerlichkeit preisgegeben sei.
Als Miguel de Cervantes Saavedra diese Papiere vorgelegt wurden, rief er aus: „Fürwahr! Der Kerl ist mir über!“ Und mit einem resignierenden, doch keineswegs verdrießlichen Mienenspiel fragte er weiter: „Wäre es vielleicht immer so? Weiß nicht am Ende jedes Geschöpf ein wenig mehr als sein Schöpfer?“
DER GERUFENE
Legende aus dem alten Peru
Es war zu der Zeit, als der große Inka Tupak Yupanki über Tahuantinsuyu herrschte, das heißt „die vier Teile der Welt“. Da lebte in der nördlichen, am Meer gelegenen Stadt Tumbez, die gerade erst erobert worden war, ein vornehmer Herr, einer der wenigen, die es dennoch gab, wo sonst alle gleich waren gemäß den Gesetzen des Inka. Alle Verdienste, die er sich um das Gemeinwesen erworben hatte, waren bis ins einzelne in die Hauptstadt gemeldet worden. Ihn erreichte die Nachricht, er solle sich unverzüglich auf die große Heerstraße nach Kusko begeben und so geschwind wie möglich der Hauptstadt entgegenreisen. Eine außerordentlich hochgestellte Persönlichkeit, vielleicht sogar der Inka selber, wünsche ihn zu sehen. Den Zweck dieser Begegnung werde ihm eine Abordnung von Priestern mitteilen, auf die er an einer nicht näher bezeichneten Stelle seines Weges treffen würde.
Der Gerufene entließ den Läufer mit ausreichender Wegzehrung und zog sich mit dem Kipú in den abgelegenen Raum seines Hauses zurück, wo er nachzudenken, zu planen und mit sich selber zurate zu gehen pflegte. Noch einmal tastete er die Knotengebilde an den Schnüren des Kipú ab, den ihm der Läufer überbracht hatte. Er wollte den Angaben größere Genauigkeit abgewinnen. Aber sosehr er die Augen zusammenkniff, um sich besser auf die Mitteilungen zu konzentrieren, sooft er alle Knoten abtastete und die Farben der Fäden überprüfte, er fand keinen letzten Grund für die Reise, sondern nur, dass er sie unverzüglich anzutreten habe und Kusko ihr Ziel sei. Und über die Person, die ihn rief, erfuhr er nichts weiter, als dass ihr zu gehorchen sei wie dem Inka selber, ja die Knotenzeichen ließen es völlig offen, ob der Befehl nicht gar vom Inka in höchsteigener Person ausgehe. Denn ebenso, wie der Herrscher sich seiner gottgleichen Natur gemäß nur zu seltenen religiösen Anlässen, zu Höhepunkten des Jahres für kurze Augenblicke vor seinem Volk zeigte, verbarg er den Ausgangspunkt seiner Befehle hinter einer Reihe von Beamten aus seinem eigenen Geschlecht, denen zu gehorchen war wie ihm selber, ob sie gleichwohl ihm zu Gehorsam verpflichtet waren wie der Allergemeinste und ihr Wohl und Wehe, ihr Leben und ihr Tod dem Inka zu Gebote standen wie ihnen die Geschicke der Leute aus dem Volk.
Am meisten bewegte den Gerufenen die Mitteilung des Kipú, er werde von dieser Reise niemals in seine Heimat zurückkehren, dürfe sich aber auch von niemandem begleiten lassen als von Dienern, an Gegenständen könne er dagegen mit sich führen, was und wie viel ihm beliebe. Er trat aus seinem Gedankenverlies, versammelte seine Söhne, Töchter und Frauen, schickte auch nach seinen Geschwistern und ließ zu sich ins Haus kommen, wer ihm von seinen Freunden lieb war, bewirtete alle köstlich mit Chicha und Maiskuchen, ließ aufspielen und tanzen und bat jeden, der ihn nach dem Sinn dieses plötzlichen verschwenderischen Festes fragte, noch ein Weilchen zu warten. Mehrmals verließ er die Gesellschaft, um sich davon zu überzeugen, dass die Diener, die im Halbdunkel des Hofes die Lamas beluden, alle seine Anweisungen richtig befolgten. Der Kipú ermächtigte ihn, nach Gutdünken Lamas samt Treibern, Kleidung, Gerätschaften und Proviant zu requirieren, und da die Reise mehrere Wochen dauern würde und durch sehr dünn besiedelte Gebiete führte, achtete der Gerufene darauf, dass er und seine Begleitung reichlich mit allem Notwendigen eingedeckt wurden.
Er beobachtete das Verpacken und Verschnüren, lehnte seine Stirn an die Wand und trocknete seine Tränen. Dafür, dass er sich vor wenigen Jahren wie der Kuraka der Stadt bei der Einnahme von Tumbez mit allem Hab und Gut dem Feldherrn des Inka unterworfen hatte, war ihm ein großer Teil davon belassen worden, und der Kuraka hatte ihn, sobald er in seinem Amt durch die Behörden von Kusko bestätigt worden war, wieder mit wichtigen Verwaltungsangelegenheiten betraut. So kam er nun mit sich überein, dass er, bislang einfacher Provinzbeamter, wohl für irgendein höheres Amt vorgesehen sei, um dessentwillen er alle verlassen müsse, um nur noch dem Inka zu dienen. Diese Ansicht teilte der Kuraka, der unter seinen Gästen war und dem er sich als einzigem anvertraut hatte. Der Gerufene ließ noch den einen oder anderen Gegenstand herbeischaffen, an dem sein Herz hing, befahl kraft des Kipú und im Namen des Inka, da die Lamas nicht ausreichten, Mais aus dem öffentlichen Speicher zu holen und in der Vorstadt gegen Lasttiere einzutauschen, bis ihm nichts mehr einfiel, was mitzunehmen ihm würdig erschienen wäre, was ihm über die Trennung von den Menschen hinweghelfen sollte, die ihm am liebsten waren.
Der Morgen graute. Im Hof erwartete eine ansehnliche Lamakarawane den Aufbruch. Denn die Tiere hatten nicht nur die kostbarste Habe des Gerufenen zu tragen, sondern, da es durch einsame und unwirtliche Gegenden, über Schneefelder und Gebirgspässe, über Geröllhalden und Felsschroffen gehen würde, auch Verpflegung für Herrn und Dienerschaft und ihr eigenes Futter, und je mehr Dinge der Herr aufzuladen befohlen hatte, um so mehr Lamas wurden benötigt, um so mehr Futter also und auch um so mehr Treiber, für die wieder Nahrung mitgeführt werden musste, was die Zahl der Lamas weiter erhöhte einschließlich derer, die das Futter für diese Lamas und sich selber trugen. Sehr viele Lasttiere waren nötig, denn jede Last musste genau abgewogen werden, weil das Lama sich niederlegt und stirbt, wenn man ihm zu viel auflädt.
Der oberste Verwalter des Gerufenen, ein Rechenkünstler, der in Windeseile Kipús zu knüpfen und zu lesen verstand, hatte schließlich alle nachträglichen Wünsche seines Herrn mit unversieglicher Geduld berücksichtigt, die Kette der Berechnungen geschlossen und in genauer Kenntnis aller Tambus entlang der großen Heerstraße, wo man rasten und seine Vorräte auffüllen konnte, die Reisetage und Rationen gegeneinander aufgerechnet und endlich auch exakt nach Anzahl und Wert die Tauschgegenstände kalkuliert, mit denen die Versorgung aufrechterhalten werden konnte. Die Karawane bildete einen in sich geschlossenen Organismus, vergleichbar einem der Balsaschiffe, wie sie von Tumbez aus zu den Guanoinseln segelten, um Dünger für die Mais- und Kartoffelfelder zu holen. Wegen der Kompliziertheit dieses Organismus musste der oberste Verwalter mitreisen; er durfte es, denn er war Diener, für den Gerufenen zumal der allerwichtigste und am wenigsten entbehrliche – obgleich freilich nun die Familie noch schlechter versorgt und beschützt zurückblieb. Aber diesem ortsfesten Haushalt gegenüber war die Karawane infolge ihrer Bewegung viel gefährdeter und brauchte dringender die weitsichtige Führung. Ein mit kunstreichem Verstand erschaffenes Gebilde, stellte sie gleichsam einen wandelnden kleinen Staat dar, dem ihr Besitzer wie ein Inka vorstand und den das unfehlbare Kalkül des obersten Verwalters gegen alle möglichen Zwischenfälle zu schützen hatte. Stürzte ein Lama ab oder erkrankte ein Diener, fand man ein Tambu von Räubern geplündert oder wurde man selbst angefallen, war irgendwo die Straße von Steinschlag versperrt oder durch einen Erdrutsch unterbrochen, so dass ein Umweg eingeschlagen werden musste – wer anders hätte den Haushalt der Karawane neu organisieren können als der oberste Verwalter?
Der Gerufene bezwang, gehalten von Gehorsam gegenüber dem Inka, seine Wehmut über die bevorstehende Trennung von seiner Familie und seinen Freunden und verscheuchte seine Verzagtheit über das Ungewisse der bevorstehenden Reise. Er ging hinein zu seinen Gästen, gebot den Musikanten Schweigen und eröffnete den Staunenden, welche Nachricht er gestern erhalten habe und dass er sie alle für immer verlassen müsse.
„Immer ergehen an uns die Befehle des Inka oder derer, denen wir wie ihm selber gehorchen, unwiderruflich und voller Härte, und da sie göttlicher Natur sind, bedürfen sie keiner Begründung“, sagte er. „Nur ihre Seltenheit macht sie erträglich. Solch einen Befehl erhält man nur einmal im Leben, und mir wurde nur eine Person in dieser Gegend bekannt, an die je ein derartiger Befehl erging. Bleibt frohen Mutes und grämt euch nicht um mich. Ihr wisst mich unter den Lebenden und habt keinen Grund zur Trauer. Was ich hier hinterlasse, gehört euch. Ich möchte die Gesichter derer, die mir am liebsten sind, lachend in Erinnerung behalten. Wer von euch eine Träne vergießt, der widersetzt sich dem Willen des Inka und ist des Todes.“
Alle, die in der Runde saßen, Männer wie Frauen, Mädchen und Jungen, erstarrten wie die Gletscher der Anden, und ihre Gesichter schimmerten grünlich wie das Eis der Gletscherhöhlen. Der Gerufene blickte ins Antlitz der Frau, die er am innigsten liebte, und erkannte befriedigt, dass sie sich an Beherrschung seiner würdig erwies. Die zweite Frau führte eilig die Kinder hinaus, ehe sie begriffen. Die dritte Frau aber, die ihm in tieferer Liebe zugetan war als alle anderen, übersah er, bis ihr Schluchzen seinen Blick zu ihr hinriss. Die Umsitzenden schnalzten verächtlich mit der Zunge.
Während die Frau, deren Schluchzen den Augenblick des Abschieds verunreinigt hatte, von einem Diener niedergestochen wurde, ergeben und dankbar, warf sich der Gerufene auf der Terrasse seines Hauses der aufgehenden Sonne entgegen und sprach folgendes Gebet:
„O allgewaltiger Inti
der du alle Welt mit deinem Licht
erhellst und belebst
der du leuchtest
über Erleuchtete wie über Verschlossene
über Erhabene wie über Niedrige
über Erlesene wie über Verworfene!
Wer dich mit schmutzigem Auge anschaut
den blendet dein Glanz nicht
doch er wird dich niemals erkennen
wer aber reinen Auges dich anschaut
der erblindet
und hat dich gleichwohl erkannt.“
Es galt dem Sonnengott und gleichermaßen dessen Sohn, dem Inka, in dem er verfleischlicht und irdisch gegenwärtig war und der nach dem Mann, der da betete, hatte rufen lassen. Ob ein Unterschied bestand, blieb ewig unfragbar. Die Priester, die mit den Eroberern in die Stadt gekommen waren, bewiesen die Zweiheit von Inti und Inka als Einheit damit, dass etwas zweimal vorhanden sein muss, damit es identisch ist. Der Inka aber sei der Sonne gleich an Erhabenheit, Macht, Härte und Gnade. Jeder habe mit dem Auge des Gottherrschers zu rechnen, das beständig nachprüfe, wieweit er seinen Willen in der Ausführung seiner Befehle wiedererkenne. Je getreuer das Abbild sei, das der Gehorsam vom Gebot schüfe, desto weiter nähere sich der Gehorchende dem Befehlenden. Da der Abstand zwischen beiden aber dennoch unermesslich groß bliebe, käme jedem Eifrigen die gottherrscherliche Gnade entgegen, so dass dem Vortrefflichen, der alle Härte hinnähme, die Güte nicht unerreichbar wäre.
In diesem Sinn deutete sich der Gerufenie die Mitteilung des Kipú, eine Abordnung von Priestern werde ihm begegnen und ihn über den Zweck der Reise aufklären. Er tröstete sich, dass er nicht die ganze Strecke im Ungewissen würde zurücklegen müssen, denn gewiss waren die Priester des Inka, Verkörperungen seiner Gnade, bereits in Richtung Tumbez unterwegs. Doch er nahm sich auch vor, so rasch wie möglich zu reisen, nicht nur, weil es ihm der Kipú so befahl, sondern vor allem, um den Zorn dieser Abgesandten und ihres Auftraggebers nicht durch eine Säumigkeit zu reizen, die sie dazu zwänge, sich weiter von Kusko zu entfernen, als es ihrer Würde entsprach. Diese Eile verlängerte zwar wieder die Wegstrecke, die der Gerufene in Ungewissheit zurücklegen musste, sein Ehrgeiz gebot ihm sogar, sich den Teil der Reise, der in Ungewissheit verlief, so lang wie möglich zu wünschen. Der bedeutendste Erfolg wäre zweifellos, die Priesterabordnung erst anzutreffen, wenn sie gerade noch das Tor von Kusko durchschritt. Aber das bedeutete für den Gerufenen eine unerreichbare Geschwindigkeit, für die Abgesandten hingegen eine unvorstellbar langsame Bewegungsweise. Dieser Widerspruch bestätigte den Lehrsatz der Priester sehr anschaulich, dass einerseits das Maß der gottherrscherlichen Gnade um so bedeutender sein musste, je weniger sich einer ihrer würdig erwies, und dass andererseits der gottherrscherliche Zorn zu besänftigen war, wenn man die Gnade sowenig wie möglich beanspruchte. Denn wer die Härte hinnahm, durfte der Gnade versichert sein; wer aber der Gnade teilhaftig wurde, hatte den Zorn zu fürchten. Das gemeine, schmutzige Volk liebte der Inka wie ein milder Vater, weil es seiner Gnade am meisten bedurfte; die Vollstrecker seines Willens hingegen zeichnete er aus durch unerbittliche Strenge. So konnte die Reise für den Gerufenen auch eine Prüfung bedeuten. Die Priesterabordnung reiste möglicherweise ungewöhnlich schnell und verschaffte sich durch geheime Läufer Nachrichten über das Reisetempo des Gerufenen. Der Punkt ihrer Begegnung war vielleicht bereits festgelegt im Hinblick auf seine größtmögliche Beschämung. Aber wozu der Aufwand, wenn ihm doch keine Hoffnung gelassen wurde? Das alles blieb unergründlich, und der Gerufene versprach sich das meiste davon, sich so zu verhalten, als gäbe es Hoffnung.
In diese Überlegungen vertieft, erreichte der Gerufene in seiner Sänfte an der Spitze seiner Lamakarawane die Ausläufer der Gebirgskette. Der erste Reisetag verlief ganz ohne Zwischenfälle. Die Straße war mäßig belebt durch Reisende zu Fuß und durch Lamakarawanen verschiedener Länge, die aus den Bergen Kartoffeln und Koka, Webwaren und Eisblöcke zur Küste hinabbrachten. Man überholte andere, die Fische und Guano, Töpfereiwaren und Früchte der wärmeren Regionen ins Gebirge trugen. Die Straße war hier noch breit genug, dass Sänften und Karawanen einander ohne Schwierigkeiten begegnen oder überholen konnten. Dann und wann erblickte man den schweißglänzenden athletischen Körper eines Läufers, der mit langen, raschen und gleichmäßigen Laufschritten und wohlbemessenem Armschwingen die Straße herabsprang oder hinaufkeuchte und verschiedene Kipús am Gürtel trug. Einmal musste, durch mehrere äußerst gebieterisch auftretende bewaffnete Läufer genötigt, die Karawane des Gerufenen eine Stunde lang in einer Seitenschlucht warten, weil in einer prächtigen, mit bunten Vogelfedern reichbestickten Sänfte der Kuraka des Nachbardistrikts vorübergetragen wurde. Gegen Mittag sandte der Gerufene einen der ihm unterstellten Läufer voraus, damit er in einem nahe gelegenen Tambu Quartier beschaffe; einen anderen, kräftigeren, beauftragte er, die Nacht durchzulaufen, um im nächsten Tambu seine Ankunft für den folgenden Tag zu melden und dort einen weiteren Läufer um Nachtlager für das Ende des dritten Reisetages auszuschicken und so weiter.
Während der folgenden Reisetage drangen sie höher ins Gebirge vor. Von Stunde zu Stunde ließ der Gerufene sich Decken in die Sänfte reichen, denn während des steilen Aufstieges nahm die Temperatur ständig ab. Er mahnte die Diener, Träger und Treiber, sich ebenfalls wärmer zu kleiden, und als gegen Abend, noch ehe das bestellte Nachtlager erreicht war, ein feiner, eisiger Regen einsetzte, gestattete er seinen Leuten, die mitgeführten Wollmützen aufzusetzen.
Gerade an diesem Abend, als die gesamte Dienerschaft durchnässt war und vor Kälte zitterte, ergab es sich, dass der vorgeschickte Läufer keine einzige Schlafstelle mehr im Tambu hatte reservieren können, weil das Haus überfüllt war mit dem Gefolge eines Reisenden, dessen Kipú um mehrere Grade mächtiger war als der des Gerufenen, so dass eine Räumung nicht in Frage kam. Denn den Rang eines Kipú bestimmte nicht der Absender, sondern der Adressat. Der Vorsteher des Tambu erklärte sich bereit, da er gerade dringend Lamas benötigte, gegen einige Tiere aus der Karawane des Gerufenen Zelte abzugeben, die eine Übernachtung im Freien ermöglichten. Für die Lasten der Tiere hatte er allerdings keine Verwendung, es sei denn, der Gerufene lasse sich herbei – was allerdings niemand in dieser öden Felsgegend von ihm verlangen könne –, sich auch von ein paar Ladungen Proviant oder Futter zu trennen. Davon riet jedoch der oberste Verwalter des Gerufenen dringend ab: Vom Proviant und von der Futterversorgung hinge die Fortsetzung der Reise ab, lieber solle der Herr fortan nicht mehr täglich, sondern nur alle zwei Tage die Kleider wechseln; auf diese Weise könne man ebenso viele Lasten entbehren, wie Lamas veräußert werden müssten, um die Zelte zu erhalten.
Der Gerufene willigte ein, wenngleich zähneknirschend und sich den Namen des Tambuvorstehers für eine scharfe Beschwerde einprägend. Denn nun musste er nicht nur ohne jeden Gegenwert eine stattliche Anzahl kostbarer Kleider liegenlassen, die der Tambuvorsteher nach seinem Abzug wahrscheinlich doch den Durchreisenden anbieten würde, sondern nach einer durchfrorenen Nacht würde er, gleichfalls ohne Gegenwert, auch die Zelte dalassen müssen, eben weil ihm die eingetauschten Lamas zum Transport der Zelte fehlten.
Die Nacht war hart für Mensch und Tier, denn die Zelte schützten vor dem Regen wohl, aber nicht vor der Kälte, und der Wind verschaffte sich überall Einlass, denn das Gewebe war nicht neu. Im Laufe des nächsten Tages erkrankten mehrere Diener, und der oberste Verwalter schlug vor, sie mit einem entsprechenden Teil an Lasttieren samt Futter und Verpflegung zurückzulassen; sie sollten die Heimreise antreten, sobald ihr Zustand sich gebessert hatte. Auch diesen neuerlichen Verlust nahm der Gerufene hin mit zusammengebissenen Zähnen, obgleich die Rechnung des Verwalters ergab, dass er für den Rest der Reise auf einige seiner liebsten Leckerbissen würde verzichten müssen.
Den Verdruss über die Verwirrungen im Haushalt der Karawane überwog jetzt der Ehrgeiz, auf keinen Fall langsamer zu reisen, denn wie schnell oder langsam die Priesterabordnung dem Gerufenen auch entgegenkommen mochte, er konnte für seinen Teil die Tage der Ungewissheit und der Entbehrungen am sichersten abkürzen, indem er sein Tempo beschleunigte. Über die bitteren Verluste half er sich auch damit hinweg, dass er sich vorredete, wie unvergleichlich wichtiger als alles andere seine eigene Unversehrtheit sei. Denn er war gerufen worden, nicht die Diener und nicht die Lamas.
Als aber am nächsten Tag drei seiner Lamas fehltraten und mit ihren Lasten in einen Abgrund stürzten, übermannte der Zorn ihn, denn er kannte den unfehlbaren Instinkt dieser Tiere zu gut, als dass er sich über die Ursache des Unglücks hätte täuschen lassen: Es war die Unachtsamkeit der Aufseher. Vergeblich mahnte der oberste Verwalter, die Tiere seien übermüdet und die Treiber geschwächt, da der Herr in den letzten Tagen sehr zur Eile getrieben habe. Mit drohend erhobenem Kipú schrie ihm der Gerufene ins Gesicht, diese Eile sei der Wille des Inka. Und da sich in den Quersäcken der abstürzenden Lamas Verpflegung für die Dienerschaft befunden hatte, gab er den Befehl, ihre unachtsamen Aufseher den Tieren und ihren Tagesrationen in den Abgrund hinterherzuwerfen.
So geschah es. Mit Befriedigung stellte der Gerufene fest, dass die Karawane nach diesen Aderlässen rascher vorankam, und so zeigte er keine nennenswerte Betroffenheit, als fünf seiner Diener von einem plötzlichen Steinschlag getötet wurden, sondern er ordnete an, dass der eine, der noch lebte, aber nicht mehr laufen konnte, den Gnadenstoß empfange. Allerdings bewirkte die abermalige Verringerung seiner Dienerschaft, dass er nun mehrere Handgriffe beim Essen sowie beim An- und Auskleiden selbst tun musste. Er fand mit Erleichterung, dass sie Abwechslung in seine Tagesabläufe brachten, und als über Nacht eine komplette Mannschaft seiner Sänftenträger spurlos verschwand, so dass er, um die verbliebenen nicht zu überanstrengen, steilere Steigungen zu Fuß bewältigen musste, genoss er die anregenden und erfrischenden Wirkungen körperlicher Bewegung. Nicht selten lief er länger, als es nötig war, da er sich scheute, in die Stickluft der mit Wolldecken verhängten Sänfte zurückzukehren.
Je näher der Gerufene der Hauptstadt Kusko kam, umso kleiner wurde seine Karawane. Ein Unwetter mit starken Regenfällen, das einen Erdrutsch verursachte, entführte vor seinen Augen mehrere Lamas samt Gepäck und Treibern in eine neblige Tiefe. Sie mussten auf trocknes Wetter warten, um die Reise auf Umwegen fortzusetzen, und da es an Futter fehlte, ermatteten einige Lasttiere bis zur Unbrauchbarkeit. Diener aber, die nachts heimlich eins geschlachtet hatten, um ihren bohrenden Hunger zu stillen, verfielen dem Tod. In der Furt eines reißenden, nach den Regenfällen lehmig angeschwollenen Gebirgsflusses kamen noch einmal Lamas mit ihren Treibern abhanden. Die Verluste an Tieren, Lasten und Bediensteten ergänzten einander manchmal, so dass der oberste Verwalter dem Gerufenen am Abend einen einigermaßen stimmenden Karawanenhaushalt melden konnte. Doch das waren seltene Zufälle. Und da der oberste Verwalter deshalb kaum noch gelobt und an die Essschüssel des Gerufenen geladen wurde, die sich immer weniger von denen der Dienerschaft unterschied, schenkte er eines Nachts den verlockenden Worten eines Tambuvorstehers Gehör und verschwand mit einem beträchtlichen Teil der Karawane.
Das war bitter. Blieben dem Gerufenen doch nicht mehr genug Träger für seine Sänfte, und überdies gab es niemanden mehr, der den Haushalt überwachte, der zwar inzwischen so weit zusammengeschmolzen war, dass der Gerufene ihn selbst überblickte, dafür aber durch kein Rechenkunststück mehr ins Lot gebracht werden konnte. Den ganzen Tag zu Fuß reisen, die Treiber selbst antreiben und allabendlich mitsamt den Lamas durchzählen und auch noch über die Lasten wachen, gleich, ob sie überhaupt noch benötigt wurden oder nicht, das war doch für einen Herrn recht viel auf einmal.
Reisende, die ihm entgegenkamen, trösteten ihn jedoch mit der Versicherung, bis zur Hauptstadt habe er nur noch wenige Tage. Die Gegend wurde fruchtbarer und dichter besiedelt, die Straße belebter, die Witterung freundlicher. Allerdings ging, wie der Gerufene ärgerlich bemerkte, die Gastfreundschaft der Leute spürbar zurück. Seine abgerissene, nun seit Tagen überhaupt nicht mehr gewechselte Kleidung stach immer beschämender ab von dem verschwenderischen Aufzug derer, die ihm entgegenkamen. Die Blicke dieser Leute wurden immer hochmütiger, selbst ihre Diener benahmen sich immer anmaßender und weigerten sich nicht nur, dem zerlumpten Gefolge des Gerufenen auszuweichen, sondern rempelten im Vorübergehen auch ihn selber an und riefen sich Witzeleien zu.
Immer ungeduldiger erwartete der Gerufene die rettende Priestergesandtschaft, die ihm versprochen worden war. Hinter jeder Wegbiegung hoffte er auf sie zu treffen. Er stellte sich vor, wie prächtig die Boten gekleidet wären, wie sie ihn gnädig empfangen, wegen seiner Missgeschicke bedauern und mit Wohltaten überhäufen würden. Da es so lange gedauert hatte, bis er ihnen begegnete, nahm er an, dass er sie an einem ungewöhnlich langsamen, gemessenen, gravitätischen Gang erkennen werde. Das Verlangen, Reisende zu fragen, ob sie nicht etwa eine derartige Gruppe überholt hätten, wuchs unwiderstehlich. Noch bezwang er es mit der Vorstellung, dass man ihm in Ansehung seines liederlichen Aufzuges eine derartige Frage missdeuten und ihn festnehmen würde, als führe er Böses im Schilde gegen die Abgesandten des Inka. Dann aber vertraute er seinem Kipú, der ihn ausweisen konnte als Gerufenen, und wagte klopfenden Herzens die auf seinen Lippen brennende Frage. Der erste Mensch, den er fragte, hob mit einem Ausdruck, der sowohl Ehrfurcht als auch Entsetzen bedeuten konnte, die Brauen, verhüllte schweigend sein Gesicht und stahl sich ohne Antwort an dem Gerufenen vorbei. Wusste er von dem hohen Amt, für das der Besitzer des geheimnisvollen Kipú ausersehen war? Der Gerufene beschloss, einfachere Leute zu fragen, einen Bauern oder einen Hirten. Aber die er rechts und links von der Landstraße in den Terrassenfeldern hacken und auf den Wiesen die Herden weiden sah, konnten ihm keine Auskunft geben, denn sie wussten nicht, wer sich außerhalb ihres Gesichtskreises auf der Straße bewegte. Da versuchte der Gerufene, was er so heftig zu wissen begehrte, von Händlern zu erfahren, die ihm begegneten. Und als er sich einen dieser diensteifrigen, linkischen Gesellen vornahm und ihm seinen Kipú unter die Nase hielt, hörte der Gefragte gar nicht zu, sondern wollte sofort den Kipú eintauschen und zählte mit öliger Zunge auf, was er dafür anbieten konnte. Ein Vorübergehender schaltete sich ein, prüfte den Kipú, nahm den Händler beiseite und riet ihm mit undurchsichtigen Seitenblicken auf den Gerufenen dringend von dem beabsichtigten Tausch ab, denn er könne für ihn schlimme Folgen haben. Der Gerufene, der ohnehin alles andere eher veräußert hätte als den Kipú, zog mit dem kümmerlichen Rest seiner Karawane weiter, bestärkt in dem Glauben, in eine allerhöchste Staatsangelegenheit verwickelt zu sein.
Da aber die Priester, die ihn über den Zweck seiner entbehrungsreichen, verlustbringenden Reise aufklären sollten, noch immer nicht auftauchten, obwohl Wegkundige versicherten, noch vor Einbruch der Nacht werde die Hauptstadt in Sicht kommen, fragte der Gerufene eine wenig vertrauenerweckende Gestalt, die er von fern hatte kommen und sich auf einen Rain in die Sonne legen sehen. Auch dieser Verwegene hörte ihm nicht besonders aufmerksam zu, sondern maß nur neugierig die abgerissene Erscheinung des Reisenden, seine ausgehungerte, missmutige, übermüdete Dienerschaft und die wenigen verschmutzten Lamas mit ihren Lasten. Dann verschwand er wortlos.
Eine halbe Stunde darauf wurde der Gerufene in einem einsamen Hohlweg von Räubern überfallen. Sie trieben seine Lamas mit allem Gepäck fort, stachen jeden Diener nieder, der sich widersetzte, und hatten um so schneller gewonnenes Spiel, als die gute Hälfte der Lamatreiber im Handumdrehen den Herrn wechselte und den Räubern bei ihrer Arbeit half, die flink beendet sein wollte, denn schon hörte man die munteren Pfiffe einer sich nähernden Karawane hinter der Biegung. Zuletzt, fast alle Räuber waren schon verschwunden, warf der Anführer den Gerufenen mit einem überraschenden Griff ins Gras, zog ihm das Gewand aus und entwich. Der Gerufene lag nackt am Straßenrand. In der Hand hielt er den Kipú. Der Räuber hatte mit abergläubischer Furcht jede Berührung mit den farbigen Knotengebilden vermieden.
Einen Augenblick lang hoffte der Gerufene, die soeben in den Hohlweg einmarschierende, von Bewaffneten geführte Karawane begleitete die Priesterabordnung. Bereit, sich nackt, blutig und schmutzig, wie er war, seinen Rettern vor die Füße zu werfen und ihnen sein Erkennungszeichen entgegenzuhalten, das die Knotenverbindung der gottherrscherlichen Macht des Inka aufwies, wartete er hinter einem Stein. Da er aber unter den Reisenden keine Priester entdeckte, schämte er sich seiner Blöße und blieb im Versteck. Dann setzte er, quer durchs Gelände, nach Möglichkeit immer die Straße im Auge, seinen Weg in Richtung der Hauptstadt fort. Denn zu dem Glück, dass die Räuber ihm Leib und Leben und obendrein auch den Kipú gelassen hatten, gesellte sich nun wieder in seiner Brust die gebieterische Stimme der Pflicht und die Verheißung des Amtes. Der Inka, so sagte er zu sich selber, wird ermessen können, unter welch gewaltigen Opfern ich seinem Befehl gefolgt bin. Es ist durchaus keine Schande, wenn ich nun nackt, arm, schmutzig und gedemütigt vor seinen Priesterbeamten in den Staub fallen werde. Umso höher wird man mein Verdienst veranschlagen.
Da erblickte er in den Strahlen der frühabendlichen Sonne, die eben hinter die Schneegipfel der Anden sank, die Mauern und Dächer von Kusko, umgeben von der grünen Talniederung, die Zinnen der Festung und die goldblitzenden Friese des Sonnentempels. Der Gerufene fiel in das taufeuchte Gras und dankte dem Sonnengott Inti. Er sorgte sich nicht mehr, dass er während der letzten Stunden, da er sich von der Straße ferngehalten hatte, die Priesterabordnung etwa verfehlt hätte. Die Torwache musste wissen, was sie zu tun hatte, wenn er ihr nur seinen Kipú vorwies. Und er lief, so schnell seine zitternden Beine ihn tragen konnten, über die grünen Wiesen der Flussniederung, um das Tor der Hauptstadt noch zu erreichen, ehe es geschlossen würde.
Das Blut rauschte in seinen Ohren; kaum hörte er etwas vom Lärm der Stadt, als er unter ihren Mauern stehenblieb, um Atem zu schöpfen. Aus dem Tor traten prächtig gewandete Männer mit großen Goldpflöckchen in den Ohren, die sie als hohe priesterliche Beamte aus dem Geschlecht des Inka kenntlich machten. Nackt, wie er war, lief ihnen der Gerufene entgegen, schwenkte den Kipú und nannte seinen Namen und seine Vaterstadt. Die hohen Herren erkannten ihn, hängten ihm einen Poncho über und nahmen ihn, damit das zusammengelaufene und nachdrängende Volk ihn nicht länger sähe, in ihre Mitte.
Da erst vernahm der Gerufene, in dessen Ohren noch eben nur das Plumpsen der eigenen nackten Füße, das Keuchen des eigenen Atems, das Pochen des eigenen Herzens, das Rauschen des eigenen Blutes geklungen hatte, über den Mauern der Stadt ein tausendstimmiges Klagegeheul. Dumpfe Trommeln schlugen ins Tosen der menschlichen Stimmen ihren Takt, Flöten und Pfeifen gellten hinauf zu den Tempelriesen und Festungszinnen, die ihren Widerhall den dämmernden Bergen zuwarfen. Im Tor erschien, auf den Schultern festlich gekleideter Träger ruhend, der goldene Thronsessel des Inka. Starr und leicht gekrümmt vom Alter, gehüllt in Gewebe aus feinster Vicunawolle, saß über den Köpfen der Prozession der große Inka Tupak Yupanki. Seine leeren Augen waren auf das Gewölk gerichtet, das in den Farben der sinkenden Sonne glühte. Reglos saß die Gestalt im Thronsessel, steif und wie aus Holz schaukelte sie auf den wogenden Schultern der Träger. Plötzlich begriff der Gerufene, dass der Inka tot war, dass seine frische Mumie in feierlichem Geleit zur Grabstätte gebracht wurde, damit sie im heiligen Fels bei den Vätern sitze.
Dem Thronsessel folgten in unabsehbarer Reihe Lamas, die trugen dem göttlichen Herrscher die Leichen derer nach, denen es vergönnt war, mit ihm zu sterben. Es waren seine Frauen, von seinen Freunden die vertrautesten, von seinen Dienern die getreusten, alle die Menschen, die sich in der Sterbestunde des Inka selbst getötet hatten, um ihm in die andere Welt zu folgen, wie es Sitte war. Der Gerufene hatte noch keinen Gedanken gefasst, als er fühlte, wie etwas Kaltes in seine Rechte geschoben wurde. Der Priesterbeamte, dem er seinen Kipú ausgehändigt hatte, war fertig mit seiner Entzifferung und drückte ihm ein goldenes, mit Smaragden besetztes Opfermesser in die Hand, die Klinge aufs Herz gerichtet. Die Frage, die dem Gerufenen auf der Zunge lag, fand nicht mehr Zeit, sich in Worte zu verwandeln. Die Hand des Priesters schloss sich wartend und drängend um seine Faust, deren Finger den Messergriff umkrampften. Schon ritzte die Spitze der Klinge seine Brust. Doch der Gerufene zögerte. Sein Arm widersetzte sich, sein Mund verzerrte sich, als wolle er etwas rufen. Aber sein Körper wurde wie von einem Fieber geschütttelt.
Er sank auf die Knie vor dem Priesterbeamten, der seine Faust mit dem Messer nicht losließ und in dessen herabgebeugtes Gesicht eine verständnislose Ungeduld trat. Die Zunge des Gerufenen lallte Unverständliches. Schon rann ein schmaler Streifen Blut seinen Leib herab. Ein verächtliches, mitleidiges Zucken zog das Gesicht des Beamten breit, und dem Gerufenen schien es ein Grinsen, während er fühlte, wie die fremde Hand das Messer immer tiefer in seine Brust trieb.
DER EID DES SEHERS
Auch fehlte es nicht an einem Manne – er war von prätorischem Range –, der eidlich bezeugte, er habe die Gestalt des Verbrannten zum Himmel emporsteigen sehen.
(Sueton, Kaiserbiografien, Augustus 100, 4)
1
Ein kühler, trockener Spätsommermorgen stand über Rom. Das Schilpen der Spatzen übertönte zwar wie immer die raunenden Stimmen der Klienten, die seit Sonnenaufgang geduldig vor dem Haus des Senators Numerius Atticus warteten, um ihrem Schirmherrn einen guten Tag zu wünschen, doch der Tonfall der Gespräche war ein anderer als sonst. Man murmelte nicht paarweise miteinander, Rücksicht auf den vielleicht noch nicht erwachten Hausherrn vortäuschend, dabei aber misstrauische Blicke auf Nebenstehende richtend, die womöglich ihr Schweigen zum Lauschen benutzten; man suchte nicht den Mund so nahe wie möglich ans Ohr seines Gegenübers zu bringen und mit hochgezogenen Schultern Schweigern den Rücken zu kehren. Sondern in größeren Gruppen wurden eifrige Worte gewechselt, und um Schweiger brauchte sich heute niemand zu kümmern. Denn auch wer sonst lediglich aus Müdigkeit oder Mangel an Gesprächsstoff geschwiegen hatte, beeilte sich, wenigstens einen oder zwei Sätze zu dem Thema beizusteuern, das alle bewegte: Der Imperator Caesar Octavianus Augustus war in dem Städtchen Nola gestorben. Rom erwartete seinen Leichnam und bereitete sich auf die Beisetzungsfeierlichkeiten vor.
Jeder versuchte auf seine Art auszudrücken, wie unsinnig ihm die Vorstellung erscheine, dass solch ein erhabener Mann, ein unter Sterblichen wandelnder Gott, der Verwesung und dem Schattenreich anheimfallen solle. Einige äußerten den Verdacht, Rom sei das Opfer einer Falschmeldung. Sie verwiesen auf die Wühltätigkeit des zwar schwachen, aber noch immer nicht entmutigten inneren Feindes. Heute noch, verkündete einer von ihnen, werde man den Caesar, den Sohn des Vergöttlichten, lebendig in die Stadt einziehen sehen, und zwar verjüngt und herrlicher als je zuvor.
Er erntete bei den meisten ein nachsichtiges Lächeln. Warum dann der Imperator wohl nachts reise, wagte eine plärrende Stimme zu fragen, was er denn, wenn er noch lebte, vom Tageslicht zu befürchten hätte. „Die Hitze natürlich“, antwortete jemand, wartete aber vergeblich auf Zustimmung. Da ließ die plärrende Stimme sich wieder hören: „Er wird wohl nicht gerade nach Schweiß riechen, der göttliche Mann.“ Der Zerlumpte, der diesen Satz gesagt und ihn mit einem scheußlichen Gelächter zerrissen hatte, entfernte sich humpelnd. Steine flogen ihm nach.
Derlei sei vorauszusehen gewesen, da man die Öffentlichkeit im Unklaren gelassen habe, äußerte ein hagerer Mann mit bescheidener Würde. Jeder Verständige müsse sich sagen, dass der Imperator Augustus wie sein Großoheim und Adoptivvater zu Lebzeiten ein Sterblicher geblieben sei, und ein jeder möge nun gewärtigen, Zeuge einer Vergöttlichung zu werden, wie sie vor einem Menschenalter dem großen Julius Caesar geschehen.
Damit lenkte er die Gedanken der Wartenden auf den Hausherrn, der sich in Rom den Ruf eines Sehers erworben hatte. Sonst erwarteten die Klienten nur einen huldvollen Wink oder ein freundliches Versprechen von Numerius Atticus sowie ein Taschengeld aus der Hand seines Rechnungsführers. Heute aber hofften sie zuversichtlich, auch über diesen unlässlichen Todesfall aus dem Mund des Mannes etwas zu hören, der mit den Schatten Verstorbener verkehren, die Stimmen von Göttern hören, die Sprache der Vögel verstehen und ihrem Flug für menschliche Geschicke Wichtiges ablesen konnte, der manchmal sogar den behördlich anerkannten Auguren über die Schultern sah, aus den Innereien der Opfertiere anderes erfuhr als die Amtspersonen und nicht selten von den Tatsachen recht bekam.
Die Mutmaßungen der Klienten, was der Seher ihnen an diesem Morgen mitteilen werde, waren allerdings sehr geteilt. Denn Numerius Atticus hatte sich stets hartnäckig geweigert, seine außergewöhnlichen Gaben öffentlich zur Verfügung zu stellen; sondern streng blieb er darauf bedacht, nur über private Belange auszusagen. Die einen rechneten es ihm hoch an, dass er den Amtspersonen nicht ins Handwerk pfuschte. Andere maßen die marmornen Säulen vor seinem Hauseingang mit Blicken und spielten auf die Einträglichkeit dieser Beschränkung an. Jemand erinnerte daran, dass der Senat bereits ein Gesetz beschlossen hatte, das solche eigenmächtige Wahrsagerei verbot, und wunderte sich, mit zusammengekniffenen Augen die Umstehenden musternd, weshalb man in diesem Fall durch die Finger sehe. Denn man wisse doch, welchen Einfluss Aussagen über private Belange gelegentlich auf die öffentlichen Dinge gewännen. Aber er fand keinen Beifall, sondern Lobsprüche über die Redlichkeit des Numerius Atticus brachten ihn zum Schweigen. Ein kleiner Glatzkopf bestürmte ihn erbittert und gestenreich, es gebe keinen deutlicheren Beweis für die Glaubwürdigkeit gerade dieses Sehers als das Spielerische seines Auftretens. Oft genug verweigere er die Aussage, räume ein Versagen seiner Gabe ein und zahle das im Voraus entrichtete Honorar umgehend zurück! Ob etwa schon einmal ein beamteter Vogelschauer eingestanden hätte, dass er nichts sähe?
Seine Frage ging in erstauntem Gemurmel und Gezisch unter, da ein Gedränge entstand. Unwille tat sich kund, wo man noch nicht erkannt hatte, dass sich vor zwei der vornehmsten Senatoren eine ehrfurchtsvolle Gasse bildete. Die Männer mit dem breiten Purpursaum an der Toga stiegen, ohne ihren Schritt zu verlangsamen, die marmornen Stufen hinauf und betätigten energisch den Türklopfer. Der Torhüter, der sich in der Annahme, er habe es mit einem dreisten Klienten zu tun, entrüsten wollte, wurde zur Seite geschoben. Jeder Anweisung zuvorkommend, nahmen die beiden Senatspersonen im Atrium auf den schönsten Polstern Platz. Ihre Mienen ließen keinen Zweifel darüber zu, dass der Hausherr gut daran täte, augenblicklich zu erscheinen.
2
Numerius Atticus tat einen letzten ordnenden Griff in die Falten seiner Toga, bevor er seine Gäste begrüßte. Sein Gesicht war schlaff von zu viel Wein und zu wenig Schlaf. Doch er versuchte das durch einen bitteren Zug der Lippen in die Spuren einer durchtrauerten Nacht zu verwandeln. Beim Anblick seiner Kollegen aus dem Senat raufte er sich die soeben sorgsam gekämmten Haare und brach in Tränen aus. „Unser geliebter Herr – ihr wisst – es ist zu furchtbar.“
„Du bist Numerius Atticus?“ fragte einer der beiden Senatoren ungerührt.
„Aber was soll das?“, erstaunte der Hausherr. „Wir kennen einander seit Jahren!“
„Wir müssen die Frage trotzdem stellen.“
„Wollt meine Gattin bitte entschuldigen“, sagte Numerius Atticus. „Sie konnte die schmerzliche Nachricht, die uns alle betroffen hat, noch nicht verwinden.“
„Wir können sie jetzt auch nicht gebrauchen“, brummte der Senatskollege mit einem scharfen Blick auf den Torhüter und die beiden Sklaven, die Erfrischungen brachten.
„Entfernt euch!“, rief der Hausherr.
„Vielleicht sollten lieber wir den Raum wechseln“, wandte der andere Senator ein.
„Selbstverständlich“, antwortete Numerius Atticus eilig. „Darf ich vorangehen?“
Die Senatoren nickten. In der Bibliothek wiederholten sie, nachdem die Sklaven hinausgeschickt worden waren, ihre förmliche Frage, die der Hausherr, nun leicht zitternd, ebenso förmlich beantwortete.
„Du bist also jener Numerius Atticus, der zuweilen mit den Schatten Verstorbener verkehrt, Stimmen von Göttern hört, die Sprache der Vögel versteht, ihren Flug deutet und aus den Eingeweiden von Opfertieren Wichtiges für die Geschicke der Menschen herausliest?“
„Ich bitte euch“, sagte Numerius Atticus, „ich behandele diese Gabe als eine gut gemeinte Laune der Götter und verwende sie ausschließlich zu meinem Vergnügen und zum Nutzen von Privatpersonen, denen ich kleinere Geschenke nicht abschlagen kann.“
„Du hast nie öffentlich einen Spruch getan?“, fragte der erste Senator, ohne den freundlichen Hinweis des Hausherrn auf die Erfrischungen zu beachten.
„So ist es“, antwortete dieser, wischte sich Schweiß von der Stirn und leerte sichtlich beherrscht einen Silberbecher mit jungem Most. „Das ist mein unumstößlicher Grundsatz, dem ich treu bleiben werde. Ihr dürft jeden Verdacht fallen lassen.“
„Woher weißt du, ob wir mit einem Verdacht kommen?“, fragte der zweite Senator.
Numerius Atticus glaubte einen freundlichen Ton herauszuhören und wurde aufgeräumter: „Aber ihr habt doch die Schar der Klienten vor meinem Haus gesehen. Was meint ihr wohl, was sie von mir hören wollen?“
„Du verstehst es bemerkenswert gut, beim Thema zu bleiben“, sagte der erste Senator. „Was wirst du ihnen sagen, sobald du geruhst, dich zu zeigen?“
„Natürlich nichts, was unseren inniggeliebten göttlichen Herrscher betrifft.“
„Sehr gut“, sagte der zweite Senator.
„Ach, äh“, mischte sich der erste ein, „was denkst du überhaupt von der Göttlichkeit des Augustus, da er nun gestorben ist?“
Numerius Atticus atmete tief durch und suchte die Mienen seiner Gäste zu ergründen. Er trank aus einem anderen Silberbecher, diesmal einen starken Wein. Dann versuchte er unbeschwert zu lächeln. „Wir hatten uns doch, meine werten Mitbürger, im Senat darauf geeinigt, dem einfachen Volk zwar nicht zu widersprechen, wenn es den Imperator als Gott verehrte – aber, nicht wahr, es blieb ja sein eigener Wunsch, solange er unter den Lebenden weilte, den Verständigen als Sterblicher zu gelten.“
„Ja“, sagte der zweite Senator und richtete den Blick einer Sphinx auf den Gastgeber. „Ja, solange er unter den Lebenden weilte.“
„Nun sehen wir“, lächelte Numerius Atticus verwirrt, „wie weise das war. Denn was könnten wir wohl, wenn wir ihn schon zum Gott erklärt hätten, nun bei seinem Tod noch für ihn tun? Wie ständen wir denn da? Der innere Feind fände Gelegenheit, zu einem gefährlichen Schlag auszuholen, um die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Ich bin doch hoffentlich zutreffend unterrichtet“, fügte er augenzwinkernd an, „dass der tüchtige Sohn der Livia, unser hochverehrter Tiberius, nun der Erste Bürger sein wird?“
„Wir wissen leider nicht, wer dich über Dinge unterrichtet hat, die dich nichts angehen“, sagte der erste Senator. „Und wir können solche dunklen, um nicht zu sagen ungesetzlich erworbenen Nachrichten natürlich weder bestätigen noch entkräften. Uns bewegt etwas ganz anderes, und obwohl du schon so nahe daran warst, hast du dich bedauerlicherweise durch sehr profane Überlegungen wieder davon abbringen lassen.“
„Was meinst du denn, Numerius Atticus“, fuhr der zweite Senator fort, „was für jeden guten Römer daraus folgt, dass Augustus zu Lebzeiten ein Sterblicher war?“
Der Mund des Hausherrn löste sich von dem Silberbecher, in den eine Gemme mit dem jugendlichen, lorbeerbekränzten Profil des Augustus eingearbeitet war, und blieb eine Weile offen.
„Meint ihr etwa“, fragte er, als er sich gesammelt hatte, „dass ich an seiner Vergöttlichung zweifle? Ist sie denn nicht schon geschehen zu Nola, als er den letzten Atemzug im Kreise seiner Nächsten tat? Kann denn das niemand aus seiner Familie bezeugen?“ Er erschrak über diese Frage und verdeutlichte: „Nicht dass ich solch ein Zeugnis etwa benötige, um …“
„Jetzt bist du wieder nahe daran“, sagte der zweite Senator. „Du nicht, du brauchst es nicht. Das wollen wir dir gern glauben. Aber das Volk braucht es und, allerdings, auch ein Teil des Senats. Die Vergöttlichung des Augustus hat bis zur Stunde noch nicht stattgefunden. Unsere Vogelschauer sagen, sie werde morgen geschehen, wenn der Leichnam des Erhabenen auf dem Marsfeld verbrennt.“
Numerius Atticus nickte. „Dessen bin ich völlig sicher.“
„Wir sind es auch“, sagte der erste Senator. „Denn du wirst den Vorgang beobachten.“
„Natürlich werde ich nicht zu Hause bleiben“, sagte der Seher.
„Stell dich nicht so an!“, rief der zweite Senator ungeduldig. „Bediene dich gefälligst deiner Gabe, die du so sinnreich eine gut gemeinte Laune der Götter genannt hast! Du wirst sie ihnen zu danken wissen. Morgen, sage ich, morgen siehst du über dem Holzstoß, auf dem die sterblichen Überreste des Augustus verbrannt werden, den Vergöttlichten zum Himmel steigen. Anschließend wirst du deine Beobachtung dem Senat mitteilen und einen Eid darauf leisten.“
Numerius Atticus sprang auf. „Meine Freunde! Wie könnt ihr das verlangen! Ich habe auf meine Gesichte noch nie einen Eid geleistet!“
„So sind sie etwa nicht wahr?“
„O doch. Aber ich werde meinen beamteten Kollegen in dieser wichtigen Sache nicht zuvorkommen.“
„Beruhige dich“, sagte der erste Senator. „Sie lassen dir den Vortritt. Nicht weil sie über geringere Gaben verfügen, sondern weil du dir bei den Leuten mehr Glaubwürdigkeit erworben hast. Die Leute sind nun mal so.“
Numerius Atticus hob beide Hände: „Nein.“
„Dann wird er von einem anderen geleistet. Dich aber müssen wir verschwinden lassen.“
„Wie meint ihr das?“
„Du weißt, dass private Seherei verboten ist. Wir werden dann kein Auge mehr zudrücken.“
„Nur weil ich den Eid nicht leiste? Es gibt ein Gesetz, das ihn mir verbietet. Und ihr wollt ihn mir befehlen?“
„Ich verstehe dich nicht“, unterbrach ihn der zweite Senator. „Die Sache liegt auf der Hand: Du wirst den Vergöttlichten zum Himmel steigen sehen. Willst du dich weigern, diese Beobachtung uns unter Eid mitzuteilen? Welchen Grund solltest du dafür haben, wenn nicht die Begünstigung des inneren Feindes?“
„Aber meine Gabe versagt zuweilen.“
Die beiden Senatoren zogen mitleidige Gesichter. „In diesem bedeutenden Fall“, sagte der erste Senator, „halten wir es für ausgeschlossen, dass sie versagt.“
Sie verabschiedeten sich.
„Wir sind überzeugt“, fügte der erste Senator während des Hinausgehens an, „dass du genau hinsehen und uns den Eid nicht vorenthalten wirst.“
3
Numerius Atticus zeigte sich seinen Klienten nur kurz und blieb dabei stumm. Er ließ den Torhüter ausrufen, er danke allen für ihre Morgengrüße, fühle sich aber außerstande, irgend jemanden anzuhören, und bitte alle, die ihm Gutes wünschten, seine tiefe Trauer um den erhabenen Imperator zu teilen, indem sie nach Hause gingen. Nur von den Zunächststehenden reichte er einigen symbolisch die Hand, die er dann welk über die Köpfe der anderen erhob, indem er sich schon abwandte, so dass sein Gruß mehr der Geste glich, mit der man sich jemanden vom Leib hält.
Seine Gattin wagte er noch nicht zu wecken. Gerade jetzt aber verlangte es ihn nach ihrem Rat. Fast war er bereit, ihr eine größere Sehergabe zuzubilligen als sich selbst. Die Vorhaltungen, mit denen Laelia ihm den Abend verdorben hatte, fand er nun nicht mehr so abwegig. Warum reiste er dem Leichnam des größten Herrschers aller Zeiten nicht entgegen? War die Luft um ihn nicht geradezu schwanger von Gesichten? Gab es da wirklich nichts für einen Seher von seiner Begabung zu besorgen? Zumal da die sterbliche Hülle nachts über die Heerstraße getragen wurde? In der Eskorte befanden sich mehrere Personen aus dem Ritterstand, denen Numerius Atticus schon, freilich privatissime, wertvolle Seherdienste geleistet hatte. Er brauchte ja auch nach dem Ableben des Ersten Bürgers seine Gabe nicht unbedingt öffentlichen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Doch wo war man besser darüber unterrichtet, wer nun die Nachfolge antrete, als in jenem nächtlichen Geleitzug, der zugleich mit dem Schutz der Hinterbliebenen beauftragt war? Numerius Atticus hatte vor den beiden Senatoren so getan, als bedürfe es kaum noch einer Bestätigung, dass Tiberius der neue Imperator werde. In Wirklichkeit wusste Laelia durch ihren Schwager, wie umstritten gerade dieser Punkt noch am Sterbelager des Augustus gewesen war.
„Du sagst“, hatte Laelia ihn angefaucht, „du sagst Brautpaaren, welchen Tag sie für ihre Vermählung wählen sollen, und Kaufleuten, wie viel Getreide sie in den Speichern zurückhalten müssen, du versicherst Schwangeren, dass sie einen Jungen gebären werden, und warnst Erbschleicher davor, ihre Zeit an einen zu vergeuden, der genesen wird. Aber wenn wir wissen müssen, wer morgen der Erste Bürger ist und ob wir behalten, was wir haben – ich schweige davon, was wir haben könnten! –, dann sitzt du da und befragst die Weinschläuche! Ein Schwärmer bist du, aber kein Seher!“
Wie recht sie hat, dachte Numerius Atticus, setzte sich an den Rand des Wasserbeckens, tauchte die heißen Füße hinein und hielt seine immer noch welke Hand an die überlaufende Brunnenschale, die halbtierische Unterlippe eines Fabelwesens aus dem Meer, das ihn beinahe schadenfroh angrinste. In der Tat, wiederholte er sich, denn von einem bekannten Feldherrn hatte er gelernt, eine Schlacht sei schon halb gewonnen, wenn man dem Feind entgegenzöge, statt zu warten, bis er einem die Stätte der Entscheidung vorschriebe.
Gern hätte er noch ein Stündchen geschlafen. Aber er lag mit weitgeöffneten Augen auf dem Ruhelager neben dem plätschernden Brunnen, lauschte dem Schilpen der Spatzen und starrte in das Blau des Himmels über dem Innenhof, das an Tiefe zunahm, während die Sonnenstrahlen schon die Säulenkapitelle erreichten und das Lockenhaupt der Apollostatue berührten, als wollten sie es erleuchten. Er ließ sich seinen Silberbecher und einen kleinen Krug Wein bringen, trank einen Schluck Falerner, betrachtete die Gemme mit dem Profil des Augustus.
Er liebte diesen Becher, den er einmal aus der Hand des Kaisers empfangen hatte, weil er als Prätor so unbestechlich gewesen war, dass es niemandem mehr einfiel, gegen eine Person zu prozessieren, die der kaiserlichen Familie nahestand. Auf der anderen Seite des Bechers verdeckte ein schlecht gearbeiteter Bacchus die Stelle, die einmal ein Doppelporträt des Tiberius und der Julia geziert hatte. Es hatte nach der Verbannung der Julia einem Porträt der Livia weichen müssen, das, ebenso schön gearbeitet, auf den Wink eines Freundes hin bald wieder in die Schublade gewandert war. Es hatte geheißen, der Erste Bürger verarge seiner Gattin die Liebe zu ihrem eigenbrötlerischen, unentschlossenen, mit Hörnern gekrönten, kurz: zum Regieren nicht tauglichen Sohn, der nicht sein leiblicher war. Numerius Atticus hatte eine köstliche Gemme mit dem Profil des Tiberius in der Schublade und wusste, dass ihn ein Kunstschmied auf dem Aventin bevorzugt bedienen würde, wenn der Becher umgearbeitet werden konnte. Ein Bräutigam, der im Kaiserhaus auf dem Palatin verkehrte und dem er durch eines seiner Gesichte einen strahlend schönen Hochzeitstag auserkoren hatte, war so freundlich gewesen, ihm mitzuteilen, wie entschlossen Livia sei, beim Tod ihres erhabenen Gatten ihren Sohn zum Ersten Bürger machen zu lassen. Aber was, wenn es nun dem inneren Feind gelänge, die alten Verhältnisse wiederherzustellen, wie sie vor der Diktatur des Julius Caesar geherrscht hatten? Woher wäre dann ein geschnittener Stein mit den Zügen des Brutus zu nehmen, so gut gearbeitet, dass er den silbernen Becher nicht verschandelte?
Numerius Atticus wartete nicht länger auf das Erwachen seiner Gattin. Er ließ den Torhüter nachsehen, ob alle Klienten abgezogen waren, verlangte seine beste Toga und machte sich auf den Weg in die Stadt, um die Stimmung unter denen zu erkunden, denen er sich befreundet fühlen durfte.
So groß sein Erschrecken über den Wortwechsel mit den beiden Senatoren gewesen war – er lernte die nüchterne Stimmung schätzen, in der er stattgefunden hatte. Numerius Atticus gehörte zwar dem Senat an. Aber die Herablassung, die ihm nun bei seinen Besuchen von allen Kollegen widerfuhr, ließ ihn deutlicher als je zuvor spüren, dass er nicht nur dem Zeitpunkt seiner Ernennung nach einer der letzten in der Reihe war. Die wichtigsten Leute traf er nicht an. Sie wurden erst im Lauf des Tages von ihren Landgütern zurückerwartet. Wo er Einlass fand, ging man würdevoll auf seine Trauerworte ein und bot ihm zu trinken an. Viele fragten nicht einmal, ob er Most oder Wein vorziehe. Numerius Atticus staunte, wie bekannt seine Liebe zum Wein war, und wusste nicht recht, ob er sich etwas darauf einbilden durfte, wenn sein einflussreicher Gastgeber womöglich fraglos die richtige Sorte traf. Wäre auch nur einer im geringsten auf seine Anspielungen eingegangen und zu der leisesten Vermutung über die Frage der Nachfolge bereit gewesen, Numerius Atticus hätte manchen Becher Wein stehenlassen. Um aber das leere Geschwafel von Leuten zu ertragen, die ihn nicht für voll nahmen, um die schäbigen Zweideutigkeiten zu verwinden, mit denen man unter Hinweis auf seine Sehergabe die Frage der Nachfolge, obgleich er sie so direkt gar nicht gestellt hatte, an ihn zurückverwies, – um sich mit der erfolglosen Klinkenputzerei dieses Tages abzufinden und die Müdigkeit, die an seinen Augenlidern zerrte, zu verscheuchen, trank er jeden Becher aus, der ihm vorgesetzt wurde, manchmal Most, öfter Wein. Zuletzt gab er ohne Ziererei, ganz aus dem echten Verlangen nach unverfänglicher Erfrischung, den Wein zurück und verlangte Most.
Die Abendsonne rötete sich im Staub über der Stadt. Numerius Atticus wusste nicht mehr als am Morgen. Er nahm in einer öffentlichen Anstalt ein erfrischendes Bad und beschloss, in der Nähe der Porta Capena die Nachtstunde abzuwarten, zu der vermutlich der Trauerzug eintreffen würde. Aber in dieser Gegend waren schon alle Straßen durch Prätorianer abgesperrt. Er musste umkehren, und plötzlich war ihm, als sage hinter ihm einer der Senatoren, die ihn in aller Frühe aufgesucht hatten: Gedulde dich! Deine Stunde ist morgen!
Er musste sich setzen. Er setzte sich auf den Rand eines Brunnens und spielte mit der Hand in dem Wasser, das den türkisfarbenen Himmel spiegelte. In den Hauptstraßen wurden bereits die Laternen angezündet. Er fröstelte. In gemessener Entfernung erwartete der Sklave, der ihn begleitete, schüchtern seine Befehle. Numerius Atticus rief ihn heran und ließ sich aus einer Taberne einen Krug Wein bringen. Er trank in langen Zügen. „Das tut gut“, brummte er und gab dem Sklaven auch einen Schluck. „Alle sind sie hohl, alle! Nur schäbige Lumpen!“, knurrte er und wischte sich den Mund. „Ich werde es euch schon zeigen!“ Und er dachte: Wenn sie einen Meineid wünschen, bitte, dann verdienen sie ihn auch. Aber er schrak auf. Wenn er über die Nachfolge nichts wusste, konnte er sich gehörig in die Nesseln setzen. Wer von all den Schweigern war über die Maßnahmen informiert, die getroffen würden, falls der innere Feind die Gelegenheit ergreifen wollte? Wer paktierte gar schon mit dem inneren Feind?
Numerius Atticus griff sich an die Stirn. Warum war er nicht eher auf die Idee gekommen, zu einem zu gehen, der dem inneren Feind näher stand als dem Palatin?
Der verarmte Patrizier, den er nun mit seinem Besuch überraschte, war vor Jahren unter dem Vorwurf, er habe die Caesarmörder Brutus und Cassius Ehrenmänner genannt, einstimmig aus dem Senat verstoßen und seiner bürgerlichen Rechte verlustig erklärt worden. Numerius Atticus hatte den Mut gehabt, sich bei ihm persönlich für sein Abstimmungsverhalten zu entschuldigen. Nun wurde er zwar erstaunt, aber sehr höflich empfangen. Sein Gastgeber trug ihm nichts nach. Im Gegenteil, er schien vor Mitteilungsbedürfnis beinahe zu platzen.
„Meine große Stunde steht unmittelbar bevor. Man wird mich rehabilitieren!“ Numerius Atticus wurde auf einmal schweigsam wie seine vorigen Gastgeber.
„Tiberius tritt die Nachfolge an“, sagte der verarmte Patrizier strahlend, „daran ist nicht zu zweifeln. Aber er selbst wird die alten Verhältnisse wiederherstellen, er selbst wird dem Senat und dem Volk die Rechte zurückgeben, die sie vor der Diktatur des Julius Caesar hatten.“ So und nicht anders werde es kommen, noch ehe der Holzstoß für Augustus auf dem Marsfeld verraucht sei. Numerius Atticus schwieg skeptisch.
4
Laelia erwartete ihn voll Sorge. Sie wandte das Gesicht ab, als er sie küssen wollte. „Was hat dir der Wein eingegeben?“, fragte sie.
Er stand ihr, gebieterisch wie seine Apollostatue, im Weg: „Und was hat dir der Schlaf eingegeben? Weißt du überhaupt, was hier heute Morgen vorgefallen ist?“ Er genoss seinen eigenen Bericht, als hätte er an der Bahre des Augustus Wache gestanden.
„Endlich hast du dich entdecken lassen“, rief Laelia freudig.
„Hoffentlich greifst du jetzt einmal zu, damit wir uns ein Landhaus leisten können und nicht jeden Sommer wie der letzte Flickschuster in dieser stinkenden Stadt zubringen müssen.“
Numerius Atticus war nicht froh über das, was er bei dem verarmten Patrizier erfahren hatte. Aber nun kam es ihm zupass, weil er seiner Frau nicht recht zu geben brauchte. Sofort berichtete er auch davon. Als er schloss, wusste er schon nicht mehr, weshalb er sich so aufgeblasen hatte. Eine schreckliche Leere überfiel ihn. „Verstehst du denn nicht, meine Laelia, dass man diesen Eid wie eine Schlinge um meinen Hals legt? Ob ich ihn leiste oder verweigere – ich stehe vor dem Senat für immer als Schwindler da.“
Laelia half ihm auf eins der Polster, drückte seine erhobenen Hände in die Falten seiner Toga und sah ihm fest in die Augen. „Mein Teurer, der Senat wird, was auch kommen mag, für deine wundersame Gabe weiterhin Verständnis haben, wie schon immer. Wärest du sonst ungeschoren geblieben, als das halbe Emporium abbrannte, als das Feuer die Hälfte einer ägyptischen Getreideernte vernichtete, weil du ahntest, dass die Preise fallen würden? Ich bin überzeugt, diesmal braucht der Senat deinen Eid genauso dringend wie damals der Getreidepräfekt deine unverbindliche, private Aussage über eines deiner Gesichte. Du wirst unter allen Umständen schwören. Es kann dir doch nicht so schwer fallen, in dem Rauch etwas zu sehen!“
„Aber wenn es nun stimmt, dass Tiberius die alten Verhältnisse wieder einführt?“, wandte Numerius Atticus ein. „Die Auguren werden sogar die Vergöttlichung des Julius Caesar widerrufen. Dann macht mich mein Eid über kurz oder lang in ganz Rom unmöglich.“
„Wenn der Senat deinen Eid braucht“, erwiderte Laelia, „und der Tonfall der Männer von heute Morgen sollte dich darüber belehren – dann wirst du vielleicht mit deinem Eid darüber entscheiden, ob sich die Hirngespinste gewisser Leute erfüllen oder nicht! Und nun schlaf dich aus!“
Doch Numerius Atticus fand keinen Schlaf. Die Nacht blieb nach diesem wolkenlosen Tag heiß und windstill. Es pochte in seinen Schläfen, es sirrte in seinen Ohren. Ein Käuzchen rief auf dem First des Nachbarhauses. Numerius Atticus wälzte sich von einer Seite auf die andere. Er spürte eine Trockenheit in der Kehle, als züngelte eine Flamme aus seinen Eingeweiden. Das Laken war längst schweißnass. Er ließ sich einen Krug Wein bringen und hoffte sich damit zu betäuben und den scheuen Schlaf zu überlisten. Der Trunk tat so wohl wie kein anderer den ganzen heißen Tag zuvor.
Vorübergehend wurde der Schlaflose wirklich schlaff. Zum tausendsten Mal sagte er sich, was der verarmte Patrizier da von sich gegeben habe, sei reines Wunschdenken. Alles werde auch unter Tiberius bleiben, wie es sich unter Augustus eingespielt hatte. Aber er konnte sich nicht verheimlichen, dass Tiberius ein überaus seltsamer, geradezu rätselhafter Mensch sein musste nach allem, was über ihn erzählt wurde. Dieser menschenscheue Sonderling mit dem alterslosen Gesicht, der ein Fremdling auf dem Palatin geblieben war, hatte sich jahrelang selbst auf die Insel Rhodus „verbannt“, als es seine Julia gar zu unverfroren mit anderen Männern trieb. Warum sollte dieser linkische Hahnrei, der für die Herrschaft des Augustus alles gab und nichts als Spott erhielt, nicht wirklich, und sei es aus Rache, dem Senat und dem Volk ihre alten Rechte zurückgeben, um sich dann ins Privatleben zurückzuziehen?
Numerius Atticus saß aufrecht und lauschte dem Käuzchen. Er fühlte sich wach, als werde er niemals wieder des Schlafes bedürfen. Es hieß, Tiberius pflege dem ungemischten Wein mehr zuzusprechen, als einem Römer anstand. Wer hatte darüber zu befinden, was einem Römer anstand? Kam es nicht immer darauf an, was einer vertrug? Numerius Atticus glaubte im Halbdämmer seinen wartenden Kämmerer zu sehen. Als er ihn rief, kam keine Antwort. Er machte sich selbst auf den Weg und erkannte, dass er nicht von dem Polster aufgestanden war, auf das er sich niedergelegt hatte, und dass er seine Apollostatue für den Sklaven gehalten hatte. Er musste im Halbschlaf umhergeirrt sein. Seine Beine trugen ihn nicht weit. Einer der krausköpfigen Sklaven, die, obwohl sie hätten wachen sollen, im Atrium herumlagen, brachte ihn zu Fall. Ein anderer erriet den Durst des Hausherrn und holte Wein, ein dritter führte ihn an sein Lager zurück, gab ihm neues Bettzeug, hielt ihm den Krug an den Mund und legte behutsam seinen Kopf in die Kissen. Der Himmelsausschnitt über dem Innenhof lichtete sich. Die ersten Spatzen schilpten. Veilchenfarben dämmerte der Morgen. Ich habe noch immer nicht geschlafen, fuhr es Numerius Atticus durch den Kopf. Das Käuzchen war verstummt. Er hörte Laelia schnarchen. Tränen traten in seine Augen. Er vergrub den Kopf im Kissen und schlug es mit den Fäusten. Ein solcher Meineid, dachte er, könnte Jupiter am Ende vielleicht doch dazu bewegen, von seinem Blitzstrahl Gebrauch zu machen.
Gerade hatte er im Gewühl der Leute, die ihm durch Staubwolken entgegenkamen, das sonnenflimmernde Marsfeld erreicht und die Auskunft des Prätorianers vernommen, er komme zu spät, die Asche des Imperators sei bereits eingesammelt worden, als jemand seinen Kopf zwischen die Hände nahm und ihn schüttelte. Dann spürte er eine schallende Ohrfeige. Nicht der Prätorianer hatte sich das herausgenommen, sondern Laelia, die sich über ihn beugte, um ihn zur Entschuldigung zu küssen. „Du hast gekeucht, als müsstest du sterben“, sagte sie. „Was hast du geträumt?“
„Ich kam zu spät aufs Marsfeld.“
Laelia lachte. „Das kann leicht Wirklichkeit werden, wenn du nicht sofort aufstehst und frühstückst.“ Sie berichtete, kurz nach Mitternacht sei, wie man vor zwei Stunden ausgerufen habe, der Leichnam des Imperators in der Stadt eingetroffen. Sie wusste auch die Stunde seiner Verbrennung und trieb fortwährend zur Eile. Das Haupt der Apollostatue ragte schon voll in die grelle Vormittagssonne.
Numerius Atticus aß nichts. Er ließ alles mit sich geschehen. Den Weinbecher wies er zurück; er verlangte Wasser. Er vermisste die Kopfschmerzen, auf die er gefasst war. Stattdessen fühlte er sich am ganzen Körper wie betäubt. Bei jeder Bewegung hatte er das Gefühl, er führe sie unter Wasser aus. Auch sein Blick zeigte ihm die Welt, wenn er die Augen nicht mit äußerster Willensanstrengung auf eine bestimmte Linie heftete, als stünde sie unter Wasser. „Wir sind überzeugt, dass du genau hinsehen und uns den Eid nicht vorenthalten wirst“, hallte noch einmal die Stimme des Senators aus der Bibliothek. Ich werde einen Meineid auf mich nehmen, dachte Numerius Atticus, einen allen offenkundigen Meineid. Und ob es herauskommt oder nicht – ich bin ehrlos, und jeder wird mich fortan in der Hand haben, vor allem Laelia.
Laelia führte ihn am Arm. „Die Lobrede des Drusus auf dem Forum haben wir schon verpasst“, sagte sie, „lass uns gleich zum Marsfeld gehen.“ Ein Stück des Weges legten sie in der Sänfte zurück. Er schloss die Augen und hoffte, wenn er sie wieder öffnete, die Welt klarer zu sehen. Doch als sie durch die Straßen der Innenstadt gingen, die für Sänften verboten waren, traten alle Dinge, auf die er die Augen richtete, wieder auseinander und verdoppelten sich. Überall bewegten sich Menschenströme. Sie mussten zahlreiche Umwege in Kauf nehmen.
Dennoch kamen sie zu früh aufs Marsfeld. Sie gingen zwischen schweigenden Rittern und Prätorianern unter der Sonne, die höher und höher stieg, und hörten die Klagegesänge. Aber Laelia stellte fest, dass noch etwa die Hälfte des Senats fehlte. Der Holzstoß stand bereit. Die festgesetzte Stunde war längst verstrichen. Man munkelte, es hätte einen Auftritt zwischen Livia und Tiberius gegeben. Aus den weißen Reihen der Vestalinnen wurden einige Mädchen ohnmächtig fortgetragen. Numerius Atticus fürchtete, dass auch ihm die Sinne versagen könnten. Er bewunderte Laelia, die schon fast seine ganze Körperlast aufrecht halten musste.