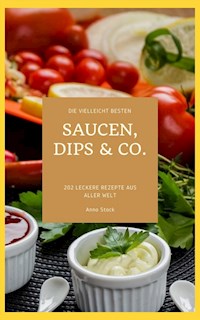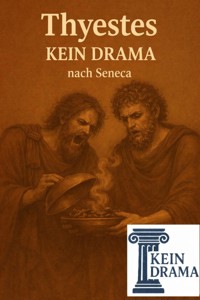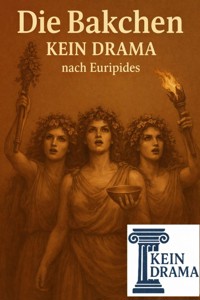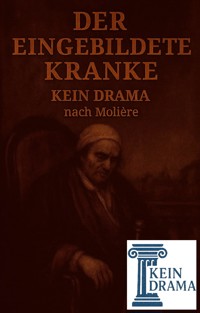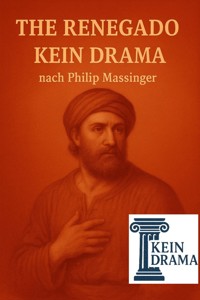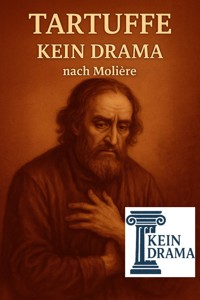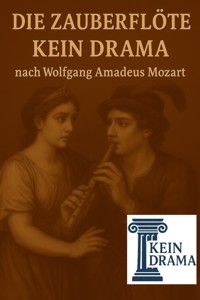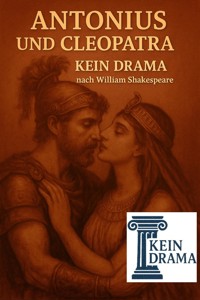
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Als die Welt zwischen zwei Herzen zerrissen wurde: Alexandria, 41 v. Chr. Marcus Antonius, der mächtigste General Roms, betritt das goldene Schiff einer Königin – und verliert sein Herz an eine Frau, die Reiche zu Fall bringen wird. Cleopatra VII., letzte Pharaonin Ägyptens, Geliebte Julius Caesars, steht vor dem Abgrund. Rom will ihr Reich verschlingen. Doch in Antonius findet sie nicht nur einen Beschützer, sondern einen Seelenverwandten. Ihre Liebe entfacht einen Krieg, der die antike Welt erschüttern wird. Zwischen Alexandria und Rom, zwischen Leidenschaft und Pflicht, zwischen Ost und West müssen sie wählen: ihr Herz oder ihr Vermächtnis. Octavius, der eiskalte Erbe Caesars, mobilisiert gegen sie. Bei Actium prallen Flotten aufeinander. In Alexandria fallen die letzten Verteidigungen. Und am Ende bleibt nur eine Frage: Kann Liebe Imperien überdauern? Ein monumentaler historischer Roman über das berühmteste Liebespaar der Geschichte – intensiv, bewegend, unvergesslich. Eine Geschichte von Macht und Hingabe, Triumph und Tragödie, die zweitausend Jahre überdauerte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Antonius und Cleopatra - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Antonius und Cleopatra – Kein Drama nach William Shakespeare
KAPITEL 1: ALEXANDRIA
KAPITEL 2: DER BOTE AUS ROM
KAPITEL 3: ROM ERWACHT
KAPITEL 4: DAS TREFFEN AUF DEM PALATIN
KAPITEL 5: DIE HOCHZEIT
KAPITEL 6: ENOBARBUS ERINNERT SICH
KAPITEL 7: CLEOPATRAS WUT
KAPITEL 8: DIE RÜCKKEHR NACH ÄGYPTEN
KAPITEL 9: SCHENKUNGEN VON ALEXANDRIA
KAPITEL 10: OCTAVIUS BEREITET SICH VOR
KAPITEL 11: KRIEGSRAT
KAPITEL 12: DIE FLOTTE VERSAMMELT SICH
KAPITEL 13: ZWEIFEL UND LOYALITÄT
KAPITEL 14: ACTIUM – DER MORGEN
KAPITEL 15: ACTIUM – DIE FLUCHT
KAPITEL 16: SCHANDE UND VERZWEIFLUNG
KAPITEL 17: DER VERRAT DES ENOBARBUS
KAPITEL 18: LETZTE HOFFNUNG
KAPITEL 19: DIE LETZTE SCHLACHT
KAPITEL 20: DIE KÖNIGIN UND DER SIEGER
KAPITEL 21: DIE SCHLANGE
KAPITEL 22: OCTAVIUS' TRIUMPH
KAPITEL 23: EPILOG – DAS VERMÄCHTNIS
KAPITEL 24: DIE ÜBERLEBENDEN
KAPITEL 25: DURCH DIE JAHRHUNDERTE
KAPITEL 26: DIE BEDEUTUNG DER LIEBE
KAPITEL 27: DIE SUCHE
KAPITEL 28: DER ABSCHLUSS – WAS BLEIBT
NACHWORT
Impressum neobooks
Antonius und Cleopatra – Kein Drama nach William Shakespeare
Ein historischer Roman
KAPITEL 1: ALEXANDRIA
Die Sonne Ägyptens brannte gnadenlos über Alexandria, doch im Palast der Ptolemäer herrschte kunstvolle Kühle. Wasser plätscherte durch Marmorbecken, Dienerinnen schwenkten Pfauenfederfächer, und der Duft von Myrrhe und Rosenöl lag schwer in der Luft. Hier, im Herzen des Reiches am Nil, hatte Marcus Antonius vergessen, dass er einst ein Römer war.
Er lag auf einem Diwan aus purpurner Seide, den massigen Körper eines Kriegers erschlafft in der Nachmittagshitze. Sein Gesicht, einst scharf geschnitten wie das einer römischen Münze, war weicher geworden in den Monaten seit seiner Ankunft. Die breite Stirn glänzte vom Wein, die dunklen Augen – Augen, die Schlachten befehligt und Legionen zum Sieg geführt hatten – starrten träge zur bemalten Decke, wo ägyptische Götter in ewigem Blau thronten.
„Mehr Wein, mein Antonius?"
Die Stimme war Musik und Gift zugleich. Cleopatra, siebte ihres Namens, Königin von Ägypten, Herrin des Nils, Pharaonin und lebende Göttin, erhob sich von ihrem eigenen Lager mit der geschmeidigen Anmut einer Katze. Sie war keine Schönheit im klassischen Sinne – das wusste Antonius, das wusste die ganze Welt. Ihre Nase war zu prominent, ihr Kinn zu spitz für griechische Ideale. Doch wenn sie sich bewegte, wenn sie sprach, wenn sie lachte, dann verblasste jede Helena, jede Venus vor ihr.
„Immer mehr", murmelte Antonius und streckte seinen Becher aus. „Bei den Göttern, Cleopatra, du hast mich in einen orientalischen Prinzen verwandelt. Octavius würde mich nicht wiedererkennen."
„Octavius." Sie sprach den Namen aus wie einen Fluch, während sie den Wein selbst einschenkte – eine Geste, die in Rom undenkbar gewesen wäre. Eine Königin, die einem Mann Wein reichte? Aber das war Cleopatras Genius: Sie verstand es, Macht und Unterwerfung so zu vermischen, dass niemand mehr wusste, wer wen beherrschte. „Dein kleiner Octavius sitzt in Rom und zählt seine Sesterzen wie ein Geizhals. Während du hier..." Sie machte eine ausladende Geste, die den ganzen Raum, die ganze Stadt, das ganze Reich umfasste. „...lebst."
Antonius lachte – ein tiefes, kehlig Lachen, das einst über Schlachtfelder gehallt hatte. „Leben. Ja, das ist es, was ich tue. Leben, während Rom..." Er verstummte, und etwas Dunkles huschte über sein Gesicht.
Cleopatra sah es sofort. Sie ließ sich neben ihm nieder, so nah, dass ihr Atem seine Wange streifte. „Rom", flüsterte sie, „ist ein Grab. Ein prächtiges Grab aus Marmor und Gesetzen, wo Männer in Togen erstarren und vergessen, dass sie Blut in den Adern haben. Du warst dort tot, mein Liebster. Hier bist du lebendig."
Er drehte den Kopf und sah sie an. Ihre Augen waren schwarz wie Nilschlamm und tief wie die Zeit selbst. In diesen Augen sah er nicht nur Verlangen – das wäre zu einfach gewesen. Er sah Intelligenz, die seinen eigenen Verstand schärfte. Er sah Macht, die seiner eigenen entsprach. Er sah ein Königreich, das seiner wartete.
„Die Parther", begann er, doch sie legte einen Finger auf seine Lippen.
„Später. Die Parther können warten. Rom kann warten. Heute Abend gibt es ein Fest."
„Es gibt immer ein Fest."
„Natürlich." Sie lächelte, und in diesem Lächeln lag die Gewissheit von dreitausend Jahren königlicher Herrschaft. „Ich bin eine Königin. Ich gebe Feste. Und du, Marcus Antonius, Triumvir Roms, Herr der Legionen, bist mein ehrenwertester Gast."
„Gast", wiederholte er bitter. „Ist es das, was ich bin?"
Sie richtete sich auf, und plötzlich war die verspielte Geliebte verschwunden. An ihrer Stelle stand eine Herrscherin, deren Vorfahren Pyramiden errichtet und Imperien regiert hatten, als Rom noch ein Dorf am Tiber war. „Du bist", sagte sie mit einer Stimme wie geschliffener Stahl, „was du sein willst. Ein Gast. Ein Liebhaber. Ein Verbündeter. Ein König." Sie hielt inne. „Oder ein Feigling, der nach Rom zurückkriecht, wenn Octavius mit dem Finger schnipt."
Das Wort traf wie ein Schwerthieb. Antonius sprang auf, seine Hand fuhr instinktiv zum Griff eines Schwertes, das nicht da war. „Ich bin kein Feigling!"
„Dann beweise es." Ihre Stimme war wieder sanft, verführerisch. „Bleib. Regiere an meiner Seite. Zusammen sind wir unbesiegbar – deine Legionen, mein Gold, dein römisches Genie, meine ägyptische Weisheit. Wir könnten die Welt neu formen."
In diesem Moment schwangen die Türen auf, und ein Mann trat ein – ein Römer, an seiner Toga erkennbar, an seinem Gang, an der Art, wie er die prachtvolle ägyptische Umgebung mit unverhohlenem Misstrauen musterte. Es war Domitius Enobarbus, Antonius' ältester Freund und treuster Gefährte, ein Mann, der mehr Schlachten gesehen hatte als Jahre gelebt.
„Antonius", sagte Enobarbus, und seine Stimme klang wie Eisen auf Stein. „Ich muss mit dir sprechen. Allein."
Cleopatra erhob sich mit beleidigter Würde. „Allein? In meinem eigenen Palast fordert ein römischer Untertan-"
„Lass ihn, Cleopatra", unterbrach Antonius, plötzlich wieder der General, der Befehlshaber. „Enobarbus ist kein Untertan. Er ist mein Freund."
Sie warf ihm einen Blick zu – verletzt, zornig, berechnend, alles zugleich – und rauschte hinaus, gefolgt von ihrem Gefolge. Der Raum, eben noch erfüllt von Parfüm und Verführung, wirkte plötzlich kahl.
„Nun?" fragte Antonius.
Enobarbus trat näher, seine wettergegerbten Züge hart im gedämpften Licht. „Nachrichten aus Rom. Aus Parthien. Keine guten."
„Wann sind Nachrichten je gut?"
„Deine Frau ist tot."
Die Worte hingen zwischen ihnen wie Klingen. Antonius starrte seinen Freund an, den Becher noch immer in der Hand. „Fulvia?"
„Fulvia. Sie starb in Griechenland, auf der Flucht nach ihrem missglückten Krieg gegen Octavius."
„Ihr Krieg." Antonius' Stimme war flach. „Sie führte Krieg in meinem Namen, während ich..." Er sah sich um in der prächtigen ägyptischen Pracht. „Während ich hier Wein trank und vergaß, dass ich eine Frau hatte."
„Sie liebte dich", sagte Enobarbus leise. „Auf ihre Art. Sie wollte dich zurück nach Rom zwingen, dich aus Cleopatras Armen reißen."
„Und jetzt ist sie tot." Antonius setzte den Becher ab, plötzlich klar im Kopf. „Was noch?"
„Die Parther haben Syrien überrannt. Labienus – ja, der Verräter Labienus, der Römer, der für die Parther kämpft – hat mehrere Städte eingenommen. Deine Provinzen brennen, während du hier..."
„Während ich hier was?" Antonius' Stimme war gefährlich leise. „Sag es. Während ich hier herumhure wie ein Orientale? Während ich meine Pflicht vergesse?"
Enobarbus wich nicht zurück. „Während du vergisst, wer du bist. Du bist Marcus Antonius. Du hast an Caesars Seite gekämpft. Du hast bei Philippi gesiegt. Du bist der mächtigste Mann der römischen Welt – zusammen mit Octavius und Lepidus. Aber wenn du hier bleibst, wenn du dich von dieser Frau weiter verzaubern lässt..."
„Diese Frau", unterbrach Antonius, und etwas Gefährliches loderte in seinen Augen, „ist die Königin von Ägypten. Sie könnte mit einem Wort mehr Gold mobilisieren, als Rom in zehn Jahren eintreiben kann. Sie beherrscht Flotten, Armeen, die Kornkammer der Welt. Unterschätze sie nicht, Enobarbus."
„Ich unterschätze sie nicht." Der alte Soldat trat näher. „Ich fürchte sie. Nicht für sich selbst, sondern für das, was sie aus dir macht. Du bist nicht mehr der Mann, der-"
„Genug!" Antonius schlug mit der Faust auf einen Tisch, und Becher klirrten. „Ich weiß, wer ich bin. Ich brauche keine Vorträge von dir oder irgendjemand anderem."
Stille senkte sich zwischen die beiden Männer. Durch die hohen Fenster drang das ferne Rauschen der Stadt – Alexandria, die prächtigste Stadt der Welt, wo die Bibliothek das Wissen aller Zeitalter beherbergte und der Leuchtturm Schiffen den Weg wies.
„Was willst du tun?" fragte Enobarbus schließlich.
Antonius wandte sich zum Fenster. Draußen lag der Hafen, und darauf seine Flotte – römische Kriegsschiffe, die im ägyptischen Hafen vor Anker lagen wie Wölfe in einem goldenen Käfig. „Ich muss nach Rom", sagte er, und die Worte schmeckten bitter. „Fulvia ist tot. Die Parther rebellieren. Octavius wird mich rufen – wenn er es nicht schon getan hat."
„Er hat." Enobarbus zog eine versiegelte Tafel hervor. „Das Siegel des Triumvirats."
Antonius nahm die Tafel, brach das Siegel, las. Sein Gesicht wurde härter mit jeder Zeile. „Er fordert mich auf, nach Rom zurückzukehren. Für Verhandlungen. Um das Triumvirat zu erneuern." Er lachte bitter. „Um mich zu kontrollieren, meint er."
„Wirst du gehen?"
Die Frage hing in der Luft. Antonius dachte an Cleopatra, an ihre Arme, an ihr Reich, an die Macht, die sie gemeinsam haben könnten. Dann dachte er an Rom – an die Foren, an die Senate, an die Legionen, die seinen Namen riefen. An das Imperium, das er miterbaut hatte.
„Ich werde gehen", sagte er schließlich. „Aber ich werde zurückkommen."
„Bist du sicher?"
Antonius sah seinen Freund an. „Bin ich je sicher? Ich bin zwischen zwei Welten zerrissen, Enobarbus. Rom fordert mich, Ägypten lockt mich. Octavius ist mein Rivale, Cleopatra ist..." Er stockte. „Sie ist alles."
„Sie ist eine Frau."
„Sie ist ein Königreich."
Die Tür öffnete sich wieder, und als hätte sie auf diesen Moment gewartet, trat Cleopatra ein. Sie hatte sich umgekleidet – nun trug sie ein einfacheres Gewand, fast schlicht, und ihr Haar war lose. Sie sah aus wie eine Frau, nicht wie eine Königin, und das, wusste Antonius, war die gefährlichste Maskerade von allen.
„Du gehst", sagte sie. Es war keine Frage.
„Ich muss."
„Natürlich musst du. Der kleine Octavius ruft, und der große Antonius gehorcht wie ein Hund."
„Cleopatra-"
„Nein." Sie hob eine Hand. „Geh. Geh zurück zu deinem Rom, zu deinen Pflichten, zu deinen römischen Tugenden. Aber weißt du, was du dort finden wirst?" Sie trat näher, ihre Stimme wurde leiser, eindringlicher. „Du wirst finden, dass Rom dich schon vergessen hat. Dass Octavius dich als Schwächling betrachtet. Dass deine Legionen nach neuer Führung hungern. Du wirst finden, dass du ohne mich nichts bist."
„Das ist nicht wahr."
„Ist es nicht?" Sie lächelte, aber es war ein trauriges Lächeln. „Dann geh und beweise es. Aber ich warne dich, Marcus Antonius – wenn du diesen Palast verlässt, wenn du mich verlässt, dann gibt es kein Zurück."
„Es gibt immer ein Zurück."
„Für einen römischen General vielleicht. Aber für einen Mann, der die Liebe einer Königin gekannt hat?" Sie schüttelte den Kopf. „Rom wird dich klein machen. Es wird dich in seine Formen pressen, bis du vergessen hast, wie es ist, groß zu sein."
Enobarbus räusperte sich. „Mit Verlaub, Majestät, aber Antonius gehört nach Rom. Er ist ein Triumvir. Er hat Pflichten."
„Pflichten." Cleopatra sprach das Wort aus, als wäre es ein Fluch. „Welche Pflichten hat er mir gegenüber? Ich, die ich ihn empfangen habe, die ich ihm mein Königreich geöffnet habe, die ich-" Sie brach ab, drehte sich um.
Antonius sah, wie ihre Schultern bebten, und etwas in ihm brach. Er trat zu ihr, legte seine Hände auf ihre Schultern. „Ich komme zurück", flüsterte er. „Ich schwöre es bei allen Göttern Roms und Ägyptens. Ich komme zurück zu dir."
Sie drehte sich um, und in ihren Augen glänzten Tränen – ob echt oder gespielt, konnte selbst Antonius nicht sagen. „Versprich es", sagte sie. „Versprich mir, dass Rom dich nicht hält. Dass ihre Tugenden und Gesetze dich nicht von mir fernhalten."
„Ich verspreche es."
„Dann geh." Sie küsste ihn, lange und heftig, ein Kuss, der wie ein Siegel auf sein Schicksal gelegt wurde. „Geh zu deinem Rom. Aber denk daran – ich bin Cleopatra. Ich bin Ägypten. Und wenn du zurückkommst, wirst du nicht als Gast kommen. Du wirst kommen als König."
Antonius verließ den Raum, Enobarbus an seiner Seite. Hinter ihnen stand Cleopatra am Fenster und blickte hinaus auf den Hafen, wo römische Schiffe sich zur Abfahrt bereitmachten. Auf ihrem Gesicht lag ein Lächeln – ein Lächeln, das Jahrhunderte von königlicher Berechnung und weiblicher Weisheit enthielt.
„Er wird zurückkommen", murmelte sie zu sich selbst. „Sie kommen immer zurück."
Und während die Sonne über Alexandria unterging und die Stadt in goldenes Licht tauchte, bereitete sich Marcus Antonius auf die Reise vor, die sein Schicksal besiegeln würde – die Reise zurück nach Rom, in die Arme seines Rivalen, weg von der Frau, die seine Seele besaß.
Das Spiel hatte begonnen.
KAPITEL 2: DER BOTE AUS ROM
Die Nacht brach über Alexandria herein wie eine samtene Decke, doch für Marcus Antonius brachte sie keinen Frieden. Er stand auf dem Balkon seines Gemachs, den Blick über die Stadt gerichtet, die niemals schlief. Tausend Lichter flackerten in den Straßen – Fackeln, Laternen, die ewige Flamme des Leuchtturms, der wie ein Finger der Götter in den Himmel ragte.
Fulvia war tot.
Er versuchte, Trauer zu empfinden, doch alles, was kam, war ein dumpfes Schuldgefühl. Sie war seine Frau gewesen, hatte ihm Söhne geboren, hatte für ihn gekämpft – buchstäblich gekämpft, Legionen aufgestellt, gegen Octavius selbst Krieg geführt. Und er? Er hatte hier gelegen, berauscht von Wein und einer Frau, die nicht seine Ehefrau war.
„Du grübelst."
Enobarbus trat aus dem Schatten. Der alte Soldat hatte sich nicht zurückgezogen, wie Antonius es befohlen hatte. Aber das war typisch für Enobarbus – er gehorchte nur dann, wenn es ihm passte.
„Ich denke nach", korrigierte Antonius. „Es gibt einen Unterschied."
„Nicht in deinem Fall." Enobarbus lehnte sich gegen die Balustrade. „Du denkst nach und kommst zu dem Schluss, dass du hier bleiben solltest. Oder du grübelst und kommst zu dem Schluss, dass du gehen musst. Am Ende läuft es auf dasselbe hinaus – du bist hin und her gerissen."
„Und du nicht? Du, der du so viele Jahre an meiner Seite gekämpft hast – fühlst du dich nicht zerrissen zwischen Pflicht und..." Er suchte nach dem richtigen Wort.
„Vergnügen?" Enobarbus schnaubte. „Nenn es beim Namen, Antonius. Zwischen Pflicht und Cleopatra."
„Sie ist mehr als Vergnügen."
„Das macht es nur schlimmer." Der alte Soldat seufzte. „Ich kannte Fulvia. Sie war eine schwierige Frau, eine herrische Frau. Aber sie liebte dich auf ihre Art. Und sie starb im Exil, weil sie in deinem Namen Krieg führte."
„In meinem Namen." Antonius' Stimme wurde bitter. „Ich habe sie nie darum gebeten. Ich bat sie zu warten, ruhig zu sein, mir Zeit zu geben. Stattdessen stürzte sie das Reich in Chaos."
„Sie wollte dich zurückholen."
„Sie wollte mich kontrollieren." Antonius drehte sich um, sein Gesicht hart im Mondlicht. „So wie sie immer alles kontrollieren wollte. Meine Karriere, meine Entscheidungen, mein Leben. Bei den Göttern, Enobarbus, ich trauere um sie, aber ich kann nicht heucheln, dass ich..."
Er brach ab. Was sollte er sagen? Dass er erleichtert war? Dass Fulvias Tod ihn befreite? Solche Gedanken durfte ein römischer Patrizier nicht aussprechen, nicht einmal in der Dunkelheit, nicht einmal zu seinem treusten Freund.
„Die Botschaft von Octavius", sagte Enobarbus nach einer Weile. „Hast du sie ganz gelesen?"
„Ja."
„Und?"
„Und er ist klug. Zu klug." Antonius holte die Wachstafel hervor, die er in seinem Gewand verborgen hatte. „Er kondoliert zum Tod Fulvias. Er bedauert die 'unglücklichen Umstände', die zu ihrem Konflikt führten. Er betont, dass das Triumvirat über persönlichen Zwistigkeiten stehen muss." Antonius lachte bitter. „Und dann, ganz am Ende, erwähnt er beiläufig, dass Sextus Pompeius die Meere kontrolliert und dass wir – er sagt 'wir', als wären wir Brüder – gemeinsam handeln müssen."
„Sextus Pompeius." Enobarbus pfiff leise. „Des großen Pompeius Sohn. Der hat also überlebt und macht Ärger?"
„Er kontrolliert Sizilien. Er blockiert die Kornlieferungen nach Rom. Das Volk hungert." Antonius starrte auf die Tafel. „Octavius braucht mich. Ohne meine Flotte, ohne meine Legionen kann er Pompeius nicht besiegen."
„Dann hast du die besseren Karten."
„Habe ich das?" Antonius sah seinen Freund an. „Octavius sitzt in Rom. Er kontrolliert den Senat, die Schatzkammer, die Herzen der Menschen. Sie sehen ihn als Caesars Erben – den göttlichen Caesar, der ermordet wurde. Während ich..." Er machte eine Geste zu dem prachtvollen ägyptischen Palast. „Während ich hier sitze wie ein orientalischer Despot."
„Du bist der größere Feldherr."
„Feldherrn gewinnen Schlachten. Politiker gewinnen Kriege." Antonius ballte die Fäuste. „Ich muss zurück. Nicht weil Octavius mich ruft, sondern weil ich, wenn ich nicht zurückkehre, alles verliere. Meine Position im Triumvirat, meine Provinzen, meine Legionen – alles."
„Und Cleopatra?"
Die Frage hing zwischen ihnen wie ein Schwert. Antonius antwortete nicht sofort. Er dachte an sie – an ihre Intelligenz, die seiner gleichkam, an ihre Leidenschaft, die ihn verzehrte, an ihr Königreich, das ihm Macht gab, von der Caesar selbst nur träumen konnte.
„Cleopatra", sagte er schließlich, „ist mein größtes Gut und meine größte Schwäche."
„Das ist keine Antwort."
„Es ist die einzige Antwort, die ich habe." Antonius wandte sich wieder dem Meer zu. In der Ferne konnte er die Umrisse seiner Flotte sehen – römische Triremen, die im Hafen vor Anker lagen. „Ich werde nach Rom gehen. Ich werde mich mit Octavius arrangieren. Ich werde tun, was getan werden muss."
„Und dann?"
„Dann komme ich zurück." Die Worte klangen wie ein Schwur. „Ich komme zurück zu ihr, und nichts – nicht Rom, nicht Octavius, nicht die ganze Welt – wird mich davon abhalten."
Enobarbus schwieg. Er kannte Antonius lange genug, um zu wissen, dass Worte in der Nacht gesprochen, am Tag oft vergessen wurden. Aber er kannte auch die Macht, die Cleopatra über seinen Freund hatte – eine Macht, die tiefer ging als Lust, stärker als Liebe. Es war die Macht eines Königreichs, das sich mit einem Feldherrn verband, die Macht zweier Menschen, die gemeinsam die Welt erobern könnten.
„Wann brechen wir auf?" fragte er.
„Bei Tagesanbruch. Ich will nicht länger warten, sonst..." Antonius brach ab.
„Sonst ändert sie deine Meinung."
„Sonst ändere ich meine Meinung." Antonius lächelte grimm. „Siehst du, Enobarbus? Ich kenne mich selbst. Ich weiß, dass ich schwach bin, wo sie betroffen ist. Deshalb muss ich gehen, bevor sie mich wieder in ihren Bann zieht."
„Sie ist schon gekommen."
Antonius fuhr herum. Tatsächlich, aus den Schatten des Gemachs trat Cleopatra. Sie hatte ihr aufwendiges Gewand abgelegt und trug nun ein einfaches weißes Leinenkleid, das im Mondlicht schimmerte. Ihr Haar fiel lose über die Schultern, ungekämmt, natürlich. Sie sah aus wie eine Sterbliche, nicht wie eine Göttin, und das machte sie nur schöner.
„Wie lange stehst du schon dort?" fragte Antonius.
„Lang genug." Sie trat auf den Balkon, ignorierte Enobarbus völlig. „Bei Tagesanbruch also. Du kannst es kaum erwarten, mich zu verlassen."
„Cleopatra-"
„Nein, ich verstehe." Ihre Stimme war ruhig, fast sanft. „Du bist ein Römer. Rom ruft, und du musst gehorchen. Wie ein Hund, der das Pfeifen seines Herrn hört."
„Ich bin niemandes Hund!"
„Wessen dann?" Sie trat näher, und ihre Augen funkelten gefährlich. „Bist du dein eigener Herr? Dann bleib. Bist du Roms Herr? Dann lass Rom warten. Aber wenn du bei Tagesanbruch aufbrichst, dann bist du Octavius' Hund, sein Diener, sein Sklave."
„Ich bin Triumvir Roms!"
„Du warst Triumvir Roms." Ihre Stimme wurde scharf wie eine Klinge. „Jetzt bist du Cleopatras Liebhaber. Und morgen? Morgen wirst du wieder Antonius der Römer sein, der Mann, der alles für sein Vaterland opfert – seine Würde, seine Liebe, sein Leben."
Enobarbus räusperte sich. „Majestät, mit Verlaub, aber Antonius hat Pflichten-"
„Schweig!" Sie wirbelte zu ihm herum. „Du wagst es, in meiner Gegenwart zu sprechen? Du, ein römischer Soldat, der nicht mehr ist als der Schatten meines Geliebten?"
„Cleopatra!" Antonius' Stimme war Donner. „Enobarbus ist mein Freund. Behandle ihn mit Respekt, oder bei allen Göttern-"
„Oder was?" Sie lachte, ein Lachen, das bitter und süß zugleich war. „Wirst du mich verlassen? Du tust es ohnehin. Wirst du mich hassen? Das wäre wenigstens ehrlich. Oder wirst du weiterhin so tun, als wärst du zerrissen, als würde es dir das Herz brechen, mich zu verlassen, während du in Wahrheit erleichtert bist?"
Die Worte trafen wie Peitschenhiebe. Antonius starrte sie an, und zum ersten Mal seit Wochen sah er hinter ihre Maske. Er sah nicht die selbstsichere Königin, nicht die verführerische Geliebte. Er sah eine Frau, die verletzt war, die sich fürchtete.
„Cleopatra", sagte er leise, „ich bin nicht erleichtert. Ich bin verzweifelt."
„Lügner."
„Nein." Er trat zu ihr, nahm ihre Hände. Sie wollte sie zurückziehen, doch er hielt sie fest. „Hör mir zu. Ich muss nach Rom. Wenn ich nicht gehe, verliere ich alles. Aber wenn ich gehe und nicht zurückkomme, verliere ich mehr. Ich verliere dich."
„Du hast mich schon verloren."
„Habe ich das?" Er zog sie näher. „Dann warum bist du hier? Warum kämpfst du um mich? Wenn ich nichts für dich bedeute, wenn ich nur ein weiterer Mann bin in einer langen Reihe von Männern-"
„Wage es nicht." Ihre Stimme zitterte. „Wage es nicht, mich so zu beleidigen. Ich bin Cleopatra. Ich habe Julius Caesar selbst verführt, den mächtigsten Mann der Welt. Ich hätte jeden haben können. Und ich wählte dich."
„Warum?"
Die Frage überraschte sie. Sie starrte ihn an, und für einen Moment sah Antonius Unsicherheit in ihren Augen. Dann riss sie sich los.
„Weil du anders warst", sagte sie schließlich. „Caesar war brillant, aber kalt. Er sah mich als Verbündete, als Werkzeug. Du..." Sie wandte den Blick ab. „Du sahst mich als Frau."
„Ich sehe dich immer noch als Frau."
„Eine Frau, die du verlässt."
„Eine Frau, zu der ich zurückkehre." Er drehte sie zu sich um, zwang sie, ihn anzusehen. „Ich schwöre es dir, Cleopatra. Ich werde zurückkommen. Ich werde meine Angelegenheiten in Rom regeln, ich werde Octavius besänftigen, ich werde tun, was getan werden muss. Und dann kehre ich zurück."
„Versprechen sind wie Wind", flüsterte sie. „Sie kommen und gehen."
„Nicht meine." Er küsste sie, heftig, verzweifelt. „Nicht dieses."
Sie erwiderte den Kuss, klammerte sich an ihn wie eine Ertrinkende. Enobarbus, diskret wie immer, verschwand leise ins Innere des Gemachs.
Als sie sich schließlich lösten, atmeten beide schwer. Cleopatra legte ihre Hand auf Antonius' Wange.
„Wenn du gehst", sagte sie, „dann geh schnell. Denn wenn du zögerst, wenn du zurückblickst, dann werde ich dich nicht gehen lassen. Dann werde ich dich mit Ketten aus Gold und Seide binden, bis du vergisst, dass es ein Rom gibt."
„Ich werde zurückblicken", sagte Antonius. „Jeden Tag werde ich zurückblicken."
„Dann bist du verloren."
„Ich war schon verloren, in dem Moment, als ich dich sah."
Sie lächelte, und es war ein trauriges Lächeln. „Geh mit den Göttern, Marcus Antonius. Und vergiss nicht – ich bin eine Königin. Ich warte nicht ewig."
„Du wirst nicht lange warten müssen."
Aber während er die Worte sprach, wusste ein Teil von ihm, dass es eine Lüge war. Rom würde ihn nicht so leicht gehen lassen. Octavius würde Forderungen stellen, Bedingungen auferlegen. Das Triumvirat würde ihn in seinem goldenen Käfig gefangen halten, so sicher wie Cleopatra ihn in ihrem seidenen Netz gefangen hatte.
Er war ein Mann zwischen zwei Welten, und beide beanspruchten seine Seele.
Die Nacht verging zu schnell. Im ersten Licht der Morgendämmerung stand Antonius am Hafen, umgeben von seinen Offizieren. Seine Schiffe waren bereit, die Segel gesetzt, die Ruderer auf ihren Plätzen.
Cleopatra kam nicht, um ihn zu verabschieden.
Das, dachte Antonius, war vielleicht ihre grausamste Rache – ihn gehen zu lassen, als bedeute es nichts. Als bedeute er nichts.
„Bereit?" fragte Enobarbus.
Antonius nickte. Er bestieg das Flaggschiff, stellte sich ans Heck. Als die Ruder ins Wasser eintauchten und das Schiff langsam vom Kai ablegte, erlaubte er sich einen letzten Blick zurück.
Dort, auf dem höchsten Balkon des Palastes, stand eine Gestalt in weißem Leinen. Selbst aus dieser Entfernung konnte er sie erkennen – an ihrer Haltung, an der Art, wie sie dastand, königlich und allein.
Cleopatra.
Sie hob eine Hand, nicht zum Gruß, sondern wie eine Priesterin, die einen Segen – oder einen Fluch – ausspricht. Dann drehte sie sich um und verschwand im Inneren des Palastes.
Antonius wandte den Blick nach Westen, wo Rom lag. Sein Herz war schwer, sein Verstand voller Zweifel. Aber seine Entscheidung war getroffen.
Er war auf dem Weg nach Rom. Auf dem Weg in eine Zukunft, die er weder vorhersehen noch kontrollieren konnte.
Hinter ihm verblasste Alexandria im Morgennebel wie ein Traum.
KAPITEL 3: ROM ERWACHT
Die Reise über das Mare Nostrum dauerte zwölf Tage. Zwölf Tage, in denen Marcus Antonius zwischen Vergangenheit und Zukunft schwebte, zwischen der Frau, die er zurückgelassen hatte, und der Stadt, die ihn erwartete.
Das Mittelmeer war ruhig in dieser Jahreszeit, die Winde günstig. Die Flotte segelte nordwestwärts, vorbei an Kreta, vorbei an Griechenland, wo Fulvia ihren letzten Atem getan hatte. Antonius stand oft am Bug, den Blick auf den Horizont gerichtet, während hinter ihm seine Offiziere tuschelten und spekulierten.
„Er denkt an sie", hörte er einen jungen Tribunen zu einem anderen sagen.
„An die Ägypterin? Natürlich denkt er an sie. Würdest du nicht?"
„Ich würde an Rom denken. An meine Pflicht."
„Du bist auch kein Marcus Antonius."
Nein, dachte Antonius bitter, das war er nicht. Marcus Antonius war der Mann, der neben dem göttlichen Caesar gekämpft hatte. Der bei Philippi triumphiert hatte, als Brutus und Cassius, die Mörder Caesars, besiegt wurden. Der das östliche Reich beherrschte wie kein Römer vor ihm. Und der jetzt nach Rom zurückkehrte wie ein geschlagener Hund.
„Du grübelst schon wieder."
Enobarbus trat neben ihn. Der alte Soldat hatte die Seefahrt besser verkraftet als die meisten – er hatte einen Magen aus Eisen und Nerven aus Stahl.
„Ich denke nach."
„Über sie? Oder über ihn?"
Antonius musste lächeln. „Beide. Sie sind in meinem Kopf wie zwei Generäle, die um Territorium kämpfen."
„Und wer gewinnt?"
„Das weiß ich nicht." Antonius lehnte sich gegen die Reling. „Cleopatra bietet mir Macht – echte Macht. Ägyptens Gold, Ägyptens Flotten, die Kornkammer der Welt. Mit ihr an meiner Seite könnte ich..." Er brach ab.
„Könntest du was? Kaiser werden? Das Reich spalten?" Enobarbus' Stimme wurde ernst. „Antonius, hör mir zu. Caesar selbst hat davon geträumt, die Republik zu stürzen, sich zum König zu krönen. Und weißt du, was mit ihm geschah?"
„Er wurde ermordet."
„Von seinen eigenen Leuten. Von Brutus, seinem Ziehsohn. Von Cassius, seinem Freund." Enobarbus legte eine Hand auf Antonius' Schulter. „Rom hasst Könige. Es hasst Tyrannen. Wenn du mit Cleopatra zurückkommst, wenn du versuchst, als orientalischer Potentat zu herrschen, werden sie dich töten."
„Dann werde ich nicht als Potentat herrschen." Antonius richtete sich auf. „Ich werde als Triumvir zurückkehren, als gleichberechtigter Partner von Octavius und Lepidus. Ich werde ihnen zeigen, dass ich immer noch ein Römer bin."
„Bist du das?"
Die Frage traf ins Schwarze. Antonius schwieg lange, dann sagte er leise: „Ich weiß es nicht mehr."
Rom erschien am dreizehnten Tag. Erst als ferner grauer Strich am Horizont, dann als Hügel, die sich aus der Ebene erhoben, schließlich als die größte Stadt der Welt – ein Meer aus roten Ziegeldächern, überragt von Tempeln und Palästen, die im Nachmittagslicht glänzten.
Antonius hatte Rom hundertmal gesehen, doch jedes Mal traf es ihn wie ein Schlag. Dies war das Herz der Welt. Von hier aus wurden Provinzen regiert, Armeen befehligt, das Schicksal von Millionen entschieden. Und doch erschien es ihm jetzt kleiner als früher – enger, grauer, weniger prächtig als Alexandria.
„Nach Hause", murmelte Enobarbus neben ihm.
„Ist es das?" fragte Antonius.
Sie legten in Ostia an, dem Hafen Roms. Sofort begann das Chaos – Hafenarbeiter, die die Ladung löschten, Beamte, die Manifeste prüften, Händler, die Geschäfte anboten. Und Spione. Überall Spione. Antonius sah, wie Männer in unauffälliger Kleidung die Ankunft seiner Flotte beobachteten, Notizen machten, dann verschwanden.
„Octavius wird in einer Stunde wissen, dass du hier bist", sagte Enobarbus.
„Er weiß es schon." Antonius stieg von Bord. Seine Beine waren unsicher auf festem Boden – zwölf Tage auf See hatten ihren Tribut gefordert. „Die Frage ist: Was wird er tun?"
Die Antwort kam schneller, als erwartet. Ein Reiter galoppierte den Kai entlang, brachte sein Pferd vor Antonius zum Stehen. Es war ein junger Mann in der Uniform eines Kuriers, das Siegel des Triumvirats auf seiner Brust.
„Marcus Antonius?" keuchte er.
„Der bin ich."
„Gaius Julius Caesar Octavianus lässt dich grüßen." Der Junge – er konnte kaum zwanzig sein – reichte eine versiegelte Botschaft hinüber. „Er erwartet dich morgen bei Sonnenaufgang in seinem Haus auf dem Palatin."
„Erwartet oder lädt ein?" fragte Antonius scharf.
Der Kurier blinzelte verwirrt. „Ich... ich weiß nicht, Herr. Ich wurde nur geschickt, um die Botschaft zu überbringen."