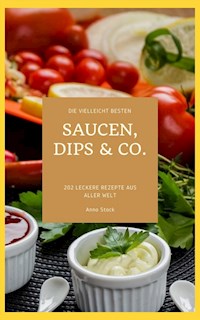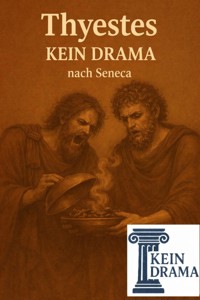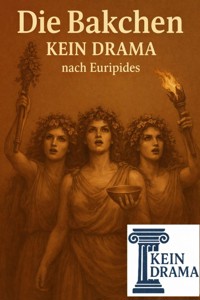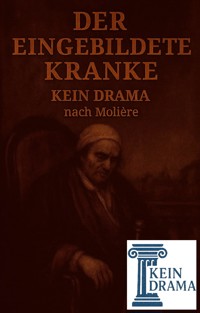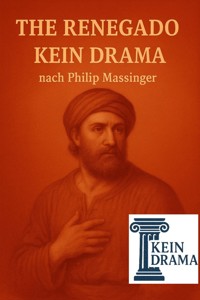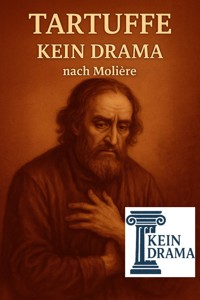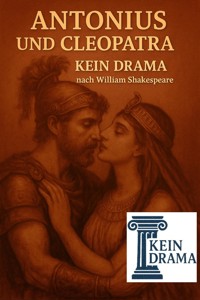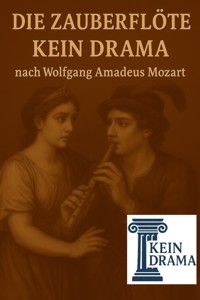6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Mönch, der Zar werden wollte. Eine Frau, die an ihn glaubte. Ein Reich, das in Flammen stand. Russland, 1605: Das Reich taumelt unter der Herrschaft des verhassten Boris Godunow. Da erscheint ein junger Mann, der behauptet, Dimitrij Iwanowitsch zu sein – der tot geglaubte Sohn Iwans des Schrecklichen. Mit polnischen Truppen, unerschütterlicher Entschlossenheit und der Liebe der schönen Marina Mniszek erobert er Moskau und besteigt den Zarenthron. Aber ist er wirklich der rechtmäßige Erbe? Oder ist er Grigorij Otrepjew, ein entlaufener Mönch mit einer gefährlichen Vision? Selbst Dimitrij kennt die Wahrheit nicht mehr. Zwischen orthodoxer Kirche und katholischem Polen, zwischen misstrauischen Bojaren und einem hungernden Volk kämpft er um Legitimität – und um seine Seele. Als die Gerüchte sich verdichten, die Verbündeten ihn verlassen und Marina zur Feindin erklärt wird, beginnt die Belagerung: nicht nur von Moskaus Mauern, sondern auch seines Herzens. In einer Zeit ohne Gnade muss Dimitrij entscheiden: Wer ist er wirklich? Und welchen Preis ist er bereit zu zahlen für einen Traum, der zur Hölle wurde? Nach Friedrich Schillers unvollendetem Drama – ein epischer Roman über Identität, Macht und die Tragödie des Scheiterns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Demetrius - Kein Drama nach Friedrich Schiller
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Der Mönch im Kloster
Kapitel 2: Die Offenbarung
Kapitel 3: Flucht nach Polen
Kapitel 4: Am Hof der Mniszeks
Kapitel 5: Der Schwur
Kapitel 6: Werbung um Marina
Kapitel 7: Die polnische Allianz
Kapitel 8: Der Feldzug beginnt
Kapitel 9: Erste Siege
Kapitel 10: Das Volk jubelt
Kapitel 11: Zweifel und Verrat
Kapitel 12: Moskaus Tore
Kapitel 13: Die Krönung
Kapitel 14: Marina in Moskau
Kapitel 15: Das Zeugnis der Mutter
Kapitel 16: Belagerung des Herzens
Kapitel 17: Die Allianz bröckelt
Kapitel 18: Der Aufstand
Kapitel 19: Die Bojarenverschwörung
Kapitel 20: Das Gift der Gerüchte
Kapitel 21: Marfas Zeugnis – Die Wendung
Kapitel 22: Isolation
Kapitel 23: Verratene Ideale
Kapitel 24: Das Ende
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
DEMETRIUS
Ein historischer Roman nach Friedrich Schiller
Anno Stock
Teil I: Erwachen
Kapitel 1: Der Mönch im Kloster
Die Glocken des Tschudow-Klosters läuteten zur Komplet, und ihr eherner Klang breitete sich über den Kreml aus wie ein Netz aus Bronze und Gebet. Im schwachen Licht der Maiabende des Jahres 1602 warf das alte Gemäuer lange Schatten über die gepflasterten Höfe, und in den schmalen Zellen der Mönche flackerten bereits die ersten Kerzen. Moskau lag in jener eigenartigen Dämmerung, die weder Tag noch Nacht war, sondern ein Dazwischen, in dem die Seelen der Menschen sich zwischen irdischem Treiben und himmlischer Kontemplation bewegten.
Grigorij Otrepjew – so nannte man ihn hier – kniete in seiner kargen Kammer vor dem hölzernen Kruzifix. Seine Lippen formten die vertrauten Worte des Abendgebets, doch seine Gedanken schweiften ab, glitten fort wie Wasser durch die Finger eines Dürstenden. Es war nicht das erste Mal. Seit Wochen schon befand er sich in einem Zustand innerer Unruhe, der ihm keine Ruhe ließ, weder tags noch nachts.
Die Zelle maß kaum vier Schritt in der Länge und drei in der Breite. Eine schmale Pritsche, ein wackliger Tisch, ein Schemel – mehr besaß er nicht, und mehr brauchte ein Diener Gottes nicht zu besitzen. Das Fenster, nicht größer als ein Buch, gab den Blick frei auf einen Ausschnitt des Himmels, der jetzt im Verblassen der Dämmerung von einem tiefen Violett gefärbt war. Sterne begannen zu erscheinen, zögernd zunächst, dann immer deutlicher, als erwachten sie aus einem langen Schlaf.
Grigorij erhob sich von den Knien. Seine Gelenke knackten – er war noch jung, gerade einundzwanzig Jahre, doch das harte Leben im Kloster, die endlosen Stunden des Knieens auf kaltem Stein, die kargen Mahlzeiten und die schlaflosen Nächte voller Grübeleien hatten seinen Körper vorzeitig gezeichnet. Er trat ans Fenster und legte die Hand flach gegen die kühle Wand.
Dort draußen, jenseits der Klostermauern, pulsierte das Leben Moskaus. Er konnte es nicht sehen, doch er spürte es wie ein leises Vibrieren in der Luft. Die Stadt war ein gewaltiger Organismus, der atmete, der lebte, der sich ausdehnte und zusammenzog im Rhythmus von Tag und Nacht, von Arbeit und Schlaf, von Gebet und Sünde. Und hier, in dieser steinernen Zelle, sollte er sein Leben verbringen, abgeschnitten von dieser Welt, ein Schatten unter Schatten.
„Bruder Grigorij?"
Die Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Er drehte sich um. In der Tür stand Pater Pitirim, der alte Beichtvater, dessen weißer Bart bis auf die Brust herabfiel wie ein gefrorener Wasserfall. Seine Augen, tief in den Höhlen liegend, musterten Grigorij mit einer Mischung aus Sorge und Misstrauen.
„Vater Pitirim", sagte Grigorij und neigte respektvoll das Haupt.
„Du warst nicht bei der Vesper."
„Ich... verzieh mir, Vater. Ich fühlte mich unwohl."
Der alte Mönch trat näher. Der Saum seiner Kutte schleifte über den Boden und hinterließ eine feine Spur im Staub. „Unwohl? Dein Körper oder deine Seele?"
Grigorij schwieg. Was sollte er antworten? Die Wahrheit? Dass er sich hier gefangen fühlte wie ein Vogel in einem Käfig? Dass die Gebete, die er sprach, ihm leer und hohl vorkamen? Dass etwas in ihm nach mehr verlangte, nach einem Leben, das größer war als diese vier Wände?
„Beide, Vater", sagte er schließlich leise.
Pitirim seufzte. Er setzte sich auf den Schemel und bedeutete Grigorij, auf der Pritsche Platz zu nehmen. „Ich kenne dich seit fünf Jahren, mein Sohn. Seit du als Knabe zu uns kamst, habe ich dich beobachtet. Du bist klug, gebildet, belesener als die meisten hier. Du sprichst nicht nur Russisch, sondern auch Latein, du hast die Heilige Schrift studiert, die Kirchenväter, sogar weltliche Autoren. Aber..."
„Aber?"
„Aber du bist nicht hier mit deinem Herzen. Dein Geist ist hier, ja, dein Körper auch. Doch dein Herz schweift umher wie ein Pilger ohne Ziel."
Grigorij senkte den Blick. Es war wahr. Alles, was der Alte sagte, war wahr. „Ich versuche, Vater. Bei Gott, ich versuche es."
„Versuch nicht", sagte Pitirim sanft. „Sei. Entweder du bist ein Mönch, oder du bist es nicht. Es gibt kein Dazwischen."
„Und wenn ich nicht weiß, was ich bin?"
Der alte Mann stand auf, langsam, mühsam, als trüge er die Last der Jahre wie einen schweren Sack auf den Schultern. „Dann bete, mein Sohn. Bete, bis du es weißt. Gott wird dir antworten – auf seine Weise, zu seiner Zeit."
Er verließ die Zelle, und die Tür fiel ins Schloss mit einem Geräusch, das endgültig klang, wie das Zuschlagen eines Grabdeckels. Grigorij blieb zurück in der wachsenden Dunkelheit, allein mit seinen Gedanken.
Die Nacht war gekommen, schwarz und undurchdringlich. Grigorij lag auf seiner Pritsche, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und starrte zur Decke. Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund, ein langgezogener, klagender Laut, der die Stille eher vertiefte als brach.
Seine Gedanken wanderten zurück, wie so oft in diesen schlaflosen Nächten. Zurück in seine Kindheit, die wie hinter einem Schleier lag, verschwommen und doch seltsam präsent. Er erinnerte sich an ein Haus in Galizien, an seine Mutter – oder war es seine Mutter gewesen? Die Erinnerungen waren bruchstückhaft, wie Scherben eines zerbrochenen Spiegels. Ein warmes Lächeln, eine sanfte Hand auf seinem Haar, ein Lied, dessen Melodie er noch kannte, dessen Worte er vergessen hatte.
Dann der Umzug nach Moskau. Sein Vater, ein kleiner Beamter am Hof, hatte eine Stellung gefunden. Grigorij war noch ein Kind gewesen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Er erinnerte sich an die Größe der Stadt, die ihn überwältigt hatte, an die goldenen Kuppeln der Kirchen, die in der Sonne glänzten wie Träume aus Metall.
Doch das Glück währte nicht lange. Sein Vater fiel in Ungnade – warum, hatte Grigorij nie ganz verstanden. Intrigen, Verleumdungen, die üblichen Giftpfeile der Höflinge. Die Familie verlor alles. Seine Mutter starb, an gebrochenem Herzen, sagten manche, an einer Krankheit, sagten andere. Sein Vater folgte ihr ein Jahr später ins Grab.
Grigorij, nun Waise, wurde ins Kloster gegeben. Wohltätigkeit, nannte man es. Barmherzigkeit. Doch er hatte es immer als Verbannung empfunden, als Strafe für Vergehen, die nicht die seinen waren.
Er schloss die Augen und versuchte zu beten, doch die Worte wollten nicht kommen. Stattdessen sah er Bilder: einen Thron, ein Zepter, eine Krone. Absurd. Lächerlich. Was hatte er, ein namenloser Mönch, mit solchen Dingen zu schaffen?
Und doch, diese Bilder kamen immer wieder, hartnäckig, eindringlich, als wollten sie ihm etwas sagen.
Die Tage vergingen in monotoner Regelmäßigkeit. Matutin vor Sonnenaufgang, Laudes im ersten Licht des Morgens, Terz, Sext, Non, Vesper, Komplet – das Leben im Kloster war gegliedert durch die Gebetszeiten wie ein Jahr durch die Jahreszeiten. Dazwischen Arbeit: Grigorij kopierte Manuskripte in der Schreibstube, seine Handschrift klar und schön, seine Konzentration jedoch oft getrübt durch Gedanken, die nicht hierher gehörten.
Bruder Leonid, der neben ihm saß, ein einfacher Mann mit runden Gesicht und gutmütigen Augen, bemerkte seine Zerstreutheit. „Du hast heute dreimal denselben Vers abgeschrieben, Bruder Grigorij."
Grigorij blickte auf das Pergament vor sich. Tatsächlich. Die Worte wiederholten sich, sinnlos, mechanisch. Er seufzte und griff nach dem Schab messer, um die Tinte abzukratzen.
„Was bedrückt dich?" fragte Leonid.
„Nichts. Alles. Ich weiß es nicht."
Leonid lächelte. „Du denkst zu viel, mein Freund. Das ist dein Problem. Denken ist gut, aber zu viel Denken macht das Herz schwer."
„Und zu wenig Denken macht den Geist stumpf", erwiderte Grigorij, schärfer als beabsichtigt.
Leonid zuckte zusammen, als hätte man ihn geschlagen. „Verzieh mir. Ich wollte nicht—"
„Nein, ich muss um Vergebung bitten", unterbrach ihn Grigorij. „Du hast Recht. Ich denke zu viel. Und zu wenig zur gleichen Zeit."
Es war ein Rätsel, das er nicht lösen konnte.
An einem Nachmittag im späten Mai, als die Sonne hoch am Himmel stand und das Kloster in goldenes Licht tauchte, geschah etwas Ungewöhnliches. Ein Besucher wurde angekündigt, eine Frau, was an sich schon selten war. Frauen hatten nur begrenzten Zutritt zum Männerkloster, und wenn, dann nur unter besonderen Umständen.
Grigorij arbeitete gerade im Gemüsegarten, eine Tätigkeit, die er eigentlich schätzte, weil sie ihm erlaubte, draußen zu sein, die Erde unter den Händen zu spüren, das Leben zu riechen. Er hörte die aufgeregten Stimmen der anderen Brüder und blickte auf.
Eine Frau mittleren Alters, gekleidet in ein dunkles Gewand, wurde über den Hof geführt. Ihr Gesicht war verschleiert, doch ihre Haltung verriet Adel, eine Würde, die nicht zu übersehen war. Sie wurde zum Abt geleitet, und die Tür schloss sich hinter ihr.
Die Brüder tuschelten. Wer war sie? Was wollte sie? Gerüchte begannen zu kreisen wie Rauch über einem Feuer.
„Ich habe gehört, sie ist von hoher Geburt", flüsterte Bruder Iwan, ein schmächtiger Mann mit nervösen Händen.
„Sie sucht jemanden", ergänzte ein anderer.
„Wen?"
„Das weiß niemand."
Grigorij kehrte zu seiner Arbeit zurück, doch die Unruhe in seinem Inneren wuchs. Es war ein Gefühl, das er nicht benennen konnte, eine Vorahnung, dass dieser Besuch mit ihm zu tun hatte, auf eine Weise, die er noch nicht verstand.
Zwei Stunden später wurde er zum Abt gerufen. Pater Kassian, ein korpulenter Mann mit rotem Gesicht und autoritärer Stimme, empfing ihn in seiner Stube. Die Frau war noch da, saß auf einem Stuhl, die Hände im Schoß gefaltet.
„Bruder Grigorij", sagte der Abt, und etwas in seinem Ton ließ Grigorij aufhorchen. Es war nicht der übliche barsche Befehlston, sondern etwas Vorsichtigeres, beinahe Ehrfürchtiges.
„Ja, Vater Abt?"
„Diese Dame wünscht mit dir zu sprechen. Allein."
Grigorij blickte zur Frau. Sie hatte den Schleier zurückgeschlagen, und er sah ein Gesicht, das einst schön gewesen sein musste, nun aber von Kummer gezeichnet war. Ihre Augen, dunkel und tief, ruhten auf ihm mit einer Intensität, die ihn erschauern ließ.
„Aber...warum?" fragte er.
„Das wird sie dir selbst sagen", antwortete der Abt und erhob sich. „Ich lasse euch."
Die Tür schloss sich, und Grigorij war allein mit der Fremden.
Sie stand auf, langsam, und trat näher. Ihre Augen scannten sein Gesicht, als suchte sie nach etwas, als versuchte sie, ein Rätsel zu lösen.
„Kennst du mich?" fragte sie mit brüchiger Stimme.
„Nein, Herrin. Ich habe Euch nie zuvor gesehen."
Sie schüttelte den Kopf, und Tränen traten in ihre Augen. „Nein. Aber ich kenne dich. Oh Gott, ich kenne dich."
Grigorij wich einen Schritt zurück. „Ich verstehe nicht—"
„Dein Name", unterbrach sie ihn. „Wie lautet dein wahrer Name?"
„Grigorij Otrepjew. So wurde ich genannt, seit ich denken kann."
„Nein." Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. „Das ist nicht dein Name. Das war nie dein Name."
Das Zimmer schien sich zu drehen. Grigorij griff nach der Lehne des Stuhls, um Halt zu finden. „Wer... wer seid Ihr?"
Die Frau trat noch näher. Sie hob die Hand, als wollte sie sein Gesicht berühren, ließ sie dann aber sinken. „Mein Name ist Marfa Nagaja. Ich bin die Witwe des Zaren Iwan IV."
Die Worte trafen Grigorij wie Hammerschläge. Die Zarenwitwe. Hier. Vor ihm.
„Und du", fuhr sie mit zitternder Stimme fort, „du bist mein Sohn. Du bist Dimitrij, der Zarewitsch, rechtmäßiger Erbe des Throns von Russland."
Die Welt zerbrach.
Kapitel 2: Die Offenbarung
Grigorij stand regungslos da, als hätte man ihn zu Stein verwandelt. Die Worte der Frau – der Zarenwitwe – hallten in seinem Kopf wider wie das Echo in einer leeren Kathedrale. Du bist Dimitrij. Du bist der Zarewitsch. Es war unmöglich. Absurd. Wahnsinnig.
Und doch, als er in diese Augen blickte, in denen sich Schmerz und Hoffnung mischten wie Öl und Wasser, die niemals eins werden konnten, spürte er etwas in sich vibrieren, eine Saite, die seit langem stumm gewesen war und nun plötzlich angeschlagen wurde.
„Das... das kann nicht sein", stammelte er schließlich. Seine Stimme klang fremd in seinen eigenen Ohren. „Der Zarewitsch ist tot. Er starb vor neun Jahren in Uglitsch. Das weiß jeder."
Marfa Nagaja trat noch einen Schritt näher. Ihre Hand berührte nun tatsächlich sein Gesicht, zart, zögernd, als könnte er jeden Moment verschwinden wie eine Vision. „Das ist es, was sie alle glauben sollen. Was Boris Godunow die Welt glauben machen wollte. Aber es ist eine Lüge, mein Sohn. Die größte Lüge, die je über Russland erzählt wurde."
„Godunow..." Der Name des Zaren, der jetzt auf dem Thron saß, kam schwer über Grigorijs Lippen. Boris Godunow, der nach dem Tod des Zaren Fjodor, des letzten Rurikiden, die Macht an sich gerissen hatte.
„Setz dich", sagte Marfa sanft und deutete auf den Stuhl, den der Abt freigemacht hatte. „Was ich dir zu sagen habe, wird deine Welt erschüttern. Du solltest sitzen."
Mechanisch gehorchte Grigorij. Seine Beine fühlten sich an wie Wasser. Marfa nahm auf dem anderen Stuhl Platz, die Hände nun fest im Schoß gefaltet, als müsste sie sich selbst zusammenhalten.
„Ich muss am Anfang beginnen", sagte sie. „Bei der Geburt. Du wurdest geboren im Oktober 1582, in Moskau, im Terem-Palast des Kremls. Ich war deine Mutter, Iwan der Schreckliche dein Vater."
Das Zimmer schien zu eng zu werden. Grigorij atmete flach, schnell. „Iwan Wassiljewitsch..."
„Ja. Der schreckliche Iwan, wie sie ihn nannten – und nicht ohne Grund. Er war ein Mann von furchtbaren Widersprüchen, fähig zu großer Liebe und größerer Grausamkeit. Doch dich liebte er, mein Sohn. Du warst sein letztes Kind, seine letzte Hoffnung."
Sie hielt inne, und Grigorij sah, wie sie mit den Tränen kämpfte. „Als er starb, 1584, warst du noch ein Kleinkind. Der Thron ging an deinen Halbbruder Fjodor, einen frommen, aber schwachen Mann. Die wahre Macht aber lag in den Händen von Boris Godunow, Fjodors Schwager. Boris war klug, skrupellos, ehrgeizig. Er sah in dir eine Bedrohung."
„Eine Bedrohung? Ich war ein Kind."
„Du warst der legitime Erbe. Fjodor hatte keine Kinder, würde wahrscheinlich keine haben. Nach ihm würde der Thron an dich fallen, den Sohn Iwans aus seiner letzten Ehe. Das konnte Boris nicht zulassen. Er wollte selbst herrschen."
Marfa stand auf und trat ans Fenster. Die Sonne stand tief, warf lange Schatten durch das Zimmer. „Man verbannte uns nach Uglitsch, dich und mich und unseren kleinen Hof. Offiziell war es eine Ehre, ein eigenes Fürstentum. In Wahrheit war es Verbannung, Gefangenschaft unter dem Deckmantel der Höflichkeit. Wir lebten dort wie in einem goldenen Käfig."
Sie drehte sich zu ihm um. „Du warst ein fröhliches Kind. Lebhaft, neugierig. Du liebtest Spiele, besonders solche, bei denen du einen Herrscher spielen konntest. 'Ich bin der Zar', sagtest du oft und ließest die Diener vor dir niederknien." Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht, verschwand aber sofort wieder.
„Am 15. Mai 1591 geschah es. Du spieltest im Hof des Palastes in Uglitsch. Es war ein warmer Tag. Ich saß am Fenster und nähte, hörte dein Lachen. Dann... Schreie. Entsetzliche Schreie."
Ihre Stimme brach. Sie musste innehalten, Atem holen, sich sammeln.
„Ich rannte hinaus. Dort lag ein Junge, tot, mit durchschnittener Kehle. Blut überall. Die Leute schrien, weinten, ein Tumult brach aus. 'Der Zarewitsch ist tot! Der Zarewitsch ist ermordet!' Die Menge erschlug in ihrer Wut die vermeintlichen Mörder, Männer im Dienste Godunows."
Grigorij hörte zu wie in Trance. Die Geschichte war ihm bekannt – jeder Russe kannte die Geschichte vom Tod des Zarewitsch in Uglitsch. Aber er hatte sie nie so gehört, nie aus diesem Blickwinkel.
„Godunows Untersuchungskommission kam. Sie erklärten, du seist bei einem epileptischen Anfall auf dein eigenes Messer gefallen. Ein Unfall, sagten sie. Kein Mord." Marfas Stimme triefte vor Bitterkeit. „Eine Lüge natürlich. Aber wer würde es wagen, Boris Godunow zu widersprechen?"
„Aber... wenn ich der Zarewitsch war... wenn ich es bin... wie bin ich dann hier? Wie habe ich überlebt?"
Marfa kehrte zu ihrem Stuhl zurück. Sie wirkte jetzt älter, erschöpfter, als trüge das Erzählen dieser Geschichte eine unerträgliche Last. „Es gab Menschen am Hof, die mir noch treu waren. Meine Amme, eine alte Frau namens Wasssilissa, hatte von dem geplanten Attentat gehört, Gerüchte aufgeschnappt. Sie warnte mich Tage zuvor."
Sie senkte die Stimme, als könnte jemand mithören. „Wir ersannen einen verzweifelten Plan. Es gab einen Jungen, ein Findelkind, ungefähr in deinem Alter, ungefähr von deinem Aussehen. Wasssilissa hatte ihn aufgenommen, versorgt. Als die Mörder kamen, war dieser Junge es, der im Hof spielte, in deinen Kleidern."
Grigorij sprang auf. „Ihr habt ein unschuldiges Kind geopfert? An meiner Stelle?"
„Glaubst du, diese Entscheidung fiel mir leicht?" Marfas Augen blitzten. „Jede Nacht sehe ich sein Gesicht, höre ich seine Schreie. Aber was war die Alternative? Dich sterben lassen? Den rechtmäßigen Erben Russlands? Ich hatte keine Wahl. Gott möge mir vergeben."
Sie stand ebenfalls auf, stellte sich ihm gegenüber. „In der Verwirrung nach dem Mord, während die Menge tobte und Blut floss, brachte Wasssilissa dich fort. Sie versteckte dich zunächst in Uglitsch, dann wurde es zu gefährlich. Sie brachte dich nach Moskau, paradoxerweise der sicherste Ort – wer würde den toten Zarewitsch im Herzen von Godunows Macht suchen?"
„Und dann?"
„Dann übergab sie dich einer Familie. Den Otrepjews. Sie waren mir treu gewesen, hatten am Hof meines verstorbenen Gemahls gedient. Sie sollten dich aufziehen, dich verbergen, bis die Zeit reif wäre."
Grigorij ließ sich wieder auf den Stuhl sinken, den Kopf in den Händen. „Die Otrepjews... meine Eltern..."
„Nicht deine Eltern. Deine Beschützer. Sie liebten dich, das glaube ich. Aber sie kannten die Wahrheit. Als sie starben – Godunows Agenten, vermute ich, obwohl nichts bewiesen werden konnte – warst du allein. Das Kloster schien der sicherste Ort für dich."
„Ihr habt mich ins Kloster gegeben?"
„Nicht ich direkt. Wasssilissa arrangierte es über Mittelsmänner. Sie starb kurz darauf. Mit ihr starb fast das gesamte Wissen über dich. Fast." Marfa trat wieder näher. „Aber ich wusste es. Ich habe immer gewusst, dass du lebst. Und ich habe nach dir gesucht, all die Jahre."
„Warum jetzt? Warum kommt Ihr erst jetzt?"
„Weil ich sicher sein musste. Weil Boris Godunow Augen und Ohren überall hat. Weil ein falscher Schritt nicht nur dich, sondern die gesamte Hoffnung auf Gerechtigkeit vernichtet hätte." Sie griff nach seinen Händen. „Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Godunow ist verhasst, sein Regime wackelt. Hungersnöte plagen das Land, die Menschen murren. Russland braucht seinen rechtmäßigen Zaren."
Grigorij entzog ihr die Hände und stand auf. Er ging zum Fenster, starrte hinaus auf den Kreml, auf die goldenen Kuppeln, die im Licht der untergehenden Sonne glühten wie flüssiges Feuer.
„Beweise", sagte er tonlos. „Ihr müsst Beweise haben."
„Beweise?" Marfas Lachen war bitter. „Was für Beweise, mein Sohn? Offizielle Dokumente, die Godunows Häscher längst vernichtet haben? Zeugen, die längst tot sind oder aus Angst schweigen?"
Sie trat neben ihn. „Aber es gibt Zeichen. Sieh dich an. Sieh in einen Spiegel. Du hast die Züge der Rurikiden, die hohe Stirn, die dunklen Augen. Du bist klug, gebildet – Eigenschaften, die man einem einfachen Mönch nicht zutrauen würde. Und da ist noch etwas..."
Sie zog einen kleinen Beutel aus ihrem Gewand und öffnete ihn. Ein Ring fiel in ihre Handfläche, schwer, golden, mit einem großen Rubin besetzt. „Dies war der Ring deines Vaters. Iwan trug ihn immer. Als er starb, nahm ich ihn an mich. Er sollte einst dir gehören."
Sie hielt ihn Grigorij hin. „Nimm ihn. Er ist dein Geburtsrecht."
Grigorij starrte auf den Ring. Das Gold schimmerte im Dämmerlicht, der Rubin glühte wie ein Tropfen geronnenen Blutes. Er streckte zögernd die Hand aus, berührte das Metall. Es war warm, als hätte es ein eigenes Leben.
„Ich... ich weiß nicht..." Seine Stimme versagte.
„Du musst nicht sofort entscheiden", sagte Marfa. „Ich weiß, dies ist überwältigend. Aber denk darüber nach. Such in deinem Herzen. Frag dich, warum du dich hier immer fremd gefühlt hast, warum du immer das Gefühl hattest, für Größeres bestimmt zu sein."
Sie legte den Ring auf den Tisch. „Ich lasse ihn hier. Wenn du bereit bist, die Wahrheit anzunehmen, wenn du bereit bist, dein Schicksal zu erfüllen, dann weißt du, wo du mich finden kannst. Ich bin im Neuen Jungfrauenkloster, unter dem Namen einer einfachen Witwe."
Sie wandte sich zur Tür. „Aber zögere nicht zu lange, mein Sohn. Die Zeit arbeitet gegen uns. Godunow wird nicht ewig leben, aber andere gierige Hände greifen bereits nach der Krone. Russland braucht dich. Ich brauche dich."
Die Tür öffnete sich, schloss sich wieder. Grigorij war allein.
Die Nacht, die folgte, war die längste seines Lebens. Grigorij lag auf seiner Pritsche, unfähig zu schlafen, unfähig auch nur die Augen zu schließen. Der Ring lag auf dem Tisch, ein stummer Zeuge, eine Anklage, eine Verheißung.
Konnte es wahr sein? War es möglich, dass er, ein namenloser Mönch, in Wirklichkeit der rechtmäßige Zar von Russland war?
Seine Gedanken jagten sich im Kreis. Erinnerungen – oder waren es Erfindungen? – tauchten auf. Ein großer Raum mit hohen Fenstern. Eine Frau, die ein Wiegenlied sang. Der Geruch von Weihrauch und Macht. Waren das wirkliche Erinnerungen, oder bildete sein Geist sie nur ein, weil Marfas Worte einen Samen gepflanzt hatten, der nun in der fruchtbaren Erde seiner Einsamkeit wucherte?
Er stand auf, zündete eine Kerze an. Das Licht flackerte, warf tanzende Schatten an die Wände. Er nahm den Ring, hielt ihn ins Licht. Die Gravur im Inneren war abgenutzt, aber noch lesbar: Iwan – von Gottes Gnaden.
Iwan. Sein Vater? Der schreckliche Iwan, dessen Name allein Furcht einflößte, der Zehntausende hatte hinrichten lassen in seinem paranoiden Wahn, der seine eigene Schwiegertochter geschlagen, seinen eigenen Sohn erschlagen hatte in einem Anfall von Zorn?
Und doch, hatte dieser Mann nicht auch die Kathedrale des Basilius erbauen lassen, dieses Wunderwerk aus Stein und Farbe? Hatte er nicht das Reich erweitert, Kasan und Astrachan erobert, Russland zu einer Macht gemacht, die Europa fürchtete?
Grigorij schob den Ring auf seinen Finger. Er passte. Perfekt. Als wäre er für ihn gemacht worden.
Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Die nächsten Tage waren eine Qual. Grigorij versuchte, seinen gewohnten Pflichten nachzugehen, doch alles erschien ihm jetzt anders, fremd, als sähe er die Welt durch andere Augen. Die anderen Mönche waren nicht mehr seine Brüder, sondern Fremde. Die Gebete waren nicht mehr Trost, sondern leere Worte. Die Zelle war nicht mehr Heimat, sondern Gefängnis.
Er erwischte sich dabei, wie er anders ging, aufrechter, herrischer. Wie er anders sprach, mit mehr Autorität. Als ob etwas in ihm erwacht wäre, etwas, das lange geschlafen hatte.
Bruder Leonid bemerkte die Veränderung. „Du bist anders geworden, Grigorij. Seit dem Besuch dieser Frau."
„Bin ich das?" Grigorij hörte die Kälte in seiner eigenen Stimme.
„Ja. Es ist, als... als wärst du nicht mehr einer von uns."
Vielleicht war ich es nie, dachte Grigorij, sprach es aber nicht aus.
Pater Pitirim rief ihn erneut zu sich. Der alte Mönch sah ihn lange an, mit Augen, die zu viel gesehen hatten, zu viel wussten.
„Die Frau, die dich besucht hat", begann er. „Ich weiß, wer sie ist. Marfa Nagaja, die Zarenwitwe."
Grigorij schwieg.
„Ich weiß auch, was sie dir gesagt hat. Nein, sie hat es mir nicht verraten, aber ich bin nicht blind. Ich sehe, wie du dich verändert hast. Ich sehe den Ring an deinem Finger, den du zu verbergen versuchst."
Grigorij zog unwillkürlich die Hand zurück, doch es war zu spät.
„Ist es wahr?" fragte Pitirim leise. „Bist du wirklich...?"
„Ich weiß es nicht", antwortete Grigorij ehrlich. „Ich weiß nicht, was wahr ist und was Lüge. Ich weiß nur, dass alles, was ich zu wissen glaubte, in Frage gestellt ist."
Der alte Mönch nickte langsam. „Marfa Nagaja ist eine verzweifelte Frau. Sie hat ihren Sohn verloren – oder glaubt es. Verzweiflung kann viele Formen annehmen. Manchmal wird aus dem Wunsch, dass etwas wahr sein möge, die Überzeugung, dass es wahr ist."
„Ihr glaubt, sie lügt?"
„Ich glaube, sie glaubt, was sie sagt. Ob es die Wahrheit ist, steht auf einem anderen Blatt."
Grigorij fuhr sich mit der Hand durchs Haar. „Und wenn es wahr ist? Was dann?"
„Dann", sagte Pitirim nach langem Schweigen, „dann steht dir ein Weg bevor, der mit Blut gepflastert ist. Boris Godunow wird nicht freiwillig von seinem Thron steigen. Die Bojaren werden sich auf keine Seite schlagen, bis sie sicher sind, wer siegen wird. Und das Volk..." Er schüttelte den Kopf. „Das Volk ist launisch. Heute jubelt es dir zu, morgen wirft es Steine nach dir."
„Aber wenn ich wirklich der rechtmäßige Zar bin, habe ich dann nicht die Pflicht, meinen Anspruch geltend zu machen?"
„Pflicht." Pitirim lachte bitter. „Ein gefährliches Wort. Viele Verbrechen wurden im Namen der Pflicht begangen. Viel Blut wurde im Namen des Rechts vergossen."
Er stand auf, schwerfällig, alt. „Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst, mein Sohn – oder meine Majestät, sollte ich vielleicht sagen. Ich kann dir nur raten: Sei vorsichtig. Sei weise. Und vor allem: Sei ehrlich zu dir selbst. Frage dich nicht nur, ob du der Zarewitsch sein könntest, sondern auch, ob du es sein willst. Und ob du den Preis zu zahlen bereit bist, den dieses Schicksal fordert."
In jener Nacht, während die Glocken zur Matutin läuteten und die anderen Mönche schlaftrunken zu Gebet taumelten, stand Grigorij am Fenster seiner Zelle und blickte auf Moskau hinaus. Die Stadt schlief, nur vereinzelte Lichter flackerten in der Dunkelheit.
Irgendwo da draußen saß Boris Godunow auf einem Thron, der vielleicht nicht ihm gehörte. Irgendwo wartete Marfa Nagaja auf seine Antwort. Irgendwo, in den Weiten Russlands, hungerten Menschen, litten unter der harten Hand eines Herrschers, der durch Intrige und möglicherweise Mord zur Macht gekommen war.
Grigorij hob die Hand, betrachtete den Ring an seinem Finger. Im Mondlicht glühte der Rubin wie ein Auge, das ihn beobachtete, das ihn richtete.
Wer bin ich?
Die Frage hatte eine einfache Antwort verdient, doch es gab keine.
Er war Grigorij Otrepjew, Mönch im Tschudow-Kloster, ein Niemand, ein Schatten.
Oder er war Dimitrij Iwanowitsch, Sohn Iwans des Schrecklichen, rechtmäßiger Zar von ganz Russland, ein Name, der Geschichte schreiben würde.
Oder er war etwas dazwischen, ein Werkzeug in einem Spiel, dessen Regeln er nicht verstand, dessen Ausgang er nicht vorhersehen konnte.
In der Ferne begann ein Hahn zu krähen, der erste Vorbote des Morgens. Ein neuer Tag brach an. Und mit ihm eine Entscheidung, die nicht länger aufgeschoben werden konnte.
Grigorij – oder Dimitrij – atmete tief ein. Dann wandte er sich vom Fenster ab und begann zu packen.
Seine Zeit im Kloster war vorbei.
Kapitel 3: Flucht nach Polen
Die Flucht wurde in aller Stille vorbereitet. Grigorij – er nannte sich noch immer so, auch wenn der Name bereits wie eine abgelegte Haut an ihm hing – verbrachte drei Tage damit, das Notwendigste zusammenzutragen. Es war weniger, als man hätte erwarten können. Ein Mönch besaß kaum etwas: eine zweite Kutte, ein Gebetbuch, etwas Brot und getrocknetes Fleisch, das er sich vom Speisesaal abzweigte. Und natürlich den Ring, den er an einer Kette um den Hals trug, verborgen unter dem groben Stoff seiner Kleidung.
Die größte Herausforderung war nicht das Was, sondern das Wie. Das Tschudow-Kloster lag mitten im Kreml, dem befestigten Herzen Moskaus. Die Tore wurden bewacht, die Wachen kannten die Brüder vom Sehen. Ein Mönch, der nachts das Kloster verließ, würde Fragen aufwerfen. Fragen, die zu Boris Godunow führen könnten. Und das durfte nicht geschehen.
Er fand unerwartete Hilfe bei Bruder Leonid.
An seinem letzten Abend im Kloster, als die Komplet längst gesungen war und die meisten Brüder in ihren Zellen lagen, klopfte es leise an seiner Tür. Grigorij, der bereits zur Hälfte angezogen war – unter der Kutte trug er weltliche Kleidung, die er sich von einem Händler hatte besorgen lassen –, erstarrte.
„Herein", sagte er schließlich, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern.
Leonid trat ein, eine Kerze in der Hand. Sein rundes Gesicht war ernst, die sonst so fröhlichen Augen von Sorge getrübt.
„Du gehst", sagte er. Es war keine Frage.
Grigorij überlegte, zu leugnen, erkannte aber die Sinnlosigkeit. „Ja."
„Wohin?"
„Das kann ich dir nicht sagen. Zu deinem eigenen Schutz."
Leonid nickte langsam. „Ich habe es kommen sehen. Seit dem Besuch dieser Frau bist du nicht mehr derselbe. Es ist, als hättest du jemand anderen angezogen wie ein Gewand."
„Vielleicht", sagte Grigorij, „habe ich nur das Gewand abgelegt, das mir nie gepasst hat."
Eine lange Stille dehnte sich zwischen ihnen. Dann holte Leonid etwas unter seiner Kutte hervor – einen Schlüssel, alt und verrostet.
„Der Garten", sagte er. „Es gibt eine alte Pforte in der Nordmauer, fast zugewachsen mit Efeu. Sie führt zu einem schmalen Gang, der zum Fluss hinunter führt. Die Wachen kennen sie nicht, oder haben sie vergessen. Ich habe sie vor Jahren entdeckt, als ich noch neu hier war."
Grigorij starrte auf den Schlüssel. „Warum hilfst du mir?"
Leonid lächelte schwach. „Weil ich, obwohl ich ein einfacher Mann bin, erkenne, wenn jemand zu Größerem berufen ist. Und weil ich glaube, dass Gott manchmal seltsame Wege geht, um seinen Willen zu erfüllen. Vielleicht bist du so ein Weg."
Er drückte Grigorij den Schlüssel in die Hand. „Geh mit Gott, Bruder. Oder Majestät. Oder wer auch immer du sein magst."
„Leonid, ich—"
„Sag nichts. Nur eines noch: Wenn du je Macht hast, denk an die einfachen Menschen. An Leute wie mich, die nur in Frieden leben wollen. Vergiss uns nicht."
„Das werde ich nicht", versprach Grigorij. „Das schwöre ich."
Sie umarmten sich kurz, unbeholfen, wie es Männer tun, die nicht gewohnt sind, Gefühle zu zeigen. Dann war Leonid verschwunden, und Grigorij war wieder allein.
Er wartete noch eine Stunde, bis er sicher war, dass alle schliefen. Dann streifte er die Mönchskutte ab, stand da in einfacher Reisekleidung – Leinenhose, Wolltunika, ein derber Umhang. Nichts, was Aufmerksamkeit erregt hätte. Er legte den kleinen Beutel mit seinen Habseligkeiten über die Schulter, nahm den Schlüssel und trat in den Gang hinaus.
Das Kloster bei Nacht war ein anderer Ort. Die Schatten schienen tiefer, die Stille drückender. Jedes Knarren der alten Holzböden klang wie Donner in seinen Ohren. Doch er begegnete niemandem. Die Brüder schliefen den Schlaf der Rechtschaffenen, und die wenigen Nachtwachen hatten ihre Runden an anderen Orten.
Der Garten lag im Mondlicht, silbern und gespenstisch. Die Gemüsebeete warfen lange Schatten, die Obstbäume standen wie stumme Wächter. Grigorij hastete über den Weg, wobei seine Füße kaum ein Geräusch machten auf der feuchten Erde.
Die Pforte war tatsächlich fast unsichtbar, verborgen hinter dichtem Efeu. Er musste die Ranken beiseite schieben, was ein raschelndes Geräusch verursachte, das ihm viel zu laut erschien. Der Schlüssel passte ins Schloss, aber es klemmt. Der Rost von Jahren widersetzte sich. Grigorij fluchte leise, drückte fester. Mit einem Knirschen, das durch die Nacht schnitt wie ein Messer, gab das Schloss nach.
Er hielt den Atem an, lauschte. Nichts. Nur das leise Rauschen des Windes in den Bäumen.
Die Pforte öffnete sich nach außen, schwer, die Angeln quietschend. Dahinter: Dunkelheit. Ein schmaler Gang, kaum breit genug für einen Mann, führte abwärts zwischen zwei Mauern. Grigorij trat hindurch, zog die Pforte hinter sich zu. Das Schloss schnappte ein, und er stand in völliger Finsternis.
Er tastete sich vorwärts, die Hände an den feuchten Steinwänden. Der Gang roch nach Moder und Verfall. Irgendwo tropfte Wasser. Seine Schritte hallten wider, und mehr als einmal stolperte er über Unrat auf dem Boden. Aber er ging weiter, getrieben von einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit.
Nach vielleicht hundert Schritten sah er Licht – schwach, bläulich, das Licht des Mondes. Der Gang endete an einer weiteren Pforte, diese unverschlossen. Er trat hinaus und fand sich am Ufer der Moskwa wieder, unterhalb der Kremlmauern. Das Wasser glänzte im Mondlicht wie flüssiges Silber.
Er hatte es geschafft. Er war frei.
Grigorij folgte dem Flussufer nach Westen, immer im Schatten der Bäume bleibend. Moskau schlief, aber nicht völlig. Hier und dort sah er Lichter, hörte Stimmen, das Bellen eines Hundes. Patrouillen waren unterwegs – Godunows Männer, die nach Unruhestiftern suchten, nach Dieben, nach jedem, der in der Nacht ein Geschäft zu erledigen hatte, das das Tageslicht nicht vertrug.
Er musste die Stadt verlassen, und zwar schnell. Aber die Tore waren bewacht, und ein einzelner Wanderer würde Verdacht erregen. Er brauchte eine Gruppe, einen Vorwand.
Das Glück – oder die Vorsehung – spielte ihm in die Hände.
Am westlichen Stadtrand, nahe dem Arbat-Tor, fand er eine Karawane. Händler, die auf dem Weg nach Smolensk waren, der ersten größeren Stadt auf dem Weg nach Westen, Richtung Polen. Sie hatten für die Nacht Lager gemacht, ihre Wagen im Kreis aufgestellt, ein Feuer entfacht. Die Männer saßen herum, tranken Kwas, erzählten Geschichten.
Grigorij näherte sich vorsichtig. „Gott zum Gruße, Brüder", rief er aus der Dunkelheit.
Die Männer sprangen auf, griffen nach Knüppeln und Messern. „Wer da?"
„Ein Reisender. Ein Pilger, auf dem Weg nach Kiew." Die Lüge kam ihm leicht über die Lippen.
Ein älterer Mann, offenbar der Anführer, trat vor. Er hatte ein wettergegerbtes Gesicht und misstrauische Augen. „Ein Pilger? Mitten in der Nacht?"
„Ich habe mich verirrt. Die Dunkelheit kam schneller, als ich dachte."
Der Mann musterte ihn. „Du siehst nicht aus wie ein Pilger. Keine Ikone, keine Gebetsschnur."
Grigorij griff unter seine Tunika und zog das Gebetbuch hervor, das einzige, was er aus dem Kloster mitgenommen hatte. „Hier. Das Wort Gottes ist mein Schutz."
Die Spannung wich etwas. Der Händler nickte. „Nun gut. Komm ans Feuer. Die Nacht ist kalt, und die Wölfe sind hungrig."
Grigorij setzte sich zu ihnen, dankbar für die Wärme des Feuers. Man reichte ihm einen Becher mit Kwas, ein Stück hartes Brot. Er aß langsam, hörte zu, wie die Männer sprachen.
Sie beklagten sich über die Zeiten. Die Steuern seien zu hoch, die Straßen unsicher, das Wetter unbeständig. Die Ernte im letzten Jahr war schlecht gewesen, die Preise stiegen. Und über allem lag die Unzufriedenheit mit Boris Godunow.
„Ein Usurpator", murmelte einer der Händler, ein junger Mann mit finsterem Blick. „Er hat den Thron gestohlen, so wie er alles stiehlt."
„Sei still", zischte der Anführer. „Solche Worte können dich den Kopf kosten."
„Aber es stimmt doch. Jeder weiß es. Er hat den kleinen Zarewitsch töten lassen, damit sein Weg frei war."
Grigorij spürte, wie sein Herz schneller schlug. „Der Zarewitsch", sagte er vorsichtig. „Dimitrij, nicht wahr? In Uglitsch?"
„Ja", antwortete der junge Mann. „Ein Kind, keine acht Jahre alt. Ermordet. Das Volk hat die Täter zerrissen, aber der wahre Mörder sitzt auf dem Thron."
„Und wenn der Zarewitsch nicht tot wäre?" Die Worte waren heraus, bevor Grigorij sie zurückhalten konnte.
Die Männer starrten ihn an. „Was redest du da?" fragte der Anführer.
„Nur eine Annahme. Was, wenn er überlebt hätte? Wenn das Kind, das in Uglitsch starb, ein anderes war?"
Eine lange Stille. Dann lachte einer der Händler, ein bellender, ungläubiger Laut. „Das sind Märchen. Wunschträume von Leuten, die sich nach den alten Zeiten sehnen."
„Vielleicht", sagte Grigorij. „Oder vielleicht nicht."
Er sagte nichts mehr dazu, aber er sah, wie die Männer einander Blicke zuwarfen, wie die Samen des Zweifels – oder der Hoffnung – in ihren Köpfen zu keimen begannen.
Am nächsten Morgen, als die Karawane aufbrach, schloss Grigorij sich an. Der Anführer war einverstanden, solange er seinen Anteil an der Arbeit leistete. So half Grigorij, die Wagen zu schieben, wenn sie im Schlamm stecken blieben, die Pferde zu füttern, das Feuer zu entfachen.
Die Reise war beschwerlich. Die Straßen waren schlecht, oft nicht mehr als ausgefahrene Pfade durch Wälder und Sümpfe. Es regnete häufig, ein kalter, durchdringender Regen, der durch die Kleidung sickerte und die Knochen frösteln ließ. Nachts schlief man unter den Wagen, eng zusammengedrängt, lauschend auf die Geräusche der Wildnis – das Heulen der Wölfe, das Knacken von Zweigen, das jedes Mal das Herz schneller schlagen ließ.
Aber Grigorij beklagte sich nicht. Im Gegenteil, er fand eine eigenartige Befriedigung in der körperlichen Arbeit, in der Einfachheit dieses Lebens. Es war so anders als das Kloster, und doch auf seine Weise ebenso klar strukturiert. Es gab eine Aufgabe, man erfüllte sie, und am Ende des Tages gab es Essen und Schlaf.