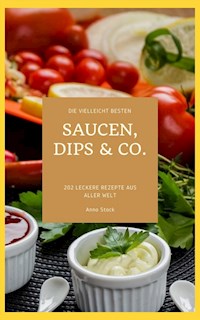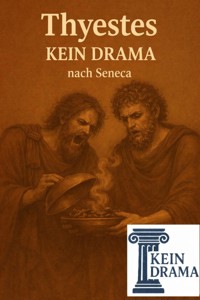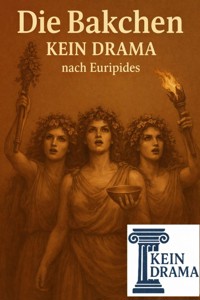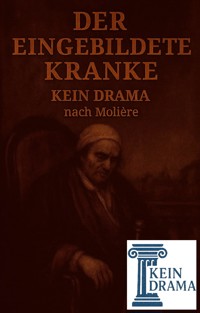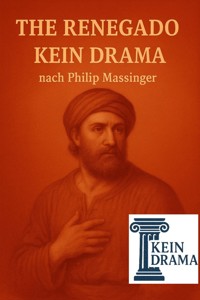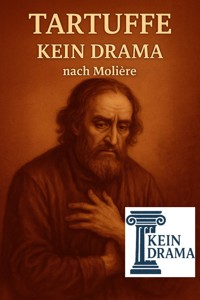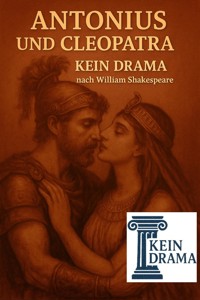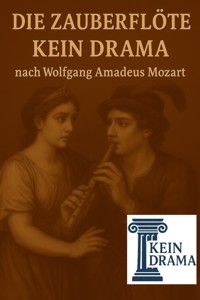6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte, die Sie zu kennen glauben – neu erzählt aus der Perspektive derer, die wirklich litten. Sevilla, 1640. Don Juan Tenorio ist charmant, gebildet, furchtlos – und gefährlich. Als Sohn einer der angesehensten Familien Spaniens scheint ihm alles erlaubt. Mit Lügen und falschen Versprechen verführt er Frauen jeden Standes, zerstört Leben und Reputationen, ohne je die Konsequenzen zu tragen. Bis zu jener Nacht, als er Don Gonzalo de Ulloa tötet – den Komtur von Calatrava, Vater der Frau, die er gerade entehrt hat. Auf der Flucht vor der Gerechtigkeit kehrt Don Juan nach Sevilla zurück, wo ihn eine unmögliche Begegnung erwartet: Die Marmorstatue des ermordeten Komturs erwacht zum Leben und lädt ihn zu einem letzten, verhängnisvollen Treffen ein. Doch dies ist nicht nur Don Juans Geschichte. Es ist die Geschichte von Isabela, die glaubte, mit ihrem Verlobten zusammen zu sein. Von Tisbea, der Fischerin, die falschen Heiratsversprechen vertraute. Von Doña Ana, deren Vater starb, um ihre Ehre zu verteidigen. Von Aminta, zweimal betrogen, zweimal zerstört. Eine kraftvolle Neuerzählung des klassischen Don-Juan-Mythos, die nicht den Verführer feiert, sondern den Überlebenden eine Stimme gibt. Ein Roman über Macht und Missbrauch, über göttliche Gerechtigkeit und menschliche Widerstandsfähigkeit – und darüber, dass die wahren Heldinnen jeder Geschichte die sind, die trotz allem weiterleben. Basierend auf Tirso de Molinas "El burlador de Sevilla" (1630) – der Originalquelle der Don-Juan-Legende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Der Verführer von Sevilla - Kein Drama nach Tirso de Molina
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
DER VERFÜHRER VON SEVILLA – KEIN DRAMA NACH TIRSO DE MOLINA
KAPITEL 1: Nächtliche Täuschung
KAPITEL 2: Der treue Diener
KAPITEL 3: Schiffbruch und Rettung
KAPITEL 4: Das Versprechen am Strand
KAPITEL 5: Flucht bei Morgengrauen
KAPITEL 6: Die Stadt der Versuchungen
KAPITEL 7: Der König und die Ehre
KAPITEL 8: Octavios Verzweiflung
KAPITEL 9: Begegnung auf dem Marktplatz
KAPITEL 10: Der falsche Freund
KAPITEL 11: Der Komtur von Calatrava
KAPITEL 12: Blut und Schatten
KAPITEL 13: Das Dorf Dos Hermanas
KAPITEL 14: Die gestohlene Hochzeitsnacht
KAPITEL 15: Stimmen der Opfer
KAPITEL 16: Die Rückkehr
KAPITEL 17: Das steinerne Grabmal
KAPITEL 18: Der unerwartete Gast
KAPITEL 19: Die Einladung zum Tode
KAPITEL 20: Die Entdeckung
KAPITEL 21: Gerechtigkeit und Trauer
KAPITEL 22: Epilog – Die Legende beginnt
KAPITEL 23: Die ewige Warnung
KAPITEL 24: Das ewige Echo
Impressum neobooks
DER VERFÜHRER VON SEVILLA – KEIN DRAMA NACH TIRSO DE MOLINA
Die wahre Geschichte von Don Juan Tenorio
Für alle, die überlebt haben.
Für alle, deren Geschichten nicht erzählt wurden.
Für alle, die sich weigern, definiert zu werden durch das,was ihnen angetan wurde.
Autor-Note:
Diese Erzählung basiert auf dem klassischen spanischen Theaterstück El burlador de Sevilla y convidado de piedra (Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast) von Tirso de Molina aus dem frühen 17. Jahrhundert. Es ist die ursprüngliche Don-Juan-Geschichte, die unzählige Adaptationen inspirierte.
In dieser Nacherzählung wurde versucht, nicht nur die dramatischen Ereignisse zu erzählen, sondern auch die menschlichen Kosten von Don Juans Taten zu beleuchten. Die Stimmen der Opfer – so oft überhört in traditionellen Versionen – stehen hier im Mittelpunkt.
Dies ist eine Geschichte über Macht und Missbrauch, aber auch über Überleben und Widerstandsfähigkeit. Es ist keine Feier eines "romantischen Helden", sondern eine Warnung vor den Konsequenzen von Rücksichtslosigkeit und die Anerkennung der Stärke derer, die trotz allem weiterleben.
Die Geschichte spielt im Spanien des 17. Jahrhunderts, aber ihre Themen sind zeitlos.
Inhaltswarnung:
Dieser Roman enthält Darstellungen von sexueller Gewalt, Betrug, Mord und emotionalem Missbrauch. Während explizite Szenen vermieden werden, sind die Themen schwer und können für manche Leser belastend sein.
Sevilla, 1640
Wo alles begann.Und wo alles endete.
KAPITEL 1: Nächtliche Täuschung
Die Nacht lag schwer über Neapel. In den engen Gassen der Stadt, wo sich das Pflaster noch von der Hitze des Tages erwärmte, herrschte jene trügerische Stille, die nur die Dunkelheit kennt – eine Stille, durchsetzt mit fernen Stimmen, dem Klirren einer Flasche, dem heiseren Lachen eines Betrunkenen. Doch hier oben, in den marmornen Korridoren des Palazzo del Viceré, wo die Macht residierte und die Etikette herrschte, schien selbst die Luft bewegungslos zu sein, als fürchte sie, den Schlaf der Mächtigen zu stören.
Don Juan Tenorio bewegte sich durch diese Stille wie ein Schatten, der keinen Körper warf. Seine Schritte auf den polierten Fliesen waren kaum mehr als ein Flüstern, ein Hauch von Bewegung in der erstarrten Welt der Nacht. Er trug die Kleidung eines Höflings, dunkel und kostbar, doch das Gesicht hatte er mit einem schwarzen Tuch verhüllt – nicht aus Vorsicht allein, sondern aus dem theatralischen Instinkt eines Mannes, der sein Leben als Bühne betrachtete und jede Geste, jede Täuschung als Teil einer größeren Inszenierung verstand.
Vor ihm lag die Tür zu Isabelas Gemach. Isabela de la Cerda, Nichte des Herzogs, verlobt mit Don Octavio, dem Sohn einer der mächtigsten Familien Spaniens – eine Frau, die man nicht einfach verführte, sondern eroberte wie eine befestigte Stadt, durch List und durch die Ausnutzung jener Schwachstellen, die jede noch so gut bewachte Festung besaß. Und Don Juan kannte diese Schwachstellen. Er kannte das Verlangen, das selbst in den tugendhaftesten Herzen schlummerte, die Sehnsucht nach jenem Moment, in dem die Vernunft schweigt und nur noch das Herz spricht – oder das, was man dafür hielt.
Er legte die Hand auf den goldenen Türknauf, kühl unter seinen Fingern, und drehte ihn langsam. Das leise Klicken des Schlosses schien in der Stille wie ein Donnerschlag, doch niemand kam. Niemand hörte. Die Wachen patrouillierten auf ihren festgelegten Routen, die Diener schliefen in ihren Kammern, und der Herzog selbst lag in seinen Gemächern, weit entfernt in einem anderen Flügel des Palastes.
Die Tür glitt auf. Ein schwacher Lichtschein drang aus dem Raum – Kerzenschein, der goldene Schatten an die Wände malte und die Konturen der Möbel in ein sanftes, verheißungsvolles Dämmerlicht tauchte. Don Juan trat ein und schloss die Tür hinter sich, leise, präzise.
„Octavio?"
Die Stimme kam aus der Dunkelheit, zögernd, hoffnungsvoll. Isabela lag in ihrem Bett, das Haar gelöst, die Gestalt unter den seidenen Laken nur schemenhaft zu erkennen. Sie hatte auf ihn gewartet – nein, nicht auf ihn, korrigierte sich Don Juan mit einem inneren Lächeln, auf Octavio, ihren Verlobten, den Mann, den sie liebte, den Mann, dessen Gestalt er nun angenommen hatte wie ein Schauspieler eine Rolle.
„Ja, meine Liebste", antwortete Don Juan, und seine Stimme war tief und sanft, moduliert nach dem Vorbild Octavios, den er studiert hatte wie ein Maler sein Modell. „Ich bin gekommen."
„Octavio!" Isabelas Stimme klang erleichtert, beinahe jubelnd. „Ich dachte schon, du hättest es dir anders überlegt. Ich fürchtete, dass die Vernunft dich doch noch davon abhält, zu mir zu kommen. Aber du bist hier! Du bist wirklich hier!"
Don Juan trat näher ans Bett, sein Gesicht im Schatten, die Züge verhüllt. Die Kerzen warfen tanzende Schatten an die Wände, und in diesem flackernden Licht konnte man kaum mehr erkennen als eine Silhouette, eine Ahnung von einem Menschen. Er setzte sich auf die Bettkante, spürte die Wärme ihres Körpers durch die Laken hindurch.
„Wie könnte ich von dir fernbleiben?", flüsterte er. „Wie könnte ich widerstehen, wenn du mich rufst?"
Es waren die Worte, die sie hören wollte, die Worte, die jede Frau hören wollte – nicht originell, nicht besonders, aber wirksam in ihrer Einfachheit. Don Juan hatte gelernt, dass Frauen nicht nach Originalität dürsteten, sondern nach Bestätigung, nach der Gewissheit, geliebt zu werden, begehrt zu werden, wichtig zu sein in einer Welt, die ihnen so wenig Raum für Bedeutung ließ.
„Aber wenn uns jemand entdeckt", sagte Isabela, und in ihrer Stimme lag nun eine Spur von Angst, „wenn der Herzog erfährt, dass du hier warst, vor unserer Hochzeit... Octavio, wir riskieren alles!"
„Dann riskieren wir es gemeinsam", erwiderte Don Juan und nahm ihre Hand. Ihre Finger waren kühl und zitterten leicht. „Was ist ein Leben ohne Risiko? Was ist Liebe, wenn sie sich nicht über die Konventionen hinwegsetzt?"
Er sprach wie ein Poet, wie ein Träumer, doch hinter seinen Worten lag keine Wahrheit, nur Kalkül. Jede Silbe war gewählt, um zu verführen, um zu täuschen, um jene unsichtbare Mauer niederzureißen, die zwischen Isabelas Verlangen und ihrer Tugend stand.
„Du hast recht", flüsterte sie, und er hörte, wie ihre Stimme weicher wurde, wie der Widerstand in ihr nachgab. „Du hast immer recht."
Don Juan lächelte in der Dunkelheit. Es war zu einfach. Fast schon langweilig. Aber das war der Preis des Erfolgs – je besser man wurde in einer Kunst, desto weniger Herausforderung bot sie noch. Dennoch, der Moment selbst, der Augenblick des Triumphs, wenn eine Frau sich ergab, wenn die Maske der Tugend fiel und darunter das nackte Verlangen zum Vorschein kam – dieser Moment blieb süß, unabhängig davon, wie oft man ihn bereits erlebt hatte.
Er beugte sich zu ihr, und sie empfing ihn mit einem Seufzer, der zwischen Hingabe und Verzweiflung schwebte.
Die Stunden vergingen. Wie viele, hätte Don Juan nicht sagen können. In solchen Momenten verlor die Zeit ihre Bedeutung, wurde zu einem fließenden, formlosen Etwas, das sich nicht mehr messen ließ. Die Kerzen brannten herab, das Wachs tropfte in langen, weißen Rinnsalen die silbernen Leuchter hinunter. Draußen begann der Himmel sich zu färben, jenes erste fahle Grau, das dem Morgen vorausging.
Isabela lag neben ihm, das Gesicht friedlich im Schlaf, eine Hand unter der Wange, das Haar über das Kissen ausgebreitet wie dunkles Wasser. Sie sah verletzlich aus in diesem Moment, unschuldig fast, und für einen Atemzug – nur einen einzigen, kurzen Atemzug – spürte Don Juan so etwas wie Reue. Nicht Reue für das, was er getan hatte, sondern Reue darüber, dass er nichts dabei empfand. Keine Liebe, keine echte Begierde, nur die kalte Befriedigung des Jägers, der seine Beute erlegt hat.
Dann schob er den Gedanken beiseite. Sentimentalität war eine Schwäche, die er sich nicht leisten konnte.
Er erhob sich vom Bett, leise, darauf bedacht, Isabela nicht zu wecken. Seine Kleidung lag verstreut auf dem Boden, und er begann sich anzuziehen, die Bewegungen mechanisch, routiniert. Gerade als er nach seinem Wams griff, hörte er es.
Schritte.
Schnelle, entschlossene Schritte auf dem Korridor draußen.
Don Juan erstarrte. Das waren nicht die schlurfenden Schritte eines Dieners oder die gemessenen Schritte einer Wache auf ihrer Runde. Das war jemand, der ein Ziel hatte, jemand, der wusste, wohin er ging.
Die Schritte kamen näher.
„Isabela!" Eine Stimme, laut und empört, durchschnitt die Stille. „Isabela, öffne diese Tür!"
Es war die Stimme des Herzogs.
Don Juan fluchte leise. Er hatte die Zeit falsch eingeschätzt, war zu lange geblieben, hatte sich zu sicher gefühlt. Hinter ihm erwachte Isabela mit einem erschrockenen Aufschrei.
„Was... was ist...?" Ihre Augen weiteten sich, als sie die Situation begriff. „Gott im Himmel! Das ist mein Onkel! Octavio, versteck dich! Schnell!"
Aber Don Juan bewegte sich nicht zum Schrank oder hinter den Wandschirm. Stattdessen ging er zur Tür, die Hand bereits am Griff. Isabela sah ihm verwirrt nach.
„Was tust du? Du kannst doch nicht—"
Die Tür flog auf, bevor sie ihren Satz beenden konnte. Der Herzog stand im Türrahmen, eine Kerze in der Hand, das Gesicht rot vor Zorn. Hinter ihm drängten sich zwei Wachen, die Hände an den Schwertgriffen.
„Was bei allen Heiligen—" Der Herzog stockte, als er Don Juan sah. Sein Blick glitt von dem Fremden zu Isabela im Bett, das Laken hastig bis zum Kinn hochgezogen, das Haar zerzaust, die Augen weit vor Entsetzen. „Du elender Hund! Wie wagst du es, dich in diesen Palast zu schleichen! Wie wagst du es, meine Nichte zu entehren!"
Don Juan neigte den Kopf in einer spöttischen Verbeugung. „Euer Gnaden, ich versichere Ihnen, die Dame hat mich durchaus willkommen geheißen."
„Schweig!" Der Herzog wandte sich zu seinen Wachen. „Ergreift ihn! Werft diesen Schurken in den tiefsten Kerker!"
Die Wachen zögerten einen Moment – Don Juan war ein Edelmann, das sah man an seiner Kleidung, und Edelleute verhaftete man nicht einfach so, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Aber der Befehl des Herzogs war eindeutig.
Sie traten vor.
Don Juan wich zurück, die Hand an seinem Dolch. Nicht, um zu kämpfen – er war kein Narr, zwei bewaffnete Soldaten anzugreifen –, sondern als Warnung. „Ich rate davon ab, mir zu nahe zu kommen."
„Feigling!", rief der Herzog. „Willst du fliehen wie ein Dieb?"
„Ich bin kein Dieb", erwiderte Don Juan kühl. „Ich nehme nur, was mir gegeben wird."
Isabelas Schluchzen erfüllte den Raum. „Octavio! Warum sagst du solche Dinge? Octavio, bitte!"
Aber ihre Worte schienen Don Juan nicht zu berühren. Er hatte die Situation bereits analysiert. Die Tür war blockiert, die Wachen rückten näher, der Herzog schrie nach Verstärkung. Es gab nur einen Ausweg.
Das Fenster.
Ohne zu zögern, wirbelte Don Juan herum und rannte auf das hohe Bogenfenster zu, das auf einen Balkon hinausging. Die Wachen stürmten hinter ihm her, ihre schweren Stiefel dröhnten auf dem Boden.
„Haltet ihn! Haltet diesen Verbrecher!"
Don Juan erreichte das Fenster, stieß die Läden auf. Kühle Morgenluft schlug ihm entgegen. Unter ihm lag der Innenhof des Palastes, drei Stockwerke tief, die Steine hart und unversöhnlich im frühen Licht.
Aber Don Juan sah nicht auf den Hof. Er sah auf die Ranken des wilden Weins, die an der Mauer emporwuchsen, dick und alt, stark genug, um das Gewicht eines Mannes zu tragen – vielleicht.
Hinter ihm packte eine Hand nach seinem Arm. Don Juan riss sich los, schwang sich über die Balustrade und griff nach den Ranken. Für einen Herzschlag hing er frei in der Luft, das Gewicht seines Körpers nur gehalten von dem grünen, nachgiebigen Geflecht. Dann begannen die Ranken nachzugeben, langsam erst, dann schneller.
Don Juan ließ sich fallen, kontrolliert, die Hände immer wieder neue Halte suchend, die Füße gegen die Wand gestemmt. Die Ranken rissen, Blätter wirbelten durch die Luft, doch er fiel nicht, er glitt, rutschte, steuerte seinen Sturz wie ein Seemann einen Kurs.
Oben auf dem Balkon erschienen die Wachen, ihre Gesichter ungläubig, während sie zusahen, wie der Flüchtling sich in einer halsbrecherischen Aktion abseilen wollte.
„Schießt auf ihn!", brüllte der Herzog. „Mit der Armbrust! Schnell!"
Aber bevor jemand eine Waffe holen konnte, hatte Don Juan den Boden erreicht. Er landete hart, rollte ab, sprang auf die Füße. Sein Knöchel schmerzte, aber nichts war gebrochen. Er war frei.
Ohne zurückzublicken, rannte er durch das Tor des Innenhofs, an schlaftrunkenen Dienern vorbei, die ihn verständnislos anstarrten, hinaus auf die Straße, wo die ersten Handwerker bereits ihre Läden öffneten und die Bäcker ihre Öfen anheizten.
Neapel erwachte, und Don Juan Tenorio verschwand in seinem Gewirr aus Gassen und Geheimnissen, ein Schatten unter Schatten, ein Mann ohne Reue und ohne Furcht – noch nicht.
Hinter ihm, im Palast, brach das Chaos aus. Isabelas Schreie durchschnitten die Morgenstille, der Herzog tobte, die Wachen stürmten durch die Korridore. Und in all dem Tumult stand eine Frage im Raum, unausgesprochen, aber allgegenwärtig:
Wer war dieser Mann?
Isabela glaubte noch immer, es sei Octavio gewesen, ihr Verlobter, der Mann, dem sie vertraut hatte. Und diese Überzeugung würde Konsequenzen haben – Konsequenzen, die Don Juan nicht kümmerten, während er durch die engen Gassen lief, das Herz ruhig, der Atem gleichmäßig, bereits planend, wie er aus der Stadt entkommen würde.
Die Sonne ging auf über Neapel, golden und gleichgültig, und mit ihr begann eine Geschichte, die in Blut und Verrat geschrieben werden würde, eine Geschichte von einem Mann, der glaubte, über den Gesetzen zu stehen – über den Gesetzen der Menschen und vielleicht sogar über den Gesetzen Gottes.
Doch jede Geschichte hat ein Ende. Und Don Juan Tenorios Ende würde nicht weniger dramatisch sein als sein Anfang.
KAPITEL 2: Der treue Diener
Die Hafenschenke „Zum goldenen Anker" roch nach Salzwasser, billigem Wein und den verschütteten Träumen unzähliger Seeleute. Sie lag in jenem Teil Neapels, wo die vornehme Gesellschaft niemals hinkam, wo die Gassen so eng waren, dass die Sonne selbst zur Mittagszeit kaum den Boden erreichte, und wo ein Mann verschwinden konnte, wenn er verschwinden musste.
Catalinón saß an einem wackeligen Tisch in der hintersten Ecke des Schankraums und wartete. Er hatte schon oft gewartet – auf Don Juan zu warten war eine jener Aufgaben, die zu seinem Dienst gehörten wie das Putzen von Stiefeln oder das Packen von Koffern. Doch dieses Warten war anders. Dieses Warten hatte einen bitteren Beigeschmack, eine Vorahnung von Unheil, die sich in seinem Magen festgesetzt hatte wie ein Stein.
Vor ihm stand ein halbvoller Becher Wein, den er kaum angerührt hatte. Catalinón war nicht zum Trinken gekommen. Er war gekommen, weil Don Juan ihm gesagt hatte, er solle hierherkommen und warten. Und so wartete er.
Er war ein untersetzter Mann von vielleicht dreißig Jahren, mit einem runden Gesicht, das zum Lachen neigte, auch wenn ihm in letzter Zeit immer weniger zum Lachen zumute war. Seine Kleidung war einfach, aber sauber – die Kleidung eines Dieners aus gutem Hause, nicht prächtig, aber respektabel. Seine Hände, die nervös den Becher umklammerten, waren die Hände eines Mannes, der sein Leben lang gearbeitet hatte, aber nie unter wirklicher Härte gelitten.
Die Tür der Schenke flog auf, und Don Juan trat ein.
Sofort erkannte Catalinón an der Körperhaltung seines Herrn, dass etwas schiefgegangen war. Don Juan bewegte sich schnell, aber nicht gehetzt, sein Blick schweifte durch den Raum, analysierte jedes Gesicht, jede potenzielle Gefahr. Als er Catalinón entdeckte, entspannte sich seine Haltung minimal, doch die Anspannung blieb.
Er schlängelte sich zwischen den Tischen hindurch, ignorierte die neugierigen Blicke der anderen Gäste und ließ sich auf den Stuhl gegenüber von Catalinón fallen.
„Wir müssen weg", sagte Don Juan ohne Präambel. „Sofort."
Catalinón seufzte tief. „Was habt Ihr diesmal angestellt, Herr?"
„Nichts, was nicht vergeben werden könnte – mit genügend Zeit und Abstand." Don Juan griff nach Catalinóns Weinbecher und leerte ihn in einem Zug. „Aber die Zeit haben wir nicht, und den Abstand müssen wir uns verschaffen."
„Isabela?", fragte Catalinón, obwohl er die Antwort bereits kannte.
„Die Dame wurde bedient, wie versprochen." Don Juan lächelte, doch in diesem Lächeln lag keine Freude, nur die kalte Befriedigung eines erledigten Geschäfts. „Leider wurde ich dabei gestört. Der Herzog persönlich hat mich erwischt."
Catalinón schloss die Augen. „Heilige Mutter Gottes."
„Ich bezweifle, dass sie uns jetzt noch helfen kann." Don Juan lehnte sich zurück, die Augen auf die Tür gerichtet. „Hast du das Schiff gefunden?"
„Ja, Herr. Die Santa María segelt mit der Mittagsflut nach Tarragona. Der Kapitän ist käuflich – für den richtigen Preis."
„Gut." Don Juan zog einen Beutel mit Münzen aus seinem Wams und warf ihn auf den Tisch. Das Klirren der Goldstücke ließ mehrere Köpfe in der Schenke sich umdrehen. „Bezahle ihn. Und sorge dafür, dass er keine Fragen stellt und keine Antworten gibt, sollte jemand nach uns suchen."
Catalinón nahm den Beutel, schwer und vielversprechend. „Und Euer Gepäck?"
„Lass es. Wir haben keine Zeit." Don Juan stand auf. „Wir gehen zum Hafen. Getrennt. Folge mir in zehn Minuten."
„Herr, wenn ich fragen darf..." Catalinón zögerte, dann sprach er die Worte aus, die er schon so oft hatte aussprechen wollen. „War es das wert? War es die Gefahr wert, die Flucht, der Ärger?"
Don Juan sah ihn an, und für einen Moment lag etwas in seinem Blick, das Catalinón nicht deuten konnte – war es Verachtung? Mitleid? Oder einfach nur Müdigkeit?
„Catalinón", sagte Don Juan leise, „wenn du das fragen musst, wirst du die Antwort niemals verstehen."
Dann war er verschwunden, glitt durch die Tür wie ein Geist, und Catalinón blieb zurück mit dem Gefühl, dass er seinem Herrn in etwas folgte, das nicht gut enden konnte.
Die Santa María war kein prächtiges Schiff. Sie war ein Handelsschiff, alt und wettergezeichnet, mit geflickten Segeln und einer Mannschaft, die aussah, als würde sie jeden Moment meutern – oder zumindest darüber nachdenken. Aber sie schwamm, und sie würde sie wegbringen von Neapel, und das war alles, was zählte.
Catalinón stand am Heck und blickte zurück auf die Stadt, die langsam am Horizont versank. Die Kuppeln und Türme, die Paläste und Kirchen – alles verschmolz zu einer goldenen Silhouette gegen den blauen Himmel. Irgendwo dort drüben waren Wachen, die nach ihnen suchten, ein Herzog, der nach Rache dürstete, und eine Frau, deren Leben Don Juan mit einer einzigen Nacht zerstört hatte.
„Du denkst zu viel."
Catalinón zuckte zusammen. Don Juan war neben ihn getreten, unbemerkt, wie immer. Er lehnte sich an die Reling, das Gesicht dem Wind zugewandt, die dunklen Haare wehten ihm um die Stirn.
„Jemand muss nachdenken, Herr", murmelte Catalinón.
„Nachdenken ist überbewertet." Don Juan atmete tief ein, füllte seine Lungen mit der salzigen Meeresluft. „Handeln ist alles, was zählt. Und Konsequenzen... nun, die kommen ohnehin, ob man darüber nachdenkt oder nicht."
„Ihr habt keine Angst vor Konsequenzen, nicht wahr?"
Don Juan lachte, kurz und ohne Humor. „Angst? Vor was sollte ich Angst haben? Vor dem Herzog? Vor dem König? Vor Gott?" Er schüttelte den Kopf. „Angst ist für Männer, die etwas zu verlieren haben. Ich habe nichts zu verlieren außer meinem Leben, und das Leben ist ohnehin nur geliehen."
Catalinón schwieg. Er kannte diese Stimmung seines Herrn, diese Mischung aus Übermut und Nihilismus, die immer dann kam, wenn eine Verführung beendet war. Es war, als ob Don Juan in diesen Momenten leer war, ausgebrannt, unfähig, echte Freude oder echten Schmerz zu empfinden.
„Erinnert Ihr Euch", sagte Catalinón nach einer Weile, „an die Zeit, als Ihr noch ein Junge wart? Damals in Sevilla?"
Don Juan warf ihm einen scharfen Blick zu. „Warum sollte ich mich daran erinnern wollen?"
„Ich war dabei, Herr. Ich war Stallbursche bei Eurem Vater, Don Diego. Ihr wart... anders damals."
„Ich war ein Kind", sagte Don Juan kalt. „Kinder sind immer anders. Sie wissen noch nicht, wie die Welt wirklich ist."
Aber Catalinón ließ sich nicht abschrecken. Vielleicht lag es an der Erschöpfung, an der Flucht, an der Gewissheit, dass sie wieder einmal nur knapp entkommen waren. Oder vielleicht war es einfach die Verzweiflung eines Mannes, der seinen Herrn zu verstehen versuchte.
„Ihr wart zwölf Jahre alt", begann Catalinón, „als Eure Mutter starb. Doña María, Gott hab sie selig. Sie war eine gute Frau, fromm und gütig. Und sie liebte Euch über alles."
Don Juans Kiefer verhärtete sich. „Katalinón—"
„Sie starb im Kindbett", fuhr Catalinón fort, unbeirrt. „Das Baby auch. Ein Mädchen. Eure kleine Schwester, die nie zur Welt kam. Ich erinnere mich an Euch, wie Ihr am Grab standet, so klein und verloren. Und Don Diego... Euer Vater weinte nicht. Er stand einfach nur da, hart wie Stein, und sagte nichts."
„Schweig."
„Nach ihrem Tod veränderte Ihr Euch. Innerhalb weniger Monate. Als ob etwas in Euch zerbrochen wäre. Ihr wurdet wild, rücksichtslos. Mit vierzehn hattet Ihr Eure erste Affäre mit der Magd—"
„Ich sagte: Schweig!" Don Juans Stimme peitschte durch die Luft wie eine Gerte. Mehrere Matrosen drehten sich um, sahen dann aber schnell wieder weg.
Catalinón senkte den Kopf. „Verzeiht, Herr."
Die Stille zwischen ihnen war angespannt wie eine Bogensehne. Das Schiff schaukelte auf den Wellen, Holz knarrte, Taue pfiffen im Wind. Irgendwo unter Deck sang jemand ein obszönes Lied, und die anderen Matrosen lachten.
Schließlich sprach Don Juan, so leise, dass Catalinón sich anstrengen musste, um ihn zu verstehen.
„Meine Mutter glaubte an Gott. Sie glaubte an Gerechtigkeit, an Erlösung, an all diese schönen Worte, die die Priester predigen. Und was hat es ihr gebracht?" Er lachte bitter. „Sie starb in Qualen, blutend, schreiend, während ihr kostbarer Gott einfach zusah. Und mein Vater... mein Vater verschanzte sich hinter seiner Ehre und seinen Pflichten und vergaß, dass er noch einen Sohn hatte."
„Don Diego liebte Euch, Herr. Auf seine Art."
„Liebe?" Don Juan spuckte das Wort aus wie Gift. „Was ist Liebe? Eine Illusion. Ein Selbstbetrug. Etwas, das die Schwachen brauchen, um die Leere zu füllen." Er wandte sich Catalinón zu, und in seinen Augen lag etwas Wildes, etwas Gefährliches. „Ich habe geschworen, an jenem Tag am Grab meiner Mutter, dass ich nie wieder schwach sein würde. Dass ich nehmen würde, was ich will, solange ich es will, und dass mich nichts und niemand davon abhalten würde."
„Aber zu welchem Preis, Herr?"
Don Juan lächelte, doch es war ein leeres Lächeln, hohl wie eine Maske. „Der Preis ist mir gleichgültig. Wir zahlen alle am Ende. Die Tugendhaften und die Sünder. Der Tod nimmt uns alle, Catalinón. Die Frage ist nur, wie wir gelebt haben, bevor er kommt."
Catalinón wollte etwas erwidern, wollte sagen, dass es mehr gab als nur Leben und Tod, dass es Bedeutung gab, Zweck, Erlösung. Aber die Worte blieben ihm im Hals stecken, denn er sah in Don Juans Augen eine Leere, die tiefer war als jeder Ozean, dunkler als jede Nacht.
Und er erkannte, dass sein Herr verloren war – nicht irgendwann in der Zukunft, sondern bereits jetzt, hier, in diesem Moment. Don Juan Tenorio war ein Mann, der sich selbst aufgegeben hatte, lange bevor die Welt ihn aufgeben würde.
Die Tage auf See verschmolzen zu einem einförmigen Rhythmus. Morgens, wenn die Sonne über dem östlichen Horizont aufstieg und das Meer in flüssiges Gold verwandelte. Mittags, wenn die Hitze auf dem Deck unerträglich wurde und selbst die Matrosen im Schatten der Segel Zuflucht suchten. Abends, wenn der Himmel sich purpurn färbte und die ersten Sterne erschienen wie kleine Verheißungen in der Unendlichkeit.
Don Juan verbrachte die meiste Zeit allein, stand an der Reling und starrte auf das Wasser, als suche er dort Antworten auf Fragen, die er nicht auszusprechen wagte. Catalinón beobachtete ihn aus der Ferne, besorgt, aber unsicher, wie er helfen konnte – falls Hilfe überhaupt möglich war.
In der dritten Nacht brach der Sturm herein.
Er kam ohne Vorwarnung, wie eine göttliche Strafe, die vom Himmel herabfuhr. Der Wind heulte, die Wellen türmten sich zu Bergen auf, das Schiff wurde geworfen wie ein Spielzeug in der Hand eines wütenden Kindes. Matrosen rannten über das Deck, versuchten verzweifelt, die Segel einzuholen, die Taue zu sichern, das Schiff unter Kontrolle zu halten.
„Alle Mann unter Deck!", brüllte der Kapitän, ein wettergegerbter Veteran mit einem Bart wie ein Busch. „Das ist kein gewöhnlicher Sturm! Das ist der Zorn Gottes!"
Catalinón klammerte sich an einen Mast, benommen vom Schwanken des Schiffes, durchnässt vom Regen, der wie Nadeln auf seine Haut prasselte. Irgendwo in dem Chaos hörte er Don Juan lachen – ein irres, wildes Lachen, das sich mit dem Heulen des Sturms vermischte.
„Don Juan!", schrie Catalinón. „Kommt runter! Kommt unter Deck!"
Aber Don Juan stand am Bug des Schiffes, die Arme ausgebreitet, das Gesicht dem Sturm zugewandt, als fordere er die Elemente heraus.
„Ist das alles?", brüllte er in den Wind. „Ist das alles, was du hast?"
Ein gewaltiger Blitz zerriss den Himmel, erhellte die Szene für einen grellen Moment – Don Juan, allein gegen die Natur, ein kleiner, trotziger Fleck in der Unendlichkeit. Dann kam die Finsternis zurück, noch tiefer als zuvor.
Das Schiff kippte zur Seite, so stark, dass Catalinón glaubte, sie würden kentern. Holz splitterte, ein Mast brach mit einem Krachen, das selbst den Donner übertönte. Irgendwo schrie ein Mann, dann wurden seine Schreie vom Tosen der Wellen verschluckt.
Und dann, so plötzlich wie er gekommen war, ließ der Sturm nach. Der Wind legte sich, die Wellen ebbten ab, der Regen wurde zu einem Nieseln. Es war, als hätte eine unsichtbare Hand ein Signal gegeben, und die Natur gehorchte.
Catalinón ließ den Mast los, seine Finger steif vom Festhalten, der ganze Körper zitternd. Langsam richtete er sich auf, blickte sich um. Das Deck war verwüstet – Trümmer überall, gerissene Taue, zerbrochene Planken. Zwei Matrosen lagen reglos, möglicherweise tot, möglicherweise nur bewusstlos.
Und Don Juan... Don Juan lachte noch immer.
„Seht ihr?", rief er, an niemanden Bestimmten gerichtet, vielleicht an den Himmel selbst. „Nicht einmal der Sturm kann mich besiegen!"
Der Kapitän stolperte über das Deck auf sie zu, das Gesicht bleich. „Das war keine natürliche Sache", flüsterte er. „Das war... das war eine Warnung. Wir haben jemanden an Bord, der verflucht ist. Jemanden, den Gott strafen will."
Sein Blick fiel auf Don Juan, und in diesem Blick lag Furcht und Abscheu.
„Dieser Mann", sagte der Kapitän leise zu Catalinón, „ist des Teufels. Was habt Ihr mir da an Bord gebracht?"
Catalinón hatte keine Antwort. Er konnte nur zusehen, wie Don Juan sich umdrehte und unter Deck ging, immer noch lachend, immer noch unberührt, immer noch überzeugt von seiner eigenen Unbesiegbarkeit.
Und während Catalinón dort stand, durchnässt und erschöpft, wusste er mit eisiger Gewissheit, dass dieser Sturm erst der Anfang war. Dass die wahren Prüfungen noch kommen würden. Und dass Don Juan Tenorio, so brillant und so verdammt er auch sein mochte, auf einen Abgrund zusteuerte, aus dem es keine Rettung gab.
Das Schiff trieb auf dem nun ruhigen Meer, unter einem Himmel, an dem langsam die Sterne wieder erschienen. Doch ihr Licht schien kälter als zuvor, distanzierter, als hätten selbst die Himmel sich von den Menschen auf diesem verfluchten Schiff abgewandt.
Und in der Ferne, kaum sichtbar im Morgendunst, tauchte die Küste Spaniens auf.
Sie waren fast zu Hause. Aber Catalinón fragte sich, ob Heimat noch existierte für einen Mann wie Don Juan – oder ob sein Herr dazu verdammt war, für immer heimatlos zu bleiben, ein ewiger Wanderer zwischen den Welten, weder ganz lebendig noch ganz tot.
Die Antwort, fürchtete er, würde er bald genug erfahren.
KAPITEL 3: Schiffbruch und Rettung
Die Küste Kataloniens erhob sich aus dem Morgennebel wie eine Verheißung – oder eine Drohung, je nachdem, wie man es betrachtete. Schroffe Klippen, übersät mit verkrüppelten Pinien, die sich gegen den ewigen Wind stemmten. Schmale Buchten mit Stränden aus grobem Sand, an denen das Mittelmeer in endlosen Wellen brandete. Und darüber, auf den Hügeln im Landesinneren, die weißen Mauern von Dörfern, die dort schon gestanden hatten, als die Römer noch Herren dieser Küste gewesen waren.
Die Santa María näherte sich langsam, vorsichtig. Der Sturm hatte das Schiff übel zugerichtet – der Hauptmast war gebrochen, die Segel zerfetzt, die Mannschaft dezimiert. Zwei Männer waren über Bord gespült worden, ihre Schreie längst verstummt in der Tiefe des Meeres. Der Rest arbeitete schweigend, mit jener grimmigen Entschlossenheit von Männern, die wussten, dass nur ihre eigenen Hände zwischen ihnen und dem Tod standen.
Catalinón stand am Steuer – der eigentliche Steuermann lag unten mit einem gebrochenen Bein –, die Hände fest um das Ruder geklammert, während er versuchte, das beschädigte Schiff durch die Strömung zu lenken. Schweiß lief ihm über das Gesicht trotz der kühlen Morgenluft. Sein Rücken schmerzte, seine Arme fühlten sich an, als würden sie jeden Moment aus den Schultern gerissen.
„Mehr nach Steuerbord!", brüllte der Kapitän von der Reling aus. Sein Gesicht war eine Maske aus Erschöpfung und Furcht. „Dort drüben ist eine Bucht! Seht ihr sie?"
Catalinón kniff die Augen zusammen gegen das grelle Morgenlicht. Ja, dort, zwischen zwei felsigen Vorsprüngen, eine Einbuchtung, kaum mehr als ein Spalt in der Küstenlinie, aber es war ihre einzige Chance.
„Ich sehe sie!", rief er zurück.
„Dann steuert darauf zu! Und betet, dass wir die Felsen nicht erwischen!"
Don Juan erschien an Deck, zum ersten Mal seit Stunden. Er hatte unter Deck geschlafen – oder zumindest so getan –, während die anderen um ihr Leben kämpften. Jetzt stand er da, frisch und unbeeindruckt, als wäre der Sturm nichts weiter gewesen als ein leichtes Unwetter.
„Probleme?", fragte er mit einem Anflug von Spott in der Stimme.
„Wir sinken, Herr", presste Catalinón zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. „Das Schiff nimmt Wasser auf. Die Pumpen können es nicht mehr bewältigen."
„Dann sollten wir wohl besser ans Land kommen." Don Juan trat an die Reling und betrachtete die näher kommende Küste mit der Miene eines Mannes, der eine Theatervorstellung beurteilt. „Diese Bucht dort? Wie malerisch."
Catalinón hätte ihm am liebsten das Steuer um die Ohren geschlagen. Stattdessen konzentrierte er sich auf seine Aufgabe, lenkte das Schiff Grad für Grad in Richtung der Bucht, während das Wasser unter ihrem Kiel immer seichter wurde, gefährlich seicht.
„Achtung!", schrie jemand. „Felsen voraus!"
Zu spät. Das Schiff rammte mit einem entsetzlichen Krachen auf einen untergetauchten Felsen. Der Aufprall schleuderte alle, die nicht festgehalten hatten, zu Boden. Catalinón verlor das Ruder, stolperte, fing sich gerade noch rechtzeitig. Das Knirschen und Splittern von Holz erfüllte die Luft – der Rumpf brach auf wie eine Nuss.
„Wir sinken!", brüllte der Kapitän. „Alle Mann von Bord! Rettet euch!"
Das Chaos, das folgte, war vollkommen. Männer sprangen ins Wasser, manche mit Planken als Schwimmhilfen, andere einfach so. Das Schiff neigte sich zur Seite, das Deck rutschte weg unter den Füßen. Wasser strömte herein, kalt und gnadenlos.
Catalinón sah Don Juan am Bug stehen, ruhig inmitten des Aufruhrs, als überlege er, ob es sich lohne, nass zu werden. Dann, mit einer eleganten Bewegung, stieß sich Don Juan ab und sprang ins Meer, die Arme ausgebreitet wie ein Taucher, der sich in einen Pool stürzt.
„Verdammter Narr", murmelte Catalinón und folgte ihm.
Das Wasser war eiskalt, raubte ihm den Atem. Die Strömung packte ihn sofort, zerrte an seinen Gliedern, versuchte ihn unter die Oberfläche zu ziehen. Catalinón strampelte, kämpfte, spuckte Salzwasser aus. Um ihn herum trieben Trümmer, Fässer, Körper – lebende und tote.
Er konnte das Ufer sehen, erschreckend nah und doch unerreichbar fern. Seine Arme wurden schwer, seine Beine weigerten sich zu gehorchen. Die Kälte kroch in seine Knochen, lähmte ihn, flüsterte ihm zu, dass es einfacher wäre, aufzugeben, sich treiben zu lassen, in die Tiefe zu sinken.
Dann packte eine Hand seinen Kragen.
„Komm schon, du alter Esel!", keuchte Don Juan. „Schwimm! Oder willst du hier ertrinken?"
Wie er die Kraft fand, wusste Catalinón nicht, aber irgendwie schafften sie es – Meter für Meter, Welle für Welle, bis seine Füße endlich Grund berührten, bis er durch hüfttiefes Wasser waten konnte, bis er sich schließlich am Strand auf die Knie fallen ließ, hustend und nach Luft ringend.
Don Juan ließ sich neben ihm in den Sand sinken, keuchend, durchnässt, aber lebendig. Um sie herum lagen andere Überlebende, erschöpft, manche weinend, manche einfach nur da und starrten ungläubig auf das sinkende Wrack der Santa María.
„Na also", sagte Don Juan nach einer Weile. „Das war doch gar nicht so schlimm."
Catalinón starrte ihn an, zu erschöpft, um zu antworten.
Sie waren acht Überlebende. Acht von zwanzig. Die anderen waren entweder ertrunken oder mit dem Schiff untergegangen. Der Kapitän gehörte zu den Toten – Catalinón hatte seinen leblosen Körper zwischen den Felsen treiben sehen.
Sie hockten am Strand, zitternd in ihren nassen Kleidern, während die Sonne langsam höher stieg und ein wenig Wärme spendete. Niemand sprach viel. Was gab es auch zu sagen? Sie lebten, aber sie hatten alles verloren. Kein Schiff, kein Geld, keine Vorräte. Nur das, was sie am Leib trugen.
„Wir müssen Hilfe suchen", sagte einer der Matrosen schließlich, ein junger Bursche mit einem Gesicht voller Angst. „Hier können wir nicht bleiben."
„Es muss ein Dorf in der Nähe geben", meinte ein anderer. „Ich habe Rauch gesehen, da oben auf den Hügeln."
Don Juan erhob sich, wrang sein Wams aus. „Dann gehen wir. Catalinón, kommst du?"
Catalinón nickte müde und rappelte sich hoch. Seine Beine fühlten sich an wie Blei, aber sie trugen ihn noch. Das musste reichen.
Sie folgten einem schmalen Pfad, der vom Strand die Klippen hinaufführte. Es war ein steiler, mühsamer Aufstieg, und mehr als einmal rutschte jemand aus auf den nassen Steinen. Aber schließlich erreichten sie die Kuppe und sahen, was auf der anderen Seite lag.
Eine kleine Bucht, geschützter als die, in der sie gestrandet waren. Am Strand standen mehrere einfache Hütten aus Holz und Stein, Netze trockneten in der Sonne, Boote lagen auf dem Sand. Ein Fischerdorf, arm aber sauber, mit dem herben Charme jener Orte, wo Menschen seit Generationen vom Meer lebten und mit dem Meer starben.
„Dort!", rief der junge Matrose. „Dort sind Menschen!"
Tatsächlich bewegten sich Gestalten am Strand – Fischer, die ihre Netze auswarfen, Frauen, die Wäsche wuschen, Kinder, die zwischen den Booten spielten.
Die Gruppe der Überlebenden stolperte den Hang hinunter, winkte, rief um Hilfe. Die Fischer am Strand hielten inne, blickten auf, dann liefen einige von ihnen los, um den Fremden entgegenzukommen.
Und an ihrer Spitze lief ein Mädchen.