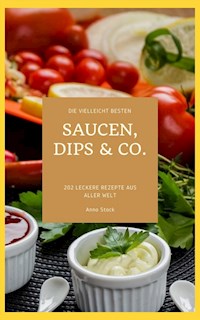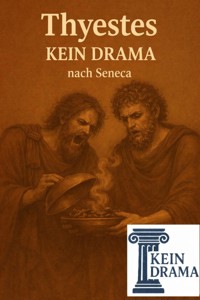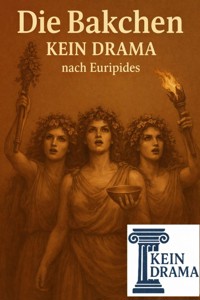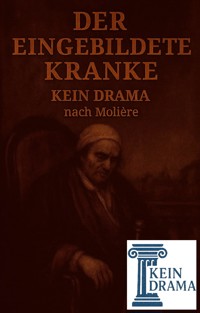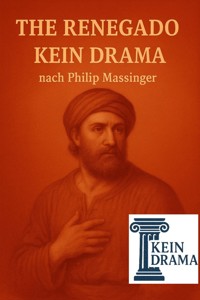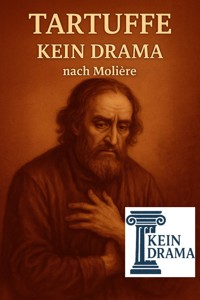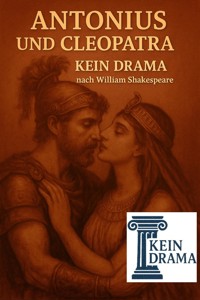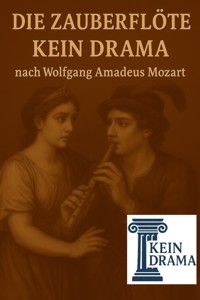6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Paris, 1844. Die angesehene Kaufmannsfamilie Duvernay führt ein komfortables Leben – bis eine mysteriöse Witwe in schwarzer Kleidung in ihr Leben tritt. Lady Tartuffe, wie sie sich nennt, ist die Verkörperung von Frömmigkeit und Selbstlosigkeit. Mit sanfter Stimme und frommen Gebeten gewinnt sie das Vertrauen der Familie, wird zur unverzichtbaren Vertrauten, zur moralischen Autorität. Doch während die Familie blind ihrer neuen Freundin verfällt, erkennt die junge Céline die Wahrheit: Hinter der Maske der Tugend verbirgt sich eine skrupellose Betrügerin. Lady Tartuffe manipuliert, spaltet und raubt – mit einer Perfektion, die erschreckend ist. Als Céline versucht zu warnen, wird sie selbst zur Außenseiterin in der eigenen Familie. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Kann Céline die Augen ihrer Familie öffnen, bevor Lady Tartuffe ihr gesamtes Vermögen und ihre Existenz vernichtet? Basierend auf Delphine de Girardins scharfem Gesellschaftsdrama von 1853, entfaltet dieser Roman ein packend-psychologisches Portrait von Täuschung, Vertrauen und der zerstörerischen Kraft vorgetäuschter Tugend. Eine zeitlose Geschichte über die Spannung zwischen Glauben und Skepsis, zwischen Familie und Fremden – und über die Frage, wie wir echte Güte von brillanter Manipulation unterscheiden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Lady Tartuffe - Kein Drama nach Delphine de Girardin
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Das Haus Duvernay
Kapitel 2: Ein Ruf eilt voraus
Kapitel 3: Die erste Begegnung
Kapitel 4: Vertrauen wird gesät
Kapitel 5: Zweifel im Schatten
Kapitel 6: Die perfekte Maske
Kapitel 7: Unter vier Augen
Kapitel 8: Die Beichte
Kapitel 9: Goldene Ketten
Kapitel 10: Verbotene Gedanken
Kapitel 11: Der Brief
Kapitel 12: Risse im Fundament
Kapitel 13: Die Beichtmutter
Kapitel 14: Verdacht und Verblendung
Kapitel 15: Die Falle
Kapitel 16: Hinter der Maske
Kapitel 17: Der Moment der Wahrheit
Kapitel 18: Zweifel und Zerrissenheit
Kapitel 19: Die verschwiegene Vergangenheit
Kapitel 20: Konfrontation im Salon
Kapitel 21: Das falsche Spiel
Kapitel 22: Verbündete und Verräter
Kapitel 23: Der Beweis
Kapitel 24: Die Stunde der Wahrheit
Kapitel 25: Der Fall der Maske
Kapitel 26: Flucht und Verfolgung
Kapitel 27: Geständnisse
Kapitel 28: Wiederaufbau
Kapitel 29: Letzte Worte
Epilog: Fünf Jahre später
Nachwort
TEIL I: DIE ANKUNFT
TEIL II: DIE VERSTRICKUNG
TEIL III: DIE ENTHÜLLUNG
TEIL IV: DIE AUFLÖSUNG
Impressum neobooks
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Vor dem Vorhang
Paris im Frühjahr 1844. Die Stadt der Lichter erstrahlte in jenem besonderen Glanz, den nur die Selbstzufriedenheit einer Gesellschaft hervorbringen kann, die sich ihrer eigenen Vortrefflichkeit gewiss ist. In den Salons des Faubourg Saint-Germain und den neueren, nicht minder prächtigen Residenzen am Boulevard des Italiens versammelte sich jene erlesene Gesellschaft, die nicht müde wurde, ihre eigene Tugend zu feiern und die Laster anderer zu beklagen.
Es war eine Zeit des Übergangs. Die Revolution von 1830 lag weit genug zurück, um nicht mehr zu beunruhigen, aber nahe genug, um als mahnendes Beispiel zu dienen. Die Julimonarchie unter Louis-Philippe hatte sich etabliert, und mit ihr ein Bürgertum, das ebenso begierig darauf war, den alten Adel nachzuahmen, wie es entschlossen schien, dessen angebliche Dekadenz zu überwinden. Man sprach von Moral, von Tugend, von christlichen Werten – und man sprach viel, sehr viel sogar, in den unzähligen Salons, bei Dinners und Empfängen, die das gesellschaftliche Leben der Hauptstadt bestimmten.
In dieser Welt, in der Schein und Sein einen erbitterten Kampf ausfochten, den der Schein meist gewann, bewegten sich Figuren von unterschiedlichster Couleur. Da waren die alteingesessenen Adelsfamilien, die ihren Besitz und ihren Namen durch die Wirren der Revolution gerettet hatten und nun zwischen nostalgischer Verklärung der Vergangenheit und pragmatischer Anpassung an die Gegenwart schwankten. Da war das aufstrebende Großbürgertum, Bankiers und Industrielle, die mit neu erworbenem Reichtum alte Privilegien kauften. Und da waren jene zahllosen Gestalten, die sich in den Zwischenräumen dieser Gesellschaft bewegten: Glücksritter und Abenteurer, fromme Seelen und geschickte Heuchler, ehrliche Menschen und perfekte Schauspieler.
Zu Letzteren – ob nun zur einen oder zur anderen Kategorie, das sollte sich noch zeigen – gehörte eine Dame, die in jenem Frühjahr 1844 in den besseren Kreisen von Paris in aller Munde war. Man nannte sie Lady Tartuffe, was freilich nicht ihr wirklicher Name war, sondern ein Spitzname, der ihr von jenen wenigen verliehen worden war, die bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gewisse Zweifel hegten. Die meisten jedoch kannten sie unter einem anderen Namen, einem Namen, der wie eine Verheißung von Frömmigkeit, Güte und uneigennütziger Tugend klang.
Sie war, so versicherten ihre zahlreichen Bewunderer, eine Frau von beispielloser Wohltätigkeit. Keine Armenspeise, keine Wohltätigkeitslotterie, kein Komitee zur Rettung gefallener Mädchen konnte sich ihrer Unterstützung sicher sein. Sie erschien überall, wo Tugend demonstriert und Mildtätigkeit zur Schau gestellt werden konnte, stets in Schwarz gekleidet, stets mit einem Ausdruck milder Strenge im Gesicht, der zugleich Mitgefühl und moralische Überlegenheit ausdrückte.
„Sie ist eine Heilige", flüsterte man in den Salons. „Eine moderne Heilige für unsere verworrene Zeit."
Andere, weniger Begeisterte, bemerkten, dass die Dame trotz ihrer zur Schau getragenen Bedürfnislosigkeit stets in den besten Häusern verkehrte, bei den reichsten Familien ein und aus ging und niemals eine Einladung zu einem opulenten Dinner ausschlug – natürlich nur, um durch ihre Gegenwart das gesellschaftliche Ereignis zu segnen und ihm jenen Anstrich von Respektabilität zu verleihen, den jede aufstrebende Familie so dringend brauchte.
Doch solche kritischen Stimmen waren selten und wurden, wenn sie denn laut wurden, rasch zum Schweigen gebracht. Denn wer wagte es schon, an der Tugend einer Frau zu zweifeln, die so unermüdlich das Gute predigte? Wer wollte sich dem Vorwurf aussetzen, selbst zu lasterhaft zu sein, um wahre Tugend zu erkennen?
So hatte sich Lady Tartuffe – oder jene Dame, die wir aus Gründen der Klarheit bei diesem Namen belassen wollen – in den höheren Kreisen der Pariser Gesellschaft etabliert. Sie war kein Phänomen, das aus dem Nichts aufgetaucht wäre. Nein, die Gesellschaft hatte sie hervorgebracht, oder besser gesagt: Die Gesellschaft hatte den Raum geschaffen, in dem eine solche Gestalt gedeihen konnte. Eine Gesellschaft, die Moral als Währung benutzte, musste sich nicht wundern, wenn geschickte Fälscher auftauchten.
Es gab allerdings eine Familie, die im Begriff stand, eine besonders intensive Bekanntschaft mit dieser bemerkenswerten Dame zu machen. Die Familie Duvernay, nicht zum alten Adel gehörend, aber durchaus wohlhabend und respektabel, hatte sich in den vergangenen Jahren einen ansehnlichen Ruf erworben. Monsieur Henri Duvernay, ein erfolgreicher Tuchhändler, der sein Geschäft durch Fleiß und Geschick zu beträchtlicher Größe entwickelt hatte, lebte mit seiner Familie in einem stattlichen Hôtel particulier nahe der Chaussée d'Antin, jenem Viertel, in dem sich das wohlhabende Bürgertum niedergelassen hatte.
Die Duvernays waren keine außergewöhnlichen Menschen. Sie waren weder besonders klug noch besonders dumm, weder besonders tugendhaft noch besonders lasterhaft. Sie waren, mit einem Wort, durchschnittlich – was in der Welt, die wir beschreiben, bereits eine bemerkenswerte Eigenschaft darstellte. Denn Durchschnittlichkeit bedeutete Normalität, und Normalität bedeutete Verletzlichkeit. Wer weder durch außergewöhnliche Intelligenz noch durch außergewöhnliche Bosheit geschützt war, der war besonders anfällig für die Verführungen der Heuchelei.
Und so sollte es geschehen, dass Lady Tartuffe ihren Weg in das Haus Duvernay fand. Wie genau dies vonstatten ging, durch welche Empfehlungen und Bekanntschaften, durch welche geschickt gesponnenen Fäden sie sich Zugang zu dieser Familie verschaffte, das wird die folgende Geschichte zeigen.
Es war eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich in vielen Häusern hätte abspielen können. Dass sie sich gerade bei den Duvernays abspielte, war weniger dem Zufall geschuldet als jener unheimlichen Fähigkeit gewisser Personen, instinktiv die verwundbarsten Stellen in der gesellschaftlichen Ordnung zu erkennen. Lady Tartuffe besaß diese Fähigkeit in höchstem Maße.
In den Salons von Paris sprach man damals von vielen Dingen: von der neuen Eisenbahn, die Paris mit Rouen verband, von den Romanen George Sands, die die Gemüter erhitzten, von der Frage, ob Frauen tatsächlich an der Börse spekulieren sollten. Aber in einigen, ausgewählten Zirkeln sprach man auch – allerdings meist hinter vorgehaltener Hand – von Lady Tartuffe und von der Familie Duvernay.
Kapitel 1: Das Haus Duvernay
Das Hôtel particulier der Familie Duvernay erhob sich in der Rue de la Victoire mit jener soliden Würde, die neu erworbener Wohlstand so gerne zur Schau stellt. Es war kein Palast, gewiss nicht, aber es war auch kein bescheidenes Bürgerhaus mehr. Die Fassade, erst vor fünf Jahren renoviert, zeigte jene geschmackvolle Zurückhaltung, die beweisen sollte, dass die Familie zwar vermögend war, aber nicht protzig – eine schwierige Balance, die den Duvernays nach eigener Einschätzung meisterhaft gelungen war.
Im Inneren präsentierte sich das Haus als Kompromiss zwischen bürgerlicher Gediegenheit und aristokratischem Anspruch. Die Möbel waren solide, aber mit einem Hauch von Eleganz ausgestattet. Die Gemälde an den Wänden zeigten keine großen Meister, aber durchaus respektable Arbeiten zeitgenössischer Künstler. Alles atmete jene Atmosphäre des kontrollierten Aufstiegs, die für Familien wie die Duvernays charakteristisch war.
An diesem Märzmorgen des Jahres 1844 herrschte im Hause Duvernay jene geschäftige Ruhe, die ein gut geführtes Heim auszeichnet. In der Küche bereitete die Köchin das Mittagsmahl vor, im Salon staubte das Hausmädchen Marie die Porzellanfiguren ab, und im ersten Stock, in seinem Arbeitszimmer, saß Monsieur Henri Duvernay über seinen Geschäftsbüchern.
Henri Duvernay hatte soeben sein fünfzigstes Lebensjahr vollendet, jenes Alter, in dem ein Mann Bilanz zu ziehen beginnt. Und diese Bilanz fiel, wie er mit Befriedigung feststellte, durchaus positiv aus. Sein Tuchhandel florierte. Die Geschäfte mit den Manufakturen in Lyon liefen ausgezeichnet, und erst kürzlich hatte er einen lukrativen Vertrag mit einem der großen Pariser Modehäuser abgeschlossen. Sein Vermögen, vorsichtig geschätzt, belief sich auf etwa achthunderttausend Francs – eine Summe, die ihm einen Platz unter den angesehensten Bürgern von Paris sicherte.
Er war ein Mann von mittlerer Größe und gediegener Erscheinung. Sein Gesicht, rund und von guter Farbe, drückte jene Zufriedenheit aus, die finanzieller Erfolg mit sich bringt. Seine Kleidung war stets korrekt, niemals auffällig, aber von bester Qualität – was bei einem Tuchhändler auch kaum anders zu erwarten war. Er rasierte sich täglich, trug sein lichter werdendes Haar sorgfältig gescheitelt und pflegte einen kleinen Backenbart, der ihm, wie er fand, ein distinguiertes Aussehen verlieh.
Henri Duvernay war kein komplizierter Mensch. Seine Wünsche waren einfach und klar: Er wollte sein Geschäft weiter ausbauen, seine Familie gut versorgt wissen und in der Gesellschaft geachtet werden. Von Philosophie verstand er wenig, von Literatur noch weniger, aber von Tuch verstand er alles, was es zu verstehen gab. Er war, mit einem Wort, ein solider Bürger, dessen größte Tugend seine Verlässlichkeit war und dessen größte Schwäche seine Eitelkeit.
Diese Eitelkeit, so harmlos sie zunächst erschien, sollte noch eine bedeutende Rolle spielen. Denn Henri Duvernay war außerordentlich empfänglich für Schmeichelei, besonders wenn sie seine gesellschaftliche Position betraf. Er liebte es, wenn man ihn als einen der angesehensten Geschäftsleute von Paris bezeichnete. Er genoss es, wenn seine Meinung in geschäftlichen Fragen gefragt wurde. Und er schwelgte geradezu, wenn jemand die Eleganz seiner Frau oder die vorzügliche Führung seines Haushalts lobte.
Diese Frau, Madame Hortense Duvernay, war in diesem Moment dabei, ihre Morgentoilette zu vollenden. Sie saß vor ihrem Frisiertisch im Schlafzimmer und betrachtete ihr Spiegelbild mit jener kritischen Aufmerksamkeit, die Frauen ihrem Äußeren widmen, wenn sie das vierzigste Lebensjahr überschritten haben.
Hortense Duvernay war eine Frau, die einmal hübsch gewesen war und die Erinnerung daran sorgfältig pflegte. Ihre Figur hatte unter drei Schwangerschaften gelitten, aber strenge Korsetts hielten sie in Form. Ihr Gesicht zeigte die ersten Spuren des Alters, aber geschickt aufgetragene Puder und Cremes milderten sie ab. Sie kleidete sich stets nach der neuesten Mode, wobei sie sorgsam darauf achtete, weder zu jugendlich noch zu matronenhaft zu wirken – eine weitere schwierige Balance, die ihr allerdings weniger gut gelang, als sie selbst glaubte.
Hortense war die Tochter eines Notars aus Orléans gewesen, hatte also eine durchaus respektable Herkunft. Ihre Mitgift war ansehnlich gewesen, ihre Erziehung sorgfältig. Sie spielte passabel Klavier, sprach etwas Italienisch, und ihre Handarbeiten waren von einer Präzision, die ihr sogar Anerkennung bei den kritischsten Damen eingebracht hatte. Sie führte ihren Haushalt mit Kompetenz, wusste die Dienstboten zu dirigieren und konnte ein Dinner für zwanzig Personen organisieren, ohne in Panik zu geraten.
Ihre Schwäche – denn auch sie hatte eine, und zwar eine beträchtliche – war ihr brennender Ehrgeiz, in höhere gesellschaftliche Kreise vorzudringen. Es genügte ihr nicht, die Frau eines wohlhabenden Tuchhändlers zu sein. Sie wollte Zugang zu den Salons des Faubourg Saint-Germain, wollte mit Gräfinnen und Baronessen verkehren, wollte – und das war ihr geheimster Wunsch – bei Hofe empfangen werden.
Dieser Ehrgeiz war nicht ungewöhnlich, aber er war gefährlich. Denn er machte sie empfänglich für all jene, die versprachen, ihr bei diesem sozialen Aufstieg behilflich zu sein. Und er machte sie blind für die Kosten, die ein solcher Aufstieg mit sich bringen konnte.
Sie beendete ihre Toilette, warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel und erhob sich. Es war Zeit für den Morgenkaffee, den die Familie gemeinsam im kleinen Salon einzunehmen pflegte.
Dort fand sie bereits ihre beiden Kinder vor. Ihr Sohn Édouard, zweiundzwanzig Jahre alt, stand am Fenster und blickte auf die Straße hinaus. Er war ein gutaussehender junger Mann, schlank und von jener nervösen Eleganz, die der Mode der Zeit entsprach. Er hatte in Rechtswissenschaften promoviert und arbeitete nun – ohne rechte Begeisterung – in der Kanzlei eines befreundeten Advokaten. Sein eigentliches Interesse galt der Literatur, und er schrieb in seiner Freizeit Gedichte, die er niemandem zeigte, aus Furcht, man könnte sie lächerlich finden.
Édouard war ein guter Sohn, aber kein starker Charakter. Er liebte seine Eltern, fand sie aber hoffnungslos bürgerlich. Er verehrte die romantische Poesie, aber es fehlte ihm der Mut, selbst ein romantisches Leben zu führen. Er träumte von großen Gefühlen und heroischen Taten, verbrachte seine Tage aber mit dem Durchsehen von Verträgen und testamentarischen Verfügungen. Diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit machte ihn melancholisch und anfällig für Schwärmereien aller Art.
Seine Schwester Céline, neunzehn Jahre alt, saß auf dem Sofa und stickte an einem Kissen. Sie war ein hübsches Mädchen mit dunklen Locken und lebhaften Augen, die eine Intelligenz verrieten, die ihre Erziehung zu unterdrücken versucht hatte. Céline hatte in einem katholischen Pensionat ihre Ausbildung erhalten und dort alles gelernt, was ein junges Mädchen aus gutem Hause wissen musste: Handarbeiten, ein wenig Musik, ein paar Brocken Französisch und Geschichte, und vor allem die Kunst, ihre Meinung für sich zu behalten.
Diese letzte Lektion hatte Céline allerdings nie richtig gelernt. Sie besaß einen scharfen Verstand und eine noch schärfere Zunge, was ihre Mutter in ständige Besorgnis versetzte. „Ein Mann will keine Frau, die klüger ist als er", pflegte Hortense zu sagen, und Céline pflegte zu antworten: „Dann wird es wohl schwierig für mich werden." Solche Bemerkungen waren nicht dazu angetan, ihre Heiratschancen zu verbessern.
Dabei war Céline durchaus nicht abgeneigt zu heiraten. Sie wünschte sich sogar nichts sehnlicher, allerdings nicht irgendeinen langweiligen Tuchhändler oder Bankbeamten, wie ihre Mutter sich das vorstellte, sondern einen Mann von Geist, einen Künstler vielleicht, oder zumindest jemanden, mit dem man über mehr als nur Geld und gesellschaftliche Positionen sprechen konnte. Solche Männer waren rar in den Kreisen, in denen die Duvernays verkehrten.
Die Familie wurde durch ein fünftes Mitglied vervollständigt: Tante Pauline, die unverheiratete Schwester von Henri Duvernay, die seit dem Tod ihrer Eltern bei ihrem Bruder lebte. Pauline Duvernay war eine Frau in den mittleren Fünfzigern, die ihr Leben der Frömmigkeit und der Wohltätigkeit gewidmet hatte – oder vielmehr: die nach einem gescheiterten Heiratsantrag in ihrer Jugend keinen anderen Lebensentwurf mehr gefunden hatte und sich nun krampfhaft an Religion und gute Werke klammerte.
Sie war eine gute Frau, das musste man ihr zugestehen. Sie kümmerte sich um die Armen der Gemeinde, organisierte Basare für wohltätige Zwecke und besuchte regelmäßig die Messe. Aber ihre Frömmigkeit hatte jenen unangenehmen Beigeschmack der Selbstgerechtigkeit, der wahre Tugend so oft kompromittiert. Sie liebte es, über die Sünden anderer zu sprechen und ihre eigene moralische Überlegenheit zur Schau zu stellen. Diese Eigenschaft sollte sie zu einem besonders leichten Opfer für Lady Tartuffe machen.
An diesem Morgen betrat Tante Pauline den Salon mit einem Gesichtsausdruck, der Wichtiges verhieß. Sie trug ein schwarzes Kleid – sie trug immer schwarze Kleider, auch wenn niemand mehr genau wusste, wen sie eigentlich betrauerte – und in der Hand hielt sie einen Brief.
„Guten Morgen, meine Lieben", sagte sie mit jener Stimme, die fromme Menschen annehmen, wenn sie Erbauliches zu verkünden haben. „Ich habe wunderbare Neuigkeiten."
Hortense, die gerade eintrat, sah auf. „Neuigkeiten, liebe Pauline?"
„Die wunderbarste Frau, die ich je kennengelernt habe, hat mir geschrieben. Sie würde sich freuen, unsere Familie kennenzulernen."
Henri, der ebenfalls den Salon betrat, runzelte die Stirn. „Welche Dame, Schwester?"
Pauline setzte sich und arrangierte ihre Röcke mit jener Umständlichkeit, die Menschen eigen ist, die eine Geschichte erzählen wollen und dabei die Spannung auskosten. „Ihr Name ist Madame de Montreuil, aber ich habe sie bei einem Wohltätigkeitstreffen kennengelernt. Sie ist eine Witwe, eine Frau von größter Tugendhaftigkeit und Frömmigkeit. Ihr ganzes Leben widmet sie den guten Werken."
„Eine Witwe?" Hortense Interesse war geweckt. Witwen, besonders wohlhabende Witwen mit guten Verbindungen, waren in der Gesellschaft immer interessant.
„Ja, ihr verstorbener Gemahl war, wie ich höre, ein Mann von Stand. Sie selbst lebt nun in größter Zurückgezogenheit, widmet sich aber unermüdlich der Unterstützung der Armen und der moralischen Besserung der Gesellschaft."
Céline, die aufgesehen hatte, verzog leicht das Gesicht. Sie hatte eine instinktive Abneigung gegen Menschen, die ihre Tugend zu laut verkündeten. Aber sie sagte nichts.
Édouard hingegen zeigte keinerlei Interesse. Eine fromme Witwe war genau die Art von Gesellschaft, die er zu vermeiden suchte.
Henri aber nickte anerkennend. „Eine Dame von Prinzipien, wie es scheint. Solche Menschen sind selten geworden in unserer Zeit."
„Sehr selten", bestätigte Pauline eifrig. „Und sie hat den Wunsch geäußert, Familien von ähnlicher Gesinnung kennenzulernen. Ich habe mir erlaubt, von euch zu erzählen, lieber Bruder, von deinem erfolgreichen Geschäft, von Hortenses tadelloser Haushaltsführung, von den wohlgeratenen Kindern. Sie war äußerst interessiert."
Hortense setzte sich aufrechter hin. Eine Frau mit Verbindungen zum alten Adel – das könnte nützlich sein. „Vielleicht", sagte sie vorsichtig, „könnten wir sie zu einem Tee einladen? Ganz zwanglos, versteht sich."
„Eine ausgezeichnete Idee", stimmte Pauline zu. „Ich werde ihr heute noch schreiben."
So wurde, in dieser scheinbar harmlosen Morgenszene, die Weiche gestellt für alles, was folgen sollte. Die Duvernays, diese durchschnittliche, anständige, etwas eitle Familie, öffneten ihre Tür für eine Fremde. Sie taten es aus verschiedenen Motiven: Pauline aus religiöser Schwärmerei, Hortense aus sozialem Ehrgeiz, Henri aus Eitelkeit, die Kinder aus Gleichgültigkeit.
Keiner von ihnen ahnte, welche Veränderungen diese Einladung mit sich bringen würde.
Das Hausmädchen Marie brachte den Kaffee herein, und die Unterhaltung wandte sich anderen Themen zu. Édouard berichtete von einem langweiligen Fall in der Kanzlei, Céline zeigte eine Stickerei, über die ihre Mutter in übertriebenes Entzücken ausbrach, Henri sprach über einen neuen Liefervertrag.
Es war eine Szene von vollkommener Normalität, von bürgerlicher Behaglichkeit. Das Haus Duvernay war ein Ort der Ordnung, der Vorhersehbarkeit, der kontrollierten Existenz. Bald würde all das erschüttert werden.
Aber noch nicht. Noch war alles ruhig.
Draußen auf der Straße rollten Kutschen vorbei. Händler riefen ihre Waren aus. Paris lebte sein gewohntes Leben. Und irgendwo in der Stadt, in einer Wohnung, deren genaue Lage niemand im Hause Duvernay kannte, las eine Dame mit einem Lächeln einen Brief von Pauline Duvernay und begann, ihre Pläne zu schmieden.
Die Falle war aufgestellt. Das Opfer hatte sich selbst eingeladen.
Die Geschichte nahm ihren Lauf.
Kapitel 2: Ein Ruf eilt voraus
Die Nachricht von der bevorstehenden Bekanntschaft mit Madame de Montreuil verbreitete sich in den folgenden Tagen in jener subtilen Weise, die typisch war für die Pariser Gesellschaft. Man sprach nicht offen darüber – das wäre vulgär gewesen –, aber man erwähnte es beiläufig, ließ Namen fallen, deutete Dinge an.
Hortense Duvernay tat dies mit besonderer Geschicklichkeit. Beim Nachmittagsempfang der Madame Leblanc erwähnte sie, ganz nebenbei, dass eine Dame von außergewöhnlicher Frömmigkeit und besten Verbindungen Interesse gezeigt habe, ihre Familie kennenzulernen. Bei ihrem wöchentlichen Besuch im Modehaus von Madame Clotilde ließ sie fallen, dass man demnächst hohen Besuch erwarte. Im Salon der Madame de Roussillon sprach sie von einer bemerkenswerten Witwe, die ihr ganzes Leben den guten Werken gewidmet habe.
Die Reaktionen waren aufschlussreich. Die meisten Damen nickten höflich und interessiert. Einige erkundigten sich nach Einzelheiten. Aber bei zwei oder drei Gelegenheiten bemerkte Hortense eine seltsame Reaktion: Die angesprochenen Damen wurden still, ihre Gesichter nahmen einen undefinierbaren Ausdruck an – war es Befremden? Warnung? –, den Hortense nicht recht zu deuten wusste.
Madame de Villiers, eine ältere Dame von unbestrittenem gesellschaftlichem Rang, hatte Hortenses Erwähnung mit einem leisen „Ah" quittiert, das mehr bedeutete als tausend Worte. Als Hortense nachfragte, ob sie die Dame kenne, hatte Madame de Villiers nur gelächelt – ein Lächeln, das alles und nichts besagte – und das Thema gewechselt.
Noch deutlicher war die Reaktion von Madame Bertrand gewesen, einer Frau von scharfem Verstand und scharfer Zunge, die für ihre unverblümten Meinungen bekannt war. Als Hortense den Namen Madame de Montreuil erwähnte, hatte Madame Bertrand sie direkt angesehen und gesagt: „Seien Sie vorsichtig, meine Liebe. Nicht alles Gold, das glänzt, ist echt. Und nicht jede Tugend, die sich zur Schau stellt, ist wahrhaftig."
Hortense war irritiert gewesen. Was sollte das bedeuten? War es Neid? Missgunst? Oder steckte mehr dahinter? Sie hatte versucht, weiterzufragen, aber Madame Bertrand hatte nur den Kopf geschüttelt und hinzugefügt: „Sie werden selbst sehen, was Sie sehen werden. Ich sage nur: Hüten Sie Ihre Geldbörse und Ihre Geheimnisse."
Diese kryptische Warnung hatte Hortense beunruhigt, aber nicht genug, um sie ernst zu nehmen. Madame Bertrand war bekannt dafür, dass sie allem misstraute, was neu und ungewöhnlich war. Vermutlich war sie einfach neidisch darauf, dass die Duvernays eine so bemerkenswerte Bekanntschaft machten.
Henri Duvernay seinerseits hatte seine eigenen Erkundigungen angestellt, allerdings auf weniger subtile Weise. Er hatte mehrere Geschäftsfreunde nach Madame de Montreuil gefragt. Die meisten wussten nichts von ihr. Einige hatten den Namen gehört, konnten aber keine Details liefern. Monsieur Legrand, ein Bankier, der fast jeden kannte, der in Paris von Bedeutung war, hatte nachgedacht und dann gesagt: „De Montreuil? Es gab einen Baron de Montreuil, der vor einigen Jahren verstorben ist. Ob sie seine Witwe ist? Möglich. Der Baron hatte, soweit ich mich erinnere, einiges Vermögen, aber er lebte sehr zurückgezogen."
„War er von altem Adel?" hatte Henri gefragt, denn das war für ihn die entscheidende Frage.
„Oh ja", hatte Legrand bestätigt. „Eine sehr alte Familie. Nicht reich, aber respektabel. Der Titel ist echt, wenn es die Familie ist, an die ich denke."
Das hatte Henri beruhigt. Eine echte Baronin, wenn auch eine verwitwete, war genau die Art von Bekanntschaft, die sein gesellschaftliches Ansehen heben würde.
Tante Pauline hingegen hatte keinerlei Zweifel. Für sie war Madame de Montreuil bereits eine Heilige. Sie verbrachte Stunden damit, den anderen Familienmitgliedern von den Tugenden der Dame zu erzählen: Wie selbstlos sie sei, wie fromm, wie großzügig gegenüber den Armen. Sie habe ein Waisenhaus unterstützt, ein Armenhaus besucht, bei der Organisation einer Wohltätigkeitslotterie geholfen. Sie bete täglich mehrere Stunden, lebe in größter Einfachheit, trage nur schwarze Kleider.
„Sie erinnert mich an die großen Heiligen", schwärmte Pauline. „An die heilige Elisabeth von Thüringen, die ihr ganzes Vermögen den Armen gab. An die heilige Teresa von Ávila, die in tiefster Demut lebte."
Céline, die dieser Lobeshymne beiwohnte, erlaubte sich eine skeptische Bemerkung: „Wenn sie wirklich in tiefster Demut lebt, warum redet dann jeder über sie? Wahre Demut sucht doch nicht die Öffentlichkeit."
Pauline war empört. „Du verstehst das nicht, Kind. Madame de Montreuil sucht nicht die Öffentlichkeit – die Öffentlichkeit sucht sie, weil ihre Tugend so hell leuchtet, dass man sie nicht übersehen kann."
„Wie praktisch", murmelte Céline, aber nur so leise, dass ihre Tante es nicht hörte.
Édouard interessierte sich wenig für die kommende Begegnung. Fromme Witwen waren genau die Art von Gesellschaft, die ihm am meisten zuwider war. Er stellte sich eine ältere Dame vor, in Schwarz gekleidet, mit einem Gesichtsausdruck ewiger Missbilligung, die über Sünde und Buße sprechen würde und jeden Funken von Lebensfreude als teuflische Versuchung betrachten würde. Er hatte bereits beschlossen, dem Empfang fernzubleiben, falls ihm eine passende Ausrede einfiel.
Am Vorabend des angekündigten Besuchs saß die Familie beim Abendessen. Die Stimmung war leicht angespannt – jene Art von Anspannung, die entsteht, wenn ein ungewöhnliches Ereignis bevorsteht und niemand so recht weiß, was er davon halten soll.
„Ich habe das Silber polieren lassen", verkündete Hortense. „Und Marie hat das gute Porzellan aus dem Schrank geholt. Wir werden im blauen Salon empfangen, der ist am repräsentativsten."
„Ist das nicht ein wenig übertrieben?" fragte Céline. „Es ist doch nur eine Dame, die zum Tee kommt."
„Es ist keine gewöhnliche Dame", korrigierte ihre Mutter streng. „Es ist eine Baronin von altem Adel und außergewöhnlicher Tugendhaftigkeit. Wir müssen einen guten Eindruck machen."
„Ich dachte, tugendhafte Menschen legen keinen Wert auf äußeren Prunk", bemerkte Céline unschuldig.
Hortense warf ihrer Tochter einen scharfen Blick zu. „Es geht nicht um Prunk, sondern um Respekt. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich morgen von deiner besten Seite zeigst. Keine vorlauten Bemerkungen, keine unangemessenen Fragen."
„Ich werde stumm wie ein Fisch sein", versprach Céline mit einem Gesichtsausdruck, der alles andere als Unterwerfung ausdrückte.
Henri räusperte sich. „Ich habe übrigens noch einmal Erkundigungen eingezogen. Madame de Montreuil ist tatsächlich die Witwe des Baron de Montreuil. Die Familie hat ihren Ursprung in der Bretagne, sehr alter Adel. Der Baron selbst war ein zurückgezogen lebender Mann, der sich hauptsächlich seinen Studien widmete. Er starb vor drei Jahren."
„Hat er ein Vermögen hinterlassen?" fragte Édouard mit plötzlichem Interesse.
„Das weiß niemand so genau", antwortete Henri. „Die Familie war nie besonders reich, aber durchaus wohlhabend. Madame de Montreuil soll ein bescheidenes, aber ausreichendes Einkommen haben."
„Bescheiden und ausreichend sind relative Begriffe", murmelte Édouard.
„Was soll das heißen?" fragte seine Mutter scharf.
„Nichts, Mutter. Nur dass Menschen, die von Bescheidenheit sprechen, oft sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was bescheiden bedeutet."
In diesem Moment betrat das Hausmädchen mit einem Brief auf einem Silbertablett. „Für Madame", verkündete sie.
Hortense öffnete das Kuvert mit einer gewissen Nervosität. Es war von Madame de Montreuil. Sie überflog die Zeilen und lächelte dann. „Sie bestätigt ihren Besuch für morgen um vier Uhr nachmittags. Sie schreibt..." Hortense las weiter, und ihr Lächeln wurde breiter, „sie schreibt, dass sie sich sehr auf die Bekanntschaft mit einer Familie freut, die, wie sie gehört hat, die christlichen Werte in vorbildlicher Weise lebt."
„Soso", sagte Céline. „Wir leben christliche Werte in vorbildlicher Weise. Das ist mir neu."
„Céline!" Hortense Stimme war schneidend. „Ein weiteres Wort, und du wirst morgen in deinem Zimmer bleiben."
Céline schwieg, aber ihr Blick sprach Bände.
Nach dem Essen zog sich die Familie wie gewohnt in den Salon zurück. Pauline setzte sich sofort an ihr ewiges Stickwerk – eine Altardecke für die Kirche, an der sie seit Monaten arbeitete. Hortense begann, Listen zu erstellen: welche Gebäckstücke serviert werden sollten, welche Teesorten, welche Themen in der Konversation angemessen wären. Henri las die Zeitung, wobei seine Gedanken offensichtlich woanders waren.
Nur Céline und Édouard schienen mit ihren eigenen Überlegungen beschäftigt. Céline saß am Fenster und blickte hinaus auf die abendliche Straße. Sie dachte über die seltsamen Reaktionen nach, die der Name Madame de Montreuil bei manchen Menschen hervorrief. Warum hatten einige Damen so merkwürdig reagiert? Was wussten sie, das sie nicht aussprechen wollten?
Édouard wiederum überlegte, ob es ihm gelingen würde, sich morgen zu drücken. Er hatte keinerlei Lust, Stunden damit zu verbringen, einer frommen Witwe zuzuhören, die vermutlich über nichts anderes als Religion und Wohltätigkeit sprechen würde. Vielleicht konnte er vorgeben, dass er dringend in der Kanzlei gebraucht würde? Oder dass er sich unwohl fühlte?
„Édouard", sagte seine Mutter plötzlich, als habe sie seine Gedanken gelesen, „ich erwarte, dass du morgen anwesend bist. Keine Ausreden."
Édouard seufzte innerlich. Er war gescheitert, bevor er überhaupt versucht hatte, sich zu entziehen.
Die Uhr im Salon schlug neun. Es war noch früh, aber die Atmosphäre war merkwürdig angespannt. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach, und niemand schien geneigt, ein Gespräch zu beginnen.
Schließlich stand Pauline auf. „Ich werde mich zurückziehen", verkündete sie. „Ich möchte noch beten. Morgen ist ein wichtiger Tag."
„Ein wichtiger Tag", echote Hortense, ohne von ihren Listen aufzusehen.
Nach und nach löste sich die Versammlung auf. Bald war nur noch Céline im Salon, die am Fenster saß und in die Dunkelheit hinausblickte.
Draußen war Paris lebendig. Kutschen rollten vorbei, Menschen eilten durch die Straßen, aus einem Haus gegenüber drang Musik und Gelächter. Leben, Bewegung, Freiheit. Céline seufzte. Sie fühlte sich gefangen in einer Welt von Konventionen und Erwartungen, eine Welt, in der eine junge Frau nichts zu sagen hatte und nichts zu tun außer zu warten – auf einen Mann, der sie heiraten würde, auf ein Leben, das jemand anderes für sie bestimmte.
Sie dachte an die morgige Begegnung und verspürte eine seltsame Vorahnung. Etwas würde geschehen, sie wusste nicht was, aber sie spürte es. Eine Veränderung lag in der Luft, unmerklich, aber spürbar, wie der erste Hauch von Wind, der einen Sturm ankündigt.
Sie schüttelte den Kopf über ihre düsteren Gedanken. Was sollte schon passieren? Eine fromme Witwe würde zum Tee kommen, man würde höfliche Konversation machen, die Dame würde wieder gehen, und alles würde weitergehen wie bisher.
Und doch – diese Unruhe blieb.
Céline stand auf und verließ den Salon. Morgen würde sie sehen, ob ihre Vorahnung berechtigt war oder nur das Produkt einer überaktiven Fantasie.
In ihrem Zimmer, allein, kniete Tante Pauline vor einem kleinen Altar, den sie in einer Ecke eingerichtet hatte. Sie betete inbrünstig, dankte Gott für die Begegnung, die bevorstand, bat um Segen für das Haus und die Familie. Ihre Gebete waren echt, ihre Hingabe aufrichtig. Aber sie war auch blind – blind für die Möglichkeit, dass nicht alles, was fromm erscheint, auch gut ist.
In seinem Arbeitszimmer saß Henri Duvernay noch eine Weile über seinen Büchern. Die Zahlen waren gut, sehr gut sogar. Das Geschäft florierte. Die Familie war gesund. Das Haus war in Ordnung. Alles war, wie es sein sollte.
Und morgen würden sie eine Dame von Stand kennenlernen, eine Baronin, die ihre Gesellschaft schätzte. Das würde seinem Ansehen guttun. Vielleicht würden weitere Türen sich öffnen, weitere Bekanntschaften sich ergeben. Henri lächelte zufrieden. Ja, es war gut so.
Er ahnte nicht, dass er im Begriff stand, die Tür zu öffnen für jemanden, der sein Leben und das seiner Familie auf eine Weise verändern würde, die er sich in seinen kühnsten – oder seinen schlimmsten – Träumen nicht vorstellen konnte.
Die Nacht senkte sich über Paris. Im Haus Duvernay wurden die Lichter gelöscht. Die Familie schlief, jeder in seinem Zimmer, jeder mit seinen eigenen Gedanken und Erwartungen.
Und irgendwo in der Stadt, in einer Wohnung in einer weniger vornehmen Gegend, saß eine Frau vor einem Spiegel und probierte verschiedene Ausdrücke: Demut, Frömmigkeit, sanfte Würde. Sie übte ihre Rolle für den morgigen Tag.
Lady Tartuffe – denn so wollen wir sie weiterhin nennen, auch wenn die Duvernays sie unter einem anderen Namen kennenlernen würden – war eine erfahrene Schauspielerin. Sie wusste, wie man Menschen las, wie man ihre Schwächen erkannte, wie man ihr Vertrauen gewann. Und die Duvernays, das hatte sie bereits in Erfahrung gebracht, waren ein perfektes Ziel: wohlhabend, ehrgeizig, eitel, gutgläubig.
Sie lächelte ihrem Spiegelbild zu. Es würde einfach werden. Es war immer einfach mit Leuten wie den Duvernays.
Morgen würde sie die Maske aufsetzen. Und dann würde das Spiel beginnen.
Kapitel 3: Die erste Begegnung
Der Nachmittag des folgenden Tages fand das Haus Duvernay in einem Zustand kontrollierter Aufregung. Die Dienstboten hatten den blauen Salon bis zur Perfektion hergerichtet. Jedes Kissen saß an seinem Platz, jedes Möbelstück war entstaubt, der Parkett glänzte wie ein Spiegel. Das gute Porzellan war aufgetragen, die Silberkanne poliert, und in der Küche hatte Madame Beaumont Gebäckstücke von solcher Raffinesse geschaffen, dass sie selbst stolz darauf war.
Hortense hatte sich dreimal umgezogen, bevor sie mit ihrer Erscheinung zufrieden war. Sie trug nun ein Kleid aus dunkelblauer Seide, elegant aber nicht zu prunkvoll, mit einer diskreten Brosche, die einst ihrer Großmutter gehört hatte. Ihr Haar war kunstreich frisiert, ihre Haltung eine Studie in würdevoller Erwartung.
Henri hatte seinen besten Gehrock angelegt und sah aus wie die Verkörperung des erfolgreichen Bürgers – was er ja auch war. Er hatte sich zweimal rasiert, um sicherzugehen, dass kein Stoppelchen seine Erscheinung beeinträchtigte.
Pauline trug ihr übliches Schwarz, hatte aber eine neue Spitzenhaube aufgesetzt, die sie eigentlich für besonders feierliche Kirchenbesuche aufbewahrt hatte. Sie war so nervös, dass ihre Hände zitterten, was sie durch ständiges Falten und Entfalten ihres Taschentuchs zu kaschieren versuchte.
Édouard war anwesend, wie seine Mutter es befohlen hatte, aber sein Gesichtsausdruck verriet deutlich, dass er sich lieber überall sonst befunden hätte. Er hatte sich in die Ecke beim Fenster zurückgezogen und blätterte mit demonstrativer Gleichgültigkeit in einem Buch.
Céline saß auf dem Sofa, äußerlich ruhig, innerlich aber von einer seltsamen Anspannung erfüllt. Sie trug ein einfaches graues Kleid, das ihre Mutter für zu schlicht befunden hatte, aber Céline hatte darauf bestanden. Sie wollte nicht aussehen, als habe sie sich für diese Begegnung besonders herausgeputzt.
Die Uhr zeigte drei Minuten vor vier, als Gaspard den Salon betrat und mit seinem würdevollsten Ton verkündete: „Madame la Baronne de Montreuil."
Alle Blicke richteten sich auf die Tür. Und dann trat sie ein.
Das erste, was man an Lady Tartuffe bemerkte – oder vielmehr an jener Person, die die Duvernays als Madame de Montreuil kennenlernten –, war eine seltsame Diskrepanz zwischen dem, was man erwartete, und dem, was man sah. Man hatte eine alte Frau erwartet, streng und düster. Stattdessen trat eine Frau ein, deren Alter schwer zu bestimmen war – sie konnte dreißig sein oder fünfundvierzig, es war unmöglich zu sagen.
Sie war nicht schön, aber sie besaß jene Art von Präsenz, die interessanter ist als Schönheit. Ihre Gestalt war schlank, beinahe zerbrechlich, in schwarze Seide gehüllt, die so schlicht war, dass sie beinahe luxuriös wirkte. Ihr Gesicht war blass, mit feinen Zügen, die Leid auszudrücken schienen – oder zumindest die Erinnerung an Leid. Die Augen, dunkel und groß, blickten mit einem Ausdruck in die Welt, der zugleich traurig und gütig war, demütig und doch von einer gewissen Würde.
Sie bewegte sich mit einer geschmeidigen Langsamkeit, als koste jeder Schritt sie Überwindung, aber als sei sie entschlossen, diese Überwindung zu leisten. Es war die Art von Bewegung, die sofort Mitleid und Bewunderung hervorrief.
„Madame Duvernay", sagte sie, und ihre Stimme war leise, aber klar, mit einem Hauch von Heiserkeit, der sie noch eindringlicher machte. „Wie gütig von Ihnen, mich zu empfangen. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit."
Hortense, die sich erhoben hatte, machte einen Schritt nach vorn. „Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, Madame la Baronne. Darf ich Ihnen meinen Gemahl vorstellen? Monsieur Henri Duvernay."
Henri verbeugte sich mit jener Mischung aus Respekt und Selbstbewusstsein, die er bei Begegnungen mit dem Adel zur Schau stellte. „Madame la Baronne, wir fühlen uns geehrt."
Lady Tartuffe – denn wir wollen sie bei diesem Namen behalten, auch wenn niemand im Raum ihn kannte – neigte leicht den Kopf. „Bitte, nennen Sie mich einfach Madame de Montreuil. Ich lege keinen Wert auf Titel. Wir sind alle gleich vor Gott, nicht wahr?"
Diese Bemerkung, scheinbar so bescheiden, hatte eine kalkulierte Wirkung. Henri fühlte sich geschmeichelt, dass eine Baronin so wenig Wert auf Standesunterschiede legte. Hortense war gerührt von so viel Demut. Und Pauline, die sich nun vordrängte, war bereits völlig hingerissen.
„Oh, Madame", rief sie aus, „wie wahr! Wie wahrhaft christlich! Wir sind in der Tat alle Kinder Gottes."
Lady Tartuffe wandte sich ihr zu und schenkte ihr ein Lächeln von solcher Wärme, dass Pauline beinahe in Tränen ausbrach. „Sie müssen die liebe Pauline sein, von der mir so viel Gutes berichtet wurde. Ihre Wohltätigkeitsarbeit ist in unseren Kreisen wohl bekannt."
Pauline errötete vor Freude. Dass ihre bescheidenen Bemühungen „wohl bekannt" sein sollten, war eine Übertreibung, aber eine, die sie gerne glaubte.
„Darf ich Ihnen unsere Kinder vorstellen?" Hortense führte die Besucherin zu Édouard. „Unser Sohn, Édouard."
Édouard verbeugte sich mechanisch und erwartete die üblichen Floskeln. Stattdessen sah Lady Tartuffe ihn einen Moment an – einen Moment, der gerade lange genug war, um interessiert zu wirken, aber nicht so lange, dass es unangemessen erschien – und sagte dann: „Sie haben die Augen eines Dichters, Monsieur. Eines Mannes, der die Welt nicht nur sieht, sondern fühlt."
Édouard war verblüfft. Wie konnte diese Frau, die ihn nie zuvor gesehen hatte, erraten, dass er Gedichte schrieb? War es so offensichtlich? Oder besaß sie eine ungewöhnliche Menschenkenntnis? Sein Interesse war geweckt, trotz seiner Vorbehalte.
„Und dies ist unsere Tochter, Céline", fuhr Hortense fort.
Lady Tartuffe wandte sich dem jungen Mädchen zu, und für einen Augenblick – nur für einen Sekundenbruchteil – trafen sich ihre Blicke. Es war, als würden zwei Kämpfer einander abschätzen. Dann lächelte Lady Tartuffe, dasselbe warme, gütige Lächeln, das sie allen anderen geschenkt hatte.
„Welch reizende junge Dame. Sie erinnern mich an mich selbst in jungen Jahren – voller Fragen, voller Suche nach der Wahrheit."
Es war geschickt formuliert. Die meisten hätten es als Kompliment aufgefasst. Aber Céline hörte etwas anderes heraus: eine Warnung, vielleicht, oder eine Herausforderung. Sie neigte höflich den Kopf, sagte aber nichts.
„Bitte, nehmen Sie doch Platz", bat Hortense und führte ihren Gast zum besten Sessel im Salon. „Wir haben Tee vorbereitet. Oder bevorzugen Sie vielleicht heiße Schokolade?"
„Tee wäre wunderbar", antwortete Lady Tartuffe und ließ sich mit einer anmutigen Bewegung nieder, die zugleich erschöpft und würdevoll wirkte. „Ich trinke nur noch selten Schokolade. Sie ist zu... reichhaltig für meine einfachen Gewohnheiten."
„Natürlich", murmelte Hortense und fragte sich gleichzeitig, ob sie mit dem Angebot der Schokolade einen Fehler gemacht hatte. War es zu prunkliebend gewesen?
Der Tee wurde serviert. Die Konversation begann, zunächst zaghaft, dann fließender. Lady Tartuffe erwies sich als meisterhafte Gesprächspartnerin. Sie sprach, wenn sie angesprochen wurde, aber nie zu lange. Sie stellte Fragen, aber nie indiskret. Sie hörte zu, mit jener intensiven Aufmerksamkeit, die Menschen das Gefühl gibt, dass das, was sie sagen, wichtig ist.
Als Henri von seinem Geschäft erzählte, nickte sie verständnisvoll und bemerkte: „Wie bewundernswert, dass Sie durch ehrliche Arbeit zu Wohlstand gelangt sind. Das ist wahrlich gottgefällig. Es gibt so viele, die ihr Geld auf fragwürdige Weise verdienen, durch Spekulation und Betrug. Aber ehrliche Arbeit ist ein Segen."
Henri wuchs um mehrere Zentimeter. Hier war jemand, der den Wert seiner Arbeit verstand und schätzte!
Als Hortense die Unterhaltung geschickt auf gesellschaftliche Themen lenkte und andeutete, dass die Familie gerne weitere Bekanntschaften machen würde, besonders in höheren Kreisen, nickte Lady Tartuffe nachdenklich.
„Ich verstehe Ihr Anliegen vollkommen", sagte sie leise. „Es ist wichtig, dass Menschen von ähnlichen Werten einander finden. Ich selbst verkehre nur noch in sehr ausgewählten Kreisen – nicht aus Hochmut, verstehen Sie, sondern weil ich nach dem Tod meines geliebten Gemahls die Gesellschaft als zu... ablenkend empfunden habe. Aber gewisse Verbindungen..." sie ließ den Satz in der Luft hängen, vielsagend.