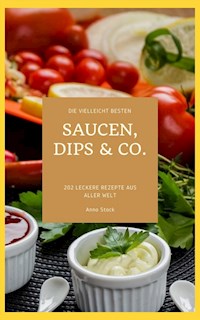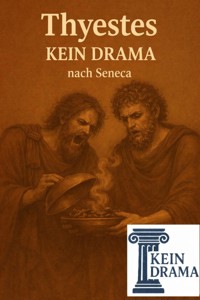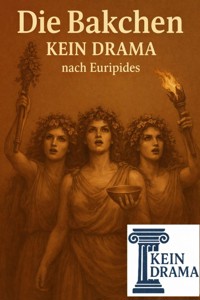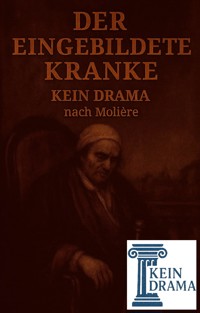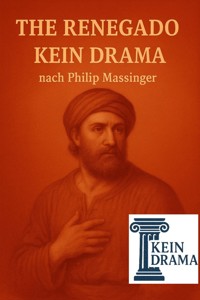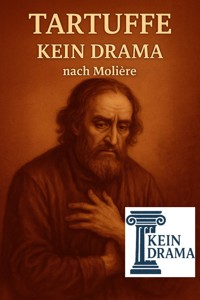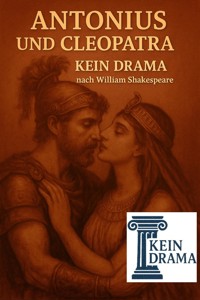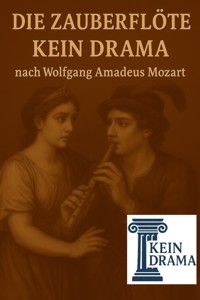6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Die eiserne Hand, die sich nicht beugte: Franken, 1480. Der junge Götz von Berlichingen verliert im Kampf seine rechte Hand – und gewinnt eine Legende. Mit einer mechanischen Prothese aus Eisen wird er zum Symbol des Widerstands gegen die wachsende Macht der Fürsten und Bischöfe. Als freier Reichsritter kämpft Götz für seine Rechte, seine Freiheit und seine Überzeugungen in einer Welt, die sich unaufhaltsam verändert. Doch seine Ideale führen ihn in immer dunklere Konflikte: Der Verrat seines besten Freundes Weislingen erschüttert ihn. Die Reichsacht macht ihn zum Geächteten. Und als 1525 die verzweifelten Bauern gegen ihre Unterdrücker aufbegehren, wird Götz – gegen seinen Willen – zu ihrem Anführer in einem Krieg, der nur in Blut und Tränen enden kann. Zwischen Treue und Verrat, zwischen alter Ehre und neuer Ordnung, zwischen Liebe und Pflicht muss Götz einen hohen Preis zahlen: seinen Sohn, seine Freiheit, schließlich sein Leben. Aber niemals seinen Stolz. Basierend auf Goethes berühmtem Drama und der wahren Geschichte des Götz von Berlichingen, erzählt dieser historische Roman von einem Mann, der sich weigerte, zu knien – und dafür alles verlor. Und alles gewann. Ein epischer Roman über den letzten der freien Ritter und die Geburt einer Legende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Götz von Berlichingen - Kein Drama nach Johann Wolfgang von Goethe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
GÖTZ VON BERLICHINGEN
Kapitel 1: PROLOG: DIE EISERNE HAND
KAPITEL 2: DER FREIE RITTER
KAPITEL 3: WEISLINGEN
KAPITEL 4: DER BAMBERGER BISCHOF
KAPITEL 5: GEFANGENNAHME
KAPITEL 6: BEFREIUNG AUF BURG HASLACH
KAPITEL 7: DIE VERSÖHNUNG
KAPITEL 8: RÜCKKEHR ZUM HOF
KAPITEL 9: REICHSACHT
KAPITEL 10: FRANZ VON SICKINGEN
KAPITEL 11: DIE BELAGERUNG VON JAXTHAUSEN
KAPITEL 12: KAPITULATION
KAPITEL 13: EHRENWORT
KAPITEL 14: GEGEN SEINEN WILLEN
KAPITEL 15: DAS LAGER BEI HEILBRONN
KAPITEL 16: MILTENBERG UND MORD
KAPITEL 17: ADELHEIDS RACHE
KAPITEL 18: DIE Schlacht
KAPITEL 19: GEFANGENSCHAFT
KAPITEL 20: LETZTE TAGE
21: Epilog
22: NACHWORT
Impressum neobooks
Table of Contents
GÖTZ VON BERLICHINGEN
Kein Drama nach Johann Wolfgang von Goethe
Ein historischer Roman
Die Geschichte eines Mannes zwischen zwei Welten
Die Chronik der eisernen Hand
Das Vermächtnis des letzten freien Ritters
Franken, 1480 - 1562
Kapitel 1: PROLOG: DIE EISERNE HAND
Jaxthausen, im Jahr des Herrn 1480
Der Morgen kroch zaghaft über die bewaldeten Hügel des Jaxtgrundes, als hätte er Angst, die Schatten der Nacht zu vertreiben. Nebelschwaden hingen zwischen den Tannen wie die Geister gefallener Ritter, und die Luft roch nach feuchter Erde und dem ersten Frost des kommenden Winters. Auf der kleinen Burg Jaxthausen knarrten die Läden, als die Mägde sie aufstießen, und aus der Schmiede im Burghof drang bereits das rhythmische Hämmern von Eisen auf Eisen.
Gottfried von Berlichingen, zehn Jahre alt und noch ohne den Beinamen, der ihn unsterblich machen sollte, stand auf der Wehrmauer und blickte hinaus in die dämmernde Landschaft. Seine Finger umklammerten den kalten Stein, und seine Augen – dunkel und wachsam wie die eines jungen Falken – suchten den Horizont ab. Irgendwo da draußen, jenseits der Wälder und Täler, lag das große Reich, von dem sein Vater sprach: ein Reich voller prächtiger Städte und mächtiger Fürsten, ein Reich, in dem ein freier Ritter wie die Berlichingens immer kleiner wurde, zusammengepresst zwischen den Mühlsteinen von Kaiser und Kirche.
„Götz!" Die raue Stimme seines Vaters ließ ihn zusammenfahren. „Träumst du wieder? Ein Ritter träumt nicht – er handelt!"
Berlichingen der Ältere trat neben seinen Sohn, ein Mann wie aus Eichenholz geschnitzt, mit einem Gesicht, das Wind und Wetter gezeichnet hatten wie eine Landkarte der Kämpfe. Er legte dem Jungen eine schwere Hand auf die Schulter.
„Heute beginnt deine wahre Ausbildung", sagte er. „Du reitest mit Junker Albrecht nach Nürnberg. Seine Knappen brauchen Verstärkung."
Götzens Herz machte einen Sprung. Nürnberg! Die große Reichsstadt, von der er so viel gehört hatte. Dort würde er nicht nur das Schwert führen lernen, sondern auch die höfischen Sitten, die ein Ritter beherrschen musste – selbst wenn sein Vater wenig davon hielt.
„Ich bin bereit, Vater."
Der Alte lachte, ein kurzes, hartes Bellen. „Bereit? Du bist ein Welpe, der noch nie einen echten Wolf gesehen hat. Aber du wirst lernen. Die Berlichingens waren immer schnelle Lerner – wir mussten es sein."
Er deutete mit dem Kinn auf die Landschaft unter ihnen. „Siehst du da unten? Das sind unsere Ländereien. Nicht viel, gewiss. Aber es ist freies Gut, niemandem untertan außer dem Kaiser selbst. Dein Großvater hat dafür gekämpft, ich habe dafür gekämpft, und du wirst dafür kämpfen müssen. Die Fürsten wollen uns verschlingen wie Wölfe ein lahmes Lamm. Vergiss das nie."
Götz nickte ernst. Er verstand noch nicht alle Verwicklungen der Reichspolitik, aber er spürte die Anspannung, die in seinem Vater vibrierte wie eine zu straff gespannte Bogensehne.
„Ich werde unsere Ehre verteidigen", sagte er mit der unerschütterlichen Überzeugung eines Jungen, der noch nie eine Schlacht gesehen hatte.
Sein Vater betrachtete ihn lange, und etwas wie Wehmut huschte über seine harten Züge. „Möge Gott dir die Kraft dazu geben, Sohn. Und möge er dir mehr Glück schenken, als er mir gegeben hat."
Die Reise nach Nürnberg dauerte drei Tage. Junker Albrecht von Rosenberg, ein bulliger Mann mit rotem Gesicht und lauter Stimme, führte einen kleinen Trupp von sechs Bewaffneten. Götz ritt auf einem struppigen braunen Wallach, der zu alt für den Krieg und zu störrisch für die Feldarbeit war, aber genau richtig für einen Knappen in Ausbildung.
Sie ritten durch Wälder, die schon die alten Germanen gekannt hatten, passierten befestigte Städtchen, deren Tore sich misstrauisch vor den bewaffneten Reitern schlossen, und überquerten reißende Bäche auf wackeligen Holzbrücken. Götz sog alles in sich auf wie ein Schwamm: die Art, wie die erfahrenen Männer ihre Waffen trugen, wie sie ein Lager aufschlugen, wie sie die Pferde versorgten.
Am zweiten Tag, als sie durch ein enges Tal ritten, hob Junker Albrecht plötzlich die Hand. Der Trupp hielt.
„Räuber", murmelte einer der Knechte und spuckte aus.
Götz spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Vor ihnen, wo der Weg eine Kurve machte, standen fünf Männer mit gezogenen Schwertern. Lumpengesindel, wie es die Straßen des Reiches unsicher machte – entlaufene Leibeigene, gescheiterte Handwerker, ehemalige Söldner, die keinen Sold mehr fanden.
„Wegzoll", rief ihr Anführer, ein hagerer Mann mit einer Narbe, die vom Ohr bis zum Mundwinkel lief. „Zehn Gulden, und ihr dürft passieren."
Junker Albrecht lachte. „Zehn Gulden? Ich gebe dir zehn Zoll Stahl, du Straßenköter!"
Er zog sein Schwert, und seine Männer taten es ihm gleich. Götz griff nach seinem kurzen Jagdschwert, aber Albrecht hielt ihn zurück.
„Du bleibst hinter uns, Junge. Halte die Pferde."
Die Schlacht – wenn man das Gemetzel so nennen konnte – dauerte keine fünf Minuten. Die Räuber waren hungrig und verzweifelt, aber keine ausgebildeten Kämpfer. Sie flohen, nachdem zwei von ihnen gefallen waren, und ließen eine Blutspur im Staub zurück.
Götz starrte auf die Leichen. Er hatte schon tote Tiere gesehen, aber dies war anders. Der eine Mann, jung, kaum älter als zwanzig, starrte mit gebrochenen Augen in den Himmel. Blut sickerte aus seinem Mund.
„Sieh hin", sagte Junker Albrecht leise. „Sieh genau hin, Junge. Das ist die Welt, in der wir leben. Ein Mann, der nicht kämpfen kann, ist ein toter Mann. Und ein Mann, der falschen Herren dient, endet im Dreck."
Götz nickte, konnte aber den Blick nicht von dem Toten wenden. Etwas in ihm veränderte sich in diesem Moment, etwas Hartes bildete sich in seiner Seele wie Eisen, das im Feuer gehärtet wird.
„Weiter", befahl Albrecht. „Die anderen kommen vielleicht zurück mit Verstärkung."
Nürnberg erhob sich vor ihnen wie eine Vision aus Stein und Macht. Die gewaltigen Mauern, die Türme, die zum Himmel ragten, die endlosen Reihen von Häusern – Götz hatte noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Jaxthausen hätte dreimal in einen einzigen Bezirk der Stadt gepasst.
Sie ritten durch das Tor, und Götz wurde von Eindrücken überwältigt: der Lärm der Händler, die ihre Waren anpriesen, das Hämmern der Schmiede, der Gestank von Menschen und Tieren, die auf engem Raum zusammenlebten, die Pracht der Patrizierhäuser mit ihren geschnitzten Erkern.
Das Haus des Junkers Albrecht lag nahe der Burg, ein stattliches Gebäude mit einem gepflasterten Hof. Hier sollte Götz die nächsten Jahre verbringen, unter der Anleitung von Albrechts Waffenmeister und zusammen mit einem Dutzend anderer Knappen.
Die Ausbildung war hart. Götz lernte, mit Schwert und Lanze umzugehen, er lernte zu reiten wie ein Teufel, er lernte die Regeln der Heraldik und die Kunst der höfischen Konversation – obwohl ihm Letzteres nie so recht gelingen wollte. Er hatte die direkte Art seines Vaters geerbt, und die geschliffenen Floskeln der Höflinge kamen ihm falsch und hohl vor.
Aber er war begabt im Kampf. Seine Bewegungen waren schnell und präzise, und er hatte keine Angst. Der Waffenmeister, ein alter Söldner namens Heinrich, der bei Grandson gegen die Burgunder gekämpft hatte, sah in ihm einen natürlichen Krieger.
„Du hast das Feuer", sagte er eines Tages zu Götz, nachdem dieser einen viel älteren Knappen im Übungskampf besiegt hatte. „Aber pass auf, dass es dich nicht verzehrt. Ein Feuer, das außer Kontrolle gerät, verbrennt alles – auch den, der es entfacht hat."
Götz verstand diese Warnung nicht. Noch nicht.
Es war im Sommer seines zweiten Jahres in Nürnberg, als das Schicksal zuschlug.
Junker Albrecht hatte sich dem Heer des Markgrafen von Brandenburg-Ansbach angeschlossen, der eine Fehde mit der Stadt gegen einen benachbarten Fürsten austrug – eine dieser endlosen Streitigkeiten um Grenzen und Rechte, die das Reich wie ein Fieber schüttelten. Götz, inzwischen zwölf und schon beinahe so groß wie ein erwachsener Mann, durfte als Page mitreiten.
Die Schlacht fand auf einem flachen Feld nahe Forchheim statt. Es war kein großes Gefecht – vielleicht zweihundert Mann auf jeder Seite – aber für Götz war es die ganze Welt.
Er hörte zum ersten Mal den wahren Lärm der Schlacht: das Kreischen der Pferde, das Klirren von Stahl auf Stahl, die Schreie der Verwundeten. Er roch das Blut und den Schweiß, den Dreck und die Angst. Und er spürte die wilde Freude des Kampfes, die durch seine Adern raste wie flüssiges Feuer.
Junker Albrecht kämpfte an vorderster Front, und Götz hielt sich dicht hinter ihm, bereit, seinem Herrn eine frische Waffe zu reichen oder dessen Pferd zu halten. Aber dann, als die feindlichen Linien zu wanken begannen, geschah es.
Eine verirrte Kanonenkugel – abgefeuert von einem der primitiven Geschütze, die gerade erst Mode wurden – traf einen Baum zu Götzens Rechten. Der Stamm explodierte in einem Regen aus Splittern. Ein großes Stück Holz, scharf wie eine Axt, traf Götzens ausgestreckte rechte Hand.
Der Schmerz war unbeschreiblich. Götz schrie, ein Schrei, der aus den tiefsten Tiefen seiner Seele kam. Er sah auf seine Hand hinab und sah... nichts. Wo eben noch seine Finger gewesen waren, war nur noch ein blutiger Stumpf.
Alles um ihn herum wurde seltsam langsam und still. Er sah Junker Albrecht zu ihm herumreiten, sah das Entsetzen in dessen Gesicht. Er sah seinen eigenen Arm, der hilflos herabbaumelte, das Blut, das auf die Erde tropfte und kleine dunkle Flecken im Staub bildete.
Dann wurde die Welt schwarz.
Er erwachte in einem Zelt, umgeben von Stöhnen und dem süßlichen Geruch von Wundbrand. Ein Feldscher beugte sich über ihn, ein zahnloser Alter mit blutigen Händen.
„Er lebt", sagte der Mann überrascht. „Bei Gott, der Junge lebt."
Götz versuchte zu sprechen, aber seine Lippen waren rissig und trocken. Er blickte auf seinen rechten Arm und sah einen dick bandagierten Stumpf. Die Realität traf ihn wie ein zweiter Schlag.
Seine Hand war fort.
„Wir mussten sie nehmen", sagte der Feldscher, als er Götzens Blick bemerkte. „Der ganze Unterarm war zerschmettert. Es gab keine andere Wahl. Aber du hattest Glück – die Wunde ist sauber. Wenn der Wundbrand nicht kommt, wirst du überleben."
Überleben. Das Wort hallte in Götzens Kopf wider. Was für ein Leben konnte ein einarmiger Ritter führen? Ein Krüppel, ein Bettler, ein Objekt des Mitleids?
Junker Albrecht besuchte ihn am nächsten Tag. Er sah alt und müde aus, und seine Augen konnten Götz nicht lange ansehen.
„Es tut mir leid, Junge", sagte er leise. „Ich habe deinem Vater eine Nachricht gesandt. Er wird kommen, dich zu holen."
„Nein." Götzens Stimme war heiser, aber fest. „Ich bleibe."
„Götz, sei vernünftig. Du kannst nicht—"
„Ich bleibe!", schrie Götz, und die Kraft in seiner Stimme ließ den älteren Mann zurückweichen. „Ich werde ein Ritter sein. Mit einer Hand oder ohne. Ich werde es sein!"
Albrecht betrachtete ihn lange. Dann, langsam, nickte er. „Du hast den Willen deines Vaters. Und seinen Starrsinn. Nun gut. Wir werden sehen, was sich machen lässt."
Die folgenden Monate waren die dunkelsten in Götzens jungem Leben. Die körperliche Heilung ging schnell – er war jung und stark – aber die seelischen Wunden klafften tiefer. Er musste alles neu lernen: wie man isst, wie man sich anzieht, wie man ein Pferd sattelt. Die anderen Knappen mieden ihn, teils aus Mitleid, teils aus Aberglauben. Ein Krüppel brachte Unglück.
Aber Götz gab nicht auf. Mit verbissenem Zorn trainierte er jeden Tag, übte mit der linken Hand, bis seine Muskeln brannten. Der alte Heinrich, der Waffenmeister, half ihm, entwickelte neue Techniken, neue Griffe.
„Ein Schwertkämpfer braucht nicht nur Kraft", sagte er. „Er braucht Geschwindigkeit, Gleichgewicht, Mut. Das alles hast du noch. Du musst nur lernen, damit anders zu kämpfen."
Und dann kam der Tag, der alles veränderte.
Junker Albrecht führte Götz in die Werkstatt eines Mechanikers in der Vorstadt. Der Mann hieß Meister Gottfried – ein Namensvetter – und war bekannt für seine kunstvollen Konstruktionen.
„Ich habe gehört, du fertigst künstliche Gliedmaßen", sagte Albrecht.
Der Mechaniker, ein kleiner, drahtiger Mann mit flinken Händen, nickte. „Ich versuche es. Die Kunst ist noch neu, aber... ja, ich habe einige Erfolge gehabt."
Er zeigte ihnen eine Hand aus Metall, kunstvollerweise aus eisernen Platten zusammengefügt, mit Lederriemen, die sie am Armstumpf befestigen konnten. Die Finger waren beweglich, durch ein System von Federn und Hebeln.
„Sie wird nie so gut sein wie eine echte Hand", warnte der Mechaniker. „Aber du kannst damit eine Waffe halten, einen Zügel greifen. Es ist besser als nichts."
Götz starrte auf die eiserne Hand, und etwas in ihm erwachte. Dies war kein Ersatz für das, was er verloren hatte. Dies war etwas Neues, etwas Anderes.
„Macht sie", sagte er.
Es dauerte Wochen, bis die Hand fertig und angepasst war. Als Götz sie zum ersten Mal anlegte, war es, als würde ein Teil von ihm zurückkehren. Nicht der gleiche Teil – etwas Härteres, Kälteres. Die eiserne Hand war schwer und fühlte sich fremd an, aber sie funktionierte.
Er übte Tag für Tag, lernte, die Hebel zu bedienen, die die Finger bewegten. Lernte, damit ein Schwert zu halten, einen Schild, einen Zügel. Es war mühsam und frustrierend, aber Götz ließ sich nicht beirren.
Und langsam, sehr langsam, begannen die anderen Knappen, ihn mit neuen Augen zu sehen. Nicht mehr als Krüppel, sondern als etwas anderes. Als jemanden, der das Schicksal herausgefordert und nicht verloren hatte.
„Götz mit der eisernen Hand", murmelte einer von ihnen eines Tages, halb spottend, halb ehrfurchtsvoll.
Der Name blieb.
Als Götz zwei Jahre später nach Jaxthausen zurückkehrte, war er nicht mehr der Junge, der fortgeritten war. Er war ein Mann geworden, gehärtet durch Schmerz und Willenskraft. Die eiserne Hand glänzte matt im Sonnenlicht, als er vom Pferd stieg.
Sein Vater stand im Burghof und betrachtete ihn lange. Dann trat er vor und umarmte seinen Sohn mit einer Heftigkeit, die Götz überraschte.
„Ich habe gedacht, ich hätte dich verloren", murmelte der Alte.
„Ihr habt mich nicht verloren, Vater", erwiderte Götz. „Ich habe nur einen Teil von mir zurückgelassen. Und dafür etwas anderes gewonnen."
Er hob die eiserne Hand, und das Metall fing das Licht wie eine Verheißung.
„Ich bin jetzt stärker als zuvor. Härter. Und ich werde niemals vergessen, was ich gelernt habe."
Sein Vater nickte langsam. In seinen Augen stand Stolz, aber auch etwas anderes – Sorge vielleicht, oder Vorahnung.
„Dann möge Gott mit dir sein, mein Sohn", sagte er leise. „Denn ich fürchte, du wirst jeden Funken dieser Stärke brauchen. Die Zeiten werden härter, und ein Mann wie du – ein freier Ritter mit eisernem Willen – wird viele Feinde haben."
Götz lächelte, ein kaltes, entschlossenes Lächeln.
„Dann sollen sie kommen", sagte er.
KAPITEL 2: DER FREIE RITTER
Der Morgennebel hing noch zwischen den Bäumen, als Götz von Berlichingen das Signal gab. Ein kurzer Pfiff, kaum lauter als der Ruf eines Vogels, aber seine Männer kannten ihn. Im Unterholz zu beiden Seiten des Weges regten sich Schatten.
Der Kaufmannszug kam langsam näher. Sechs schwer beladene Wagen, eskortiert von einem Dutzend bewaffneter Knechte – Würzburger Söldner, wie Götz an ihren blauen Wämsern erkannte. Die Pferde schnaubten in der feuchten Morgenluft, und das Knarren der Wagenräder hallte durch den Wald wie eine Ankündigung.
Götz saß reglos auf seinem Rappen, verborgen hinter einer Gruppe alter Eichen. Die eiserne Hand ruhte auf dem Griff seines Schwertes, und er spürte das vertraute Gewicht des Metalls, das längst zu einem Teil von ihm geworden war. Neben ihm hielt Georg Lerse, sein treuester Gefährte, den Atem an.
„Der dritte Wagen", flüsterte Lerse. „Siehst du, wie er tiefer liegt? Da ist unsere Ware."
Götz nickte. Seine Augen, scharf wie die eines Raubvogels, musterten die Eskorte. Zwölf Mann – keine schlechten Chancen gegen seine acht Reiter, wenn man Überraschung und Gelände richtig nutzte.
„Der Bischof von Würzburg sollte bessere Wachen anheuern", murmelte er mit einem schmalen Lächeln. „Diese da sehen aus, als hätten sie mehr Angst vor uns als wir vor ihnen."
„Sie haben recht damit", grinste Lerse.
Götz wartete, bis der Zug genau die richtige Stelle erreicht hatte – dort, wo der Weg sich verengte und ein umgestürzter Baum die Flucht nach vorn blockierte. Dann hob er die eiserne Hand.
„Jetzt!"
Sie brachen aus dem Unterholz wie Wölfe. Götzens Männer – allesamt erfahrene Reiter, Veteranen aus einem Dutzend Fehden – trieben ihre Pferde an die Flanken des Zuges. Die Söldner fuhren herum, griffen nach ihren Waffen, aber sie waren zu spät und zu überrascht.
Götz ritt direkt auf den Hauptmann zu, einen stämmigen Mann mit grauem Bart. Sein Schwert blitzte in der aufgehenden Sonne.
„Im Namen meiner Fehde gegen den Bischof von Würzburg", rief er mit donnernder Stimme, „lege ich Beschlag auf diese Waren! Wer Widerstand leistet, hat es mit Götz von Berlichingen zu tun!"
Der Hauptmann starrte auf die eiserne Hand, und das Blut wich aus seinem Gesicht. Jeder in Franken kannte die Geschichten von Götz mit der eisernen Hand – Geschichten, die mit jedem Erzählen größer und furchteinflößender wurden.
„Herr von Berlichingen", stammelte er. „Wir sind nur einfache Söldner. Wir haben keinen Streit mit Euch."
„Dann legt eure Waffen nieder, und euch geschieht nichts. Ich führe Krieg gegen euren Herrn, nicht gegen euch."
Es war keine lange Überlegung nötig. Die Söldner ließen ihre Waffen fallen. Sie waren nicht bereit, für den kargen Sold des Bischofs zu sterben, nicht gegen einen Mann wie Götz.
Lerse und die anderen machten sich über den dritten Wagen her. Unter der Plane kamen Fässer zum Vorschein – feiner Würzburger Wein, bestimmt für den fürstlichen Keller in Bamberg.
„Fünfzig Fässer mindestens", sagte Lerse und pfiff durch die Zähne. „Das ist ein guter Fang, Götz."
„Ein gerechter Fang", korrigierte Götz. „Der Bischof hat mir Unrecht getan, hat meine Handelsrechte missachtet. Dies ist nur, was mir zusteht."
Er wendete sein Pferd und betrachtete die verängstigten Fuhrleute. „Sagt eurem Herrn, Götz von Berlichingen lässt sich nicht wie ein Leibeigener behandeln. Ich bin ein freier Reichsritter, nur dem Kaiser verpflichtet. Wenn der Bischof meine Rechte achten will, gibt es Frieden. Wenn nicht..." Er hob die eiserne Hand. „Dann wird er noch mehr verlieren als ein paar Fässer Wein."
Zwei Stunden später saßen Götz und seine Männer in einer versteckten Lichtung, teilten Brot und Käse und tranken von dem erbeuteten Wein. Die Fässer waren bereits auf dem Weg nach Jaxthausen, wo sie verkauft oder gegen andere Waren eingetauscht werden würden.
Georg Lerse, ein Mann Ende zwanzig mit einem offenen, ehrlichen Gesicht und Händen, die so kräftig wie Schmiedehämmer waren, hob seinen Becher.
„Auf Götz von Berlichingen! Der letzte freie Ritter in diesem verfluchten Reich!"
Die anderen stimmten ein, und Götz musste lächeln, obwohl ihm unbehaglicher zumute war, als er sich anmerken ließ. Der letzte freie Ritter – ein schöner Titel, aber auch ein schweres Gewicht.
„Sagt das nicht zu laut", meinte Hans von Selbitz, der älteste unter ihnen, ein grauhaariger Veteran mit einer Narbe, die von der Stirn bis zum Kinn lief. „Die Fürsten würden uns am liebsten alle aufhängen sehen. Freie Ritter sind ihnen ein Dorn im Auge."
„Dann sollen sie es versuchen", erwiderte Götz, aber seine Stimme klang nachdenklicher als trotzig. „Wisst ihr, Männer, manchmal frage ich mich, ob wir nicht die letzten unserer Art sind. Überall schaue ich hin, sehe ich, wie die alten Freiheiten sterben. Die Städte werden mächtiger, die Fürsten verschlingen die kleinen Ritter, der Kaiser ist zu schwach, um uns zu schützen. Es ist, als würde eine alte Welt untergehen."
„Dann werden wir kämpfen, bis sie untergegangen ist", sagte Lerse einfach. „Was sollen wir sonst tun? Uns in den Städten als Söldner verdingen? Unsere Burgen an irgendeinen fetten Kaufmann verkaufen?"
„Niemals", knurrte Selbitz.
Götz trank einen Schluck Wein. Er war gut, dieser Würzburger, süß und schwer. Zu gut für einen Bischof, der mehr an Gold als an Gott interessiert war.
„Habt ihr von der Fehde zwischen Sickingens und dem Kurfürsten von der Pfalz gehört?" fragte er in die Runde.
Die Männer nickten. Franz von Sickingen – ein Name, der in diesen Tagen auf vielen Lippen lag. Ein Ritter wie Götz, aber mit mehr Männern, mehr Burgen, mehr Macht.
„Sie sagen, Sickingen hat zweitausend Mann unter Waffen", sagte Lerse. „Zweitausend! Gegen den Kurfürsten selbst."
„Sickingen ist ein guter Mann", sagte Götz langsam. „Ich habe ihn vor Jahren kennengelernt. Er kämpft für dasselbe wie wir – für die Freiheit der Ritterschaft. Aber manchmal frage ich mich, ob er nicht zu groß denkt. Zweitausend Mann – das ist schon fast eine Armee. Das ist nicht mehr die Fehde eines freien Ritters, das ist Krieg."
„Und was ist falsch daran?" fragte Selbitz. „Vielleicht braucht es einen Krieg, um diesen Fürsten zu zeigen, dass sie nicht alles verschlingen können."
Götz schüttelte den Kopf. „Ein Krieg verschlingt alle, Selbitz. Das habe ich gelernt. Nein, ich will nur das, was mir zusteht – meine Rechte, meine Freiheit, ein anständiges Leben für meine Familie. Mehr nicht."
„Und wenn sie dir auch das nicht lassen?"
Die Frage hing in der Luft wie eine Drohung. Götz hatte keine Antwort darauf.
Jaxthausen lag friedlich in der Nachmittagssonne, als Götz durch das Tor ritt. Die kleine Burg war kein prächtiges Schloss – nur ein viereckiger Wohnturm mit einer Mauer drum herum, ein paar Nebengebäude, ein Hof – aber es war sein Zuhause, und er liebte jeden Stein davon.
Seine Frau Maria stand auf der Treppe und wartete auf ihn. Sie war eine schöne Frau, Maria von Grumbach, mit dunklem Haar und klaren, intelligenten Augen. Als Götz abstieg und zu ihr ging, sah er die Sorge in ihrem Gesicht.
„Wieder eine Fehde?" fragte sie leise.
„Nur eine kleine", erwiderte er und küsste sie auf die Stirn. „Der Bischof von Würzburg musste eine Lektion lernen."
„Götz..." Sie seufzte. „Wie viele Lektionen müssen diese Leute noch lernen? Wie lange willst du so weitermachen?"
„So lange, bis sie uns in Ruhe lassen. So lange, bis sie verstehen, dass wir keine Leibeigenen sind, die man herumkommandieren kann."
Maria legte ihm eine Hand auf die Brust – auf die linke Seite, wo sein Herz schlug. „Du hast das Herz eines Löwen, mein Gemahl. Aber auch Löwen können fallen, wenn zu viele Jäger sie umringen."
„Dann werde ich kämpfen, bis ich falle."
„Das fürchte ich", murmelte sie.
Im Burghof spielten seine Kinder. Der älteste, Georg – genannt nach seinem besten Freund – war jetzt acht Jahre alt, ein lebhafter Junge mit dem unbändigen Willen seines Vaters. Die kleine Anna, sechs, versuchte ihrem Bruder nachzueifern, und der jüngste, Hans, erst drei, tollte zwischen ihnen herum wie ein junger Hund.
Als Georg seinen Vater sah, rannte er mit leuchtenden Augen herbei.
„Vater! Hast du gegen die Würzburger gekämpft? Gab es eine Schlacht?"
Götz hob den Jungen hoch – mit der linken Hand, die eiserne Hand war für solche zarten Dinge nicht geeignet – und lachte.
„Keine Schlacht, mein Sohn. Nur ein kleiner Streit um Wein."
„Ich will auch kämpfen! Ich will ein Ritter sein wie du!"
„Das wirst du", versprach Götz. „Aber erst musst du lernen. Ein guter Ritter braucht mehr als Mut – er braucht Wissen, Geschick, Ehre."
„Und eine eiserne Hand?" fragte Georg mit der unschuldigen Neugier eines Kindes.
Götz lachte, aber es war ein bitteres Lachen. „Die eiserne Hand ist kein Vorteil, mein Sohn. Sie ist... ein Preis, den ich bezahlt habe. Ein Preis für eine Lektion."
Er setzte den Jungen ab und blickte zu Maria. In ihren Augen las er alles, was sie nicht sagte: die Angst um ihn, die Sorge um die Zukunft, die Liebe, die all das überwog.
„Komm", sagte sie leise. „Das Essen ist bereit. Und heute Abend gehörst du uns, nicht den Fehden und Fürsten."
Am Abend saß Götz in seinem Gemach – einem spartanisch eingerichteten Raum mit dicken Steinwänden, einem großen Tisch und einem Kamin – und ging seine Papiere durch. Fehden waren nicht nur eine Sache von Schwert und Mut, sie erforderten auch Bürokratie. Man musste sie ordnungsgemäß ansagen, musste Listen der Forderungen führen, musste jeden Schritt dokumentieren, sonst riskierte man, als gemeiner Räuber behandelt zu werden.
Maria brachte ihm warmes Bier und setzte sich zu ihm.
„Der Bischof wird nicht schweigen", sagte sie. „Er wird sich beim Reichskammergericht beschweren."
„Soll er. Ich habe das Recht auf meiner Seite. Er hat meine Handelsrechte verletzt, hat meine Leute misshandelt. Das ist dokumentiert."
„Recht und Gerechtigkeit sind nicht dasselbe, Götz. Das weißt du. Die Gerichte sind voller Juristen und Schreiber, die im Sold der Fürsten stehen. Sie werden dir Unrecht geben, egal was die Wahrheit ist."
Götz ballte die eiserne Hand zur Faust. Das Metall knarrte leise.
„Dann werde ich kämpfen. Was soll ich sonst tun, Maria? Mich beugen? Mich unterwerfen? Soll ich hingehen und dem Bischof die Füße küssen, ihm danken, dass er mich wie Dreck behandelt?"
„Nein", sagte sie ruhig. „Das erwarte ich nicht von dir. Ich kenne dich zu gut. Aber..." Sie zögerte. „Versprich mir, dass du vorsichtig sein wirst. Dass du nicht zu weit gehst. Du hast Feinde, Götz. Mehr, als du denkst."
„Ich weiß." Er nahm ihre Hand – die warme, lebendige Hand, so anders als seine eigene kalte, eiserne. „Aber ich kann nicht anders sein, als ich bin. Ich bin kein Höfling, kein geschmeidiger Diplomat. Ich bin ein Ritter, und ein Ritter verteidigt seine Ehre und seine Freiheit."
„Auch wenn es ihn das Leben kostet?"
„Auch dann."
Sie schwiegen lange, hielten einander bei den Händen und starrten ins Feuer.
„Weißt du", sagte Götz schließlich, „manchmal träume ich von einer anderen Zeit. Von den Tagen, als das Reich noch stark war, als der Kaiser noch wirklich regierte, als die Ritter noch geachtet wurden. Jetzt... jetzt fühlt es sich an, als würden wir alle im Treibsand versinken, langsam aber unaufhaltsam."
„Dann müssen wir kämpfen, um nicht zu versinken", erwiderte Maria. „Aber klug kämpfen, nicht blind."
Er nickte. „Du hast recht. Du hast immer recht."
„Nicht immer", sagte sie mit einem schwachen Lächeln. „Aber heute Abend schon."
In der Nacht lag Götz wach und lauschte den Geräuschen der Burg. Das Knarren der Holzbalken, das leise Heulen des Windes, das ferne Bellen eines Hundes. Vertraute Geräusche, beruhigende Geräusche.
Aber sein Geist fand keine Ruhe. Er dachte an die Fehde mit Würzburg, an die anderen Konflikte, die sich wie dunkle Wolken am Horizont zusammenbrauten. Der Bischof war nicht sein einziger Gegner. Da war der Markgraf von Brandenburg-Ansbach, der Ansprüche auf einige von Götzens Ländereien erhob. Da war die Stadt Nürnberg, die ihn beschuldigte, ihre Kaufleute belästigt zu haben. Da waren ein Dutzend kleinerer Streitereien mit Nachbarn und Rivalen.
Überall Feinde. Überall Gefahre.
Und doch – wenn er aufgab, was blieb dann? Ein Leben in Unterwürfigkeit, in Kriecherei? Das konnte er nicht. Das würde er nicht.
Er drehte sich zu Maria um, die friedlich neben ihm schlief. Im Mondlicht, das durch das schmale Fenster fiel, sah sie jung aus, beinahe mädchenhaft. Er liebte sie mehr, als er je in Worte fassen könnte.
Für sie würde er kämpfen. Für seine Kinder. Für Jaxthausen. Für die Idee von Freiheit und Ehre, die langsam aus der Welt verschwand wie Rauch im Wind.