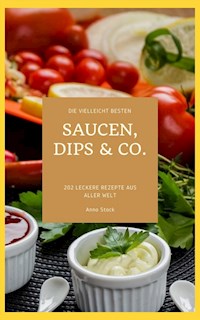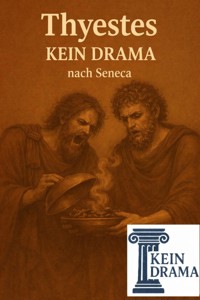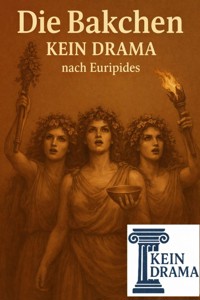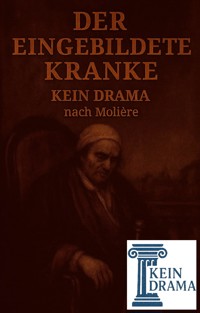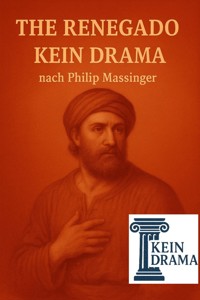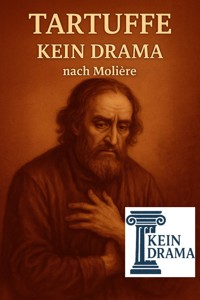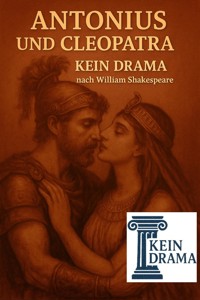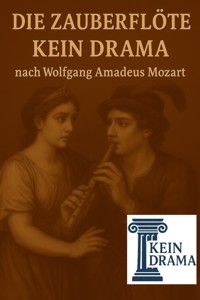6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Er verführte aus Prinzip. Er zerstörte aus Philosophie. Aber kann ein Monster lernen, Mensch zu sein? Don Juan Tenorio ist der Mann, vor dem Väter ihre Töchter warnen. Charmant, gebildet, skrupellos – er durchquert Europa und hinterlässt eine Spur gebrochener Herzen. Aus dem Kloster entführt er die unschuldige Elvira, heiratet sie und verlässt sie kurz darauf. Für ihn ist es nur ein weiteres Abenteuer in einem Leben, das er als philosophisches Experiment betrachtet: Wenn das Leben bedeutungslos ist, warum dann nicht nehmen, was man begehrt? Doch das Schicksal holt jeden ein. Als Don Juan einem Ertrinkenden das Leben rettet, ahnt er nicht, dass es sich um Elviras Bruder handelt – einen Mann, der geschworen hat, ihn zu töten. Zwischen Freundschaft und tödlichem Geheimnis gefangen, muss Don Juan sich den Konsequenzen seiner Taten stellen. Und dann erscheint der steinerne Komtur – eine Statue, die zum Leben erwacht und ihn zwingt, in den Abgrund seiner eigenen Seele zu blicken. Was er dort findet, ist erschreckend: nicht Leere, sondern die verzweifelte Angst eines Mannes vor Liebe, Verletzlichkeit, Leben selbst. Eine kraftvolle Neuerzählung des klassischen Stoffes – psychologisch tiefgreifend, moralisch kompromisslos, und doch voller Hoffnung auf Veränderung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Don Juan - Kein Drama nach Molière
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Sganarelles Bericht
Kapitel 2: Die Flucht aus dem Kloster
Kapitel 3: Aufbruch in die Nacht
Kapitel 4: Die verlassene Braut
Kapitel 5: Sehnsucht nach Freiheit
Kapitel 6: Am Strand von Sizilien
Kapitel 7: Charlotte und Mathurine
Kapitel 8: Der Sturm
Kapitel 9: Ein geretteter Feind
Kapitel 10: Im Wald der Versuchung
Kapitel 11: Der Bettler
Kapitel 12: Schatten der Vergangenheit
Kapitel 13: Das Grabmal
Kapitel 14: Die steinerne Einladung
Kapitel 15: Don Luis' Verzweiflung
Kapitel 16: Familienschande
Kapitel 17: Der Gläubiger
Kapitel 18: Die Maske der Frömmigkeit
Kapitel 19: Sganarelles Gewissen
Kapitel 20: Der steinerne Gast
Kapitel 21: Letzte Warnungen
Kapitel 22: Don Juans Trotz
Kapitel 23: Höllenfahrt
EPILOG: Die Ewigkeit in einem Moment
Nachwort des allwissenden Erzählers:
NACHWORT
Impressum neobooks
Table of Contents
DON JUAN - Eine Romanadaption nach Molière
Anno Stock
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEIL I: Der Verführer
Kapitel 1: Sganarelles Bericht
Es gibt Männer, dachte Sganarelle, während er seinem Herrn beim Ankleiden half, die von Gott zur Tugend geboren wurden. Und dann gibt es Don Juan Tenorio.
Der Diener nestelte an den goldbestickten Manschetten, während sein Herr sich im venezianischen Spiegel betrachtete – nicht mit der Eitelkeit eines Gecken, sondern mit der kühlen Berechnung eines Feldherrn, der sein wichtigstes Kriegswerkzeug inspiziert. Und dieses Werkzeug war, das musste Sganarelle widerwillig zugeben, von verheerender Wirkung.
Don Juan Tenorio war dreißig Jahre alt und trug die Züge der spanischen Hochadligen mit einer Lässigkeit, die andere zu erreichen versuchten und doch nie erlangten. Schwarzes Haar fiel ihm in leichten Wellen bis auf die Schultern, das Gesicht schmal und von der Sonne Andalusiens gebräunt, die Augen dunkel wie Mitternacht und ebenso undurchdringlich. Wenn er sprach, was er selten ohne Absicht tat, lag in seiner Stimme jene Mischung aus Samt und Gift, die Frauen zum Schaudern brachte – nicht vor Angst, sonern vor einer Ahnung dessen, was kommen würde.
„Du starrst mich an wie ein Priester einen Ketzer", bemerkte Don Juan, ohne sich umzudrehen. „Hast du wieder Gewissensbisse, alter Freund?"
Gewissensbisse. Das Wort war zu klein für das, was in Sganarelles Brust wütete. Er war seit zwölf Jahren im Dienst dieses Mannes, hatte ihm durch halb Europa gedient, hatte Briefe überbracht, Lügen verbreitet, Treppen hochgeklettert und durch Hintertüren geflohen. Er hatte gesehen, wie Don Juan Herzen brach wie andere Männer Brot brachen – achtlos, selbstverständlich, mit einer Eleganz, die das Verbrechen fast zur Kunst erhob.
„Herr", begann Sganarelle vorsichtig, „ich denke nur an Donna Elvira."
„Ah." Don Juan griff nach dem Degengürtel, den sein Diener ihm reichte. „Die gute Elvira. Sie wird uns verzeihen, denke ich."
„Verzeihen?" Sganarelle konnte sich nicht zurückhalten. „Ihr habt sie aus dem Kloster entführt, ihre Gelübde gebrochen, sie geehelicht – und nun, keine drei Monate später, flieht Ihr aus Sevilla wie ein Dieb in der Nacht!"
Don Juan wandte sich um, und auf seinen Lippen spielte jenes Lächeln, das Sganarelle gleichzeitig faszinierte und erschreckte. Es war das Lächeln eines Mannes, der die Welt als Schachbrett sah und sich selbst als den einzigen Spieler, der die Regeln durchschaute.
„Ich fliehe nicht, mein Freund. Ich breche auf. Es ist ein Unterschied." Er trat ans Fenster der Herberge, durch das die Morgendämmerung über die Küste von Sizilien kroch. Irgendwo dort draußen lag das Meer, das sie vom spanischen Festland getrennt hatte. „Und was Elvira betrifft – ich habe ihr die größte Gunst erwiesen, die ein Mann einer Frau erweisen kann."
„Eine Gunst?" Sganarelle schnaubte. „Welche Gunst liegt darin, eine Frau zu verführen, zu heiraten und zu verlassen?"
„Die Gunst", sagte Don Juan leise und mit einer Intensität, die seinen Diener verstummen ließ, „sie leben zu lassen. Begreifst du das nicht, Sganarelle? Die Liebe – diese große, besungene, vergötterte Liebe – ist nichts als ein langsamer Tod. Ein goldener Käfig, in dem zwei Menschen einander so lange ansehen, bis sie blind werden für alles, was die Welt noch zu bieten hat. Ich habe Elvira gerettet vor der größten Lüge der Menschheit: der Vorstellung, dass Glück in Dauer liegt."
Er sprach diese Worte mit der Überzeugung eines Propheten, und Sganarelle, der diese Reden schon hundertmal gehört hatte, wusste, dass es sinnlos war zu widersprechen. Don Juan glaubte, was er sagte – davon war der Diener überzeugt. Und darin lag vielleicht das Schrecklichste: dass dieser Mann keine Heuchelei kannte, sondern eine eigene, teuflische Philosophie lebte.
„Aber die arme Frau weint", wagte Sganarelle einzuwenden. „Ihr Herz ist gebrochen."
„Herzen brechen nicht", erwiderte Don Juan. „Sie vernarben. Und Narben, mein Freund, machen interessant." Er wandte sich vom Fenster ab, und sein Blick streifte über den Raum, als suche er bereits das nächste Abenteuer. „Elvira wird diese Episode überstehen. In einem Jahr wird sie im Kloster sitzen und unsere Begegnung für eine Prüfung Gottes halten. In zehn Jahren wird sie meinen Namen kaum noch erinnern. Aber in ihren letzten Minuten, wenn das Leben aus ihr weicht, wird sie sich an jene drei Monate erinnern – an die einzigen Monate, in denen sie wirklich gelebt hat."
Es war unmöglich, mit ihm zu streiten. Don Juan besaß die gefährliche Gabe, jede Untat in ein philosophisches Argument zu verwandeln. Sganarelle hatte gelernt, dass sein Herr nicht einfach ein Lüstling war – das wäre einfach gewesen, beinahe verzeihlich. Nein, Don Juan war ein Mann, der an nichts glaubte und gerade deshalb alles für möglich hielt. Für ihn gab es keinen Himmel, keine Hölle, keine Moral jenseits des eigenen Vergnügens. Die Welt war ein großes Theater, und er der einzige Schauspieler, der wusste, dass es nur ein Spiel war.
„Und was nun?" fragte Sganarelle, während er die Reisetasche schloss. „Wohin führt uns der Weg?"
Don Juan trat an den Tisch und goss sich einen Becher Wein ein. Er trank langsam, genießerisch, wie er alles tat. „Palermo", sagte er schließlich. „Ich höre, dort gibt es ein Mädchen – die Tochter eines Admirals. Sie soll Augen haben wie das Meer bei Mondschein." Er lächelte. „Wie könnte ich da widerstehen?"
Sganarelle seufzte. Natürlich. Eine neue Stadt, ein neues Opfer. So war es immer gewesen, so würde es immer sein. Manchmal fragte er sich, warum er Don Juan nicht einfach verließ, warum er diesem Mann diente, dessen Seele – wenn er denn eine besaß – schwärzer war als die Nacht.
Aber er kannte die Antwort. Es war dieselbe Antwort, die alle kannten, die Don Juan begegneten. Der Mann besaß eine Anziehungskraft, die rational nicht zu erklären war. Er war die Flamme, und sie alle – Sganarelle eingeschlossen – waren die Motten. Man folgte ihm nicht trotz seiner Verderbtheit, sondern wegen ihr. In seiner Gegenwart fühlte man sich lebendig auf eine Weise, die das brave, rechtschaffene Leben niemals bieten konnte.
„Übrigens", Don Juan leerte seinen Becher und stellte ihn ab, „pack auch die blaue Schatulle ein. Die mit den Briefen."
„Die Briefe?" Sganarelle runzelte die Stirn.
„Von den Damen aus Madrid, Neapel, Lissabon..." Don Juan zählte an den Fingern ab. „Besonders die von Isabella solltest du griffbereit halten. Ihr Bruder, der Marchese, ist angeblich in Sizilien. Sollte er uns begegnen, könnte es nützlich sein, ihre... sagen wir, glühenden Schwüre vorzeigen zu können."
„Ihr würdet sie erpressen?"
„Ich würde mich verteidigen", korrigierte Don Juan. „Es ist ein Unterschied, ob man ein Schwert zieht oder ein Schild erhebt." Er griff nach seinem Hut, einem breitkrempigen Ding mit einer blutroten Feder. „Komm, alter Freund. Die Sonne steigt, und mit ihr unsere Chancen, ungesehen die Stadt zu verlassen. Ich habe keine Lust, mich heute zu duellieren."
„Heute nicht?" Sganarelle konnte die Ironie nicht unterdrücken.
„Heute nicht", bestätigte Don Juan mit einem Grinsen. „Morgen jedoch, wer weiß?"
Sie verließen die Herberge durch einen Seitenausgang, vorbei an noch schlafenden Gästen und einem schnarchenden Wirt. Die Straßen von Catania lagen still im frühen Morgenlicht, nur vereinzelt waren Fischer zu sehen, die ihre Netze zum Hafen trugen. Don Juan bewegte sich mit der Selbstverständlichkeit eines Mannes, der überall und nirgendwo zu Hause war. Er gehörte nicht zu jenen nervösen Flüchtlingen, die sich ständig umsahen. Er ging, als sei die ganze Welt sein rechtmäßiges Erbe.
„Weißt du, Sganarelle", sagte er, während sie durch eine enge Gasse schlenderten, „was der größte Fehler der Menschheit ist?"
Der Diener seufzte. Philosophische Vorträge am frühen Morgen gehörten zu den weniger angenehmen Aspekten seiner Anstellung. „Nein, Herr. Was ist es?"
„Sie verwechseln Versprechen mit Wahrheit. Ein Mann schwört einer Frau ewige Treue, und beide glauben, dass diese Worte die Zukunft verändern können. Aber die Zukunft", er machte eine wegwerfende Handbewegung, „kümmert sich nicht um unsere Schwüre. Sie kommt, wie sie will. Und wenn die Leidenschaft verflogen ist, wenn die Schönheit welkt, wenn die ersten grauen Haare erscheinen – was bleibt dann von der ewigen Liebe? Nichts als die Lüge, die man weiterleben muss, weil man einmal einen Schwur geleistet hat."
„Aber ohne Versprechen", wandte Sganarelle ein, „ohne Treue und Beständigkeit – was bleibt dann?"
Don Juan blieb stehen und sah seinem Diener direkt in die Augen. „Die Wahrheit bleibt, mein Freund. Die schmerzhafte, schöne Wahrheit, dass wir alle sterblich sind, dass jeder Augenblick einzigartig ist, dass keine Umarmung je wiederkehrt. Ich lüge den Frauen nicht vor, ich würde sie ewig lieben. Ich liebe sie in dem Moment, in dem ich sie liebe – vollständig, bedingungslos, mit jeder Faser meines Seins. Und wenn dieser Moment vorüber ist, gehe ich. Das ist ehrlicher als ein Leben in der Lüge."
„Aber sie leiden", flüsterte Sganarelle.
„Sie leben", korrigierte Don Juan. „Endlich leben sie."
Sie erreichten den Stadtrand, wo die Häuser niedriger wurden und die Straße in einen staubigen Pfad überging. In der Ferne erhob sich der Ätna, sein Gipfel mit Schnee bedeckt, ein schwarzer Riese, der Feuer und Eis in sich vereinte. Don Juan betrachtete den Vulkan mit einem Ausdruck, den Sganarelle nicht deuten konnte.
„Siehst du den Berg?" fragte sein Herr. „Er explodiert, wann immer es ihm gefällt. Er kümmert sich nicht um die Dörfer am Fuß, nicht um die Gebete der Menschen. Er folgt seiner Natur." Don Juan wandte sich ab und setzte seinen Weg fort. „Genau wie ich."
Und Sganarelle folgte, wie er es immer tat, mit einem Herzen voller Zweifel und einer Gewissheit, die ihn beunruhigte: Dieser Mann würde nicht friedlich sterben. Irgendwo, irgendwann würde es eine Abrechnung geben. Man konnte nicht ewig mit dem Feuer spielen, ohne sich zu verbrennen.
Aber heute war nicht dieser Tag. Heute war die Sonne warm, der Weg breit, und vor ihnen lag Sizilien mit all seinen Geheimnissen und Versuchungen. Don Juan pfiff eine Melodie, die Sganarelle nicht kannte, und in diesem Moment hätte niemand vermuten können, dass dieser elegante Kavalier ein Monster war.
Doch Sganarelle wusste es besser. Er hatte die Tränen gesehen, die Don Juan hinterließ. Er hatte die Briefe gelesen, die verzweifelten Bitten, die flehentlichen Schwüre. Und er hatte gesehen, wie sein Herr sie las – mit einem Lächeln auf den Lippen und Eis in den Augen.
Ja, Don Juan Tenorio war ein Monster. Aber er war ein Monster, das die Sprache der Engel sprach, und das machte ihn so gefährlich.
Sie wanderten weiter durch die erwachende Landschaft, zwei Gestalten am Rand der Welt, der eine ein Teufel im Mantel eines Edelmanns, der andere ein einfacher Mann, gefangen zwischen Loyalität und Gewissen.
Und hinter ihnen, das wusste Sganarelle, würde Donna Elvira früher oder später aufbrechen. Sie würde Don Juan suchen, getrieben von Liebe oder Rache oder beidem. Das Schicksal hatte seinen Lauf genommen, und niemand konnte ihn mehr aufhalten.
Kapitel 2: Die Flucht aus dem Kloster
Drei Monate zuvor hatte Donna Elvira de Montemayor geglaubt, ihr Leben sei entschieden. Sie war fünfundzwanzig Jahre alt, und die Welt hatte ihr nichts mehr anzubieten als die Stille hinter Klostermauern. Ihre Familie – alt, stolz und verarmt – hatte sie ins Kloster Santa Teresa de Sevilla geschickt, nicht aus Frömmigkeit, sondern aus Pragmatismus. Eine mittellose Tochter war eine Last; eine Nonne war eine Lösung.
Elvira hatte sich in ihr Schicksal gefügt. Was blieb ihr anderes übrig? Sie hatte die Gelübde noch nicht abgelegt, war erst Novizin, aber in ihrem Herzen hatte sie bereits abgeschlossen mit der Welt draußen. Die Liebe, von der die Troubadoure sangen, war für andere Frauen bestimmt – für solche mit Mitgift und Aussehen. Sie selbst war zu blass, zu still, zu sehr in sich gekehrt. Oder so hatte man ihr beigebracht zu glauben.
Dann kam Don Juan Tenorio.
Es war an einem Herbsttag, als die Blätter der Orangenbäume im Klosterhof wie goldene Münzen fielen. Elvira kniete in der Kapelle, ihre Lippen formten mechanisch die vertrauten Gebete, während ihre Gedanken wanderten. Sie dachte an nichts Bestimmtes – an die Stickerei, die sie am Nachmittag vollenden musste, an die Novizin Ines, die am Fieber darniederlag, an den Winter, der bald kommen würde.
Die Tür zur Kapelle öffnete sich. Das war nicht ungewöhnlich; Gläubige kamen und gingen. Aber als Elvira – mehr aus Gewohnheit als aus Interesse – aufblickte, erstarrte ihr Atem.
Ein Mann stand im Eingang, vom Nachmittagslicht umrahmt wie eine Erscheinung. Er war ganz in Schwarz gekleidet, nur das weiße Hemd leuchtete an Hals und Handgelenken. Sein Haar war dunkel und fiel ihm offen über die Schultern – in einer Zeit, in der Männer Perücken trugen, eine unerhörte Freiheit. Und sein Gesicht... Elvira hatte in ihrem Leben viele Gesichter gesehen, aber keines, das so war wie dieses. Es war nicht die klassische Schönheit eines Jünglings, sondern etwas Gefährlicheres: die Schönheit eines Raubtiers, elegant und tödlich zugleich.
Der Mann – Don Juan, wie sie später erfahren sollte – trat näher. Seine Schritte hallten auf den Steinfliesen, ein rhythmisches Echo in der Stille der Kapelle. Elvira senkte schnell den Blick, aber es war zu spät. Sie hatte ihn gesehen, und schlimmer noch: Er hatte gesehen, dass sie ihn sah.
Don Juan kniete neben ihr nieder, in angemessenem Abstand, und begann zu beten. Seine Stimme war leise, kaum mehr als ein Murmeln, aber Elvira hörte jedes Wort. Es waren lateinische Verse, die Confessiones des Augustinus, und er sprach sie mit einer Inbrunst, die sie bewegte. Hier war ein Mann, der Gott suchte, der rang mit dem Glauben, der – wie sie – verloren war in dieser Welt.
So jedenfalls schien es.
Nach einer Weile – Elvira hätte nicht sagen können, ob es Minuten oder Stunden waren – erhob sich Don Juan. Er verneigte sich leicht vor dem Altar, dann verließ er die Kapelle, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Elvira blieb zurück, verwirrt und seltsam erregt. Ihr Herz schlug schneller als sonst, und ihre Gebete wollten nicht mehr fließen.
Am nächsten Tag kam er wieder. Und am übernächsten. Immer zur gleichen Stunde, immer mit derselben Andacht. Manchmal betete er, manchmal saß er nur da und starrte auf das Kruzifix über dem Altar, als suche er dort eine Antwort, die sich ihm verweigerte. Und niemals sprach er sie an, niemals sah er sie direkt an. Aber Elvira spürte seine Gegenwart wie eine körperliche Berührung.
Nach einer Woche – es war ein Mittwoch, sie würde sich immer daran erinnern – sprach er sie zum ersten Mal an.
„Verzeiht", seine Stimme war samt und dunkel, „kennt Ihr den Weg zur Bibliothek? Ich suche ein Buch über die Mystiker, aber ich fürchte, ich habe mich verirrt in diesem Labyrinth."
Elvira hätte schweigen sollen. Die Regel verbot ihr, mit fremden Männern zu sprechen. Aber als sie in seine Augen blickte – diese dunklen, unergründlichen Augen –, fand sie sich antwortend: „Die Bibliothek ist im Ostflügel, durch den Kreuzgang und dann die Treppe hinauf."
„Ich danke Euch." Er lächelte, und dieses Lächeln veränderte alles. Es war kein höfliches Lächeln, kein gesellschaftliches – es war ein Lächeln, das sagte: Ich sehe dich. Nicht die Novizin, nicht die Pflicht, nicht die Rolle. Dich.
Elvira spürte, wie Hitze in ihre Wangen stieg. Sie senkte den Blick, murmelte etwas Unverständliches und floh aus der Kapelle. Hinter sich hörte sie sein leises Lachen, nicht spöttisch, sondern... zärtlich?
Die Äbtissin, eine alte Frau mit scharfen Augen und noch schärferem Verstand, beobachtete Don Juans häufige Besuche mit Argwohn. Sie ließ ihn rufen und fragte nach dem Grund seines Kommens.
„Ich suche Gott", antwortete Don Juan mit einer Demut, die überzeugend wirkte. „Mein Leben war sündhaft, Ehrwürdige Mutter. Ich habe geliebt und verloren, gekämpft und versagt. Nun suche ich Frieden in den Worten der Heiligen."
Die Äbtissin war nicht leicht zu täuschen, aber selbst sie konnte in Don Juans Gesicht keine Falschheit erkennen. Vielleicht, dachte sie, war dies einer jener seltenen Fälle, in denen ein Sünder wahrhaft Reue zeigte. Sie gestattete ihm weiterhin den Zugang zur Kapelle – ein Fehler, der sie später teuer zu stehen kommen würde.
Don Juan intensivierte seine Besuche. Er kam nun nicht nur zur Kapelle, sondern auch zum Kreuzgang, zur Bibliothek, zum Klostergarten. Und immer, wenn möglich, war Elvira in seiner Nähe. Sie sprachen nicht viel – die Regeln erlaubten es nicht –, aber Worte waren auch nicht nötig. Ein Blick genügte, ein zufälliges Streifen der Finger beim Überreichen eines Buches, ein Lächeln im Vorbeigehen.
Elvira begann zu leben. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich gesehen, gewollt, lebendig. Die Gebete, die sie sprach, bekamen eine neue Bedeutung. Wenn sie von Liebe las, dachte sie an ihn. Wenn sie von Sehnsucht sang, galt es ihm. Die Heiligen, die sie studierte, waren alle von göttlicher Liebe entzündet – warum sollte ihre eigene Liebe weniger heilig sein?
Don Juan spielte seine Rolle meisterhaft. Er war nie aufdringlich, nie unangemessen. Er behandelte sie mit einem Respekt, der sie berührte, und einer Distanz, die sie wahnsinnig machte. Und langsam, sehr langsam, begann er ihr Fragen zu stellen.
„Seid Ihr glücklich hier?" fragte er eines Tages, als sie allein in der Bibliothek waren.
Elvira zögerte. Die ehrliche Antwort war nein, aber das durfte sie nicht sagen. „Ich diene Gott", erwiderte sie ausweichend.
„Das habe ich nicht gefragt." Seine Augen ruhten auf ihr mit einer Intensität, die sie erzittern ließ. „Ich fragte nach Eurem Glück."
„Glück", sagte sie leise, „ist nicht wichtig."
„Nicht wichtig?" Don Juan trat näher, noch immer in respektvollem Abstand, aber nahe genug, dass sie seinen Atem spüren konnte. „Glück ist das Einzige, was wichtig ist, Donna Elvira. Alles andere – Pflicht, Ehre, Gehorsam – sind nur Worte, mit denen die Mächtigen die Schwachen kontrollieren."
„Das ist Blasphemie", flüsterte sie, aber ohne Überzeugung.
„Ist es Blasphemie, die Wahrheit zu sagen?" Er lächelte traurig. „Gott hat uns das Leben gegeben. Glaubt Ihr wirklich, er will, dass wir es wegwerfen? Dass wir unsere Jugend, unsere Leidenschaft, unsere Liebe opfern auf dem Altar einer Pflicht, die andere für uns erfunden haben?"
„Ich... ich weiß nicht."
„Dann findet es heraus." Don Juan griff nach ihrer Hand – die erste wirkliche Berührung zwischen ihnen – und Elvira spürte, wie ein Schock durch ihren Körper fuhr. Seine Hand war warm, fest, lebendig. „Kommt heute Nacht in den Garten. Bei Mitternacht. Ich werde auf Euch warten."
„Das kann ich nicht."
„Könnt Ihr nicht? Oder wollt Ihr nicht?" Seine Augen forderten sie heraus. „Eine Stunde, Elvira. Gebt mir eine Stunde, und dann entscheidet. Wenn Ihr danach zurückkehren wollt in Eure Zelle, in Euer Leben des Verzichts – ich werde Euch nicht aufhalten. Aber wenn Ihr auch nur den kleinsten Zweifel habt, wenn Ihr auch nur einen Funken Neugier verspürt... dann kommt."
Er ließ ihre Hand los und verließ die Bibliothek, bevor sie antworten konnte.
Elvira stand da, ihre Hand noch warm von seiner Berührung, ihr Herz ein wildes Tier in ihrer Brust. Sie sollte zur Äbtissin gehen, diesen Mann anklagen, ihn fortweisen lassen. Aber selbst während sie das dachte, wusste sie, dass sie es nicht tun würde.
Die Stunden bis Mitternacht waren eine Ewigkeit. Elvira ging durch die Routinen des Klostertags wie eine Schlafwandlerin. Sie betete, sie aß, sie arbeitete – aber ihr Geist war nicht bei dem, was sie tat. Er war bereits im Garten, bei ihm, in der Nacht.
Als die Glocke die zwölfte Stunde schlug, erhob sich Elvira von ihrem Lager. Die anderen Novizinnen schliefen, ihre Atemzüge gleichmäßig in der Dunkelheit. Elvira zog ihren Mantel über das Nachthemd und schlich hinaus, ihr Herz hämmerte so laut, dass sie fürchtete, es würde alle wecken.
Der Klostergarten lag im Mondlicht, silbern und unwirklich. Die Orangenbäume warfen lange Schatten, und die Luft roch nach Jasmin und Nacht. Und dort, unter dem ältesten Baum, wartete Don Juan.
Er hatte seinen formellen Anzug abgelegt und trug nur Hemd und Hose. Im Mondlicht sah er aus wie ein Geist, oder ein Traum, oder vielleicht der Teufel selbst. Als er sie sah, lächelte er.
„Ihr seid gekommen."
„Ich... ich sollte nicht hier sein."
„Und doch seid Ihr hier." Er streckte die Hand aus. „Kommt."
Elvira nahm seine Hand, und in diesem Moment wusste sie, dass sie verloren war.
Don Juan führte sie tiefer in den Garten, dorthin, wo die Mauern mit Efeu bewachsen waren und eine steinerne Bank stand. Sie setzten sich, und für lange Zeit schwiegen sie beide, lauschten nur dem Rauschen des Brunnens und dem fernen Ruf einer Nachtigall.
„Erzählt mir von Euch", sagte Don Juan schließlich. Seine Stimme war weich, einladend. „Nicht von der Novizin, nicht von der Tochter aus gutem Hause. Von Elvira."
Und Elvira, die noch nie in ihrem Leben so gefragt worden war, begann zu sprechen. Sie erzählte von ihrer Kindheit, von den Büchern, die sie gelesen hatte, von den Träumen, die sie geträumt und dann begraben hatte. Sie erzählte von der Einsamkeit, die sie kannte, seit sie denken konnte, von dem Gefühl, unsichtbar zu sein, überflüssig.
Don Juan hörte zu, wirklich zu. Er unterbrach nicht, urteilte nicht. Er war einfach da, präsent, aufmerksam. Und als sie schließlich verstummte, erschöpft vom eigenen Geständnis, sagte er: „Ihr seid wunderschön."
Elvira lachte bitter. „Das bin ich nicht. Ich weiß, wie ich aussehe."
„Nein." Don Juan drehte sich zu ihr, nahm ihr Gesicht in beide Hände. „Ihr wisst nicht, wie Ihr aussieht. Ihr seht Euch mit den Augen derer, die Euch klein halten wollen. Aber ich sehe Euch mit meinen Augen." Seine Daumen strichen über ihre Wangen, eine Berührung, die sie erbeben ließ. „Ich sehe Feuer unter Asche. Ich sehe Leben, das darauf wartet, gelebt zu werden. Ich sehe eine Frau, die gemacht ist für Leidenschaft, nicht für Gebete."
„Ihr kennt mich nicht", flüsterte Elvira, aber ihre Stimme zitterte.
„Ich kenne Euch besser als Ihr Euch selbst kennt." Er beugte sich vor, seine Lippen fast an ihren. „Lasst mich es Euch zeigen."
Der Kuss kam langsam, fast zögernd. Don Juan, der tausend Frauen geküsst hatte, küsste Elvira, als sei sie die erste. Seine Lippen waren weich, fragend, voller Versprechen. Und Elvira, die noch nie geküsst worden war, antwortete mit einer Heftigkeit, die sie selbst überraschte.
Die Welt verschwand. Es gab nur noch diesen Moment, diesen Mann, diese Berührung. Don Juans Hände glitten durch ihr Haar, lösten es aus dem strengen Knoten, ließen es fallen wie einen dunklen Wasserfall. Seine Lippen wanderten von ihrem Mund zu ihrem Hals, zu der Stelle, wo der Puls wild schlug.
„Kommt mit mir", murmelte er gegen ihre Haut. „Fort von hier. Fort von diesen Mauern, von dieser Kälte. Ich will Euch zeigen, was Leben bedeutet."
„Ich kann nicht", stöhnte Elvira, selbst während ihre Hände seinen Rücken umfassten, ihn zu sich zogen. „Meine Gelübde..."
„Ihr habt noch keine Gelübde abgelegt." Seine Hände fanden die Schnüre ihres Mantels, öffneten sie mit geübter Geschicklichkeit. „Ihr habt Euer Leben noch nicht weggeworfen. Es ist nicht zu spät."
Das dünne Nachthemd war kaum eine Barriere. Don Juans Finger glitten darunter, fanden ihre Haut, warm und zitternd. Elvira hätte protestieren sollen, hätte ihn wegstoßen sollen. Aber ihr Körper hatte eigene Gedanken, eigene Wünsche, die jahrelang unterdrückt worden waren.
„Sagt mir, dass Ihr mich wollt", flüsterte Don Juan, seine Stimme heiser vor Verlangen. „Sagt es."
„Ich..." Elvira rang nach Atem, nach Worten, nach Vernunft. „Ich will... oh Gott, ich will..."
„Gott hat nichts damit zu tun." Don Juan lächelte gegen ihren Hals. „Dies hier ist zwischen Euch und mir. Zwischen Eurem Körper und meinem. Zwischen dem Leben und dem Tod, den Ihr wählt, wenn Ihr hierbleibt."
Seine Hand glitt höher, fand ihre Brust, und Elvira schrie leise auf – nicht vor Schmerz, sondern vor einer Lust, die sie nicht gekannt hatte. Ihr Körper war ein Instrument, das plötzlich gespielt wurde, und jede Berührung war eine Note in einer Symphonie, die sie nie gehört hatte.
„Kommt mit mir", wiederholte Don Juan, und seine Stimme war jetzt ein Befehl. „Jetzt. Heute Nacht. Wir reiten nach Norden, heiraten in Córdoba, und niemand wird Euch je wieder sagen, was Ihr zu tun oder zu lassen habt."
„Heiraten?" Elvira hob den Kopf, ihre Augen groß im Mondlicht. „Ihr wollt mich heiraten?"
„Ich will Euch." Seine Augen brannten mit einer Intensität, die keine Lüge zu sein schien. „Ich will Euch zur Frau, in meinem Bett, in meinem Leben. Ich will jeden Morgen neben Euch aufwachen und jeden Abend neben Euch einschlafen. Sagt ja, Elvira. Sagt ja, und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich werde Euch glücklich machen."
Es war die Lüge, auf die sie gewartet hatte, ohne zu wissen, dass sie wartete. Die Lüge, die jede Frau hören will: dass sie gewollt ist, dass sie geliebt wird, dass das Verlangen mehr ist als nur Fleisch.
„Ja", flüsterte Elvira. „Ja, ich komme mit Euch."
Don Juan küsste sie noch einmal, tiefer, fordernder. Seine Hände vollendeten, was sie begonnen hatten, und Elvira ließ es geschehen, ließ ihn ihre Unschuld nehmen dort unter den Orangenbäumen, während die Nacht zusah und die Sterne schwiegen.
Es war schnell, intensiv, schmerzlich und wunderbar zugleich. Elvira klammerte sich an ihn, spürte sein Gewicht, seine Hitze, sein Leben. Und als es vorbei war, als sie beide keuchend dalagen, ihr Nachthemd zerknittert, ihr Haar wild, da fühlte sie sich zum ersten Mal vollständig.
„Wir müssen gehen", sagte Don Juan nach einer Weile. Er stand auf, ordnete seine Kleidung. „Wartet hier. Ich hole die Pferde."
Er verschwand in der Dunkelheit, und Elvira blieb zurück, ihr Körper noch zitternd von dem, was geschehen war. Sie wusste, sie sollte Angst haben, Reue empfinden. Aber alles, was sie fühlte, war eine wilde, irrationale Freude.
Don Juan kehrte rasch zurück, zwei Pferde hinter sich. „Könnt Ihr reiten?"
„Ja."
„Gut. Dann kommt. Wir haben keine Zeit zu verlieren."
Elvira schwang sich auf das Pferd, noch immer in ihrem Nachthemd und Mantel. Es war absurd, es war skandalös – und es war das Aufregendste, was sie je getan hatte.
Sie ritten durch die Nacht, durch die schlafende Stadt Sevilla, durch Olivenhaine und über staubige Straßen. Don Juan ritt voraus, sicher und zielstrebig, und Elvira folgte ihm, wie sie ihm von nun an immer folgen würde.
Bei Sonnenaufgang machten sie Halt bei einem Wirtshaus. Der Wirt, ein verschlagener Mann mit wissendem Lächeln, stellte keine Fragen. Don Juan bezahlte gut, und Gold war die beste Schweigepflicht.
In einem kleinen Zimmer unter dem Dach liebten sie sich erneut, diesmal langsamer, gründlicher. Don Juan zeigte Elvira Dinge, von denen sie nicht gewusst hatte, dass sie existierten. Er war ein Lehrer und sie eine willige Schülerin, und die Stunden vergingen in einem Rausch aus Haut und Schweiß und Lust.
„Ich liebe Euch", flüsterte Elvira in der Hitze des Mittags, erschöpft und glücklich.
„Ich weiß", antwortete Don Juan, und in seinem Lächeln lag etwas, das Elvira nicht deuten konnte.
Drei Tage später heirateten sie in Córdoba, in einer kleinen Kirche, mit Sganarelle und der Wirtin als Zeugen. Elvira trug ein einfaches Kleid, das sie in einem Laden gekauft hatten, und Blumen im Haar. Don Juan sprach die Gelübde mit fester Stimme, und Elvira glaubte jedes Wort.
Das war vor drei Monaten gewesen.
Nun, auf einer Straße in Sizilien, mit dem Ätna in der Ferne, erinnerte sich Sganarelle an jene Zeit. Er hatte gesehen, wie Elvira vor Glück strahlte, wie sie Don Juan ansah mit Augen voller Anbetung. Und er hatte gesehen, wie dieses Strahlen langsam verblasste, wie Don Juan mehr und mehr Zeit außer Haus verbrachte, wie die Lüge brüchig wurde.
Elvira hatte nichts Böses getan. Ihr einziges Verbrechen war gewesen, zu lieben. Aber für Don Juan war Liebe keine Tugend, sondern eine Schwäche. Sobald eine Frau ihn liebte, verlor sie ihren Reiz. Die Jagd war vorbei, die Eroberung vollbracht.
„Denkst du an sie?" fragte Sganarelle, als sie durch einen Pinienwald wanderten.
Don Juan blickte auf, aus seinen Gedanken gerissen. „An wen?"
„An Elvira."
Ein Schatten huschte über Don Juans Gesicht, zu schnell, um ihn zu deuten. „Nein", sagte er dann. „Ich denke an die Zukunft. Die Vergangenheit ist tot."
Aber Sganarelle wusste es besser. Die Vergangenheit war nicht tot. Sie war unterwegs, in einem schwarzen Reisekleid, ihr Herz brennend vor Schmerz und Wut. Donna Elvira de Montemayor, die aus Liebe alles aufgegeben hatte, würde nicht einfach verschwinden.
Die Rechnung würde kommen. Es war nur eine Frage der Zeit.
Kapitel 3: Aufbruch in die Nacht
Die sizilianische Landschaft breitete sich vor ihnen aus wie ein Gemälde aus Licht und Schatten. Olivenhaine zogen sich die Hügel hinauf, Zypressen standen wie dunkle Wächter am Wegrand, und in der Ferne glitzerte das Meer – ein endloser blauer Teppich, der sich bis zum Horizont erstreckte. Die Luft war warm und trockenheitsgeschwängert, roch nach Thymian und Rosmarin und jener eigentümlichen Mischung aus Salz und Stein, die nur der Süden kennt.
Don Juan ritt voraus, sein Körper in perfekter Harmonie mit dem Pferd. Er saß im Sattel wie ein Mann, der überall zu Hause und nirgendwo gebunden war. Von Zeit zu Zeit wandte er den Kopf, als lausche er auf etwas, das nur er hören konnte – eine innere Musik vielleicht, oder die Stimme jener Dämonen, die ihn antrieben.
Sganarelle folgte in respektvollem Abstand, das Packpferd am Zügel. Seine Gedanken wanderten zwischen Sorge und jener merkwürdigen Resignation, die alle befiel, die Don Juan lange genug dienten. Man konnte diesen Mann nicht ändern, konnte ihn nicht zur Vernunft bringen. Man konnte nur zusehen und hoffen, dass der Sturm, in dessen Zentrum er lebte, einen selbst verschonte.
Gegen Mittag erreichten sie ein kleines Dorf, das sich an einen Berghang schmiegte. Weiße Häuser mit roten Ziegeldächern, eine kleine Kirche mit einem schiefen Turm, ein Brunnen auf dem Platz. Es war der typische sizilianische Ort – arm, stolz, vom Rest der Welt vergessen.
„Wir machen hier Rast", verkündete Don Juan und stieg ab. „Ich brauche Wein, und die Pferde brauchen Wasser."
Sie führten die Tiere zum Brunnen. Eine alte Frau, die dort ihre Wäsche wusch, betrachtete sie argwöhnisch. Fremde waren in diesen abgelegenen Dörfern selten und meist unwillkommen. Aber Don Juan schenkte ihr eines seiner Lächeln, und die Misstrauen schmolz wie Schnee in der Sonne.
„Guten Tag, Madonna", sagte er auf Italienisch, das er perfekt beherrschte. „Ein prächtiges Dorf habt Ihr hier. Gibt es eine Taverne, wo zwei müde Reisende sich stärken können?"
Die Alte zeigte mit knorrigem Finger auf ein Haus am Ende der Straße. „Dort. Bei Giuseppe. Aber sagt ihm nicht, dass ich Euch geschickt habe. Er schuldet mir noch Geld."
Don Juan lachte – jenes warme, aufrichtige Lachen, das eine seiner gefährlichsten Waffen war. „Euer Geheimnis ist bei mir sicher, Madonna. Aber erlaubt mir, Euch für Eure Freundlichkeit zu danken." Er zog eine Münze aus seinem Beutel, eine großzügige, und legte sie in ihre Hand.
Die Alte starrte auf das Geldstück, dann auf Don Juan, als könne sie nicht glauben, was geschah. „Gott segne Euch, Signore", murmelte sie.
„Gott hat genug zu tun", erwiderte Don Juan mit einem Augenzwinkern. „Segnet mich lieber selbst."
In der Taverne – einem niedrigen Raum mit rauchgeschwärzten Balken und dem Geruch von altem Wein – waren nur wenige Gäste. Ein paar Bauern, die stumm über ihren Bechern hockten, ein reisender Händler, der an einem Käse nagte. Der Wirt, Giuseppe, ein massiger Mann mit Schürze und misstrauischen Augen, kam auf sie zu.
„Was wollt Ihr?"
„Das Beste, was Ihr habt", sagte Don Juan und warf einige Münzen auf den Tisch. „Wein, Brot, Käse. Und wenn Ihr Fleisch habt, das nicht älter ist als eine Woche, würden wir auch das nehmen."
Das Geld wirkte Wunder. Giuseppes Gesicht hellte sich auf, und plötzlich war er ein freundlicher Gastgeber. „Setzt Euch, Signori! Ich bringe Euch unseren besten Rotwein – aus eigenen Trauben! Und meine Frau macht gerade Lamm mit Kräutern."
Sie setzten sich an einen Tisch am Fenster. Durch die schmutzigen Scheiben konnte man den Dorfplatz sehen, die Kirche, die wenigen Menschen, die ihre täglichen Verrichtungen nachgingen. Es war eine Welt, die Don Juan so fremd war wie der Mond – eine Welt der Routine, der Pflicht, des ewigen Gleichen.
„Wie kannst du es ertragen?" fragte er plötzlich und wandte sich an Sganarelle. „Dieses Leben. Tag für Tag dasselbe. Aufstehen, arbeiten, schlafen. Keine Überraschungen, keine Abenteuer. Nur das stumpfe Fortschreiten der Zeit bis zum Tod."
Sganarelle, der gerade einen großen Schluck Wein genommen hatte, verschluckte sich fast. „Herr", sagte er, nachdem er sich geräuspert hatte, „nicht jeder misst sein Leben an Abenteuern. Manche finden Glück in der Beständigkeit."
„Beständigkeit." Don Juan sprach das Wort aus, als schmecke es bitter. „Ein schönes Wort für Feigheit. Die Menschen klammern sich an ihre Routinen, weil sie Angst haben vor dem Leben. Vor der Freiheit."
„Freiheit?" Sganarelle schüttelte den Kopf. „Was Ihr Freiheit nennt, Herr, ist für andere Chaos. Ein Mann braucht Ordnung, Struktur. Er braucht zu wissen, wo er hingehört."
„Hingehören." Don Juan lachte bitter. „Noch so ein schönes Wort für Gefängnis. Der Mensch gehört nirgendwohin, Sganarelle. Er ist ein Wesen ohne Heimat, geworfen in eine Welt, die er sich nicht ausgesucht hat, ausgestattet mit einem Bewusstsein, das ihn dazu verdammt, seine eigene Bedeutungslosigkeit zu erkennen."
Der Wirt brachte das Essen – dampfendes Lammfleisch, frisches Brot, einen scharfen Ziegenkäse. Don Juan aß mit dem gleichen Hedonismus, mit dem er alles tat – als sei es das letzte Mahl seines Lebens.
„Ihr seid ein Philosoph, Herr", sagte Sganarelle vorsichtig. „Aber Eure Philosophie führt nur ins Verderben."
„Ins Verderben?" Don Juan wischte sich den Mund ab und lehnte sich zurück. „Oder zur Wahrheit? Sag mir, Sganarelle: Was ist besser – ein langes Leben in der Lüge oder ein kurzes in der Wahrheit?"
„Das hängt davon ab, was man für die Wahrheit hält."
„Die Wahrheit", Don Juan beugte sich vor, seine Augen brannten mit jener Intensität, die seine Gesprächspartner immer verunsicherte, „ist, dass wir geboren werden, ohne gefragt zu werden. Dass wir leben in einer Welt voller Regeln, die andere für uns gemacht haben. Dass wir leiden, lieben, hoffen – und am Ende sterben wir. Einfach so. Vorbei. Ausgelöscht. Alles, was wir waren, alles, was wir dachten und fühlten, verschwindet wie Rauch."
„Aber die Seele—" begann Sganarelle.
„Die Seele!" Don Juan lachte laut auf, sodass einige der anderen Gäste aufschauten. „Ein schönes Märchen, das die Priester erfunden haben, um die Massen zu kontrollieren. 'Sei brav', sagen sie, 'unterdrücke deine Wünsche, gehorche den Regeln, und nach dem Tod wartet das Paradies.' Aber was, wenn es kein Paradies gibt? Was, wenn der Tod einfach nur... das Ende ist?"
„Dann", sagte Sganarelle leise, „wäre das Leben sinnlos."
„Endlich!" Don Juan schlug auf den Tisch, dass die Becher klirrten. „Endlich verstehst du! Das Leben ist sinnlos. Es hat keine vorgegebene Bedeutung, keinen großen Plan. Und genau deshalb müssen wir ihm selbst einen Sinn geben. Indem wir leben – wirklich leben. Indem wir jeden Augenblick auskosten, jedes Vergnügen genießen, jede Erfahrung mitnehmen."
„Aber die anderen", wandte Sganarelle ein. „Die Menschen, die Ihr verletzt. Die Frauen, die Ihr betrügt. Zählen sie nicht?"