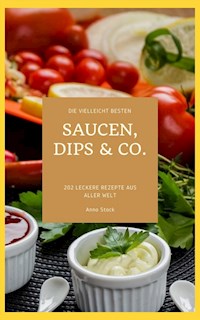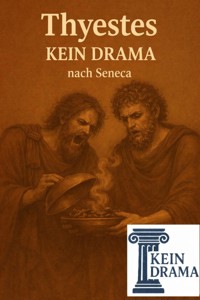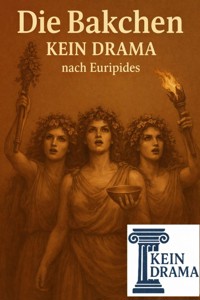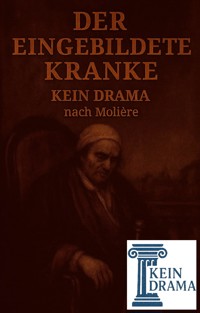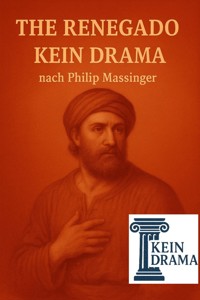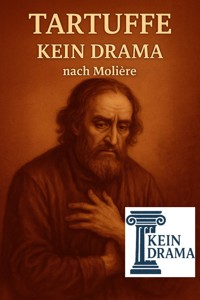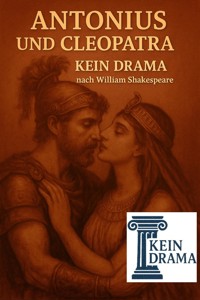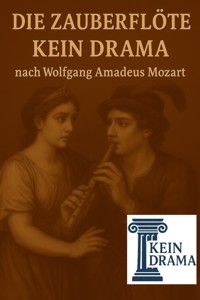6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Eine zeitlose Tragödie von Liebe, Schuld und SchicksalTroizen, Griechenland: Als die athenische Königin Phädra dem Stiefsohn ihres Mannes begegnet, bricht eine Welt zusammen. Hippolytos – jung, schön und der Göttin Artemis geweiht – verkörpert alles, wonach sich Phädras einsames Herz sehnt. Doch ihre Liebe ist unmöglich, verboten, verflucht.Während Phädra gegen ihre verzehrende Leidenschaft kämpft, ahnt sie nicht, dass sie nur die neueste in einer langen Reihe von Frauen ihrer Familie ist, die von den Göttern mit unheiliger Begierde geschlagen wurden. Der Fluch, der einst ihre Mutter Pasiphaë zum Minotaurus führte, holt nun auch sie ein.Hippolytos, zerrissen zwischen seiner Treue zum Vater und seinem eigenen Herzen – das heimlich der Gefangenen Aricia gehört – weist Phädras Avancen zurück. Doch seine Amme Oinone, verzweifelt ihre Herrin zu retten, spinnt ein Netz aus Lügen, das alle in den Abgrund reißen wird.Als König Theseus von seiner Reise zurückkehrt und die Anschuldigungen hört, ruft er in blindem Zorn den Gott Poseidon an – und setzt damit eine Tragödie in Gang, die keine Umkehr mehr kennt."Phädra" ist eine packende Neuerzählung der klassischen Tragödie nach Jean Racines Meisterwerk. Mit psychologischer Tiefe und atmosphärischer Sprachgewalt erweckt dieser über 110.000 Worte umfassende historische Roman die antike Welt zum Leben und zeigt, dass die großen Fragen der Menschheit – Liebe, Schuld, Vergebung – zeitlos sind.Ein episches Drama über: Die zerstörerische Macht verbotener Liebe Den Fluch, der über Generationen lastet Die Tragik menschlicher Fehler Die schwierige Suche nach Vergebung Die Grausamkeit der Götter – und der Menschen Für Leser:innen von Madeline Miller, Pat Barker und Natalie Haynes. Für alle, die große Gefühle, komplexe Charaktere und die zeitlose Faszination der griechischen Mythologie lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Phaedra - Kein Drama nach Jean Racine
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 2: Die Königin von Athen
Kapitel 3: Der Held und sein Sohn
Kapitel 4: Erste Begegnungen
Kapitel 5: Das Flüstern der Götter
Kapitel 6: Oinone, die Vertraute
Kapitel 7: Die verbotene Sehnsucht
Kapitel 8: Theseus' letzte Reise
Kapitel 9: Aricia, die Gefangene
Kapitel 10: Hippolytos' Herz
Kapitel 11: Nachricht aus der Unterwelt
Kapitel 12: Entfesselte Leidenschaft
Kapitel 13: Die Ablehnung
Kapitel 14: Oinones Plan
Kapitel 15: Die Rückkehr des Toten
Kapitel 16: Das Gift der Verleumdung
Kapitel 17: Der Zorn des Vaters
Kapitel 18: Phädras Schweigen
Kapitel 19: Der Fluch
Kapitel 20: Aricias Verzweiflung
Kapitel 21: Die letzte Jagd
Kapitel 22: Das Meeresungeheuer
Kapitel 23: Oinones Ende
Kapitel 24: Die Wahrheit ans Licht
Kapitel 25: Das Gift
Kapitel 26: Theseus' Vermächtnis
Kapitel 27: Epilog - Aricia
Impressum neobooks
Table of Contents
PHAEDRA
Ein Roman nach Jean Racine
Anno Stock
TEIL I: DIE SCHATTEN DER VERGANGENHEIT
Kapitel 1: Ankunft in Troizen
Die Sonne hing tief über dem Saronischen Golf, als die Galeere in den Hafen von Troizen einlief. Ihre purpurnen Segel, die das königliche Wappen Athens trugen, schimmerten golden im Abendlicht. Phädra stand am Bug des Schiffes, die Finger um die geschnitzte Reling gekrampft, und starrte auf die fremde Küste, die nun ihr Zuhause werden sollte.
Der Wind zerrte an ihrem dunklen Haar und brachte den Duft von Salz, Thymian und Pinien. Es war nicht der Geruch ihrer Heimat. Kreta roch anders – nach Zedernholz und wildem Jasmin, nach den großen Palästen von Knossos, nach ihrer Kindheit. Aber Kreta lag weit hinter ihr, und mit ihm alles, was sie einst gewesen war.
„Herrin, Ihr solltet Euch ausruhen." Oinone, ihre Amme, trat neben sie. Die alte Frau hatte die gesamte Überfahrt an Phädras Seite verbracht, still und wachsam wie immer. „Die Reise war beschwerlich, und Ihr seht blass aus."
„Mir fehlt nichts," erwiderte Phädra, ohne den Blick vom Land abzuwenden. Ihre Stimme klang dünn, selbst in ihren eigenen Ohren. „Ich bin nur müde."
Müde. Was für ein erbärmliches Wort für das, was sie fühlte. Diese Erschöpfung, die in ihren Knochen saß, hatte nichts mit der Seefahrt zu tun. Sie begleitete Phädra seit Monaten, seit Jahren vielleicht. Eine Schwere, die keine Nacht Schlaf lindern konnte, ein Schleier zwischen ihr und der Welt, der alles grau und fern erscheinen ließ.
Die Ruderer zogen die Riemen ein, und das Schiff glitt sanft an die Kaimauer. Hafenarbeiter eilten herbei, warfen Taue, riefen einander Befehle zu. Auf dem Kai hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt – Neugierige, die die Ankunft der athenischen Königin miterleben wollten. Phädra konnte ihre Blicke spüren, prüfend und erwartungsvoll.
Sie richtete sich auf, straffte die Schultern. Sie war die Tochter des Minos, des großen Königs von Kreta, und die Enkelin des Sonnengottes Helios. Sie war die Gattin des Theseus, des Bezwingers des Minotaurus, des Königs von Athen. Sie würde sich ihre Schwäche nicht anmerken lassen.
„Wo ist mein Gemahl?" fragte sie.
Oinone deutete zum Ende des Kais. „Dort, Herrin. Er spricht mit den örtlichen Beamten."
Theseus. Selbst aus der Entfernung war seine Gestalt unverkennbar – groß und breitschultrig, das dunkle Haar von grauen Strähnen durchzogen, die Haltung eines Mannes, der gewohnt war, dass die Welt sich vor ihm verbeugte. Er lachte über etwas, das einer der Männer gesagt hatte, ein kehlige Lachen, das über das Wasser hallte.
Phädra beobachtete ihn mit einer Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit, die sie selbst nicht ganz verstand. Zehn Jahre waren sie nun verheiratet. Zehn Jahre, in denen sie ihm zwei Söhne geschenkt, sein Haus verwaltet, seine Gäste bewirtet hatte. Zehn Jahre, in denen sie Seite an Seite existiert hatten, ohne sich je wirklich zu berühren.
Sie liebte ihn nicht. Diese Erkenntnis hatte keine Bitterkeit mehr, nur noch die stumpfe Gewissheit einer längst akzeptierten Tatsache. Theseus hatte nie ihre Liebe verlangt. Er hatte eine Ehefrau gebraucht, eine Königin, eine Mutter für seine Erben. All das war sie geworden. Mehr nicht.
„Die Gangway wird ausgelegt, Herrin," meldete einer der Matrosen.
Phädra nickte und wartete, bis die schweren Holzplanken gesichert waren. Dann schritt sie von Bord, Oinone dicht hinter ihr. Ihre Sandalen berührten den Stein des Kais, und zum ersten Mal seit Wochen stand sie wieder auf festem Grund. Troizen. Ihre neue Heimat, gewählt von Theseus, um der Pest zu entfliehen, die Athen heimsuchte.
Die Menge wich zurück und verneigte sich. Phädra schritt hindurch, den Blick geradeaus gerichtet, eine Hand locker an ihrem Gürtel. Sie hatte gelernt, wie eine Königin zu gehen – aufrecht, gemessen, als gehöre ihr die Erde, auf die sie trat.
„Phädra!" Theseus kam auf sie zu, die Arme ausgebreitet. Er küsste sie auf beide Wangen, eine förmliche Geste vor den Zuschauern. „Endlich. Die Überfahrt hat zu lange gedauert."
„Der Wind stand ungünstig," erwiderte sie.
„Natürlich." Er wandte sich bereits wieder den Beamten zu. „Das ist meine Gemahlin, Phädra, Tochter des Minos von Kreta. Ihr werdet ihr die gebührende Ehre erweisen."
Die Männer verneigten sich tiefer. Phädra schenkte ihnen ein knappes Nicken.
„Der Palast ist vorbereitet?" fragte Theseus.
„Ja, mein König. Alles ist bereit für Euren Empfang. Auch für den jungen Prinzen Hippolytos, der Euch bereits erwartet."
Bei diesem Namen zuckte etwas in Phädras Brust. Hippolytos. Theseus' erstgeborener Sohn aus seiner Verbindung mit der Amazone Antiope. Sie hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen, vor vielen Jahren in Athen, als er noch ein Kind gewesen war. Jetzt war er ein Mann, und er lebte hier, in Troizen, dem Land seiner Ahnen.
„Gut," sagte Theseus. „Führt uns zum Palast."
Die Straße vom Hafen hinauf zur Stadt wand sich steil den Hang hinauf. Phädra ging neben Theseus, während ihre Dienerschaft und das Gepäck ihnen folgten. Die Häuser von Troizen waren aus hellem Stein erbaut, ihre Dächer mit Terrakotta gedeckt. Überall blühten Bougainvilleen in leuchtendem Purpur und Rosa. Kinder rannten lachend durch die Gassen, und aus den Werkstätten drangen die Geräusche von Hämmern auf Metall.
„Eine schöne Stadt," bemerkte Phädra, mehr aus Höflichkeit denn aus echter Überzeugung.
„Bescheiden im Vergleich zu Athen," antwortete Theseus. „Aber Pittheus, mein Großvater, hat sie weise regiert, solange er lebte. Sein Erbe wird respektiert."
Sie passierten einen kleinen Tempel, dessen Säulen mit Weinlaub umrankt waren. Eine Priesterin stand auf den Stufen und streute Blütenblätter für die Götter.
„Aphrodite," murmelte Oinone hinter Phädra. „Die Göttin der Liebe wird hier verehrt."
Phädra verspürte einen unerklärlichen Schauder. Aphrodite. Die Göttin, die ihre Mutter Pasiphaë mit jenem unseligen Wahnsinn geschlagen hatte, der zum Fluch ihrer Familie geworden war. Die Göttin, vor der Phädra sich fürchtete, ohne genau zu wissen, warum.
„Komm," drängte Theseus. „Es ist nicht mehr weit."
Der Palast erhob sich am höchsten Punkt der Stadt, umgeben von Zypressen und Olivenhainen. Er war kleiner als der Palast in Athen, aber dennoch eindrucksvoll – ein Komplex aus weißem Marmor mit offenen Höfen und schattigen Säulengängen. Das Tor stand offen, und ein Trupp Wachen in bronzenen Rüstungen salutierte bei ihrem Anblick.
Im Innenhof erwartete sie ein Mann.
Phädra sah ihn zuerst nur als Silhouette gegen das Abendlicht – groß, schlank, mit einer Haltung, die sowohl anmutig als auch kraftvoll wirkte. Dann trat er vor, und das Licht fiel auf sein Gesicht.
Die Welt hielt den Atem an.
Es war, als hätte jemand die Zeit zurückgedreht und Theseus vor ihr erschaffen, wie er vor zwanzig Jahren gewesen sein musste. Dieselben ebenmäßigen Züge, dasselbe dunkle Haar, dieselbe stolze Haltung. Nur die Augen waren anders – grau wie ein Wintersturm, nicht braun wie die seines Vaters.
„Hippolytos," sagte Theseus, und seine Stimme schwoll an vor Stolz. „Mein Sohn."
Der junge Mann verneigte sich. „Vater. Willkommen in Troizen."
Seine Stimme war tief und klar, ohne jede Unsicherheit. Er war höchstens zwanzig Jahre alt, schätzte Phädra, aber er trug sich wie ein Mann, der seinen Platz in der Welt kannte.
„Und das," Theseus legte eine Hand auf Phädras Schulter, „ist meine Gemahlin, Königin Phädra. Deine Stiefmutter."
Hippolytos' Blick wanderte zu ihr. Für einen Herzschlag trafen sich ihre Augen, und Phädra spürte etwas Seltsames – ein Prickeln, als hätte sie zu nah an einem Feuer gestanden. Dann neigte er höflich den Kopf.
„Meine Königin. Es ist mir eine Ehre."
„Prinz Hippolytos." Ihre Stimme klang fremd in ihren eigenen Ohren, zu hoch, zu atemlos. Sie räusperte sich. „Die Freude ist ganz meinerseits."
Eine Lüge. Eine glatte, höfische Lüge. Aber was sollte sie sonst sagen? Dass sein Anblick sie erschüttert hatte? Dass etwas in ihr mit einer Gewalt erwacht war, die sie nicht benennen konnte?
„Hippolytos wird uns herumführen," verkündete Theseus. „Er kennt den Palast besser als jeder andere. Er hat hier die letzten Jahre verbracht."
„Gern, Vater." Hippolytos wandte sich wieder an Phädra. „Wenn Ihr mir folgen möchtet?"
Er ging voran, durch den Hof, unter einem Bogen hindurch, in einen weiteren Innenhof mit einem plätschernden Brunnen in der Mitte. Phädra folgte, Theseus an ihrer Seite, aber sie nahm kaum wahr, was Hippolytos über die Räume und ihre Geschichte erzählte. Ihre Augen hafteten an seiner Gestalt, an der Art, wie er sich bewegte – mit der geschmeidigen Kraft eines Jägers, eines Mannes, der in Wäldern und Bergen zu Hause war, nicht in Palästen.
„Die Gemächer der Königin sind hier," sagte Hippolytos und deutete auf eine Tür. „Sie wurden frisch hergerichtet. Ich hoffe, sie werden Euch gefallen."
„Ich bin sicher, sie werden wunderbar sein," murmelte Phädra.
Theseus trat vor und öffnete die Tür. „Prächtig! Sieh nur, Phädra – der Ausblick auf das Meer."
Sie zwang sich, einzutreten. Die Gemächer waren tatsächlich schön – luftig und hell, mit Wandmalereien von Delfinen und Nymphen. Durch die offenen Fenster wehte eine sanfte Brise.
„Ruht Euch aus," sagte Theseus. „Das Abendmahl wird in einer Stunde serviert. Wir werden im kleinen Speisesaal zusammenkommen."
„Ja," flüsterte Phädra. „Ich werde... ich werde mich frisch machen."
Theseus und Hippolytos verließen den Raum. Oinone schloss die Tür hinter ihnen und wandte sich zu Phädra um.
„Herrin? Ist alles in Ordnung?"
Phädra sank auf die Kante des Bettes. Ihre Hände zitterten. Sie faltete sie im Schoß, drückte sie zusammen, bis die Knöchel weiß hervortraten.
„Mir ist nur schwindlig," sagte sie. „Die Reise..."
„Legt Euch hin. Ich werde kühles Wasser holen."
Oinone eilte davon. Phädra blieb allein zurück, in der Stille der fremden Gemächer. Sie schloss die Augen, aber das Bild blieb – Hippolytos, wie er im Licht gestanden hatte, jung und strahlend und unerreichbar schön.
„Nein," flüsterte sie ins Leere. „Nein, nein, nein."
Aber die Götter hörten nicht auf ihre Gebete. Sie hatten noch nie auf sie gehört.
Das Abendmahl war eine förmliche Angelegenheit. Der kleine Speisesaal war in Wahrheit ein prächtiger Raum mit Säulen aus grünem Marmor und einem Mosaikboden, der Poseidon auf seinem Streitwagen zeigte. Theseus lag auf dem Hauptsofa, Phädra zu seiner Rechten, Hippolytos zu seiner Linken. Diener trugen Platten mit gebratenem Fisch, Lammfleisch, Oliven und frischem Brot herein.
Theseus war in bester Stimmung. Er erzählte von seinen Plänen für Troizen, von den Tempeln, die er restaurieren wollte, von den Jagden, die er organisieren würde. Hippolytos antwortete höflich, aber zurückhaltend. Er aß wenig und trank noch weniger.
Phädra saß stumm dabei. Sie schob das Essen auf ihrem Teller hin und her, brachte aber kaum einen Bissen hinunter. Jedes Mal, wenn sie aufblickte, drohte ihr Blick zu Hippolytos zu wandern, und jedes Mal riss sie sich gewaltsam davon los.
„Du bist still, meine Liebe," bemerkte Theseus irgendwann. „Fühlst du dich unwohl?"
„Nur erschöpft," erwiderte sie. Es war bereits die dritte Lüge an diesem Tag. Sie verlor die Zählung.
„Dann solltest du dich zurückziehen. Hippolytos, begleite deine Stiefmutter zu ihren Gemächern."
„Nein!" Das Wort kam zu scharf, zu laut. Alle Augen richteten sich auf sie. Phädra zwang sich zu einem Lächeln. „Das ist nicht nötig. Oinone wartet bereits auf mich. Ich kenne den Weg."
„Wie du meinst." Theseus wandte sich bereits wieder seinem Wein zu.
Phädra stand auf, verneigte sich knapp und verließ den Speisesaal. Ihre Schritte hallten durch die leeren Gänge. Sie ging schneller, dann noch schneller, bis sie fast rannte. Als sie ihre Gemächer erreichte, schlug sie die Tür hinter sich zu und lehnte sich dagegen, keuchend, das Herz rasend in ihrer Brust.
„Herrin!" Oinone eilte herbei. „Was ist geschehen?"
„Nichts. Alles. Ich weiß es nicht." Phädra presste die Hände gegen ihr Gesicht. „Oinone, ich... ich kann nicht..."
„Was könnt Ihr nicht? Sprecht zu mir."
Aber Phädra schüttelte nur den Kopf. Wie sollte sie es in Worte fassen? Dieses Gefühl, das sie überfallen hatte, als sie Hippolytos zum ersten Mal gesehen hatte – diese plötzliche, vernichtende Erkenntnis, dass etwas in ihr erwacht war, das sie nicht kontrollieren konnte. Es hatte keinen Namen, noch nicht, aber es war da, dunkel und hungrig, und es erschreckte sie mehr als alles, was sie je erlebt hatte.
„Helft mir aus diesem Kleid," flüsterte sie schließlich. „Ich will schlafen. Vielleicht... vielleicht geht es mir morgen besser."
Oinone half ihr schweigend. Als Phädra schließlich allein in ihrem Bett lag, die Vorhänge zugezogen, starrte sie in die Dunkelheit und wartete auf den Schlaf, der nicht kommen wollte.
Draußen, über dem Meer, gingen die Sterne auf. Und in ihrem Tempel lächelte Aphrodite.
Kapitel 2: Die Königin von Athen
Phädra schlief nicht.
Sie lag wach, während die Nacht sich über Troizen senkte und der Mond langsam über den Himmel wanderte. Durch die offenen Fenster drang das ferne Rauschen des Meeres, ein endloses, gleichförmiges Flüstern, das sie an Kreta erinnerte. An ihre Kindheit. An alles, was sie zu vergessen versucht hatte.
Die Erinnerungen kamen wie Wellen, unaufhaltsam.
Sie war fünf Jahre alt gewesen, als sie zum ersten Mal verstand, dass ihre Familie verflucht war.
Es war ein heißer Sommertag in Knossos, und die Dienerin, die sie hätte beaufsichtigen sollen, war eingenickt. Phädra, neugierig und unruhig wie alle Kinder, war durch die weitläufigen Gänge des Palastes gewandert, vorbei an Wandgemälden von Stieren und Tänzerinnen, durch Höfe mit Säulen, die wie Baumstämme bemalt waren. Schließlich hatte sie sich verirrt – oder vielleicht hatte etwas sie geführt, eine unsichtbare Hand, die sie dorthin lenkte, wo sie nicht sein sollte.
Sie fand sich vor einer Tür wieder, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie war aus schwerem Bronze, und auf ihr prangte das Symbol des Labyrinths, jene verschlungenen Linien, die überall in Knossos zu finden waren. Phädra hatte die Tür aufgestoßen – sie war überraschend leicht gegangen – und war eine Treppe hinabgestiegen, tiefer und tiefer, bis die Luft kühl und feucht wurde und nach Erde roch.
Unten, in einem Gewölbe, das von Fackeln erhellt wurde, hatte sie ihre Mutter gefunden.
Pasiphaë, die Königin von Kreta, stand vor einem Altar, auf dem ein totes Lamm lag. Ihre Hände waren blutverschmiert, und sie murmelte Worte in einer Sprache, die Phädra nicht verstand. Neben dem Altar stand etwas, das aussah wie ein großes Holzgestell, bedeckt mit weißem Fell. Es dauerte einen Moment, bis Phädra erkannte, dass es die Form einer Kuh hatte.
„Mutter?" hatte sie geflüstert.
Pasiphaë hatte sich umgedreht, und in ihren Augen war etwas gewesen, das Phädra erschreckt hatte – eine wilde Verzweiflung, ein Hunger, der nicht von dieser Welt war.
„Phädra. Du solltest nicht hier sein."
„Was machst du?"
„Ich... ich bete zu den Göttern." Aber ihre Stimme hatte gezittert, und Phädra hatte gewusst, dass es eine Lüge war.
Später, viel später, hatte sie die Wahrheit erfahren. Ihre Mutter war von Aphrodite verflucht worden, geschlagen mit einer unnatürlichen Leidenschaft für den weißen Stier, den Poseidon ihrem Vater Minos geschenkt hatte. Der Handwerker Daedalus hatte die hölzerne Kuh gebaut, damit Pasiphaë ihre grauenhafte Begierde stillen konnte. Und aus dieser Vereinigung war ein Monster geboren worden – der Minotaurus, halb Mensch, halb Stier, Phädras Halbbruder.
Minos hatte das Ungeheuer tief unter dem Palast im Labyrinth eingesperrt. Dort lebte es, ernährte sich von den Tributen, die Athen senden musste – sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen, alle neun Jahre. Dort lebte es, bis Theseus kam und es tötete.
Phädra erinnerte sich an den Tag, als die Nachricht eintraf. Sie war zwölf gewesen. Ihr Vater hatte getobt, Vasen gegen die Wände geschleudert, Diener angeschrien. Ihre Schwester Ariadne war verschwunden – geflohen mit dem Helden aus Athen, der den Minotaurus erschlagen hatte.
Theseus.
Damals hatte Phädra ihn gehasst. Er hatte ihr Ungeheuer getötet – ja, ein Ungeheuer, aber ihr Blut dennoch. Er hatte ihre Schwester verführt und dann auf der Insel Naxos zurückgelassen, als wäre sie weniger wert als Ballast auf einem Schiff. Ariadne, die schöne, kluge Ariadne, die Phädra Geschichten erzählt und ihr Haar geflochten hatte.
„Er ist ein Schurke," hatte Phädra zu ihrer Mutter gesagt. „Ein Verräter."
Pasiphaë hatte nur gelacht, ein bitteres, hohles Lachen. „Er ist ein Mann, meine Tochter. Das ist alles, was du wissen musst."
Phädra wälzte sich auf die Seite und starrte durch die Vorhänge auf das schwache Mondlicht. In ihren Gemächern war es still, nur Oinones gleichmäßiges Atmen aus der Nebenkammer war zu hören.
Drei Jahre nach Ariadnes Verschwinden war Minos gestorben – erstochen von Daedalus' Tochter in Sizilien, wohin er den Handwerker verfolgt hatte. Phädras Brüder hatten um die Macht gekämpft, und Kreta war in Unruhe versunken. Pasiphaë, längst dem Wahnsinn verfallen, war in ihre Gemächer zurückgezogen und kam kaum noch hervor.
Phädra, gerade fünfzehn Jahre alt, war allein gewesen. Keine Eltern, keine Schwester, keine Zukunft. Nur der Fluch, der über ihrer Familie lag wie ein dunkler Schatten.
Dann war die Botschaft aus Athen gekommen.
Sie erinnerte sich an den Tag, als hätte sie ihn erst gestern erlebt. Sie hatte im Garten gesessen, unter einem Feigenbaum, und versucht, die Tränen zurückzuhalten, als ihr ältester Bruder ihr mitteilte, was beschlossen worden war.
„Theseus von Athen hat um deine Hand angehalten."
Phädra hatte ihn angestarrt, unfähig zu begreifen. „Der Mann, der Ariadne entführt hat?"
„Derselbe. Er sucht eine neue Gemahlin. Seine erste Frau, die Amazone, ist tot. Er braucht eine Königin, die ihm legitime Erben schenken kann." Ihr Bruder hatte mit den Schultern gezuckt. „Es ist eine politische Verbindung. Athen und Kreta werden Frieden schließen. Unsere Handelsrouten werden gesichert sein."
„Aber er hat unsere Schwester verraten!"
„Ariadne hat ihn verraten, indem sie dem Feind half, unseren... das Wesen im Labyrinth zu töten." Ihr Bruder hatte das Wort „Bruder" nicht aussprechen können. Niemand sprach je vom Minotaurus als Teil der Familie. „Sie hat bekommen, was sie verdiente. Du wirst klüger sein."
„Ich will ihn nicht heiraten."
„Was du willst, ist belanglos. Die Entscheidung ist gefallen."
Phädra hatte um Hilfe gefleht – zu den Göttern, zu ihrer Mutter, zu jedem, der zuhören mochte. Aber Pasiphaë war nicht mehr bei klarem Verstand, und die Götter schwiegen, wie sie immer schwiegen, wenn man sie am dringendsten brauchte.
Sechs Wochen später war sie auf ein Schiff gesetzt und nach Athen gebracht worden. Oinone, ihre Amme seit Kindertagen, war mit ihr gekommen – die einzige Konstante in einer Welt, die sich zu schnell drehte.
Die Hochzeit war prächtig gewesen. Ganz Athen hatte gefeiert. Theseus, der strahlende Held, der Bezwinger von Monstern, der König, der die Stadt zur Größe geführt hatte, nahm sich eine neue Braut. Die Tempel waren mit Blumen geschmückt worden, die Altäre rauchten von Opfern, Wein floss in Strömen.
Phädra hatte neben ihm gestanden in einem Gewand aus feinstem Leinen, bestickt mit Gold, eine Krone aus Lorbeer auf dem Haar. Sie hatte gelächelt, als man es von ihr erwartete, hatte die Rituale durchlaufen, hatte die Glückwünsche entgegengenommen.
Und in der Hochzeitsnacht, in dem großen Bett im königlichen Gemach, hatte Theseus sie zur Frau gemacht.
Es war nicht brutal gewesen, aber auch nicht zärtlich. Theseus hatte seine Pflicht erfüllt, effizient und zielstrebig, wie er alles tat. Danach war er eingeschlafen, einen Arm über ihre Taille gelegt, und hatte geschnarcht.
Phädra hatte wach gelegen, genau wie jetzt, und sich gefragt, ob das alles war, was das Leben für sie bereithielt.
Die ersten Jahre in Athen waren erträglich gewesen. Theseus war oft abwesend – auf Jagd, auf Reisen, auf Feldzügen. Phädra hatte den Haushalt geführt, hatte gelernt, wie man mit Dienern umging, wie man Feste ausrichtete, wie man die komplexen politischen Allianzen der Stadt navigierte. Sie hatte zwei Söhne geboren – Akamas und Demophon – und damit ihre Hauptpflicht als Königin erfüllt.
Ihre Söhne liebte sie. Ganz und gar, mit einer Intensität, die sie überraschte. Wenn sie ihre kleinen Körper in den Armen hielt, ihr Lachen hörte, ihre ersten Worte miterleben durfte, fühlte sie so etwas wie Glück. Vielleicht war das genug. Vielleicht konnte sie in der Mutterschaft finden, was ihr als Ehefrau verwehrt blieb.
Aber die Kinder wuchsen heran, brauchten Ammen und Tutoren und ihre eigene Welt. Und Phädra blieb zurück, in der Leere ihres prächtigen Lebens, umgeben von Luxus und Ehre und einer Einsamkeit, die tiefer ging als jeder Ozean.
Sie versuchte, sich zu beschäftigen. Sie lernte Musik, Weberei, die Kunst der Heilkräuter. Sie besuchte die Tempel, brachte Opfer dar, betete zu den Göttern – zu Hera für die Ehe, zu Artemis für ihre Söhne, zu Athene für Weisheit.
Nur zu Aphrodite betete sie nie. Die Göttin der Liebe hatte ihre Mutter zerstört. Phädra wollte nichts mit ihr zu tun haben.
Dann kam die Pest.
Es begann mit vereinzelten Fällen in den Armenvierteln – Fieber, Husten, dunkle Flecken auf der Haut. Innerhalb von Wochen hatte sich die Seuche über ganz Athen ausgebreitet. Die Straßen waren erfüllt vom Gestank brennender Leichen, vom Klagen der Trauernden. Die Tempel waren überfüllt mit Menschen, die die Götter um Gnade anflehten.
Theseus berief seine Ratgeber ein. Die Priester deuteten Zeichen, befragten Orakel. Schließlich kam der Beschluss: Der König und seine Familie sollten Athen verlassen, sich in Sicherheit bringen. Troizen, das Land von Theseus' Großvater, bot sich an – weit genug von der Seuche, aber immer noch Teil seines Königreichs.
„Wir brechen in drei Tagen auf," hatte Theseus verkündet. „Pack das Nötigste. Wir bleiben, bis die Pest vorüber ist."
Phädra hatte genickt, erleichtert, der todgeweihten Stadt zu entkommen. Sie hatte nicht gewusst, dass sie aus einer Gefahr in eine andere floh.
Ein Geräusch riss Phädra aus ihren Gedanken. Schritte im Gang draußen, leicht und schnell. Dann Stille.
Sie setzte sich auf, das Herz plötzlich klopfend. War das Hippolytos gewesen? Ging er nachts durch den Palast? Konnte auch er nicht schlafen?
„Hör auf," flüsterte sie sich selbst zu. „Hör auf, an ihn zu denken."
Aber es war zu spät. Seit dem Moment, als sie ihn gesehen hatte, drehten sich ihre Gedanken nur noch um ihn. Sein Gesicht, seine Stimme, die Art, wie er sich bewegte. Er war wie ein Dorn unter ihrer Haut, klein, aber schmerzhaft, unmöglich zu ignorieren.
Sie kannte ihn nicht. Sie hatte kaum ein Dutzend Worte mit ihm gewechselt. Und doch...
„Es ist nur, weil er jung ist," sagte sie laut in die Dunkelheit. „Weil er Theseus ähnelt, wie er einst war. Das ist alles. Es bedeutet nichts."
Aber auch das war eine Lüge, und sie wusste es.
Als der Morgen graute, rosa und golden über dem Meer, gab Phädra den Kampf gegen den Schlaf auf. Sie stand auf, wusch sich das Gesicht mit kaltem Wasser, kämmte ihr Haar. Ihr Spiegelbild im polierten Bronze zeigte eine blasse Frau mit dunklen Schatten unter den Augen.
Sie war dreißig Jahre alt. Nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Die Blüte ihrer Schönheit war vorüber, aber sie war noch immer ansehnlich, das wusste sie. Ihr Haar war dicht und dunkel, ihre Figur nach zwei Geburten noch immer schlank, ihre Haut glatt.
„Was denkst du da?" flüsterte sie ihrem Spiegelbild zu. „Was hoffst du?"
Das Spiegelbild gab keine Antwort.
Oinone kam herein, die Arme voller frischer Gewänder. „Ihr seid früh wach, Herrin. Habt Ihr gut geschlafen?"
„Nein," sagte Phädra schlicht. „Ich habe die ganze Nacht wach gelegen."
„Dann solltet Ihr Euch heute ausruhen. Ich werde dem König sagen—"
„Nein." Phädra drehte sich abrupt um. „Ich bin nicht krank. Ich bin nur... unruhig in der neuen Umgebung. Das wird vergehen."
Oinone musterte sie mit jenem durchdringenden Blick, den nur Ammen beherrschen – ein Blick, der durch alle Lügen hindurchsah, der jedes Geheimnis kannte, bevor es ausgesprochen wurde. Sie hatte Phädra als Baby in den Armen gehalten, hatte ihre ersten Schritte gesehen, ihre ersten Tränen getrocknet. Sie wusste, wenn etwas nicht stimmte.
„Herrin," sagte sie leise. „Was quält Euch?"
„Nichts. Alles. Ich weiß es nicht." Phädra sank auf einen Stuhl, plötzlich erschöpft. „Oinone, kennst du die Geschichten über meine Familie? Über meine Mutter?"
„Ja, Herrin."
„Glaubst du, dass Flüche real sind? Dass sie von Generation zu Generation weitergegeben werden können?"
Oinone schwieg einen Moment. Dann kniete sie sich vor Phädra hin und ergriff ihre Hände. „Was auch immer Eure Mutter getan hat, Ihr seid nicht sie. Ihr habt die Wahl. Ihr habt immer die Wahl."
„Und wenn ich falsch wähle?"
„Dann werdet Ihr lernen. So wie wir alle."
Phädra wünschte, sie könnte das glauben. Aber in ihrer Brust, dort wo ihr Herz schlagen sollte, fühlte sie nur Angst.
Die Schatten ihrer Vergangenheit waren lang, und sie reichten bis hierher, nach Troizen, in diese sonnendurchfluteten Gemächer. Sie konnte vor ihnen fliehen, so weit sie wollte – sie würden sie immer einholen.
Sie war die Tochter der Pasiphaë, die Enkelin des Helios, die Schwester des Monsters.
Und die Götter, die ihre Familie verflucht hatten, waren noch nicht mit ihr fertig.
Kapitel 3: Der Held und sein Sohn
Der Morgen brach über den Bergen an, und Hippolytos war bereits wach.
Er hatte die Nacht auf der Terrasse seiner Gemächer verbracht, auf einem einfachen Lager aus Fellen, den Sternenhimmel über sich. Die Diener hatten ihm ein prächtiges Bett mit seidenen Laken bereitet, aber er fühlte sich darin gefangen, als würde er in einem Sarkophag liegen. Er zog die Härte des Bodens vor, die kühle Nachtluft, die ihn daran erinnerte, dass er lebendig war.
Jetzt stand er auf, streckte seine Glieder und atmete tief die Morgenluft ein. Von hier oben konnte er das ganze Tal sehen – Troizen, das sich am Hang ausbreitete, den Hafen unten mit seinen Schiffen, und dahinter das endlose Blau des Meeres. Im Osten ragten die Berge auf, dunkel und geheimnisvoll, dort, wo die Wälder begannen.
Seine Heimat.
Hippolytos spürte den Drang, loszulaufen, in die Berge zu fliehen, zu den Quellen und Höhlen, die nur er kannte. Dort fühlte er sich frei. Dort war er er selbst, nicht der Sohn des Theseus, nicht der Prinz, nicht der Außenseiter, der nie richtig dazugehörte.
Aber sein Vater war angekommen, und mit ihm Pflichten, die Hippolytos nicht ignorieren konnte.
Er seufzte, griff nach seinem Bogen und Köcher – die Waffen, die er nie weit von sich ließ – und machte sich auf den Weg hinunter zu den Stallungen. Wenigstens einen kurzen Ritt konnte er sich gönnen, bevor der Tag ihn gefangen nahm.
Die Stallungen lagen am westlichen Ende des Palastkomplexes, ein langes, niedriges Gebäude aus Stein und Holz. Der Geruch von Heu und Pferden empfing ihn, vertraut und beruhigend. Die Tiere wieherten zur Begrüßung, und Hippolytos lächelte – ein seltenes, echtes Lächeln.
Sein Hengst, ein prächtiges schwarzes Tier namens Xanthos, stieß mit der Nase gegen seine Schulter. Hippolytos streichelte den warmen Hals, fühlte die Kraft, die unter der glatten Haut spielte.
„Guten Morgen, alter Freund. Bereit für einen Lauf?"
Das Pferd schnaubte, als würde es zustimmen.
„Früh auf den Beinen, wie immer."
Hippolytos drehte sich um. In der Tür stand Autolykos, der Stallmeister, ein Mann mit wettergegebenem Gesicht und Händen, die so rau wie Baumrinde waren. Er hatte Hippolytos das Reiten beigebracht, als der Junge noch so klein war, dass er aufs Pferd gehoben werden musste.
„Die Gewohnheiten von Jahren lassen sich schwer ablegen," erwiderte Hippolytos.
„Euer Vater sucht Euch. Er hat nach Euch gefragt beim Frühstück."
„Ich weiß. Ich wollte nur... einen kurzen Ritt. Um den Kopf freizubekommen."
Autolykos nickte wissend. „Geht. Ich werde ihm sagen, dass Ihr bald zurück seid."
Hippolytos sattelte Xanthos selbst – er mochte es nicht, wenn andere seine Ausrüstung anfassten – und schwang sich in den Sattel. Das Pferd tänzelte, ungeduldig wie sein Reiter.
Sie ritten durch das Tor, hinaus aus dem Palastgelände, den Hang hinauf zu den Olivenhainen. Als sie die Baumgrenze erreichten, gab Hippolytos Xanthos die Sporen, und das Tier schoss davon, ein schwarzer Blitz zwischen den silbergrünen Bäumen.
Der Wind peitschte Hippolytos ins Gesicht, riss an seinem Haar, und für einen Moment fühlte er sich schwerelos, frei von allem – von seinem Namen, seiner Herkunft, von den Erwartungen, die wie Ketten an ihm hingen.
Aber die Freiheit dauerte nie lange.
Als er zum Palast zurückkehrte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Schweiß klebte ihm am Rücken, und Xanthos war schaumbedeckt, aber beide waren zufrieden. Hippolytos übergab das Pferd an einen Stallburschen mit strikten Anweisungen zur Pflege und machte sich auf den Weg zu den Hauptgemächern.
Er fand Theseus im großen Saal, wo er Karten studierte und mit mehreren Ratgebern sprach. Als Hippolytos eintrat, blickte sein Vater auf.
„Ah, endlich. Wo warst du?"
„Reiten, Vater. Autolykos wird es dir bestätigt haben."
„Reiten." Theseus schüttelte den Kopf. „Du verbringst mehr Zeit mit Pferden als mit Menschen."
„Pferde enttäuschen einen nicht," erwiderte Hippolytos, ehe er sich bremsen konnte.
Die Ratgeber wechselten unbehagliche Blicke. Theseus' Kiefer spannte sich an, aber er zwang sich zu einem Lächeln.
„Lasst uns allein," sagte er zu den Männern. Sie verbeugten sich und verließen eilig den Raum.
Vater und Sohn standen einander gegenüber, getrennt durch die Länge des Saals und eine Kluft, die tiefer war als jeder Ozean.
Theseus war zweiundfünfzig Jahre alt, aber er war immer noch imposant – groß, muskulös, mit der Aura eines Mannes, der gewohnt war, zu siegen. Die Jahre hatten sein Gesicht mit Falten versehen, sein Haar mit Grau durchzogen, aber nichts von seiner Kraft genommen. Er war eine Legende, und er wusste es.
Hippolytos war ganz anders. Schlanker, beweglicher, mit der ruhigen Intensität eines Raubtieres. Wo Theseus die Welt mit Lärm und Pracht betrat, kam Hippolytos leise, beobachtete erst, handelte dann.
„Setz dich," sagte Theseus und deutete auf einen Stuhl.
Hippolytos blieb stehen. „Ich stehe lieber."
Ein Seufzer. „Wie du willst. Hippolytos, wir müssen reden."
„Worüber?"
„Über deine Zukunft. Du bist zwanzig Jahre alt. Es ist Zeit, dass du erwachsen wirst."
„Ich bin erwachsen."
„Bist du das?" Theseus verschränkte die Arme. „Du lebst hier wie ein Wilder, jagst in den Bergen, schläfst auf dem Boden, meidest den Hof. Das ist nicht das Leben eines Prinzen."
„Ich bin der Sohn einer Amazone," sagte Hippolytos ruhig. „Das Leben am Hof liegt mir nicht im Blut."
„Du bist auch mein Sohn. Und damit Teil einer Dynastie. Du hast Verantwortung."
„Verantwortung wofür? Ich bin nicht dein Erbe. Deine Söhne mit Phädra werden Athen erben. Ich bin nur... eine Erinnerung an eine frühere Zeit."
Die Worte hingen in der Luft, scharf wie Klingen. Theseus' Gesicht verdunkelte sich.
„Rede nicht so. Du bist mein erstgeborener Sohn. Du hast einen Platz, eine Rolle."
„Welche Rolle? Die des Bastards, der bei Festen vorgezeigt wird, damit alle sich an deinen Ruhm erinnern? Der Sohn des Helden und der besiegten Kriegerin?"
„Deine Mutter war keine besiegte Kriegerin. Sie war eine königliche Amazone, und ich habe sie geliebt."
„Hast du?" Die Frage kam leise, aber sie traf.
Theseus wandte sich ab, trat ans Fenster. Einen langen Moment sagte er nichts. Dann, fast zu leise, um gehört zu werden: „Ja. Auf meine Art."
Hippolytos erinnerte sich kaum an seine Mutter.
Er war drei Jahre alt gewesen, als Antiope starb. Was er von ihr wusste, stammte aus den Geschichten anderer – Diener, die dabei gewesen waren, Soldaten, die unter ihr gedient hatten, und die spärlichen, widerwilligen Berichte seines Vaters.
Antiope war nach Athen gekommen als Kriegerin und Gesandte ihres Volkes, der Amazonen von Themiskyra. Theseus, damals auf dem Höhepunkt seiner Macht, hatte sich in sie verliebt – oder vielleicht war es nur Begierde gewesen, das wusste niemand genau. Sie hatten keine formale Ehe geschlossen, denn Amazonen heirateten nicht nach griechischer Sitte. Aber sie hatten zusammengelebt, und aus ihrer Verbindung war Hippolytos geboren worden.
Die Athener hatten Antiope nie akzeptiert. Eine Barbarin, sagten sie, eine Frau, die mit Waffen umging wie ein Mann, die ihre Götter nicht verehrte, die sich weigerte, sich zu unterwerfen. Als andere Amazonen nach Athen kamen, um ihre Schwester zurückzufordern, war es zur Schlacht gekommen.
Antiope war in dieser Schlacht gefallen, getötet durch einen verirrten Speer – niemand wusste, von welcher Seite. Manche sagten, es waren die Amazonen gewesen, die sie als Verräterin betrachteten. Andere behaupteten, ein athenischer Soldat habe im Chaos der Schlacht nicht erkannt, wen er traf. Und es gab Gerüchte, dunkle Gerüchte, dass Theseus selbst...
Aber das glaubte Hippolytos nicht. Sein Vater mochte vieles sein – stolz, manchmal grausam, oft blind für alles außer seinem eigenen Ruhm. Aber er hatte Antiope nicht getötet. Daran musste Hippolytos glauben, sonst würde der Hass ihn zerfressen.
Nach Antiopes Tod hatte Theseus seinen Sohn nach Troizen geschickt, in die Obhut der Familie seines Großvaters. Offiziell hieß es, die Luft hier sei besser für das Kind, die Umgebung ruhiger. In Wahrheit wusste Hippolytos, dass sein Vater ihn loswerden wollte. Er war eine Erinnerung an Antiope, an Theseus' Fehler, an eine Zeit, die der König lieber vergessen wollte.
Also wuchs Hippolytos hier auf, in Troizen, fern von Athen, fern von seinem Vater. Er wurde von Tutoren unterrichtet, lernte die Künste eines Prinzen – Lesen, Schreiben, Rhetorik, Musik. Aber sein wahres Zuhause waren die Berge. Dort jagte er mit Pfeil und Bogen, dort schlief er unter den Sternen, dort baute er kleine Schreine für Artemis, die Göttin der Jagd, die einzige Gottheit, zu der er Verbindung fühlte.
Artemis, die Jungfrau, die Jägerin, die die Männer verachtete und in der Wildnis lebte. Sie verstand ihn. Sie verlangte keine falschen Höflichkeiten, keine politischen Spiele. Sie verlangte nur Respekt für die Natur und ein reines Herz.
Hippolytos hatte ihr geschworen, dass er niemals eine Frau berühren würde. Er würde keusch bleiben, wie die Priester der Göttin, wie die Jäger, die ihr dienten. Er brauchte keine Liebe, keine Leidenschaft. Das waren die Dinge, die Männer schwach machten, die sie zu Narren machten.
Er hatte gesehen, was Liebe anrichtete. Die Geschichten waren voll davon – Helden, die für eine Frau in den Untergang liefen, Königreiche, die wegen einer Schönheit brannten. Sein eigener Vater hatte wegen seiner Begierden Unheil über sich und andere gebracht.
Nein. Hippolytos würde diesen Weg nicht gehen.
„Ich habe nicht vor, dich zu enttäuschen, Vater," sagte er schließlich, als die Stille zu lang wurde. „Aber ich kann nicht sein, was du willst. Ich bin nicht du."
Theseus drehte sich wieder zu ihm um. „Das verlange ich nicht. Ich verlange nur, dass du deine Position akzeptierst. Du könntest ein großer Mann werden, Hippolytos. Ein Anführer. Du hast das Talent, die Intelligenz. Aber du versteckst dich in den Wäldern wie ein verängstigter Junge."
„Ich verstecke mich nicht. Ich lebe, wie es mir entspricht."
„Und Phädra?" Theseus' Ton änderte sich, wurde weicher. „Was hältst du von ihr?"
Die Frage kam unerwartet. Hippolytos zögerte. „Sie ist... deine Gemahlin. Meine Königin."
„Das ist keine Antwort."
„Was willst du hören?"
„Die Wahrheit. Sie wird hier leben, während wir in Troizen sind. Ihr werdet einander häufig begegnen. Ich möchte, dass ihr euch gut versteht."
Hippolytos dachte an die Frau, die gestern angekommen war. Er hatte sie nur kurz gesehen, hatte kaum mit ihr gesprochen. Aber er hatte bemerkt, wie blass sie war, wie erschöpft. Und er hatte den Blick gesehen, den sie ihm zugeworfen hatte – schnell, verstohlen, dann sofort weggedreht.
„Ich werde respektvoll sein," sagte er. „Mehr kann ich nicht versprechen."
Theseus seufzte. „Du machst es einem nicht leicht, dich zu lieben, mein Sohn."
„Liebe mich nicht. Respektiere mich. Das würde genügen."
Damit drehte sich Hippolytos um und verließ den Saal. Er spürte den Blick seines Vaters im Rücken, schwer und enttäuscht, aber er sah sich nicht um.
Den Rest des Tages verbrachte Hippolytos damit, seine Pflichten zu erfüllen – er sprach mit den Verwaltern über die Vorräte, inspizierte die Wachen, kümmerte sich um administrative Kleinigkeiten, die in Troizen anfielen. Es war langweilig, zermürbend, aber notwendig. Wenn er schon hier leben musste, dann würde er es richtig tun.
Gegen Abend zog er sich in den kleinen Tempel der Artemis zurück, der außerhalb der Stadtmauern auf einer Anhöhe stand. Es war ein bescheidener Ort, nur eine offene Säulenhalle mit einem Altar in der Mitte, aber Hippolytos liebte ihn. Hier, umgeben von Zypressen und dem Gesang der Zikaden, fand er Frieden.
Er kniete vor dem Altar nieder, auf dem eine kleine Statue der Göttin stand – Artemis mit Bogen und Köcher, eine Hirschkuh zu ihren Füßen. Hippolytos hatte Wein und Honigwaben mitgebracht, bescheidene Opfergaben, aber von Herzen kommend.
„Herrin," murmelte er, während er die Gaben niederlegte. „Beschütze mich. Halte mich rein. Lass mich nicht werden wie die anderen Männer, schwach und von Begierden getrieben."
Der Wind raschelte durch die Bäume, als würde die Göttin antworten. Hippolytos schloss die Augen und atmete tief.
„Du bist fromm für einen so jungen Mann."
Die Stimme ließ ihn herumfahren. Eine alte Frau stand am Rand der Säulenhalle, gestützt auf einen Stock. Ihre Augen waren milchig vom Alter, aber ihr Blick war scharf.
„Vergib mir, Großmutter," sagte Hippolytos und stand auf. „Ich wusste nicht, dass jemand hier ist."