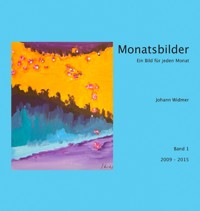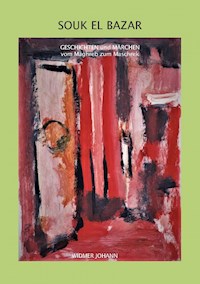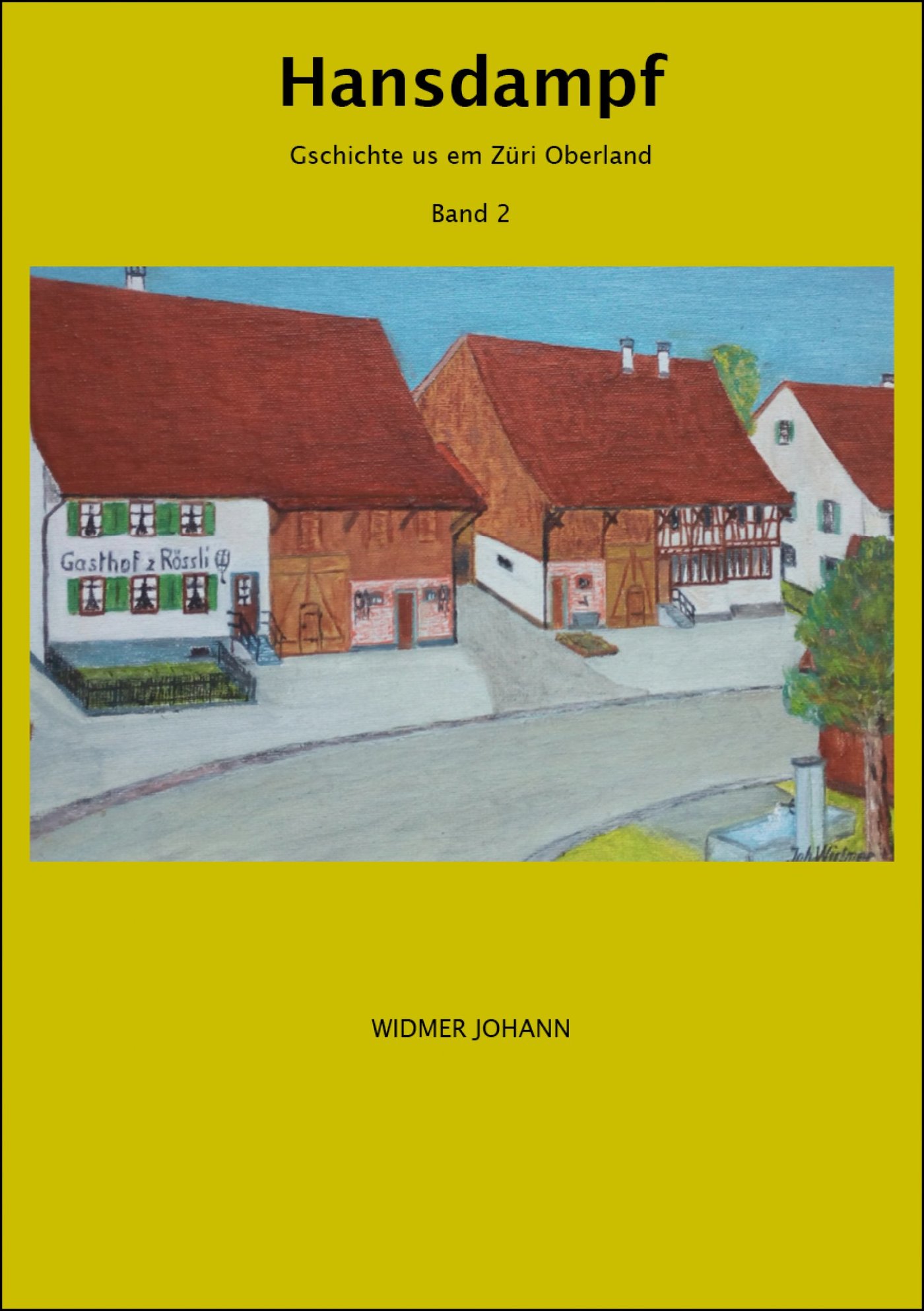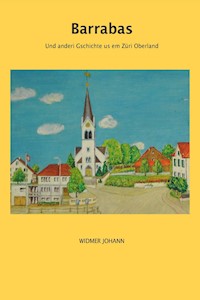Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Jahr geht zur Neige. Frühling ist nur noch ferne, verklärte Erinnerung. Die Blütenpracht hat Patina angesetzt, der silbrige Mond ist schwarz geworden und das Gold der Jugendzeit ist von Grünspan überzogen. Tinnef. Die Zeit von Sturm und Drang und jugendlichem Übermut ist Legende. Spurensuche bringt nichts an den Tag ausser ein paar Kratzern an der Seele und verwachsenen Narben Wem der Herbst keine reiche Ernte gebracht hat, dem droht ein kalter Winter ohne Freunde und ohne Feinde. Nach dem Herbst folgt eine zeitlose Epoche.. Die Zeit ist da und verrinnt sinn- und zwecklos, es sei denn, man fülle das Glas ein letztes Mal und geniesse das Leben bis zum letzten Zug. Der Sinn des Lebens … ach lassen wir das und freuen wir uns, dass wir noch leben und noch Zeit und Musse haben dieses Buch zu Ende zu lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara
BarbaraVorwortHugoJosefineEmilBarbaraMelitaBrüderHerbstzeitloseBarbara
Johann Widmer
BARBARA
LEBENSGESCHICHTEN
Band 5
Ein grosser Dank gebührt meiner Frau Augustine und meinem Sohn Hannes, die mir bei der Verwirklichung dieses Werks tatkräftig zur Seite gestanden haben.
Stiftung Augustine und Johann Widmer, Hrsg.
© Stiftung Augustine und Johann Widmer
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Bildungszentrums reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.johann-widmer.ch
ISBN: siehe Umschlag
1. Auflage 2019, Band 5
Vorwort
Zum fünften Band
Das Jahr geht zur Neige.
Frühling ist nur noch ferne, verklärte Erinnerung.
Die Blütenpracht hat Patina angesetzt, der silbrige Mond ist schwarz geworden und das Gold der Jugendzeit ist von Grünspan überzogen. Tinnef.
Die Zeit von Sturm und Drang und jugendlichem Übermut ist Legende. Spurensuche bringt nichts an den Tag ausser ein paar Kratzern an der Seele und verwachsenen Narben
Wem der Herbst keine reiche Ernte gebracht hat, dem droht ein kalter Winter ohne Freunde und ohne Feinde.
Nach dem Herbst folgt eine zeitlose Epoche..
Die Zeit ist da und verrinnt sinn- und zwecklos, es sei denn, man fülle das Glas ein letztes Mal und geniesse das Leben bis zum letzten Zug.
Der Sinn des Lebens … ach lassen wir das und freuen wir uns, dass wir noch leben und noch Zeit und Musse haben dieses Buch zu Ende zu lesen.
Hugo
Sieben Jahre lang haben wir gemeinsam die Schulbank gedrückt (wobei die Bank vor allem mich gedrückt hat), doch Freunde waren wir nie, der Hugo und ich. Er wohnte im Haus „gleich um die Ecke“, wir waren also Nachbarskinder, die sich nicht mochten. Das heisst, er hatte immer um meine Gunst geworben, sich um meine Freundschaft bemüht und war dauernd in meiner Nähe, aber genau das liebte ich nicht.
Wir hatten eine ganz eigenartige Beziehung zueinander, er war wie ein Hund, der schwanzwedelnd meine Hände leckte um mich im nächsten Moment in die Fersen zu beissen. Er war ein verdammter Schleimscheisser, der von Freundschaft sprach um mich im nächsten Moment zu verraten.
Zu alledem kamen noch meine Vorurteile: Hugo hatte rote Haare, das allein war schon ein Grund um ihn zu verachten, dann war er ein weiches Muttersöhnchen und zu allem Überfluss noch katholisch. Seine Mutter war eine Deutsche und das war während der Kriegsjahre auch keine gute Reverenz in unserer voreingenommenen Dorfgemeinschaft. Für seine Petzerei in der Schule kriegte er regelmässig seine verdiente „Klassenhaue“ was aber keine Wirkung bei ihm zeigte.
Eine meiner Eigenschaften ist meine aufbrausende, jähzornige Art. Ich kann zwar meist lange an mich halten, aber wenn man mich zu lange, zu stark und zu hinterhältig reizt, sehe ich plötzlich nur noch Rot und dann werden bei mir verborgene Kräfte frei, die, vermischt mit meiner Wut, Angst und Schrecken verbreiten und grossen Schaden anrichten. Hinterher tut es mir immer furchtbar leid, aber Reue macht die Tat auch nicht mehr ungeschehen.
Hugo verstand es ausgezeichnet mich zu reizen und zu triezen bis ich die Beherrschung verlor und genau dieses grausame Spiel liebte er, obschon er es war, der schliesslich die Prügel einheimste.
An eine der ersten unserer Auseinandersetzungen kann ich mich mit dem besten Willen nicht mehr erinnern, obschon der Ausgang blutig gewesen sein musste. Mein Vater hatte mir einen riesig grossen Sandkasten eingerichtet in dem ich Sandburgen errichtete, Strassen, Brücken und Galerien baute und lange Tunnel durch die Berge bohrte. War ich mal nicht anwesend wenn Hugo vorbeikam, so zerstörte er genüsslich meine Kunstwerke um sich anschliessend noch zu brüsten für seine Heldentat.
Man hat mir später erzählt, dass ich ihm geschworen hätte, ihn „tot zu machen“ , wenn er noch ein einziges Mal meine Arbeit kaputtmachen würde.
Ich habe ihm scheinbar mit meiner eisernen Schaufel eins übergezogen und ihm an der Stirne eine grosse klaffende Wunde zugefügt. Eine gut sichtbare, hässliche Narbe ist dabei übriggeblieben, die er fast sein ganzes Leben lang, immer mit einer Haarlocke verdeckte oder auch stolz zur Schau trug, je nach gegebener Situation.
Seine Narbe war in der Folge mein Fluch, sie zeigte, dass ich ein gefährlicher, unbeherrschter Totschläger war, der einst am Galgen enden würde. Nicht dass mich das besonders belastet hätte, doch für die anderen war seine Narbe mein feuriges Kainszeichen.
Ich glaube, ich war an und für sich nie ein geselliger Mensch, ich liebte das Alleinsein, ich liebte das einsame Träumen schon als Kind und bewegte mich gerne in meiner Fantasiewelt. Auf Störungen von aussen soll ich immer verärgert und schroff reagiert haben, so dass meine gleichaltrigen Kameraden mich mieden und bei ihren Spielen nur selten teilnehmen liessen.
Dazu kam noch, dass ich die bei uns üblichen Spiele meist als langweilig und primitiv fand und sie zu verbessern suchte. Ich erreichte damit, dass alle Spiele am Schluss unspielbar und kompliziert wurden und ich am Ende als gemeiner Spielverderber weggejagt wurde.
Einzig beim „Völkerball“ wollte man mich dabei haben, weil ich sicher war im Fangen der Bälle und mein Wurf wegen seiner Härte und Schnelligkeit gefürchtet war und regelrechte Massaker verursachte.
Falls Hugo sich in der gegnerischen Mannschaft befand, war es mir ein Vergnügen ihn möglichst hart abzuschiessen. Zum Dank verleumdete er mich dann bei den Spielkameraden mit irgendwelchen abstrusen Behauptungen, bis ich vom Platz vertrieben wurde.
Schon mit etwa fünf Jahren lernte ich lesen und damit tat sich mir eine neue Welt auf. Was mir an Gedrucktem in die Hände kam musste ich lesen, obschon ich anfänglich das meiste davon gar nicht verstand, denn die Schriftsprache unterscheidet sich sehr stark von unserem Dialekt. Dass unser Wort „Anke“ dasselbe sein sollte wie „Butter“ oder „Nidel“ gleich „Rahm“, auf diese verrückte Idee musste man erst mal kommen. Allmählich eignete ich mir den nötigen Wortschatz an und das Gelesene wurde immer verständlicher und dadurch spannender.
Zu meinem grossen Leidwesen hatten sich nur wenige Bücher in unseren Haushalt verirrt, in Arbeiterhaushalten war das Lesen noch ein Luxus, den man sich weder finanziell noch kräftemässig leisten konnte. Kam mein Vater nach 10 Stunden (im Sommer waren es 12) schwerer körperlicher Arbeit nach Hause, hatte er kaum je Lust sich in ein Buch zu vertiefen. Er überflog im besten Fall rasch die Zeitung, die dreimal wöchentlich erschien, aber meistens hatte er noch anderes zu tun im Haus und im Garten.
Das dickste Buch in unserer „Bibliothek“ (sie bestand aus ein paar Büchern und einigen zerfledderten Zeitschriften) war die Familienbibel, also begann ich mit ihr, denn sie schien mir vielversprechend zu sein.
Eine meiner vielen Tanten, eine fromme Pietistin, half mir, mich in diesem Werk zurechtzufinden und ich hatte auch bald einige Geschichten im Alten Testament gefunden, die mich besonders interessierten und die ich auf meine Art interpretierte. Zum Beispiel die Schlacht um Sodom und Gomorra. Vom Jordantal aus griffen die deutschen Panzer an und aus der Luft kam ein amerikanisches Bombengeschwader und warf Bomben ab, Phosphorbomben und Granaten. Nach einer Stunde war alles vorbei, nur noch rauchende Trümmer waren übriggeblieben und auf einem weiten. leeren Feld stand eine Salzsäule, die Frau von Lot, die sich schadenfreudig umgedreht hatte obschon die Soldaten ihr das verboten hatten. Phantasievorstellungen eines Jungen im Winter 44 / 45.
Auch der Moses hatte mir imponiert mit seinen Zaubertricks, aber ich kannte noch einen Zauberer persönlich, er nannte sich Rico Peter und zog von Dorf zu Dorf und zeigte seine Zaubertricks mit Karten oder mit seinem Zylinderhut voller Tauben und Kaninchen. Ja, von dem hätte Moses noch einiges lernen können. Am Nachmittag vor der Vorstellung bezahlte mir der Zauberkünstler ein „Vivikola“ in der Gartenwirtschaft und zeigte mir ein paar einfache Tricks mit zwei weissen Seilen und dann redeten wir noch lange über die Leute des Dorfes. Ich gab ihm genaue Beschreibungen bestimmter Personen, verriet ihm verschwiegene Dorf– und Familiengeheimnisse. Da er Gedankenleser war, hätte er meine Angaben eigentlich nicht gebraucht, aber er wollte anscheinend auf Nummer Sicher gehen. Nach einer weiteren Flasche Kola schenkte er mir noch Freikarten für unsere ganze Familie. Es wurde ein toller Abend, nur beim Kapitel Gedankenlesen stutzte ich einige Male, denn mir kam plötzlich die Idee … aber dann durfte ich sogar noch auf die Bühne und konnte ihm helfen, die zwei Kaninchen wieder einzufangen.
Am folgenden Tag verkündete ich vor einer grossen Kinderschar, dass Moses, im Vergleich mit Rico Peter ein kläglicher Stümper gewesen sei, denn wenn der Patriarch hätte Gedankenlesen können, wäre das mit dem goldenen Kalb gar nicht passiert.
Die meisten Kinder begriffen nicht, wovon ich redete nur Hugo begehrte auf und nannte mich einen gottverdammten reformierten Ketzer, den man steinigen müsste und dann schmiss er einen faustgrossen Stein nach mir.
Ich fand den „Ketzer“ nicht ehrenrührig, im Gegenteil, es war ein neues und interessantes Wort aber den Stein nahm ich ernst, obschon er weit danebengegangen war. Meine Murmel hingegen traf genau zwischen seine Augen.
Das nachfolgende Strafgericht wühlte wieder in den alten Geschichten von damals, als ich ihn hatte „totmachen“ wollen. Die zwei erzieherisch wertvollen Ohrfeigen gab ich ihm am folgenden Tag kommentarlos weiter. Ebenso wortlos händigte er mir den Ersatz für die verlorenen Murmel aus.
Mein Leseeifer war für den Aufbau eines sozialen Netzes nicht besonders förderlich, das heisst, ich hatte während meiner Schulzeit eigentlich nie einen Freund, schon gar nicht eine Freundin, denn bei der damaligen Sittenstrenge und Bigotterie war ein solches Verhältnis unmöglich. Wenn nur schon ein leiser Verdacht aufkam, wurde man von Lehrern, Eltern und Pfarrherren derart ins Gebet genommen, dass man es lieber bleiben liess.
Ich hatte einmal ein Mädchen vor dem Lehrer in Schutz genommen, weil er sie vor der ganzen Klasse so richtig fertiggemacht hatte. Wir nannten sie alle nur die „doofe Emma“, weil sie kein Licht der Wissenschaft zu werden drohte, sondern eher das Gegenteil, aber dass sie das Bruchrechnen nicht begriff und ihr sogar das kleine Einmaleins fremd war und blieb, dafür konnte sie nun mal nichts, sie war zu blöd dafür.
Dass sie der Lehrer aber tagtäglich deswegen blossstellte, beschimpfte oder gar schlug, konnte mein fanatisches Gerechtigkeitsgefühl nicht ertragen (auch Emmas verzweifeltes Weinen und Schniefen machten mich fertig).
Als es einmal gar zu arg wurde, stand ich auf und sagte zum Lehrer er sollte sich schämen für sein gemeines Benehmen. Zur allgemeinen Freude und Belustigung der Klasse erhielt ich ein Dutzend Schläge mit der Rute auf den blossen Hintern.
Der Schmerz war erträglich, die Schande nicht, sie schrie nach Vergeltung.
Am folgenden Tag brachte mir Emma ein selbstgebackenes „Bauernbrot“ (aus Weissmehl, Milch und Eiern).
Das gab natürlich zu reden, denn nun war allen (auch dem Lehrer) klar, dass wir „etwas hatten miteinander“. Nun war ich das Ziel von Spott und Hohn, aber ich war der Situation gewachsen.
Leider war es das letzte Kuchenbrot das ich von Emma erhalten hatte, denn sie wurde auf das Drängen ihrer Eltern schon wenige Tage später in eine andere Schule im Nachbardorf versetzt.
Kurz nach dem Krieg hatte der Nachbar einen neuen Knecht, einen bärenstarken Kerl, der auf seinem Kraushaar immer eine grüne Baskenmütze trug und seine Füsse steckten in Schaftstiefeln, wie sie von den Fallschirmspringern getragen wurden.
Vom ersten Tag an zeigte man ihm deutlich, dass er hier unwillkommen war, weil er direkt aus dem Gefängnis gekommen war. Das heisst, er kam vom „Zugerberg“, das war eine Strafkolonie der Schweizer Armee für „Landesverräter“. Das Militärgericht hatte ihn verurteilt, weil er in fremden Diensten gestanden hatte, er hatte in der Fremdenlegion gedient. Uns Kindern war der Umgang mit ihm strengstens verboten.
Ich beobachtete ihn eine Zeit lang und stellte dabei fest, dass er wohl kein Teufel in Menschengestalt sei, denn er war stets vergnügt bei seiner Arbeit und konnte laut und herzlich lachen. Ich mag Menschen, die lachen können, die anderen machen mir Angst.
Er heisse Jacques, stellte er sich mir vor, das töne viel besser als unser „Köbi“, sei aber dasselbe, einfach französisch. Der Typ gefiel mir. Er war stark, konnte arbeiten wie ein Pferd und wurde dabei scheinbar nie müde. Vor allem konnte er erzählen, denn er hatte einiges erlebt. Was ich aber am Anfang nicht gemerkt hatte, war seine grosse Liebe zum Alkohol. Zum Essen trank er Most (er sagte „cidre“) wie alle anderen, vielleicht ein paar Schlucke mehr, aber in der Zwischenzeit nahm er regelmässig einen Schluck aus seinem „Flachmann“ oder seiner „Wanze“ wie wir diese flachen Schnapsflaschen nennen, die so gut in die Rocktasche passen.
Am Abend, wenn die Stallarbeit beendet war, setzten wir uns auf die Bank vor dem Haus und Jacques erzählte von seinen Abenteuern in Indochina. Dabei hatte er nicht nur Krieg erlebt, er hatte fremdländische Tropenfrüchte gegessen, hatte schwitzend und keuchend den Dschungel durchquert, hatte Durst gelitten, hatte einen gefährlichen Tiger erlegt, war auf Elefanten geritten, war mit seinem Fallschirm in einem Baum hängengeblieben und hatte gute Kameradschaft erlebt.
Von Krieg und Schlachtengetümmel erzählte er wenig und wenn, dann offensichtlich ungern. Er meinte einmal, es gebe im Prinzip zwei Arten von Krieg, der schmutzige Krieg und der noch schmutzigere.
Oder einmal meinte er, die Soldaten seien keine Mörder sondern Opfer, Mörder seien jene, die den Krieg anzetteln und daran verdienten.
Meine Eltern sahen es nicht gerne wenn ich mit ihm zusammen war, sie befürchteten nämlich, dass er mir „einen Floh ins Ohr setzen werde“ mit seinen Schwärmereien von der Legion, die mich aber weit weniger lockte als fremde Welten, Dschungel, Tiger, andere Völker und ihre Kultur.
Leider waren das seltene Abende an denen er erzählte, meist zog es ihn ins Wirtshaus zu Bier und Schnaps, zu seinem Stumpen und zu Seline, der Kellnerin. Manchmal blieb er bei ihr bis zum Morgengrauen, aber meistens endete seine Sauftour mit einer handfesten Schlägerei. Seine Widersacher, alles junge Burschen aus dem Dorf, fielen oft zu dritt oder zu viert über ihn her, aber sie zogen immer schmählich den Kürzeren, denn Jacques war eine, im Nahkampf gut ausgebildete Mordmaschine, die er zum Glück für seine Gegner sicher beherrschte, so dass es immer ohne Totschlag ausging.
Aber der Schaden, den er anrichtete war trotzdem enorm. Der junge Bühl – Bauer verlor eine Ohrmuschel, ein Armbruch und zwei ausgekugelte Schultern gingen aufs Schadenkonto von Leuten aus dem Nachbardorf und schliesslich kam das gebrochene Nasenbein des Rössliwirtes noch dazu und führte zu einem generellen Wirtshausverbot für den Legionär in der ganzen Gemeinde.
Mir war das mehr als Recht, denn nun hatte er wieder mehr Zeit zum Erzählen.
Was mich nun auch interessierte war der Nahkampf, die Selbstverteidigung, denn ich war auch damals kein imposanter Muskelprotz und konnte mich bei tätlichen Auseinandersetzungen nur schwer behaupten, wenn überhaupt.
Das Karatetraining von Jacques brachte mir viel, vor allem weil es mir erst einmal half, die Angst vor dem Gegner zu überwinden. Ich bekam Selbstvertrauen und es gelang mir auch, meinen Jähzorn in bewusste und zielgerichtete Aktionen zu verwandeln. Ich lenkte meine „blinde“ Wut in die Bahnen des gezielten und wohlbedachten Angriffs. Es gelang mir bald ein geachteter Gegner auf dem Pausenplatz zu werden und schliesslich fürchteten selbst grössere Jungen sich mit mir anzulegen und ich begann meine Machtstellung aufzubauen.
Hugo seinerseits war etwas in meinen Schatten gerückt und versuchte nun wieder Boden zurück zu gewinnen mit Intrigen, Verleumdungen, Erpressungen und Drohungen.
Seine Gemeinheiten waren oft wirksamer als meine schnellen Schläge und gegen Lügen und Gerüchte hilft kein Karate.
Jacques hatte nun einige Mühe an den für ihn so wichtigen Schnaps heranzukommen. Er kaufte regelmässig im Konsum sein Kirschwasser oder eine Flasche Tresterschnaps aber er hatte keine Lust mehr am Saufen, weil ihm die Gesellschaft fehlte. Saufen um des Saufens Willen machte ihm keine Freude, aber sein süchtiger Körper wollte saufen, auch ohne Freude.
Nachdem er einige Male stockbetrunken randalierend durchs Dorf gezogen war durfte auch der Konsum keinen Alkohol mehr an ihn abgeben, doch das scherte ihn wenig, er musste noch andere versteckte Quellen haben.
In einer hellen Vollmondnacht sah ich Seline an unserm Haus vorbeischleichen mit einem Körbchen am Arm. Ihr Ziel war wohl das Nachbarhaus. Sie brachte Jacques Nachschub samt Gesellschaft in eigener Person. Das war also seine Nachschubtruppe.
In jenen Tagen erzählte mein Vater beim Abendessen, dass die Gemeinde diesen versoffenen Typen loswerden wolle, aber sie konnten ihn nicht einfach so wegschicken, weil er „ein Sohn“ dieses Gemeinwesens war, das heisst, er war ein Bürger des Dorfes und somit hatte dieses für ihn zu sorgen.
Man hatte zuerst überlegt, ob man ihn wieder in die Legion zurückschicken wolle, aber Jacques hatte derart die Schnauze voll vom Krieg, dass diese Lösung nicht in Betracht kam.
Eine Entziehungskur hätte Geld gekostet, also verwarfen die Gemeindeväter auch dieses Projekt.
Natürlich erzählte ich Jacques von den Umtrieben, die seinetwegen begonnen hatten, aber statt zu fluchen, grinste er nur und sagte mir, er wolle mir mal etwas zeigen, falls ich schweigen könne.
Er nahm mir den Schwur ab, zu schweigen wie ein Grab, ansonsten … hier machte er das gut verständliche Zeichen des Halsabschneidens.
In seiner Kammer zeigte er mir dann ein kleines graues Segeltuchsäcklein voller Goldmünzen. Noch nie im Leben hatte ich echtes Gold gesehen. Er gab mir eine Münze in die Hand und erklärte mir, dass das ein „Napoleon“ sei, eine französische Goldmünze, die sei etwa doppelt so viel wert wie ein Schweizer „Vreneli“.
Beim Wort Napoleon musste ich lachen, denn so hiess der Dackel des Försters und dieser „Näppi“ wie wir ihn nannten war ein arger Herumtreiber, Bettler und Vagabund.
Ich war ganz fasziniert vom seltsamen Glanz, der von diesem Geldstück ausging, ein warmes Leuchten, das wohl dem grossen Kaiser Napoleon galt.
Jacques erklärte mir dann, dass er im Grunde genommen ein reicher Mann sei und nicht auf die Almosen dieser Geizkrägen im Dorf angewiesen. Bevor er sich zurückziehe, wolle er die Schweinebande hier noch etwas ärgern. Er hatte geplant nach Frankreich zurückzukehren in eine Art von Altersheim speziell für Legionäre und dort mit andern Kameraden zusammen den Lebensabend zu geniessen.
Bevor er sein Leinenbeutelchen wieder verschloss, drückte er mir zwei Goldstücke in die Hand und sagte mir, dass er sie mir anvertraue bis zu seiner Abreise als eine Art von Notpfennig oder Versicherung, falls man ihm das andere Gold klauen würde. Einen dieser Goldvögel müsste ich ihm zurückgeben, den andern könnte ich behalten.
Mir schien es, dass Jacques immer mehr und stärker unter Alkoholeinfluss stehe, obschon ihm die Gemeindeväter alle Quellen verstopft hatten, ausser seinem letzten Brunnen, der Kellnerin Seline, die ihn noch versorgte. Bei der Menge, die seine gute Fee anschleppte, müsste das doch auffallen, aber niemand schien das zu interessieren.
Es war während der Heuernte als ich eines Morgens sah, wie Jacques seinen Flachmann auffüllte mit Brennspiritus. Ich glaubte, er hätte sich in der Flasche geirrt, doch er grinste nur und sagte, das sei auch Schnaps, halt mit einem schlechten Geschmack aber sonst OK.
Wir hatten Schulferien, damit wir beim „Heuet“ mithelfen konnten und ich hatte mich beim Nachbarn verdingt für diese Zeit. Ich bemerkte, dass Jacques nicht mehr viel taugte bei der strengen Arbeit. Er schwitzte schon beim Anblick der Arbeit und beim Mähen (damals noch von Hand mit der Sense) mussten wir ihm die letzte Reihe überlassen weil er so langsam war. Nach dem Mittagessen war er verschwunden und ich wurde ausgeschickt ihn zu suchen. Als ich am Stall vorbeiging hörte ich ein jämmerliches, klägliches Stöhnen im Stall. Ich vermutete sofort, dass jemand von der Heudiele heruntergefallen sei und nun im Stall liege mit gebrochenen Knochen.
Die Geräusche kamen aus der leeren Kälberbox.
Da lag Seline, den Rock hochgezogen und wurde von Jacques „besprungen“ und beide keuchten und stöhnten als ob sie Bauchgrimmen hätten.
Mich amüsierte die Szene und ich zog mich rasch wieder etwas zurück.
Als sie ihr Werk vollbracht hatten rollte Jacques grunzend wie ein Schwein in das Stroh. Seline reichte ihm die Schnapsflasche hinüber und er trank in vollen Zügen als ob es Wasser gewesen wäre.
Wenige Augenblicke später schnarchte Jacques und Seline machte sich an ihm zu schaffen. Sie drehte ihn um, damit sie besser an seine Geldtasche herankam. Ich sah nun wie sie eine rotgelbe, glänzende Münze herausklaubte und in ihr Portemonnaie steckte.
Na, der Freier hatte anscheinend gut getan, mir einen Notpfennig anzuvertrauen.
Ich betrat nun offiziell den Stall, betont lautstark um dem Liebespärchen einen ehrenvollen Abgang zu ermöglichen.
Die beiden Zugstiere mussten eingespannt werden. Am Nachmittag wurde das Heu hereingeholt und da mussten alle anpacken.
Ich hatte den ersten Stier angeredet, ihn am Hals gekrault, das mögen sie nämlich und dann habe ich die Kette vom Nasenring gelöst und das mächtige Tier am Strick hinausgeführt. Es folgte mir willig wie ein zahmes Hündchen an der Leine, dabei war es ein furchterregendes Tier mit spitzen Hörnern, schnaubenden Nüstern, einem schreckhaften Gemüt und tausend Kilo Eigengewicht, vor allem aus Muskeln bestehend.
Bevor ich mein Tier fertig angeschirrt hatte wurde es unruhig, warf den Kopf in die Luft und stiess ein heiseres Brüllen aus. Es musste irgendetwas los sein im Stall drüben. Ketten rasselten, Jacques rezitierte sein Repertoire an französischen Flüchen, immer lauter werdend, begleitet vom Klatschen der Stockschläge. Ich beruhigte mein Tier und dann eilte ich zum Stall hinüber.
Mich erwartete ein Bild des Schreckens. Jacques, an die Wand gepresst und vor ihm der Stier, dumpf brüllend, die weisse Spitze des Horns genau auf der Mitte des Hemdes, die weit aufgerissenen Augen des Knechtes und dann drang die Hornspitze in seine Brust, die mit knacken und splittern dem Druck nachgab.
Zuckend hing der Körper am langen Horn und belästigte den Stier, der sich nun zu befreien versuchte und brüllend den Kopf hin und herschwang.
Schliesslich klatschte der leblose Körper auf den Stallboden und der Stier lief ins Freie.
Ich starrte wie gebannt auf Jacques. Sein Körper zitterte noch leicht, aus der Brust sprudelte sein Blut wie Wasser aus einer Quelle und aus seinem Mund trat blutiger Schaum, die Augen starrten ins Nichts. In keinem Moment hatte er geschrien oder gestöhnt. Er hatte sich nicht mehr wehren können, dieser starke und mutige Krieger. Da war Kraft gegen Kraft angetreten und der andere war der Stärkere. Voilà.
Der Bauer meinte, dass Jacques nichts gespürt habe, besoffen wie er gewesen sei und dann das Horn, genau ins Herz, das sei sehr schnell gegangen, quasi schmerzlos.
Als ich ins Freie trat sah ich den Stier vor dem Haus wie er friedlich die Geranien der Bäuerin frass, aber niemand wagte es, ihn zu vertreiben. Ich ging zu ihm hin, redete ruhig mit ihm und dann trottete er friedlich hinter mir her und liess sich problemlos neben seinen Kumpel an den Wagen spannen.
Man schickte ein Kind ins Gemeindehaus um den Vorfall zu melden. Der Gemeindeschreiber solle bitte auch noch Arzt und Polizei benachrichtigen, damit alles seine Richtigkeit habe.
Die Stalltüre wurde abgeschlossen, die Bäuerin blieb zu Hause und wir fuhren aufs Feld um das Heu einzufahren, denn es war schlechtes Wetter vorausgesagt worden für die nächsten Tage.
Als wir uns an den Tisch setzten zum Abendessen, es ging schon gegen Mitternacht, war der Totenschein schon ausgestellt und der Tote lag, gewaschen und aufgebahrt in seinem Zimmer.
Bevor ich nach Hause ging, wollte ich den Toten nochmals sehen. Man gab mir den Zimmerschlüssel und ich eilte im Dunkeln die knarrende Treppe hoch. Plötzlich blieb ich stehen. Da war doch dieser üble Geruch nach verdorbenem Fisch in der Luft, da musste Seline, die Kellnerin irgendwo versteckt sein.
Was zum Teufel hatte die um diese Nachtzeit in einem fremden Haus zu suchen?
Ich horchte aufmerksam in die Dunkelheit. Da war nichts zu hören.
Mir schien, dass sich jemand am oberen Ende der Treppe befinde, aber das Licht vom Korridor genügte nicht, damit man etwas hätte sehen können.
Mir wurde ganz mulmig zu Mute. Wenn da oben Seline auf mich lauerte? Sie hatte es sicher auf die Goldvögel abgesehen, konnte aber ohne Schlüssel nicht in die Kammer.
Ich stellte mir vor, wie sie da oben stand und sich mit der linken Hand am Treppengeländer festhielt, in der Rechten ein grosses Küchenmesser mit dem sie mich abschlachten wollte … nun konnte ich meine Karatekünste anwenden … sie an beiden Beinen packen und dann schnell die Füsse wegziehen damit sie hintenüber fiel … und dann … ich war noch ein kleiner Knirps neben dieser stattlichen und starken Frau … sie konnte mich am Genick hochheben wie ein Kaninchen … mich mit ihrem Messer in kleine Stücke schneiden, bevor ich nur bis drei zählen konnte …
„Ist jemand da oben?“ rief ich ins Dunkel.
Da ging oben das Licht an. Seline stand heulend vor der Kammertüre des Toten.
Sie wollte Totenwache halten, sagte sie.
Wir kannten bei uns diesen Brauch nicht, aber Seline kam aus der katholischen Innerschweiz und da soll es scheinbar Sitte sein, bei einem Toten zu wachen und zu beten beim Kerzenschein.
Ich meinte, dass Jacques das wohl nicht gewollte hätte, aber nun konnte er sich nicht mehr wehren.
Sie beichtete mir nun, dass sie Jacques geliebt hätte, sie sei es ihm schuldig, denn sie seien wie Mann und Frau gewesen.
„Ja so wie heute in der Kälberbox,“ entfuhr es mir.
Wie von einer Wespe gestochen fuhr sie mich wütend an. Ich sei ein verdammter Spion und Fenstergucker, ein verdorbenes Schwein und noch so jung. Das werde ein böses Ende mit mir nehmen … und so weiter, (zum Glück war das Messer in ihrer rechten Hand nur Einbildung gewesen)
Einen Moment lang betrachtete ich das wachsbleiche Gesicht des Toten. Er machte einen friedlichen Eindruck, er war sauber rasiert und sein sonst so wirres Haar war akkurat gescheitelt.
Sein rechter Mundwinkel war leicht nach oben gebogen, als ob er sich über uns lustig machen wolle.
Am folgenden Tag wurde er eingesargt und der Totengräber hatte im Friedhof an einer entfernten Stelle das Grab ausgehoben und holte dann zusammen mit dem Sargschreiner den Sarg.
Sie fuhren den Toten mit ihrem Handkarren durchs Dorf, wurden dann aber von meinem Vater angehalten.
Er war ausser sich vor Zorn und befahl den beiden zum Gemeindehaus zu fahren. Dort machte er einen Riesenkrach, weil man einen Gemeindebürger einfach so klammheimlich verscharren wolle wie einen toten Hund. Mittlerweile hatten sich ihm noch andere Dörfler angeschlossen und eine Stunde später wurde der Sarg auf den damals üblichen Leichenwagen mit Pferdegespann umgeladen und dann unter feierlichem Glockengeläute zu seiner letzten Reiseetappe geführt. Ein Geistlicher war zwar nicht dabei, denn Jacques hatte ja auch nie eine Kirche besucht.
Wir waren etwa zehn Personen am Grab, darunter auch Seline mit ihrem geflochtenen Korb und einer Schnapsflasche unter einem Tuch versteckt. Sie betete so lange bis alle Leute weg waren und der Sarg unter der Erde lag, dann entkorkte sie die Flasche und goss den Inhalt über das Grab.
Am folgenden Tag kam Seline zu mir, den Schnapskorb am Arm und wollte mit mir sprechen.
Sie sagte sie hätte den Nachlass des Toten geordnet und dabei einiges gefunden, das mich vielleicht interessiere. Ein dickes Paket, grob verschnürt enthielt seine Papiere, wie Soldbuch, Ausweise, Entlassungspapiere, einen französischen Pass und einige kleine Notizbücher, eine Art von Tagebuch.
Dann gab sie mir noch eine nagelneue grüne Militärmütze als Andenken an ihn.
Ich erzählte ihr noch von den Goldmünzen, die er mir geschenkt hatte, wobei ich ihm die eine in den Sarg hätte legen sollen.
Seline fand, das wäre eine schlechte Idee Geld zu vergraben, aber man könnte damit eine schöne Grabplatte auf sein Grab legen, sie würde sich auch daran beteiligen, sie habe übrigens auch ein paar Goldvögel geerbt.
Auf einer Platte aus schwarzem Granit prangte die siebenflammige Granate der Fremdenlegion und darunter in schlichten Buchstaben JACQUES und die Jahreszahlen seiner knapp 40 Lebensjahre.
Die Friedhofkommission beanstandete anschliessend den Grabstein wegen der Granate aber schliesslich liess man es bei einem Brief bewenden in welchem Seline und ich gebeten wurden, in Zukunft eine genaue Beschreibung mit Zeichnung zur Bewilligung einzureichen.
Werden wir selbstverständlich tun, in Zukunft, hochgeehrte Friedhofs- und Bestattungskommission.
Der Tod des „Kriegers“ wie ihn meine Mutter genannt hatte liess meine Eltern aufatmen, denn sie waren um mich besorgt gewesen wegen dieser Bekanntschaft, denn mit seiner Sauferei war er wahrlich kein Vorbild gewesen und als er mir dann noch Anleitung gab in Kampfsport und Nahkampf, hatten sie Angst, ich werde ein übler Raufbold und Schlägertyp.
Meine geringe Körpergrösse und meine schwache Konstitution hatten mich aber frühzeitig gelehrt, allen Händeln und Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, vielleicht hatte ich nun eine geringe Chance, mich im Notfall wehren zu können.
Immerhin hatte Hugo von nun an Respekt vor meinen Kniffen und harten Schlägen und er liess mich meist in Ruhe, obschon er grösser, stärker und viel schwerer war als ich und mir weit überlegen im Ringkampf.
Einige Tage nach der Bestattung wurde der „Fall Jacques“ von den Behörden offiziell untersucht. Man verlangte auch meine Anwesenheit. Ausser dem Tierarzt, dem Metzger und dem Gemeindeschreiber waren noch zwei uniformierte Kantonspolizisten am Tatort.
Wir mussten den Ablauf des Unglücks nochmals nachspielen.
Als ich in den Stall ging um den ersten Stier zu holen waren die Polizisten strikt dagegen, dass ein „kleines“ Kind (ich war immerhin schon Sekundarschüler !) allein eine solche wilde und bösartige Bestie aus dem Stall führe.
Schliesslich konnten wir sie überzeugen, dass es absolut ungefährliche Haustiere seien.
Als ich mit der ersten Tonne Fleisch und Muskeln aus dem Stall kam, wichen die Polizisten zurück und der eine hielt vorsorglich die Hand auf seiner Pistole.
Als dann der Bauer mit dem anderen Stier, dem „Mörder“ aus dem Stall kam, wichen alle Anwesenden ein Stück zurück, denn man konnte ja nie wissen, was im Kopf eines solchen Untiers vor sich ging.
Zu zweit spannten wir die Tiere vor den Karren, ich kraulte beide am Hals und sie leckten meine Hände (die ich vorher ins Salzfass getaucht hatte). Ein Bild des Friedens und der Eintracht.
Der Tierarzt trat nun hinzu und betastete die Tiere, schaute ihnen ins Maul und leuchtete in die Nüstern.
Die beiden Hüter der Ordnung kamen nun auch etwas näher und vergewisserten sich, dass es absolut zahme und harmlose Tiere seien.
Der Bauer erklärte nun, dass die meisten Hoftiere keine betrunkenen Menschen mögen, sie hätten wohl Angst vor ihrer Unberechenbarkeit. Wenn dann der Besoffene das Tier noch quäle, schlage, in den Bauch trete oder an einer empfindlichen Stelle reize, dann müsse sich das arme Vieh irgendwie wehren, Hornträger seien ja deshalb mit ihrem Kopfschmuck ausgestattet.
Die Tiere wurden wieder in den Stall gebracht und die Bäuerin komplimentierte die ganze Gesellschaft in die Küche, wo ich bei Most, Brot, Speck und Schinken den ganzen Hergang genau schildern musste. Einer der Polizisten notierte alles und nach einem Gläschen Schnaps verliess der obrigkeitliche Besuch den Hof, satt und zufrieden und der ( Mörder-) Stier blieb am Leben.
Etwa zwei Wochen nach dem Tod des Legionärs spürte ich eine seltsame Unruhe in mir, ich konnte mich kaum mehr konzentrieren und nachts schlief ich sehr unruhig, wenn überhaupt. In der Schule war ich müde und abgespannt und völlig unaufmerksam. Ich hatte das Bedürfnis mich zu bewegen, zappelte mit den Beinen und die Hände warfen auf dem Tisch alles durcheinander und immer wieder fiel etwas zu Boden, ein Buch, ein Bleistift oder gar meine Schultasche bis mich der Lehrer vor die Türe wies. Völlig unmotiviert begann ich die Kleider von den Haken zu nehmen um sie anschliessend wieder, neu gruppiert, aufzuhängen. Dann versuchte ich mit einem Bleistift ein Loch in die Türe zu bohren und schliesslich stellte ich mir vor, ich wäre der wütende Stier und knallte mit dem Kopf in die WC Türe.
Durch den Knall aufgeschreckt eilte der Lehrer herbei und schickte mich vor die Haustüre.
Ich setzte mich auf die Treppe und schlief sofort ein.
Am Ende der Stunde wurde ich geweckt. Ich fühlte mich wieder besser, war äusserlich absolut ruhig, nur tief in mir drinnen war ich aufgewühlt. Wenn ich die Augen schloss, sah ich immer diese scharfe weisse Spitze des Horns auf dem blauen Hemd und wie dieser Dolch zuerst den Stoff eindellte, wie der Stoff zerriss und wie das Horn blitzschnell tiefer drang, wie ein feiner Blutfaden am Horn erschien und ich hörte das Knacken brechender Rippen.
Ich erzählte dem Lehrer von dem Vorfall und wie mich diese Szene nun zu verfolgen begann.
Man schickte mich in Begleitung eines Schulkameraden nach Hause. Meine Mutter schickte mich ins Bett und brachte mir den obligaten Kamillentee und ein Beruhigungsmittel, das ihr der Arzt für ihre Depressionen verschrieben hatte. Ich versank in einen Halbschlaf und begann zu delirieren.
Am Morgen hatte ich sehr hohes Fieber und der Arzt liess mich ins Krankenhaus bringen, weil er den Verdacht hatte, ich könnte eine Hirnhautentzündung haben.
Ein paar Tage soll ich im Koma gelegen haben, dann ging es wieder aufwärts mit mir, ich erwachte aus der Schockstarre und man half mir in einer Spezialklinik diesen Schock zu überwinden. Der weisse Dolch, der mitten ins Herz meines Freundes eindrang, seine leeren Augen, der blutrote Schaum, der aus seinem Mund drang und die dunkelrote Quelle, die rhythmisch Blut pumpte verfolgten mich noch jahrelang aber nach und nach wurden diese Schreckensbilder ersetzt durch die Totenmaske mit ihrem zufriedenen Ausdruck und ihrem schelmischen Grinsen.
Die ganze Geschichte mit dem Unfall und meine, etwas verspätete Schockreaktion aber auch meine Heilung machten mich eine Zeit lang zum Tagesgespräch im Dorf, was mir Hugo irgendwie missgönnte und er begann nun das Gerücht zu verbreiten, ich sei nicht mehr ganz recht im Oberstübchen, etwa wie meine Mutter, die schon mehrmals wegen ihrer schweren Depressionen in einer Nervenheilklinik (Irrenhaus nannte man das damals) interniert werden musste.
Wer körperlich krank war, mochte es Masern oder Krebs sein, der hatte das Mitleid der Dörfler auf seiner Seite, wer aber seelisch krank war, der wurde verspottet, geächtet und gemieden. Man ging ihm aus dem Weg, man hatte sogar Angst vor ihm oder man bewarf ihn auf der Strasse mit Pferdeäpfeln und man machte faule Witze über ihn. Einen „Irren“ in der Familie zu haben war damals eine grosse Schande.
In einem Nachbarland hatte man genau in jenen Jahren „Geisteskranke“ als „unwertes Leben“ definiert und zu
Hunderten umgebracht.
Wenn nun einer im Dorf herumgeht und erzählt, du seist geisteskrank, ist das eine unverzeihbare Gemeinheit, es mag nun Tatsache sein oder nicht, aber von diesem Moment an behandelt man dich anders, man nimmt dich nicht mehr für voll und dein Wort zählt nichts. Du bist ausgegrenzt, bist ein Aussätziger.
Ich hatte Hugos Verleumdungskampagne nicht verdauen können. Ich hatte eine Sauwut auf den Kerl und bedauerte ehrlich, dass ich damals als Dreijähriger mit der Schaufel nicht stärker zugeschlagen hatte um ihn wirklich „tot zu machen“.
Auch in der Schule (Sekundarschule) begann er mich als „Irrenhäusler“, „Webstübler“ oder „Burghölzler“ zu bezeichnen und verlachte mich in Gegenwart von Mädchen und das schmerzte besonders stark.
Dass er damit meinen Jähzorn entfachte, wusste er, dass ich inzwischen einige Kenntnisse von chinesischer Kampfkunst erworben hatte, wusste er nicht aber bekam es zu spüren.
Als ich ihm mit zwei gezielten Schlägen beide Vorderarmknochen gebrochen hatte gab es natürlich einen Riesenwirbel.
Meine „faulen Ausreden“ zogen nicht vor dem Lehrertribunal.
Man verlangte von mir dass ich mich vor der ganzen Schule um Verzeihung bitte.
Vor versammeltem Publikum spuckte ich ihm ins Gesicht.
Ich wurde an eine andere Schule versetzt, „auf Bewährung“ sozusagen. Bei der kleinsten Unregelmässigkeit würde ich von der Schule geschmissen und in ein Erziehungsheim gesteckt.
An der neuen Schule lief alles gut. Ich lernte feine Kerle kennen und auch ein Mädchen, mit dem mich bald eine kumpelhafte Freundschaft verband. Nach der Schule hatten wir ein Stück gemeinsamen Heimweg und dabei lernten wir uns kennen. Sie hiess Margrit, war gross (sogar einige cm grösser als ich) und hatte dunkle Augen wie ein Reh. Sie lebte mit ihren Eltern und einem kleinen Bruder auf einem grossen Bauernhof, weit entfernt vom nächsten Dorf.
Wir waren im letzten Schuljahr und es wurde Zeit, sich zu überlegen, welchen Beruf man ergreifen möchte.
Das Handwerk des „Hafners“ oder Ofenbauers, das mein Vater ausübte, kam für mich nicht in Frage. Ich habe ihm zwar in meiner Freizeit oft und gerne geholfen, aber ich hatte auch gesehen, dass man damit nicht genug Geld verdient um eine Familie ernähren zu können. Wir hätten all die Kriegsjahre hungern müssen ohne Mutters Beitrag, den sie mit Waschen und Putzen bei andern Leuten verdient hatte. Sie war aber auch eine ausgezeichnete Köchin, die mit sparsamen Mitteln ein wohlschmeckendes Essen auf den Tisch bringen konnte. Da wurde nie etwas weggeschmissen und die letzte Speckschwarte verfeinerte noch die Gemüsesuppe.
Meine Berufswünsche waren während meiner Schulzeit einem ständigen Wechsel unterworfen, je nach Alter, momentaner Lektüre und beeindruckenden Vorbildern. Das reichte vom Kampfpilot, dem Trapper, dem Legionär, dem Kapitän und dem Naturforscher bis zum Schriftsteller und dem Lehrer.
Und bei dem blieb es schliesslich, nicht zuletzt auch, weil es auch Margrits Berufswunsch war. Wir begannen uns gemeinsam auf die Aufnahmeprüfung am Gymnasium vorzubereiten. Es machte mir grossen Spass auf ein ganz bestimmtes Ziel hin zu arbeiten.
Wir kamen gut voran nur mit der Mathe kam Margrit nicht zurecht. Ich anerbot mich nun, am folgenden Samstag zu ihr nach Hause zu kommen um ihr einzelne Kapitel genauer zu erklären, aber sie lehnte den Vorschlag ziemlich brüsk ab. Ich war erstaunt, machte mir aber keine weiteren Gedanken.
Am Prüfungstag trafen wir uns am Bahnhof. Ich hatte mich „in die Schale“ gestürzt, das heisst ich war im besten Sonntagsstaat angerückt. Dunkle Hosen, einst Vaters Hochzeitsanzug, von der Mutter mir angepasst, waren nicht unbedingt im damaligen Modetrend und vor allen etwas kurz an den Beinen, sie gaben ein Stück meiner geringelten Strümpfe frei, dafür kamen die nagelneuen, etwas gross geratenen Schuhe besser zur Geltung.
Der Rock war etwas weit für meine Brust, dafür waren die Ärmel zu lang für meine Arme und die Manschettenknöpfe meines Opas kamen gar nicht zur Geltung. Umso auffälliger gebärdete sich mein faustdicker Krawattenknopf, der mich zu erwürgen drohte. Es war eine feuerrote Seidenkrawatte mit violetten Querstreifen drin. Den flachen „Fladenhut“ konnte ich den Eltern ausreden, denn ich fürchtete damit zum Gespött der anderen zu werden, wenn schon Kopfbedeckung, monierte ich, dann nur das grüne Barett, das mir Jacques vererbt hatte. „Bist du nun total verrückt geworden?“ war Vaters Kommentar.
Ich hatte mir vorgestellt mit Margrit allein am Bahnhof zu sein, aber da war eine ganze Menge von Mitschülern aus den Parallelklassen und von anderen Schulen, alle tadellos gekleidet, junge Herrchen und vornehme Dämchen, mit einem Wort, die geistige Elite des Landes.
Nachdem ich die Fahrkarte gekauft hatte benutzte ich den Hinterausgang des Bahnhofes und begab mich ans vordere Ende des Perrons und stellte mich hinter die Fahrradständer, damit mich die Meute nicht sehen konnte. Ich befürchtete mit Recht zum Gespött der anderen zu werden.
Aber es sollte noch schlimmer kommen.
Aus den Reihen der Prüflinge löste sich plötzlich eine, mir nur zu bekannte Person und eilte auf mich zu.
Hugo.
Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass er auch ans Gymnasium wollte, da wir das letzte Schuljahr an verschiedenen Schulen absolviert hatten.
Als ich ihn herankommen sah, hatte ich nur einen Gedanken: „Wann zum Teufel werde ich dieses Aas nur los? Ich hätte damals fester zuschlagen sollen.“
Er war geschniegelt und schick angezogen, es kam wohl alles direkt vom Schneider und passte perfekt. Seine roten Haare glänzten dank einer Paste dunkler Brillantine, „wie aus dem Fettnäpfchen“ , und an der goldenen Uhrkette an seinem Veston war sicher auch eine goldene Uhr angebracht.
Neben diesem Dandy kam ich mir vor wie eine hässliche Vogelscheuche.
Als der Zug einfuhr, zerrte er mich mit sich und ich folgte ihm, geduldig und blöd wie ein Opferlamm in den Zug, in ein Raucherabteil wo sich seine Kumpane schon breit gemacht hatten. An ihren Blicken war ihr Urteil über mich unschwer abzulesen und ihr blödes, hämisches Grinsen, wenn sie mich musterten, liess mich erahnen, was mich da erwarten würde.
Glücklicherweise war jeder von ihnen mit sich selbst beschäftigt, denn die Prüfungsangst steckte den meisten tief in den Gliedern. Um davon abzulenken prahlten sie, wie sie gut vorbereitet seien, einer behauptete sogar, er kenne schon die Aufgaben, war aber nicht bereit sein Geheimwissen mit uns zu teilen. Sie hatten alle in vielen teuren Privatstunden eine siegessichere Vorbereitung genossen und als ich dann nach meinem Pauker gefragt wurde und zugeben musste, dass ich mich, zusammen mit einer Mitschülerin allein vorbereitet hätte, machte ein hämisches Grinsen die Runde. Aus zwei Gründen. Erstens. wer keine Privatstunden sich leisten könne, gehöre nicht an so eine Eliteschule, das sei nichts für arme Hunde und zweitens gab mein zweiter Ausspruch „zusammen mit einer Mitschülerin“ Anlass zu Spott und blöden Anzüglichkeiten. Vor allem Hugo tat sich hervor, mich mit kleinen Anspielungen zu demütigen.
Ich war mir im Klaren, dass ich nicht in diese elitäre Aufschneiderbande gehörte und, einen schweren Hustenreiz, wegen des Rauches, vortäuschend verliess ich das Abteil.
Erst drei Wagen weiter hinten fand ich Margrit. Ich hatte sie fast nicht erkannt, denn sie hatte sich hübsch gemacht. Statt ihrer langen Zöpfe hatte sie die Haare aufgesteckt und mit einem silbrigen Kamm befestigt und ihr dunkles Kleid machte sie zu einer verdammt hübschen Dame. Sie war derart schön, dass ich mich fast nicht getraute sie anzusprechen. Der Platz ihr gegenüber war noch frei (weil sie ihre Mappe daraufgelegt hatte) und mit einem Kopfzeichen lud sie mich ein, mich hinzusetzen.
„Hast dich hübsch gemacht,“ wagte ich zu sagen und sie lachte.
Dann meinte sie, ich hätte mir ja auch Mühe gegeben, nur mein dicker (doppelter) Krawattenknopf sei eine Katastrophe. „Komm näher, ich weiss wie man‘s macht,“ und schon hatte sie die „Kartoffelknolle“, wie sie es nannte, aufgelöst und neu geknotet. Und die ganze Zeit war ihr Gesicht so nah, ich spürte ihre feinen Hände am Hals, ich roch den Duft frisch gewaschener Wäsche und dahinter ein leiser Hauch von Maiglöckchenduft. Ich war verwirrt, wusste nicht wohin schauen vor lauter Verlegenheit und ich spürte, wie mein Herz vor Aufregung eine schnellere Gangart einschaltete.
Endlich (oder : leider allzu schnell) sassen wir uns wieder gegenüber und versuchten nun ein normales und unbefangenes Gespräch zu führen aber ich merkte, dass Margrit nicht bei der Sache war, es musste die Prüfungsangst sein, die sie gepackt hatte. Ich wollte ihr Mut zusprechen aber sie winkte ab und sagte, sie hätte familiäre Probleme, ihre Mutter sei wieder einmal „unpässlich“, aber sie wolle jetzt nicht davon sprechen. „Bitte, nicht,“ sagte sie mit leiser Stimme und flehenden Augen.
Wir schwiegen und ich begann die anderen Fahrgäste im Abteil zu mustern und da fiel mir vor allem die vornehme Dame auf, die neben Margrit sass. Vor allem ihre Lesebrille war interessant, randlose Gläser an goldenen Ohrbügeln, die unter ihren rötlichen Locken verschwanden.
Ja, sie hatte fast die gleiche Haarfarbe wie Hugo, was aber bei ihm hässlich wirkte, hatte hier eine besondere Anziehungskraft und ihre Sommersprossen, die sie offensichtlich stolz zur Schau trug, waren bei Hugo ein endloser Kampf, denn er mit Salben und Cremen führte.
Sie hatte unser Krawattenduell aus den Augenwinkeln heraus verfolgt und sichtlich ihren Spass daran gehabt und als wir nun so schweigend dasassen, fragte sie uns, ob wir beide zur Aufnahmeprüfung an die „Kanti“ reisten. Wir bejahten. Sie betrachtete uns schmunzelnd und las dann in ihrem Buch weiter, aber ich musste sie immer wieder verstohlen betrachten und wenn sie meinen Blick erwiderte wurde mir ganz weh ums Herz. So mussten früher die Hexen ausgeschaut haben.
Am Bahnhof in Winterthur bestieg die rote Dame aus dem Zug ein Taxi und fuhr weg.
Wir mussten zu Fuss quer durch die Stadt zum „Rychenberg“ hinüber wandern, wo das imposante Schulgebäude der Kantonsschule hingeklotzt worden war. Hugo hatte sich nun uns beiden angeschlossen, weil ich der einzige war, der den Weg kannte (ich hatte ihn am vorherigen Sonntag ausgekundschaftet).
Er machte sich nun in seiner üblichen galanten Art an Margrit heran, machte faule Komplimente, wusste sich selber in den schönsten Farben darzustellen und mich mit kleinen Randbemerkungen herunterzutun.
Margrit fand ihn interessant, hörte aufmerksam auf sein dummes Geschwätz, lachte, wenn er seine faulen und abgestandenen Witze erzählte und bewunderte ihn, wenn er von seinen Heldentaten erzählte.
In Gedanken verloren betrachtete ich die blaue, eiserne Sandschaufel in meinen Händen … damals.
Wenn das Schulhaus (sieht aus wie eine römische Kaserne) in Sichtweite ist, quert eine wichtige Eisenbahnlinie die Strasse und eine Barriere sperrt die Strasse wenn Züge vorbeifahren, und es fahren immer Züge vorbei. Auch als wir da waren, standen wir vor geschlossener Schranke.
Ich wusste nun, dass etwa hundert Meter weiter oben eine Passerelle, eine Fussgängerbrücke die Geleise überquert und teilte es den beiden mit. Aber sie hörten gar nicht hin, derart waren sie in ihr Gespräch vertieft. Ich machte mich alleine auf den Weg. In mir drinnen spürte ich eine grosse Leere, Verlassenheit, Einsamkeit und Trauer, Enttäuschung und Wut.
Auf der Brücke schaute ich auf die Geleise runter als gerade ein Schnellzug vorbeidonnerte.
Springen?
Mich schauderte.
Wie hatte Jacques gesagt? Selbstmord ist Feigheit vor dem Leben.
Die Prüfung verlief wie in einem Traum.
Wir wurden in kleinen Gruppen geprüft.
Im mündlichen Französisch musste jeder drei, vier Sätze vorlesen und dann auf Deutsch übersetzen.
Schriftlich mussten wir ein Bild beschreiben. War alles kein Problem.
Deutsche Grammatik war mir ebenfalls kein fremdes Land und im Aufsatz gab ich mein Bestes.
Die letzten zwei Lektionen waren Geometrie und Mathematik, meine Lieblingsfächer.
Als die Glocke geläutet hatte betrat … betrat die „rote Dame“ aus dem Zug unser Zimmer.
Ich durfte (musste) dann auch als erster an die Wandtafel um eine schwierige Dreieckskonstruktion zu erklären was mir auch sehr gut gelang. Die anschliessende schriftliche Prüfung fand ich leicht und hatte sie auch schon nach der halben Zeit fertig, zweimal durchgerechnet.
Ich brachte die Blätter zum Lehrerpult, kassierte ein freundliches Lächeln und die geflüsterte Bemerkung, an dieser Schule herrsche kein Krawattenzwang. Ich nickte, schaute tief in ihre grünen Augen und verabschiedete mich.
Wie ein Schlafwandler gelangte ich zum Bahnhof, setzte mich dort auf ein Mäuerchen und versuchte im Chaos meiner Gedanken und Gefühle etwas Ordnung zu machen, doch es tauchten immer wieder die gleichen Bilder auf: zwei lächelnde grüne Augen, Hugo, der auf Margrit einredete, Margrit, die ihm an den Lippen hing, der Schnellzug unter der Brücke, die grünen Augen, die absolute Gewissheit, dass ich die Prüfung bestanden habe, die grünen Augen …
An einem Dienstag kamen die Resultate heraus und wurden in der Schule am schwarzen Brett angeschlagen und zugleich wurde die Klasseneinteilung bekanntgegeben.
Jeder Prüfling bekam das Ergebnis auch noch per Post zugeschickt aber erst etwa eine Woche später.
Am Anschlagbrett war ein dichtes Gedränge. Auch Hugo und Margrit waren im Gewimmel und versuchten vergeblich nach vorne zu kommen. Ich liess mich von der Seite her an der Tafel vorbeidriften und konnte schon aus der Ferne meinen Namen, ziemlich weit unten (weil alphabetisch geordnet) finden, dabei stand noch L1a, also in der ersten Lehramtsklasse A.
Ich wollte mich wieder entfernen, da winkte mir Hugo zu und rief, wir würden uns in der Eisdiele an der Stadthausstrasse treffen um zu feiern. Ich fuhr mit dem Fahrrad etwas später zur besagten Eisdiele, traf dort aber weder Hugo noch Margrit an, beide waren durchgefallen. Schadenfreude?
Auch Erleichterung.
Ich hatte mich rasch in der neuen Schule eingelebt. Es war eine neue Welt, eine neue Herausforderung und ein neues soziales Umfeld. Mit den Mitschülern und Mitschülerinnen verstand ich mich rasch und gut und die Lehrer schienen mir eine andere Kategorie zu sein als die, welche mir bisher untergekommen waren, vor allem war ich glücklich, dass die „rote Dame“ unsere Mathelehrerin war.
Die „rote Dame“ hatte auch einen Namen, Fräulein Doktor Barbara Meyer, aber in meinem Denken war es einfach „die Barbara“, die hübsche Barbarin oder vielleicht eine ferne, unerreichbare Fee, ein Engel aus dem Mathehimmel, ein faszinierendes Traumbild, das jeden Tag eine Stunde lang in meiner realen Welt erschien, eine Stunde des Glücks, eine Stunde algebraischen und analytischen Sonnenscheins.
Dass ihre Hausaufgaben Vorrang vor allen andern hatte, war klar, denn dann war ich in ihrer Welt, dass ich auch ihr bester und aufmerksamster Student war, (weil ich eben die Mathe so liebte) war auch nicht verwunderlich.
Zuhause lief es nicht so gut. Meine Mutter hatte immer häufiger ihre Depressionen und musste bei schweren Fällen interniert werden und fiel dann als Arbeitskraft aus, das heisst, dass der Haushalt nur auf Vaters kleines Einkommen angewiesen war und das reichte nirgendwohin.
Nun kam noch mein Studium hinzu, das im Ganzen betrachtet recht teuer war. Ich kaufte nun meine Schulbücher im Antiquariat, versuchte beim Essen zu sparen und fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule, statt mit dem Zug. Als man mich darauf aufmerksam machte, dass ich von der Schule ein Stipendium kriegen könnte, dass man mir zum Beispiel die Bahnfahrt bezahlen würde, winkte mein Vater energisch ab und meinte, so lange wir es selber machen könnten würden wir nicht betteln gehen und körperliche Betätigung sei übrigens gut für mich Stubenhocker.
Die Hinfahrt am Morgen war einfach, denn es ging, eine knappe Stunde vor allem abwärts bis zum Stadtrand, dann, zum Teil auf Schleichpfaden quer durch Winterthur.
Für die Rückfahrt musste ich zwei Stunden rechnen, aufwärts. Ein Stück der Hauptstrasse, die „Kempttaler - Kurven“ musste man sogar das Rad schieben oder sich an einen schweren LKW anhängen, die damals noch relativ langsam die Kurven hochgekrochen sind. Beim Bahnhof, dort wo die Steigung beginnt, mussten die schweren Brummer einen niedrigeren Gang einlegen, dabei verlangsamten sie die Fahrt (und stiessen eine schwarze Rauchwolke aus). Das war der Moment wo man mit einem kurzen Sprint das Fahrzeug einholen und sich daran festhalten konnte. Nach zwei oder drei Kilometern war die Talkante erreicht und dann musste man loslassen (Gangschaltung, schwarze Rauchwolke) wollte man sich nicht in Gefahr bringen, denn nun raste der Brummi davon.
Samstagnachmittag half ich meist meinem Vater bei Arbeiten , die er nicht alleine erledigen konnte und bekam eine leise Ahnung von der Kunst der Ofenbauerei. Wir bauten und renovierten Kaminfeuer, Kachelöfen und hatten vor allem Arbeit mit der damals beginnenden Mode der Gartengrill und Barbecues.
Eines Tages bemerkte ich, dass Vaters Unterarme rot und entzündet waren und machte ihn darauf aufmerksam. Ach das sei nichts, meinte er, das komme vom Zement und es werde gleich wieder vergehen.
Tat es aber nicht, sondern wurde schlimmer.
Der Arzt stufte es als typische Berufskrankheit ein, als Zementunverträglichkeit und riet ihm, den Beruf zu wechseln.
Er wollte ihn auch bei der damals neuen Invalidenversicherung melden , damit er eine kleine Rente erhalte, auf die er Anrecht habe.
„Wir sind keine Bettler,“ war die knappe und klare Antwort.
Dann solle er wenigstens bei der Arbeit Handschuhe tragen, riet der Arzt.
Seine Hände könnten viel ertragen, er sei doch kein Studierter, wehrte sich mein Vater.
Nein, kein Studierter, gab ihm der Arzt recht, aber deswegen müsse man auch nicht gleich ein sturer Dickschädel sein.
Ich lebte in zwei Welten. Zuhause die Armut, die Entbehrung, die Krankheit meiner Mutter und Vaters Hautprobleme, dazu kam die allgemein bedrückte Stimmung der trostlosen Hoffnungslosigkeit.
In der Schule, dieser Insel des Friedens herrschte Wohlstand, allgemeine Zufriedenheit, manchmal sogar Sattheit und Blasiertheit. Natürlich gab es da auch Probleme, Ärger und Enttäuschung, aber im Grunde genommen ging es um nichts Wichtiges. Manchmal wurde einer von der „Notenkeule“, von schlechten Zensuren getroffen, es gab Bestrafungen, die man sich aber selber eingebrockt hatte, es gab den ersten Liebeskummer und den ersten Kater, weil das Bier am Vorabend zu warm gewesen war.
Ich ärgerte mich oft, wenn so ein eingebildeter Affe von Lehrer vor der Klasse seine Weisheit und unseren Lehrstoff, gnädig und tröpfchenweise von sich gab und wir schlürften wissbegierig das Manna von seinen Lippen, aber wir kamen nicht vorwärts. Wir vertrödelten Stunden um Stunden für ein Kapitel, das man in zehn Minuten hätte abarbeiten können. Dabei ging mir durch den Kopf, dass sich jetzt meine Mutter mit schmerzenden, krummen Fingern am Waschtrog einer vornehmen Familie für mich, ihren Sohn, abrackerte und ich sass daumendrehend auf meiner Bank und hörte mir im Halbschlaf die inhaltslose Litanei des Geschichtslehrers an. Oder ich sah Vater, der mit wunden Armen mit seinem selber entwickelten Spezialmörtel die Schamottsteine eines Ofens aufschichtete und ich sass friedlich und schlaftrunken in meiner Bank, während unser Deutschlehrer, am offenen Fenster stehend, seine Weisheit auf den Schulplatz hinausplärrte, wo sich die Spatzen um Brotkrumen stritten. Aber jetzt wissen wenigstens alle Sperlinge der Stadt, weshalb die Judith im „Grünen Heinrich“ dunkle Augen hatte. Gibt es in Gottfried Kellers Werk auch eine Frau mit grünen Augen (und roten Haaren) so, wie Barbara? Das wäre doch eine Untersuchung wert.
In der Bio – Stunde dozierte ein angegrauter Lahmarsch monatelang über die Systematik der Insekten, seine halbleise, monotone Stimme wirkte wie ein Wiegenlied … Mundwerkzeuge beissend, saugend, stechend, leckend … ja leck mir …
Und wenn mich sechs Jahre später ein kleiner Schüler fragt, ob die Waschbären auch Fleisch fressen, weiss ich nicht einmal in welchem Buch ich nachschlagen kann.
(Statt der Wikipedia gab’s damals nur so riesige, mindestens sechsbändige Lexika.)
Die einzige spannende Stunde war Mathematik. Da war wenigstens die Lehrerin für mich ein Grund keine Lektion zu verpassen, aber auch der Stoff war spannend und faszinierend und wenn ich es einmal zu einfach fand, dann hatte mir die „rote Dame“ eine extra schwierige Hausaufgabe an der ich mir die Zähne ausbeissen konnte. Manchmal musste ich mich schon zusammenreissen um mich auf die Mathe zu konzentrieren, wenn sie da vor uns stand, vielleicht in ihrem gelbgrünen Kleid, grazil wie eine Antilope, mit ihrem schwebenden Gang, mit ihrem schlanken, mädchenhaften Körper … und wenn dich diese grünen Augen anblickten, wenn du ihre warme, weiche Stimme hörtest, da erstarrte man einfach wie das Kaninchen vor der Schlange mit dem einzigen Wunsch : gefressen zu werden …
Zuhause summierten sich inzwischen die Probleme. Auf dem Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad wurde meine Mutter von einem Auto von der Strasse gedrängt und stürzte in den Seitengraben. Ausser Prellungen und einem Rippenbruch war die rechte Wade eine einzige riesige Fleischwunde. Da sich der Fahrer gleich davongemacht hatte blieb meiner Mutter ausser einer nie mehr heilenden Wunde auch noch die Arzt- und Spitalrechnung zu bezahlen.
Auch der Vater hatte immer mehr Probleme mit seiner Zementallergie, und er konnte immer weniger Aufträge annehmen.
Mir war klar, dass ich mithelfen musste, damit wir finanziell über die Runden kamen, meine Arbeit während der Ferien verschafften mir bestenfalls mein Taschengeld, das mir ein frugales Mittagsmahl erlaubte. Etwas Milch, Brot, vielleicht mal eine Wurst, die ich auf dem, der Schule angrenzenden alten Friedhof verzehrte.
Es war ein romantischer, ja geheimnisvoller Park mit riesigen alten Bäumen, grossen Rhododendronbüschen, bemoosten Grabsteinen und mit einer zerfallenden Grabkapelle mittendrin.
Im „Stadtanzeiger“ fiel mir ein kleines Inserat auf bei den Stellenangeboten, es war in der unverkennbar rührenden Rechtschreibung eines Italieners abgefasst. Er suchte jemanden, der ihm bei der Korrespondenz mit den Behörden half. Das schien mir der richtige Job für mich zu sein. In einer Freistunde am Morgen fuhr ich hin.
Es handelte sich um ein verrusstes, rauchiges Bierlokal an der Steinberggasse, also mitten in der Altstadt, wo noch ein Hauch von Echtheit geblieben ist.
Es war noch geschlossen aber auf mein Klopfen öffnete sich sofort die Türe. Eine echte Italienermamma musterte mich mit strengem Blick, doch als sie erfuhr, weswegen ich gekommen war, zog sie mich gleich in die Wirtsstube und rief ihrem Mann : „O, Giuseppe, vieni !“
Dann fragte sie mich, ob ich schon gefrühstückt habe und ohne meine Antwort abzuwarten machte sie sich an der Kaffeemaschine zu schaffen und schleppte Brötchen herbei. Sie fragte mich nach meinem Namen und meinte dann, sie werde mich Giovanni nennen, das sei einfacher für sie.
Ihr Name sei Maria und ihr Mann, der gerade hereinkam, sei Giuseppe und ihr Sohn, der Antonio sei in der Schule. Er sei Studente, drüben im Altstadtschulhaus, er sei bravo und lerne gut Deutsch. (Er war damals ein sechsjähriger Erstklässler, dieser „Studente“)
Ich begann meine Arbeit als Dolmetscher (und lernte dabei Italienisch), wenn Beppe auf ein Amt musste, erledigte seine Korrespondenz und den ganzen amtlichen Papierkrieg. Die Buchhaltung kam dann auch noch in mein Pflichtenheft, am Samstagabend bediente ich als Kellner und wenn es nötig war, half ich dem kleinen Toni bei seinen Hausaufgaben und trainierte ihn in der deutschen Sprache.
Über der Kneipe waren noch drei Wohnungen, die den altstädtischen Charme behalten hatten, das heisst sie waren total heruntergekommen und ohne jeglichen Komfort. Immerhin gab es ein Klosett und einen Kalt - Wasserhahn in der Küche.
Im ersten Stock wohnte die Wirtsfamilie, darüber hausten drei Studenten des Technikums und in der dunkeln Zweizimmer - Dachwohnung, mit ihren stilechten Abschrägungen, der wirksamen Dachheizung im Sommer und der eisigen Frischluftzufuhr im Winter zog ich schliesslich ein. Der bescheidene Zins von zwanzig Franken pro Monat war auch für meine Verhältnisse bezahlbar.
Für mich war das ein Glücksfall, denn mein täglicher Reiseweg hatte sich um Stunden verkürzt, meine Eltern wurden entlastet und ich hatte meine Autonomie gewonnen. Ich brauchte freilich auch wieder Zeit um mich in meine neue Arbeit einzuleben, denn das war alles Neuland für mich, dieser Papierkrieg, Buchhaltung und Steuererklärung , aber ich bekam unverhofft und zufällig Hilfe von kompetenter Seite, von einer Ex - Schulfreundin, von Margrit, die sich in dieser Materie ausbilden liess.
Wenn wir an scheinbar unlösbare Probleme stiessen, konnte sie ihre Lehrer um Hilfe bitten, die uns halfen. Mit der Zeit machte mir diese „Zahlenbeigerei“ sogar Freude und ich war auf die tadellose Buchführung der Kneipe mächtig stolz.
Den Friedhof neben der Schule besuchte ich fast täglich. Manchmal setzte ich mich für einige Zeit unter einen der mächtigen Bäume um auszuruhen und um neue Kraft zu schöpfen. Ich hatte das Gefühl, dass von den dicken Stämmen eine Kraft ausging, die man auf sich einwirken lassen konnte. Wenn ich die Stirne an die raue Borke drückte, fühlte ich als erstes die Beschaffenheit des Materials, ein schwacher Schmerz auf der Haut, dann kam die Kühle, die sich langsam in meiner Stirne ausbreitete und dann plötzlich ein Strom von Ruhe und Frieden und Entspannung. Nach einigen Minuten drang eine Kraft in mich ein, die mich glücklich machte, die mich stärkte und meine Gedanken wurden wieder klar, der Verstand wurde scharf, kritisch und analysierend.
Manchmal setzte ich mich ins Gras (oder den Schnee), lehnte mich an einen dieser Stämme, schloss die Augen und liess meinen Gedanken freien Lauf und gab mich dem Rauschen oder Geflüster des Laubes hin.
Meistens schlief ich dann ein und wachte, wenige Minuten später wieder auf und fühlte mich dann frisch und gestärkt und voller Lebenslust.
Einmal lag ich in einer dunkeln Taxus – Hecke und versuchte mich an einem mathematischen Problem, das mir „Barbara“ am Morgen zugesteckt hatte, aber ich wurde immer wieder abgelenkt durch Kindergeschrei.
Dann sah ich auf dem Kiesweg eine lustige Prozession. Vorneweg zwei kleine Jungen mit Blumenkränzen im Haar und jeder hatte eine Zeitung, die zu einer Tüte gedreht war vor dem Mund und mit lautem Tuten markierten sie die Trompeter. Hinter ihnen schritt ein kleines Mädchen mit einem Blatt des Riesenkerbels als Sonnenschirm und streute Blumen auf den Weg. Dann kam eine junge Frau mit einem Kinderwagen mit zwei ganz kleinen Kindern, die zufrieden in die Welt hinausträllerten. Es war eine Augenweide, es war wie ein Bild aus alten Kinderbüchern.
Schliesslich schwenkte der Zug auf den Weg ein, an dem ich sass und als die Truppe näher kam, schaute ich etwas genauer hin. Diese junge Frau, das war doch Josefine, eine Mitschülerin, still und fast unsichtbar, am Ende der dritten Bankreihe, ja, es war tatsächlich Josy.
Mit ihren Geschwistern war sie streng und sehr lieb. Sie hatte unendlich viele Ideen, wie sie die kleine Bande in Trab halten konnte. Da wurde ein Raupe auf einem Blatt beobachtet, ein morscher Baumstamm, der am Boden lag war mal eine Kutsche, dann ein Berg, den es zu besteigen galt und dann ein Elefantenrücken auf dem man reiten konnte und schliesslich noch das hohe Seil im Zirkus auf dem die Kleinen ihre Balanceakte aufführen konnten. Und so ging es durch den ganzen Park.
Ich gesellte mich zu der Kinderschar und wurde bald einmal als Reitkamel und dann als Springpferd gebraucht. Punkt vier Uhr kehrten sie nach Hause zurück, weil Josy um fünf Uhr zur Geigenstunde musste.
Ja, ich erinnerte mich, dass schon jemand in der Klasse ihr Können auf der Violine gelobt hatte.
Josy. Das stille Mauerblümchen, das sich immer scheu zurückhielt, bescheiden und genügsam.
Ob diese Lebensstrategie sich bewähren würde?