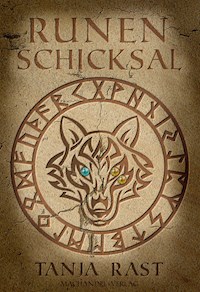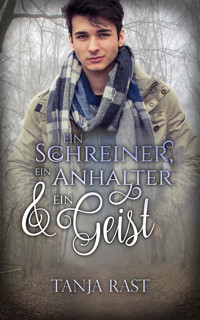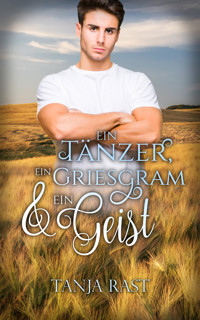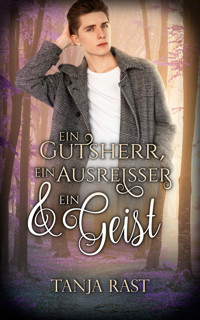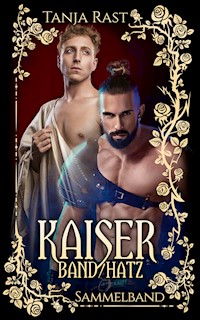4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Epische High Fantasy mit Helden, Schlachten, Magie und einer Romanze, die sich wie ein rotes Seidenband durch die Geschichte zieht und weder drohende Niederlagen noch selbst den Tod fürchtet.
Für Rebby ist die Zeit gekommen, Mut zu beweisen: Skrupellose Thronräuber nahmen ihr die Familie und ihr Königreich, doch nun bricht sie auf, um zurückzuerobern, was ihr gehört. Der Paladin Cajan bietet seine Hilfe an, doch kann Rebby ihm vertrauen? Schließlich ist er ein Halbelf, Angehöriger eines versklavten Volkes und weniger wert als ein Straßenköter. Es fällt Rebby schwer, ihre Vorurteile zu überwinden. Doch um ihren Plan umzusetzen, ist sie auf Cajan angewiesen, der so anders ist als erwartet: beharrlich und loyal bis zur Selbstaufgabe. Schon bald muss sich Rebby nicht nur gegen übermächtige Feinde zur Wehr setzen, sondern sich auch ihren unerwarteten Gefühlen für Cajan stellen ...
Die Romane können unabhängig voneinander und in beliebiger Reihenfolge gelesen werden.
Dies ist eine überarbeitete Neuauflage meines Romans
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cajan
Tanja Rast
Inhaltswarnungen
Kann Spuren von Erdnüssen enthalten!
Es gibt Inhalte, die Betroffene triggern können, das heißt, dass womöglich alte Traumata wieder an die Oberfläche geholt werden. Deswegen habe ich für diese Personen eine Liste mit möglichen Inhaltswarnungen für alle meine Romane zusammengestellt:
www.tanja-rast.de/inhaltswarnungen
1.
Der Paladin des Fürsten
Rebby saß auf der Fensterbank, die Beine angezogen, die Finger um ein Knie verschränkt. Die schweren Vorhänge schirmten sie vom Saal ab, sodass sie sich beinahe wie alleine in einem kleinen Zimmer fühlen konnte. Ein Augenblick nur für sich, statt neugierigen Blicken ausgesetzt zu sein wie so oft in letzter Zeit, seitdem ihr Großvater sie in eine Kutsche geworfen und durch beinahe unberührte Wildnis hierher gebracht hatte.
Hinter ihnen war die Festung in Flammen aufgegangen. Ihre Bücher, Spielsachen aus früher Kindheit, Rebbys Puppen, alle Zeichnungen waren ein Raub der Flammen geworden.
Ihre Vergangenheit war dahin. Sie war mit nichts als der Kleidung, die sie trug, hier angekommen.
Sie besaß nichts mehr außer dem Großvater, und sie wusste, dass sich ihre Wege hier trennten. Zu seiner Sicherheit, zu ihrer Sicherheit. Es war ein entsetzliches Gefühl, den letzten Freund und Gefährten zu verlieren.
Aber Großvater war zu alt, um sie weiterhin zu beschützen. Er konnte im Hintergrund agieren, noch immer die Fäden ziehen und Nachrichten an Verbündete senden. Aber den weiteren Weg musste sie alleine bestreiten, und sie wusste es genau.
Es gab keine Möglichkeit mehr, diese letzte Reise weiter aufzuschieben – keine Möglichkeit und auch keinen Grund. Entweder Rebby tat jetzt, worauf ihr Großvater sie die letzten Jahre vorbereitet hatte, oder sie konnte alle Hoffnungen endgültig fahren lassen.
Sie liebte ihn zu sehr, als dass sie ihn auf diesen gefährlichen Weg mitnehmen oder ihn enttäuschen wollte.
Das Tor zum Innenhof der Festung schwang langsam auf, und ein Reitertrupp ritt auf den gepflasterten Hof und zog somit Rebbys Aufmerksamkeit auf sich. Außer faulen Katzen und kratzenden Hühnern hatte der Hof bislang wenig Aufregendes präsentiert, seitdem sie vor vier Tagen angekommen war.
Dies war die Festung des letzten Getreuen, der riskiert hatte, die Flüchtlinge aufzunehmen. Rebby strich sich Haarsträhnen aus dem Gesicht und starrte nach draußen.
Sie beobachtete die Neuankömmlinge neugierig. Knechte strömten aus den Stallungen, nahmen Zügel entgegen, hoben Gepäck von den müden Tieren, während Reiter um Reiter sich aus dem Sattel hievte.
Ein bunter Trupp. Ihre Rüstungen wirkten eher praktisch denn prächtig. Die Männer hielten sich dicht beieinander. Ihre Pferde sahen erschöpft aus, aber nicht eines war dabei, das lahmte oder abgemagert schien. Rebby ließ den Blick über die Männer fliegen und hielt unwillkürlich vor Anspannung die Luft an. Sie wusste, wozu diese Krieger in die Festung gerufen worden waren. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, denn die Stunde des Abschieds von ihrem Großvater und auch von Fürst Montpar rückte mit der Ankunft dieser Männer in greifbare Nähe.
Rebby konnte den Anführer mühelos ausmachen. Er stieg als Letzter ab, nachdem er sich zuerst gründlich umgesehen hatte.
Ein großer Mann, größer noch als Großvater in seiner Jugend gewesen sein mochte. Sie erspähte breite Schultern und lange muskulöse Beine. Seine Rüstung sah ebenso schäbig aus wie die seiner Männer, aber irgendetwas an seiner Haltung imponierte Rebby, die sich weiter vorbeugte und hoffte, dass niemand sie bemerkte, während sie nach draußen starrte.
Ja, er war der Anführer! Auf einen knappen Wink seinerseits verschwanden die übrigen Krieger in den Stallungen. So müde die anderen Pferde gewirkt hatten, seines war temperamentvoll und ärgerte die Stallknechte, die es hineinführen wollten. Erst, als der Reiter ihm einen Klaps auf die runde Kruppe gab, ließ der Grauschimmel sich davonführen.
Rebby lächelte. Sie war früher viel mit ihrem Großvater ausgeritten – als das noch gefahrlos möglich gewesen war. Das Pferd gefiel ihr.
Als sie eine Tür zuschlagen hörte, erstarrte Rebby. Sie war nicht mehr alleine im Saal. Aber da sie zwischen Vorhang und Fenster saß, konnte niemand ahnen, dass sie hier war. Sie spitzte die Ohren. Das mochte als Lauschen zu werten sein, aber es war ihr gleichgültig. In ihrer Lage konnte sie sich den Luxus von moralischen Bedenken nicht leisten. Je mehr sie wusste, umso besser war sie auf den Ernstfall vorbereitet.
Ihr Großvater sagte leise: »Er ist kein Mensch, nicht wahr?«
Rebby lief ein Schauer über den Rücken. Wer war kein Mensch? Und wenn dieser Jemand kein Mensch war – was war er dann?
Sie atmete lautlos durch halb geöffnete Lippen und beugte sich angespannt vor, um jedes Wort der leise geführten Unterhaltung aufschnappen zu können.
Fürst Hiron von Montpar – ihr Gastgeber in dieser Festung – antwortete mit leicht schleppender, gelangweilter Stimme: »Er ist Halbelf und mein bester Mann. Sein Vater war der Paladin meines Vaters. Und Crollan hat alles getan, um sich mein Vertrauen vollkommen zu verdienen. Du kannst unbesorgt sein.«
»Es kann mir nicht gefallen, Rebby dem Schutz eines halben Tieres zu unterstellen.«
Rebby musste sich zusammenreißen, um nicht überrascht nach Atem zu ringen. Ihr Blick flog wieder nach draußen. Ein Halbelf? Und Montpar wollte sie dem Schutz dieses Viehs anvertrauen? Das konnte nicht sein Ernst sein, gleichgültig, welchen Nutzen er bislang selbst aus der Kreatur und deren hündischer Anhänglichkeit geschlagen hatte!
Für einen Moment erwog sie, ihr Versteck aufzugeben und sich in das Gespräch einzumischen. Sie unterdrückte den Impuls. Vielleicht erfuhr sie mehr, wenn sie still blieb; bestimmt erstickte ihr Großvater dieses Ansinnen noch im Keim.
»Er ist groß, stark und wild, das stimmt. Aber er ist kein Tier. Und selbst, wenn er eines wäre, dann wäre es ein hochintelligentes und vollkommen loyales Tier. Er hält seit Jahren meine Grenze nach Norden. Er hat Aufstände für mich niedergeschlagen. Hätte ich einen Sohn, würde ich ihn Crollans Obhut und Ausbildung übergeben.«
»Sein Vater war ein Mensch?«
»Meines Vaters und dann mein Paladin. Der treueste Diener, den ein Fürst sich wünschen kann. Er kaufte die Mutter auf dem Sklavenmarkt, und sie blieb freiwillig bei ihm, bis das Kind fünf oder sechs war. Ich stelle dir den Mann vor. Du wirst nicht viel Elfenhaftes an ihm finden, alter Freund.«
Rebbys Herz klopfte. Sie hatte ein einziges Mal einen wilden Elfen gesehen. Ein schlankes, viel zu großes, dünnes Ding mit spitzen Ohren, die höher als die Silhouette des Kopfes aufgeragt hatten. Wie das Vieh gestunken hatte! Aber es hatte gereicht, laut zu rufen, und der Elf war vor ihr geflohen.
Sie war immer froh und dankbar gewesen, dass ihre Eltern und auch ihr Großvater niemals elfische Sklaven gehalten hatten. Die Biester waren ihr unheimlich, und sie wusste aus Erzählungen, dass sich hinter hündischem Gehorsam und zur Schau getragener Sanftmut wilde Bestien versteckten, die nur auf den richtigen Moment zum Zuschlagen warteten. Wie konnte jemand ruhig schlafen, während ein Elf im Haus war?
Sie konnte die Bedenken ihres Großvaters nur zu gut verstehen. Sie teilte sie sogar von Herzen. Aber Großvater baute auf Montpar. Und auch Rebby hatte gelernt, dem ruhigen, höflichen Mann ein wenig zu vertrauen. Was blieb ihr auch anderes übrig? Es gab niemand mehr, zu dem sie fliehen konnten. Es lebte außer Montpar kein Verbündeter mehr auf dieser Seite der Großen Ebene und des Roten Gebirges.
Nur noch dieser eine Mann stand treu zu Rebby.
Und er gefiel ihr. Auch das musste sie ehrlich vor sich zugeben – wenngleich auch niemals vor Großvater!
Der alte Mann würde es nicht verstehen, wie seine lebhafte Enkelin sich in einen Mann vergaffen könnte, der alt genug war, um ihr Vater zu sein. Aber Montpar erschien stets freundlich und geduldig. Er besaß Humor und Bildung. Außerdem sah er gut aus, fand Rebby, die die letzten vier Jahre ihres Lebens als Junge verkleidet hatte verbringen müssen. Sie sehnte sich nach einem kleinen Techtelmechtel in einer verschwiegenen Ecke, nach einem erfahrenen Liebhaber. Und dieser ruhige Mann mit den ernsten Augen machte es ihr schwer, an ihrer Verkleidung festzuhalten. Er gefiel ihr, aber sie wusste nicht, ob ihm gefallen würde, was er sah. Denn selbst in der scheinbar sicheren Festung des Fürsten Montpar war sie nur als der Junge namens Rebby bekannt. Sie war froh darüber, dass niemand wusste, dass sie ein Mädchen war.
Vor den Augen ihres Großvaters und in einer Notsituation eine Romanze zu beginnen und damit die Tarnung aufzugeben, war das Dümmste, was sie machen konnte.
Rebby war nicht umsonst die würdige Tochter ihrer Mutter. Sie wusste, was sie zu tun hatte, wie sie ihre Ziele erreichen konnte und musste. War sie erst in Sicherheit, konnte sie immer noch Tagträumen über Hiron von Montpar und seinem stets leicht spöttischen Lächeln nachgehen. Götter, sie konnte ihn sogar zu sich rufen lassen und ihn verführen. Aber nicht jetzt. Jetzt war sie Rebby, der Sohn eines ermordeten Verbündeten, der irgendwie in Sicherheit gebracht werden musste.
Das war es, was Großvater Montpar erzählt hatte. Rebby betete, dass der Fürst ihre Verkleidung nicht durchschaute, dass er sich nicht wunderte, wo die Enkelin des alten Mannes sein mochte, warum dieser einen Jungen hierher gebracht hatte. Zu viel stand auf dem Spiel.
Und dann rief Montpar seinen – wie er gesagt hatte – besten Ritter und Paladin, und der stellte sich als Halbelf heraus! Götter, konnte es noch schlimmer werden?
Sie wartete, bis die beiden Männer das Zimmer verlassen hatten, schlüpfte hinter dem Vorhang hervor und rannte durch den Saal zu einer anderen Tür, um möglichst vor ihrem Großvater auf den Hof zu gelangen. Er sollte nicht wissen, dass sie Bescheid wusste. Und was erschien harmloser, als neugierig den Reitertrupp zu inspizieren, wenn sie angeblich ahnungslos war?
Ihr Großvater und vor ihm ihr Vater hatten sie ausgebildet. Sie kannte Krieger und Pferde und war stolz darauf, dass sie Kraft und Reichweite eines Mannes sicher beurteilen, die Leistungsfähigkeit eines Pferdes erkennen konnte. Großvater würde ihre Neugierde verstehen, und sie nutzte die Gelegenheit, einen Blick auf ihren angeblichen Beschützer zu werfen, bevor jemand diesem klarmachte, was von ihm erwartet wurde.
Sie hetzte eine Wendeltreppe hinab und schoss durch eine kleine Pforte auf den Innenhof. Dort stand der Halbelf und wandte sich zu ihr um, als er ihren stürmischen Auftritt bemerkte.
Sie musterte ihn gründlich, als auch schon Montpar und ihr Großvater durch das große Tor traten. Ihr Großvater warf ihr einen raschen Blick zu, den sie möglichst ausdruckslos erwiderte, bevor sie sich wieder auf den Halbelfen konzentrierte und die Kreatur abschätzte. Er war lange nicht so groß wie jener wilde Elf. Aber er war schwerer, breitschultrig und garantiert stärker. Wie ein Mischling aus Kaltblutpferd und Vollblüter vereinte er die Merkmale von Elf und Mensch in sich – beide Erbteile übersteigert.
Er musste furchterregend sein, wenn man ihn zum Gegner hatte. Das wollte sie ihm gerne zugestehen. Aber sie hatte ein sehr ungutes Gefühl in der Magengegend. Wen sah dieses Vieh als Gegner an? Wie kontrollierte Montpar es?
Rebby sah zu, wie der Halbelf vor dem Fürsten auf ein Knie fiel und endlich den Helm abnahm. Seine Ohren waren spitzzulaufend, aber nicht so albern lang wie die des anderen Elfen. Die Augenbrauen waren ein ebenso deutliches Merkmal, von was er abstammte: Von der Nasenwurzel verliefen sie in zwei geraden Linien schräg aufwärts zu den Außenseiten. Es sah fremdartig aus in seinem sonst ziemlich menschlichen Gesicht.
Sie sah ihn nur im Profil und trat neugierig näher. Das, was sie zuerst für Schmutz von der Reise gehalten hatte, war eine Tätowierung, erkannte sie angewidert. Sein Schädel war kahl – ob von Natur aus oder geschoren wusste sie weder, noch kümmerte es sie. Und zwischen seinen Augen begann eine schwarze Tätowierung, die sich in gezackten Linien über seine Stirn bis auf den Kopf hinauf ausbreitete. Es sah barbarisch und wild aus. Unrasiert war der Kerl auch noch. Er wirkte vollkommen verlottert. Das gefiel Rebby überhaupt nicht, und sie hoffte verzweifelt, dass ihr Großvater ihre Sicherheit nicht in diese schmutzigen Hände legte. Bitte, er konnte das doch nicht einen Moment lang ernsthaft in Betracht ziehen!
Ihr war egal, ob Montpar seinen Sohn in die Obhut des Halbelfen geben würde – sie war nicht Montpars Sohn, und was für diesen ungeborenen Bengel gut genug war, konnte für sie nicht genügen.
Sie ließ sich von Kraft und Körpergröße sowie dem beinahe menschlichen Gesicht nicht täuschen.
Welcher Gegensatz zu Montpar, der gepflegt und sauber aussah, dessen charmantes Lächeln aufblitzte, als er auf seinen angeblich besten Ritter und Paladin hinabsah. »Steh auf, Crollan. Du bist nicht den weiten Weg gekommen, um vor mir im Dreck zu kauern.«
Der Halbelf erhob sich – mühelos und viel zu schnell – und warf einen kurzen Blick zu Rebbys Großvater, der ihn ebenso kritisch und aufmerksam zu betrachten schien, wie Rebby selbst es tat.
Falls dem Halbelfen diese Musterung unangenehm war, ließ er es sich nicht anmerken. Aber mehr als wahrscheinlich war er es gewohnt, begafft zu werden. Er war ein Bastard und musste wissen, was Menschen über ihn und seinesgleichen dachten.
Rebby stand unschlüssig einige Schritte neben der Dreiergruppe und wartete das Urteil ihres Großvaters ab. Seiner Weisheit, Erfahrung und Menschenkenntnis musste sie sich beugen. Das war ein böser Witz, dachte Rebby, als der alte Mann ihr mit einem knappen Wink zu verstehen gab, an seine Seite zu treten. Menschenkenntnis konnte ihm bei diesem halben Tier nicht wirklich weiterhelfen.
Aber sie kam gehorsam näher und sah auf in das fremdartige, arrogante Gesicht des Halbelfen, der sie nun deutlich aufmerksamer betrachtete.
Montpar legte ihr eine warme Hand auf die Schulter, drückte beruhigend und sanft zu und erklärte: »Dies ist Rebby, ein Schutzbefohlener meines alten Freundes. Ich will, dass ihr morgen aufbrecht. Der Junge muss die Hauptstadt Torons Hald so schnell wie möglich erreichen.«
»Wie du befiehlst, mein Fürst.«
»Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und ich weiß, dass ich dich nicht auf Gefahren aufmerksam machen muss, Crollan, von denen du so gut weißt wie ich, dass sie überall auf euch lauern werden.«
»Weiß der Tyrann von dem Jungen?«
»Ich hoffe nicht.«
»Wenn er von ihm weiß: Hält er ihn für eine Gefahr?«
»Höchstwahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass er nichts von ihm ahnt.«
Crollan wandte den Blick und sah auf Rebby herab, die sich unter dem Starren der kalten braunen Augen unter diesen merkwürdigen Brauen sehr unbehaglich fühlte. Sie wusste nicht, ob sie Montpars Auswahl eines Beschützers blind vertrauen konnte. Jede Erfahrung und Erinnerung warnte sie, dass sie ihr Leben nicht diesem Mischling anvertrauen durfte.
Der Halbelf war unbestritten eindrucksvoll. Wie er unter Gegnern wüten mochte, musste beeindruckend und erschreckend zugleich sein. Aber er sah halbwegs intelligent aus – kein einfacher Schläger, sondern jemand, der sein Handwerk von klein auf beigebracht bekommen hatte und verstand, worum es ging. Jemand, der mehr als einen Kampf überlebt hatte. Reine Raufbolde überstanden selten ihre erste Schlacht, das wusste Rebby.
Sie sah Narben an seiner rechten Schläfe, die sich weiß und in gezackten Linien von seiner sonnengebräunten Haut abhoben. Das ließ ihn zusammen mit den schwarzen Tätowierungen unheimlich wirken und unterstrich auf jeden Fall seine gewaltbereite Ausstrahlung. Er sah aus wie etwas, das jederzeit entfesselt werden konnte.
»Du kannst reiten?«
Rebby nickte nur. Sie war viel zu aufgeregt und hatte Angst, dass ihre Stimme weiblich und hell klingen würde.
»Gut. Wir brechen im Morgengrauen auf. Fürst, gestatte, dass ich meine Männer in Kenntnis setze. Kann ich Vorräte erhalten? Mit einer so weiten Reise habe ich nicht gerechnet. Wir sind sofort aufgebrochen, nachdem deine Nachricht mich erreichte.«
»Natürlich, Crollan. Nimm dir, was du brauchst.«
Montpar wandte sich um, zog Rebby mit sich. Sie beobachtete über die Schulter, wie ihr Großvater den Paladin ein letztes Mal prüfend ansah, bevor er ihr und Montpar folgte.
An der Treppe trennte Montpar sich von ihnen, und die beiden konnten alleine in die Gästezimmer gehen, die ihnen zur Verfügung standen.
»Wie kann er es wagen, mich der Obhut eines halben Tiers zu übergeben?«, fragte Rebby, kaum dass die Tür hinter ihnen ins Schloss gefallen war.
Sie marschierte aufgebracht im Zimmer auf und ab, während ihr Großvater sich auf ein Sofa setzte. Er streckte die Beine aus, sah seine abgearbeiteten Hände an und dann seine Enkelin – mit so viel Geduld im faltigen Gesicht, dass sie sich beinahe schlecht fühlte, weil sie sich aufregte.
»Es ist nicht zu übersehen, ich weiß. Ich hatte gehofft, dass dieser Paladin menschlicher aussieht, sodass es dir nicht sofort ins Auge stechen würde, meine Kleine.«
»Es ist nicht zu übersehen! Wenigstens kann er sprechen! Ich weiß, dass du nur an mich denkst, Großvater. Ich bin dir dankbar für deine Fürsorge und alles, aber …«
»Ich weiß. Du würdest lieber in dieser Festung bleiben und warten, bis Montpar oder einer seiner anderen Ritter dich nach Torons Hald bringt. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Rebby. Du hast gesehen, was mit meiner Burg geschah. Denkst du, dieser Festung wird es anders ergehen? Und was immer dieser Crollan sonst auch ist, er ist Montpars Paladin. Du weißt, dass man das nicht wird, wenn man nicht wirklich gut ist. Ich hatte gehofft, dass Montpar uns einen seiner Ritter gibt, aber er hat seinen Paladin gerufen. Das ist ein Zeichen, dass er die Lage ebenso ernst sieht wie wir. Ja, es ist mehr als unglücklich, dass dieser Paladin ein Halbelf ist, ich weiß.«
Sie rollte mit den Augen, ballte die Fäuste und drehte noch eine Runde auf dem teppichbelegten Steinboden. Schließlich blieb sie abrupt stehen. »Was hältst du von ihm? Du weißt, dass nur dein Urteil für mich Wert hat. Montpar kann ich niemals so sehr vertrauen wie dir, Großvater.«
Er streckte die Hand nach ihr aus, und Rebby eilte zu ihm und setzte sich neben ihn auf das Sofa, sah ihn erwartungsvoll an und wartete auf seine Einschätzung.
»Ich habe von Crollan gehört – ob nun von dem Halbelf oder von seinem Vater kann ich dir nicht sagen. Sie tragen den gleichen Namen. Aber wenn dieser Mischling der Paladin ist, den ich meine, dann ist er ein Meister des Kampfes und versteht viel von Strategie. Er denkt nach, ehe er handelt, Rebby. Und seine Männer vertrauen ihm blind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Halbblut war, das den Kampf um die Höhen von Kenria gewonnen hat, denn sein Vater wäre da schon zu alt gewesen. Vertrau Hiron von Montpar. Er ist unser letzter Freund diesseits des Gebirges. Und ich kann dich nicht länger schützen, meine Kleine.«
»Ich weiß, Großvater, ich weiß das doch.« Sie kuschelte sich in seine Arme und hielt sich an ihm fest.
»Wir haben lange genug an deiner Tarnung gearbeitet. Die letzten vier Jahre seit dem Tod deiner Eltern. Du kannst das. Götter, Mädchen, du hast sogar Montpar getäuscht, und der ist ein Weiberheld.«
Diese Bezeichnung tat Rebby weh, aber sie sagte nichts.
Er fuhr fort: »Vertrau vor allem auf deine Tarnung als Klosterschüler, Rebby. Diese Männer sind von Jugend an zu Kriegern ausgebildet worden. Ich bezweifle, dass auch nur einer von ihnen lesen und schreiben kann. Jemand, der im Kloster aufgewachsen ist, ist für sie fremdartig. Sie werden verräterische Zeichen wahrscheinlich deiner vermeintlichen Erziehung, den Mönchen und vielen Büchern zuschreiben.«
Rebby nickte. Den weltfremden und respektablen Bücherwurm konnte sie überzeugend darstellen. Die schlichte, weite Kleidung half, Rebbys ohnehin nicht sehr ausgeprägte Kurven zu verbergen, der strenge Kurzhaarschnitt trug dazu bei, ihr Gesicht ein wenig kantiger wirken zu lassen. Sollten die Krieger sie für einen unerfahrenen Milchbart halten, der noch grün hinter den Ohren war!
Der Großvater seufzte und schien einen Augenblick lang angestrengt nachzudenken. »Mir fällt nichts mehr ein, was wir noch tun können. Meine Nachrichten sind ausgesandt, du kennst alle Einzelheiten meiner Pläne. Verzweifelt mögen sie sein, doch ich sehe keinen anderen Weg. Du wirst es schaffen, weil du musst, Rebby. Morgen früh bei Sonnenaufgang werden wir uns verabschieden. Ich werde zu den Göttern beten, dass Crollan so gut ist wie sein Ruf. Aber wir haben keine Alternative und keine Zeit mehr, Kleine. Uns bleibt kein Raum mehr zum Manövrieren. Wenn du eine Aussicht auf Leben und dein Recht haben willst, müssen wir uns trennen, und du musst mit diesem Halbelfen gehen und darauf vertrauen, dass Montpar den richtigen Mann ausgesucht hat.«
»Er ist kein Mann«, merkte Rebby undankbar an.
»Dann den richtigen Krieger, meine Liebe.«
»Das hoffe ich von Herzen.«
»Ich auch, Rebby, ich auch.«
Es war kalt und unangenehm feucht, als Rebby auf den Burghof trat. Sie hatte mit Montpar und ihrem Großvater gefrühstückt, während draußen bereits die Knechte die Pferde des kleinen Trupps vorbereitet hatten. Durch die Fenster hatte Rebby dem Treiben zugesehen. Der Appetit wurde ihr gründlich verdorben, als der Halbelf das Zimmer betrat und seinem Fürsten Bericht erstattete, welche Vorräte er mitnahm und wann er bereit zum Abritt wäre.
Sie beobachtete ihn möglichst unauffällig. Es war nicht nur seine Abstammung von einer versklavten Elfe. Wie hatte sein Vater sich überwinden können, das lange, dünne Ding zu besteigen? Wie hatte diese Vereinigung ausgerechnet den Erben eines Festungsritters hervorbringen können? Warum hatte der Vater den Mischling nicht gleich nach der Geburt ertränkt?
Aber mehr noch als das beunruhigte Rebby das selbstsichere Auftreten des Halbelfen. Diener traten respektvoll beiseite, wenn er an ihnen vorbeiging. Da waren weder Ekel noch Verachtung. Sie behandelten ihn, wie sie wohl mit jedem anderen Ritter oder gar einem menschlichen Paladin ihres Herrn umgegangen wären. Er benahm sich, als wäre er den Menschen um sich herum mindestens ebenbürtig.
Es war ein abstoßendes Schauspiel, fand Rebby, die sich bemühte, den Paladin nur aus den Augenwinkeln zu beobachten, sodass dieser ihr Interesse nicht bemerken konnte.
Elfen standen nur ein kleines Stück über einem Haushund – wenn sie verstanden hatten, dass ihre Rolle eine dienende war. Aber dieses Mischblut tat so, als wäre er ein Mensch. Hatte er nie in einen Spiegel gesehen? Seine Augenbrauen und die lächerlichen Ohren betrachtet? Oder dachte er wirklich, dass seine militärischen Erfolge und seine Treue zu Montpar ihn auf eine Stufe mit einem Menschen stellten? Wie dumm war dieses Geschöpf eigentlich?
Sie trug ihr Gepäck auf den Hof, wo es ihr von einem der Krieger des Paladins abgenommen und auf einem Packpferd verladen wurde.
Es machte sie fassungslos, denn dies war ein Mensch! Und er gehorchte einem Halbelfen – wie alle anderen, die sich um die Pferde kümmerten, die Tiere überprüften, bewegten und beluden.
Sein ganzer Trupp bestand aus Menschen, und sie behandelten ihn, als wäre er nicht ein halbes Tier.
»Du heißt Rebby?«, fragte der Halbelf genau hinter ihr, und sie fuhr erschrocken herum, da sie nicht gehört hatte, wie er sich ihr genähert hatte.
Sie nickte, starrte hinauf in das fremdartige Gesicht. Die braunen Augen sahen fast gelangweilt aus. Offenbar war er es gewohnt, ein Gaffobjekt zu sein.
»Ich bin Cajan von Crollan. Ich weiß, dass ich spitze Ohren habe, und was du über mich denkst.«
»Tust du das?«, gab sie empört zurück.
»Ein Vieh, das nur eine Handbreit über einem Köter steht. Natürlich weiß ich das. Ich werde dich sicher nach Torons Hald bringen – ob es dir passt oder nicht. Was auch immer duauch in mir siehst, ich folge dem Befehl meines Herrn. Vielleicht denkst du anders über mich und die Wahl meines Fürsten, nachdem ich diese Aufgabe erfüllt habe. Bis dahin erwarte ich, dass du mir gehorchst, dich nicht selbst in Gefahr bringst und niemals im Weg stehst.« Er nickte ihr knapp zu und ging dann weiter.
Sie blieb kochend vor Wut stehen. Aber ihr blieb keine Zeit, sich weiter in diesen Zorn zu steigern, denn ihr Großvater trat zu ihr, nahm sie in den Arm und drückte sie an sich. »Pass gut auf dich auf, Rebby.«
Sie hatten lange darüber gesprochen, ob sie auch als vermeintlicher junger Mann diesen Namen tragen sollte. Es war der Kosename aus ihrer frühesten Kindheit. Aber es war ihnen sicher erschienen. Ihr wirklicher Name stammte aus der alten Sprache und war nicht sehr geläufig, das Gleiche sollte auf den Kosenamen zutreffen. Und es war sicherer, wenn sie mit einem Namen angesprochen wurde, der ihr vertraut war, der zu ihr gehörte und auf den sie selbstverständlich hörte. Dachte sie sich einen tollen Männernamen aus, würde sie im Ernstfall möglicherweise nicht darauf antworten. Und das konnte tödlich sein, wie sie genau wusste.
Letztendlich war es die Entscheidung des Großvaters gewesen, der genau dieses Argument verwandt hatte: Sie hörte auf ihren eigenen Namen, ihr konnte kein Fehler unterlaufen. Er hatte alles getan, was in seiner Macht stand, um ihr diese Reise zu ermöglichen.
Und jetzt mussten sie sich trennen, und Rebby wollte weinen und sich an ihm festklammern. Er war ihr letzter Freund, und jetzt musste er die Verantwortung, die er seit Jahren gerne getragen hatte, in die Hände des Halbelfen legen.
Sie wusste, dass ihr Großvater dem Paladin ebenso kritisch gegenüberstand wie sie. Aber es gab tatsächlich keine Alternative mehr. Keine Zeit, keine Möglichkeit, irgendetwas zu ändern oder nach einem anderen Weg zu suchen.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie ganz leise.
»Ich weiß. Und jetzt geh. Sei tapfer, Rebby.«
»Ich will dich nicht enttäuschen.«
»Das kannst du nicht. Was immer du tust, Rebby, du weißt, dass ich stolz auf dich bin. Und eines noch: Lege dich nicht mit dem Paladin an. Ich kenne dein Temperament. Aber dieser Krieger ist jetzt alles, was zwischen dir und den Mördern steht, die der Tyrann auf dich hetzen wird. Wenn es zu einem Kampf kommt, sieh zu, dass du dich auf der linken Seite des Paladins hältst. Verstehst du?«
Sie nickte, schluckte tapfer die Tränen, die sie übermannen wollten, wandte sich mit einem Ruck ab und ging zu Crollan, der neben seinem Grauschimmel stand und offenbar nur auf sie wartete.
Wortlos wies er ihr ein Reittier zu, bevor er sich mit der Leichtigkeit langer Übung in den Sattel schwang, einen scharfen Blick unter schrägen Augenbrauen über seine Männer und Rebby schweifen ließ, ehe er den Befehl zum Abritt gab.
Rebby fand sich neben einem der Krieger und einem Packpferd wieder. Sie zwang sich, nicht zurück zu ihrem Großvater zu sehen, und trieb sanft ihr Ross an, das neben dem Lastentier in Schritt fiel und sie aus der Festung des Fürsten Montpar in graue Morgendämmerung trug. Mitten hinein in Ungewissheit und wahrscheinlich mehr als eine Gefahr.
Sie litt jetzt schon an Heimweh. Nicht nach der Burg ihrer Eltern, auf der sie ihre Kindheit verbracht hatte, oder nach der Burg ihres Großvaters. Sie vermisste das Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen. Aber es gab kein Zurück mehr. Auch Montpars Festung war nicht sicher, und sie wusste das genau.
Weit vorne ritt der Halbelf. Sein langer Umhang umwehte die Kruppe des Grauschimmels. Der Mischling hielt sich lässig, aber gerade. Die breiten Schultern, der schimmernde Helm und die griffbereiten Waffen sollten Rebby ein Gefühl der Sicherheit geben, aber noch nie zuvor in ihrem Leben hatte sie sich so gefürchtet.
Während nur das Klappern der Hufe auf der Straße zu hören war und hin und wieder ein Prusten eines aufgeregten Pferdes, zählte Rebby die Krieger des Paladins. Zusammen mit dem Hünen gerade einmal ein volles Dutzend. Sie stellten eine jämmerlich kleine Gruppe dar, dachte sie verzweifelt. Die Männer sahen abgerissen, schmutzig und nicht im Geringsten vertrauenerweckend aus. Am Vortag hatte sie diesen Anblick noch auf den hastigen Ritt zur Festung Montpars geschoben, aber keiner der Kerle hatte sich heute Morgen gewaschen, bevor er aufs Pferd gestiegen war. Die Rüstungen wirkten uneinheitlich, keiner trug ein Wappen oder einen bunten Umhang. Aus der Ferne sahen sie bestimmt wie ein Trupp Straßenräuber aus.
Dann begriff sie, dass das durchaus Absicht sein könnte. Das Wappen Montpars in das Herrschaftsgebiet des Tyrannen zu tragen, wäre das Dümmste, was das Halbblut tun konnte.
Der Trupp war klein und dadurch im Notfall schneller auf der Flucht. Und was nützte eine kleine Armee, wenn die Heere des Feindes nach Tausenden von Köpfen gezählt wurden? Niemand außer ihm konnte eine so gewaltige Menge an Soldaten aufstellen.
Sie legte den Kopf schräg und sah nach vorne, wo der Paladin ritt. Entweder hatte er nicht mehr Männer zur Verfügung, was sie angesichts der Truppen in Montpars Burg nicht ganz glauben konnte, oder er hatte sich wirklich etwas bei der Zusammenstellung seiner kleinen Schar gedacht. Vielleicht hatte sie zumindest seiner Intelligenz unrecht getan.
Während die Sonne am Horizont höher kroch, betrachtete sie die Männer um sich herum genauer. Nicht ein junger Mann. Nicht ein Krieger unter dreißig. Wie alt mochte der Halbelf sein? Es war schwer, sein Alter zu schätzen wegen dieser Augenbrauen und der Tätowierung, aber sie fand, dass die Fältchen um seine Augen und Mundwinkel auf ein höheres Alter als vierzig schließen lassen konnten.
Er musste wirklich gut sein, wenn er im Dienst eines Fürsten so alt geworden war.
Ein wenig versöhnt mit der Auswahl ihres Gastgebers ritt Rebby weiter. Mit der Anwesenheit eines Halbelfen konnte sie nicht versöhnt werden, und das wusste Crollan bestimmt genau. Er erwartete es auch nicht, das hatte seine kleine Rede bewiesen. Er forderte Rebbys abschließendes Urteil, nachdem er seine Aufgabe erfüllt hatte. Dass er sie erfüllen konnte und würde, daran schien er nicht einen Augenblick zu zweifeln. Gut, sie wollte ihm so viel Gerechtigkeit zubilligen, wenn er sie heil bei ihren Verbündeten in Torons Hald ablieferte.
Aber bis dahin war es noch weit.
2.
Die Furt
Sie legten die erste Rast kurz vor Mittag ein, und Rebby war mehr als froh, aus dem Sattel zu kommen. Sie schwang das rechte Bein mühsam über die Kruppe des Tieres, ließ sich zu Boden gleiten, und ihre Knie gaben einfach nach.
Verzweifelt hielt sie sich am Bügelriemen fest und betete, dass niemand ihre Schwäche beobachtete. Es war zu lange her, dass sie eine solche Zeit und Strecke auf einem Pferd hatte bewältigen müssen. Ihre Beine zitterten, die Knie taten weh und drohten, sie neben dem Tier auf dem Erdboden abzusetzen.
Langsam wurde es besser, und sie ließ vorsichtig den Riemen los. Als hätte er nur darauf gelauert, dass sie das Pferd endlich freigab, tauchte ausgerechnet Crollan neben dem Kopf des Tieres auf und führte es wortlos weg.
Er sah sie nicht einmal an, streichelte nur über den Hals ihres Reittieres und nahm die Zügel. Vertrauensvoll folgte es ihm. Rebby knirschte mit den Zähnen. Sie wusste genau, dass es – als vermeintlicher junger Mann – ihre Aufgabe gewesen wäre, ihr Pferd selbst zu versorgen. Dank ihrer schmerzenden Beine hatte sie ihre erste Gelegenheit verpasst, sich dieser Truppe zu beweisen und zu zeigen, dass sie ein ganz normaler Kerl war, der seinen Anteil an der gemeinsamen Arbeit mühelos bewältigen konnte. Verdammt!
Sie blieb alleine und ohne Stütze zurück, während rund um sie herum Sättel in einem Halbkreis in den Schatten gelegt, Decken ausgeschüttelt und ein Holzhaufen aufgeschichtet wurden.
»Na, lange nicht geritten, was, mein Junge? Tut der Hintern weh?«, fragte einer der Krieger. Ein rotbärtiger Kerl, den eine Narbe quer über das Gesicht entstellte, sodass sein Mund ganz schief aussah.
Rebby nickte. Dass sie steif und schmerzerfüllt war, musste jedem ins Auge springen. Sinnlos, da etwas zu leugnen.
»Hab ich vorhin schon gesehen. Musst dich nicht schämen. In ein paar Tagen hast du dich dran gewöhnt. Setz dich hier hin, dann bist du niemand im Weg und kannst dich ausruhen.«
»Danke«, sagte Rebby und sank erleichtert auf den Baumstamm, den der Rotbart ihr gewiesen hatte. Ihr tat alles weh. Die Knie waren ein einziger Schmerzensschrei. Kaum saß sie, wäre sie am liebsten wieder aufgesprungen, weil ihr der Hintern wirklich wehtat. Sie hoffte, dass sie sich nicht wundgeritten hatte, aber es waren wohl nur die Muskeln, die sich wie ein riesiger blauer Fleck anfühlten.
Der Krieger blieb bei ihr stehen und sah sie an. Sie fand den prüfenden Blick unangenehm, aber nicht unfreundlich. Schließlich streckte er ihr die Hand hin. »Orick. Wie ich Crollan kenne, wird er dich in wenigen Momenten wieder hochscheuchen.«
Rebby ergriff die angebotene Hand. »Rebby. Warum wird er mich hochscheuchen?«
»Er ist der Meinung«, sagte Orick und setzte sich neben sie, »dass schmerzende Muskeln am besten durch Bewegung kuriert werden. Aber mach dir keine Sorgen. Ich bin ja auch noch da.« Er löste einen fleckigen Beutel von seinem Gürtel und zog daraus etwas Schwarzes, eindeutig Klebriges hervor, schnitt mit einem Dolch ein Stück davon ab, steckte es sich in den Mund und kaute genüsslich.
Rebby wusste nicht, was das war, aber es sah keinesfalls appetitlich aus. Sie hoffte von Herzen, dass der Rotbart ihr nichts davon anbot.
Sie fühlte sich ziemlich verloren inmitten dieser Meute ungewaschener, halbwilder Männer, die den Launen und Befehlen eines Halbelfen gehorchten, ohne auch nur dessen Existenzberechtigung in Zweifel zu ziehen.
Orick kaute schweigend auf dem ekelhaften Klumpen, und Rebby sah sich neugierig um. Die Pferde wurden versorgt, Gepäckriemen und Sattelzeug kontrolliert. Ihr Magen knurrte leise. Seit dem Frühstück in der Festung Montpar war nicht viel Zeit vergangen, fand sie, aber der ungewohnt lange Ritt an der frischen Luft regte ihren Appetit an. Sie hoffte, dass die Rast nicht nur wegen der Mittagshitze und zur Erholung der Pferde eingelegt worden war.
Der Rotbart reichte ihr eine Wasserflasche, und Rebby trank gierig. Gegen den Hunger half das nicht, aber sie fühlte sich erfrischt.
Sie hielt Ausschau nach Crollan, der jeden seiner Männer leicht überragte. So abfällig sie und ihr Großvater sich in dem Schutz ihres Gästezimmers auch über den Halbelfen unterhalten hatten, so war Rebby wider Willen doch beeindruckt von diesem Mann.
Sie fand sein Äußeres abschreckend. Es waren nicht nur die Ohren und Augenbrauen. Vor allem ließen die Tätowierungen ihn noch barbarischer aussehen. Wie war er nur auf die Idee gekommen, sich diese schwarzen Hautmalereien zuzulegen, obwohl jeder Zoll an ihm schon von Fremdartigkeit kündete? Er fiel ohnehin auf, weil er so hochgewachsen war.
Er passte nicht in die Welt, die Rebby bislang gekannt hatte. Für einen Diener oder gar einen Sklaven gab er sich zu selbstsicher. Für einen wirklichen Ritter sah er zu heruntergekommen aus, war er zu schmutzig und vor allem zu elfenhaft.
Sie zog die Augenbrauen zusammen. Seine Männer folgten ihm, Montpar hatte ihn zu seinem Paladin erkoren. Wie Großvater schon gesagt hatte: Den Titel Paladin zu erhalten, setzte viel voraus: Leistung, Opferbereitschaft und Fähigkeiten. Ritter konnte ein Fürst viele haben, aber der Paladin war derjenige – und der Einzige – seiner Vasallen, dem er vertraute, dem er blind auch sein Leben anvertrauen würde, der in seiner Gunst am höchsten stand.
Montpars Paladin war ein Bastard, und damit dieser so hohes Ansehen erworben haben konnte, hatte er mehr leisten müssen als ein Mensch. Das war Rebby auch klar. Körpergröße und Masse befähigten Crollan im Kampf zu mehr, das war offensichtlich. Aber nur körperliche Kraft reichte nicht aus, um das Vertrauen des Fürsten zu erklären. Das Vieh musste mehr als nur erfahren und einfallsreich sein.
Sie würden sehen, befand Rebby. Sie drängte ihre bisherige Sichtweise auf Elfen beiseite, um Crollan ehrlich beurteilen zu können. War er auch ein Vieh, so erschien er doch nützlich und stellte wahrscheinlich ihre einzige Chance dar, Torons Hald lebendig und relativ unbeschadet zu erreichen.
Sie beschloss, das fremdartige Geschöpf genau im Blick zu behalten, sich nur auf sich selbst zu verlassen und ihr endgültiges Urteil in Ruhe abzuwägen.
Er trat zwischen den Pferden hervor, sah sich kurz um und kam dann zielsicher zu ihr und Orick. Sie hoffte zwar von Herzen, dass sie Torons Hald ungehindert erreichten, aber ein kleiner, wilder Teil von ihr wünschte sich, diesen Hünen in einem Gefecht zu sehen.
»Sitz nicht zu lange herum. Sonst bist du nachher steif, wenn du wieder auf das Pferd steigen willst. Sobald du dich ein wenig ausgeruht hast, solltest du ums Lager spazieren. Langsam und in Sichtweite der Wachen. Deine Beine werden es dir danken.«
Orick zwinkerte Rebby frech zu, und sie hatte Mühe, nicht zu lachen. Andererseits klangen Crollans Ratschläge vernünftig und sein Tonfall nicht zu herrisch. Beinahe erschien er ihr als höflich, was sie erstaunte.
Er ließ sich mit überkreuzten Beinen vor ihr nieder und reichte ihr und Orick Brotstücke, bevor er selbst von dem flachen, harten Gebäck abbiss und mit vollem Mund erklärte: »Ich habe Wachen aufgestellt. Doch wir befinden uns noch in Montpars Territorium, wir sollten einigermaßen sicher sein. Kerrick ist als Kundschafter vorgeritten. Er wird den bequemsten Weg für uns finden.«
Das Brot schmeckte fremdartig. Rebby kannte nur gesäuertes Brot, das in dicken, glänzenden Laiben aus dem Ofen kam und verführerisch duftete. Das Brot der Krieger war flach wie ein Kuhfladen und hatte auch sonst große Ähnlichkeit mit einem solchen. Es schmeckte würzig, war trocken und knusprig. Als Vorrat für eine längere Reise war es bestimmt besser geeignet. Sie würde sich daran gewöhnen müssen und hoffte, dass sie sich ihre Überraschung nicht allzu sehr anmerken ließ.
»Der alte Mann sagte, du bist in einem Kloster erzogen worden. Was hast du dort gelernt? Kannst du mit einer Waffe umgehen?«, fragte Crollan nach einigen Augenblicken.
Sie schüttelte den Kopf, denn sie war unter anderem dazu erzogen worden, nicht mit vollem Mund zu sprechen. Sie schluckte und setzte hinzu: »Ein wenig Stockfechten.«
Orick und Crollan wechselten einen kurzen Blick, in dem sie beinahe Verachtung zu lesen meinte. Ja, für diese beiden bedeutete Kampf den einzigen Daseinszweck, und bestimmt brachten sie kein Verständnis für einen jungen Mann auf, der eher Bücher las und Gesänge zu Ehren der Götter auswendig lernte. Der Halbelf löste einen Gürtel von seiner Hüfte und reichte ihn an Rebby. Eine Dolchscheide war daran befestigt. Rebby legte das Brot auf ihren Oberschenkel und zog die Stichwaffe aus dem Gehenk. Es war kein Dolch, stellte sie verwundert fest, sondern ein sehr schlanker, gerader Dorn mit kreisrundem Durchmesser und einer Spitze, die scharf wie eine Nadel war.
»Ein Stilett. Ich hoffe, dass du es niemals benötigst. Aber das ist eine wirkungsvolle Waffe für einen so kleinen, ungeübten Kerl wie dich. Die Klinge gleitet fast von alleine in den Körper eines Feindes. Damit kannst du jeden Schwachpunkt einer Rüstung ausnutzen. Du brauchst nicht viel Kraft. Hat ein Gegner das Ding in sich, ist seine Lebenserwartung dahin, weil er innerlich verblutet. Mir ist wohler, wenn du nicht vollkommen unbewaffnet bist.«
Rebby sah die Klinge zweifelnd an, und Crollan lächelte mit einem Mal. »Du darfst es heute Abend ausprobieren – an unserem Abendessen. Kerrick hat einen Keiler geschossen, ehe er aufbrach. Bevor das Fleisch über das Feuer kommt, darfst du mit einem normalen Dolch und dem Stilett hineinstechen. Du wirst den Unterschied merken.«
»Ich weiß nicht, ob ich das möchte.«
»Er ist tot und ausgeblutet. Selbst wenn du einem Menschen diese Waffe ins Fleisch rammst, wird kaum Blut fließen.« Er stand auf, reckte sich und ging weiter zu den anderen Männern.
Rebby sah ihm mit einem unvertrauten Gefühl nach. Es war Rührung, die sie empfand, weil er ihr seine eigene Waffe überlassen hatte. Nur für den Notfall, wie er gesagt hatte. Er trug einen breiten Waffengurt, und irgendwie hatte sie das Gefühl, dass er den zweiten Gürtel mit dem Stilett nur umgelegt hatte, um ihr die Waffe zu überreichen und es nicht allzu offensichtlich nach einem Geschenk aussehen zu lassen.
Waffen waren teuer, das wusste sie, und dieses nadelspitze Mordinstrument hatte bestimmt einen Haufen Geld gekostet. Seit wann hatte der Halbelf schon die Absicht gehabt, ihr diese Waffe zu überreichen? Dass sie kein Krieger war, musste er schon auf den ersten Blick erkannt haben.
Orick klopfte ihr auf die Schulter. »Hab keine Angst vor dem Ding. Es ist ja nur für den Notfall. Und wie ich Crollan kenne, wirst du bis Torons Hald keinerlei Gelegenheit haben, deine Künste als Messerstecher an mehr als einem toten Keiler auszuprobieren.«
Das wollte sie hoffen. Aber irgendwie wirkte das Gewicht der Waffe tröstlich. Und, sagte sie sich, Crollan hatte ihre Verkleidung nicht durchschaut. Denn einem Mädchen würde er garantiert keine Waffe in die Hand geben. Sie legte den Gürtel an, schob das Stilett samt Scheide gemäß Oricks Anweisungen an ihre linke Seite und fühlte sich ein klein bisschen sicherer.
Sie aß das Brot und stand dann gehorsam auf, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Verdammt, der Mischling hatte recht gehabt! Sie fühlte sich steif wie eine uralte Frau. Die ersten Schritte taten weh, ihre Beine fühlten sich an wie aus Holz. Aber schnell wurde es besser. Ein wenig ärgerte sie sich, dass Crollans Hinweis richtig gewesen war. Aber andererseits war sie dankbar, dass er sie angewiesen hatte, während der Rast nicht nur herumzusitzen.
Sie wanderte im Schatten der Bäume, in deren direkter Nähe ihr Lager lag, und überlegte, wie lange die Reise nach Torons Hald wohl dauern würde. Sie waren nicht sehr schnell unterwegs, und wenn der Paladin jeden Tag mittags eine so lange Pause einlegen wollte, würde es ewig dauern, bis sie endlich ankam.
Sie passierte einen der Wächter und wurde angesprochen. »Geh nicht zu weit, Rebby.«
»Ich weiß. Ich bleibe in Sichtweite.«
Der Krieger nickte nur, und Rebby ging weiter – immer im Kreis um das Lager herum, niemals mehr als fünf Schritte von der Wachpostenreihe entfernt.
Sie fand Gelegenheit, sich die Männer anzusehen, die Ordnung im Lager, die gelassenen Pferde, von denen jedes einzelne besser geputzt war als die Krieger und deren Rüstungen. Aber die Waffen waren sauber und scharf, die Blicke der Männer wach. Mitten im Lager bewegte Crollan sich hin und her, sprach mit jedem seiner Krieger, und einmal hörte Rebby sein Lachen zu sich wehen. Er klang selbstsicher und unbeschwert. Niemand war jedoch nachlässig, so schien es.
Sie bemerkte einsetzende Unruhe im Lager. Die Pferde wurden wieder gesattelt, Gepäck verstaut, und prompt rief Orick nach ihr: »Rebby, wir wollen weiter.«
»Ich komme!«, antwortete sie und kehrte in den Mittelpunkt des Lagers zurück.
»Besser?«, fragte der Rotbart, und sie nickte – dankbar, dass es ihr wirklich besser ging und jemand sich um sie sorgte. Orick wirkte väterlich und aufrichtig. Sie mochte ihn.
Ihr Pferd wurde herangeführt, und sie schwang sich in den Sattel, dankte dem Krieger, der das Tier bis dahin gehalten hatte, und suchte ihren Platz in der abreitenden Truppe.
Sie merkte schnell, dass die Krieger sie ebenso in die Mitte drängten wie die Packpferde – dort wo es sicherer war, falls es zu einem Angriff kommen sollte. Sie taten das so selbstverständlich, als würden sie überhaupt nicht darüber nachdenken. Sie war zu beschützen, und keiner von ihnen machte darum ein Aufheben.
Mit einem Mal fühlte Rebby sich ein wenig geborgen.
Der Kundschafter Kerrick kam zurück, zügelte sein Pferd direkt vor Crollans Grauschimmel und berichtete.
Rebby trieb ihr Pferd an die Seite des Schimmels und spitzte die Ohren. Sie fand, sie hätte dazu jedes Recht der Welt, denn es ging immerhin um ihre Sicherheit und ihre Eskorte nach Torons Hald.
»Noch knapp zwei Stunden, dann erreichen wir die offizielle Grenze. Dahinter habe ich ein Dorf entdeckt. Willst du dort versuchen, unsere Vorräte aufzufrischen?«
»Auf gar keinen Fall. Wir haben genug von Montpar bekommen, und je später Grenzposten entdecken, dass wir auf dem Territorium des nächsten Fürsten sind, umso besser ist es.«
»Dachte ich mir. Ich habe einen Viehpfad gefunden, der uns in weitem Bogen um das Dorf führt. Ein Fluss versperrt den Weg. Ich habe eine Furt entdeckt.«
»Ach, ich liebe Furten. Sie eignen sich so wunderbar für Hinterhalte«, sagte Crollan mit einem bösen Lächeln, von dem Rebby fand, dass es ihm verblüffend gut stand.
Verdammt, er ist ein halbes Tier. Sie wiederholte den Singsang in ihrem Kopf, bis er albern klang.
Der Paladin wandte sich halb im Sattel. »Bogenschützen, haltet euch bereit. Jeder bewaffnet sich, bevor wir diese Furt erreichen. Rebby, du bleibst im Hintergrund, notfalls an meiner linken Seite.«
Sie nickte. Genau das hatte ihr Großvater gesagt. Diesen Rat nun das zweite Mal zu erhalten, machte noch deutlicher, wie wichtig es war, im Schatten des Halbelfen Deckung zu suchen.
»Wir legen vorher noch eine Rast ein, damit die Tiere frisch sind. Und ich hoffe, wir finden in unseren Beständen«, sein Blick glitt abschätzend über ihre schlanke Gestalt, »etwas, das dir halbwegs passen wird. Keine Rüstung dieser Welt kann dich vor einem Schwerthieb schützen, der vorher nicht pariert wurde. Aber zumindest Pfeile wird sie aufhalten können.«
Der Schatten eines Wäldchens bot sich für die Rast an. Von hier aus konnte Rebby bereits die mannshohen Steine sehen, die die Straße flankierten und die Grenze von Montpars Fürstentum markierten.
Sie hatte nicht viel Zeit, diesen Anblick in sich aufzunehmen, denn Crollan berührte sie sacht an der Schulter und führte sie zu den abgeladenen Packtaschen, die Orick bereits nach Rüstungsteilen durchsuchte.
»Der Bengel ist zu klein«, beschwerte der Rotbart sich. Er hielt einen ledernen Brustpanzer hoch, sah an diesem vorbei auf Rebbys schlanke Gestalt, schüttelte den Kopf und suchte im nächsten Gepäckstück nach etwas Passenderem.
Rebby richtete sich auf eine längere Wartezeit ein. Die Männer waren alle erheblich größer und breiter als sie. Jede Rüstung musste ihr zu groß sein.
Neben ihr beugte sich Crollan über einen Mantelsack und zerrte die Schnüre auf. »Ich habe nicht vor, ihn in meine Rüstung zu stecken, Orick. Hör auf zu jammern wie ein altes Weib. Irgendeinen leichten Lederpanzer wirst du ja wohl finden.«
Rebby sah auf seinen gebeugten Rücken, die breiten Schultern und musste mühsam ein Grinsen unterdrücken. In einer Rüstung von Crollan würde sie beständig über den unteren Saum stolpern!
Halbelf und Rotbart steckten sie schließlich in eine speckige Lederrüstung, die nach Ungeziefer und Männerschweiß roch. Rebby wusste sofort, dass sie in diesem Ding nicht alleine war. Bislang hatte sie es wohlweislich vermieden, sich in einem Tümpel oder Bachlauf zu waschen, da es anatomische Details gab, die niemand übersehen konnte. Wie es ihr nach einigen Stunden in der stinkenden Rüstung ergehen würde, wusste sie noch nicht. Etwas biss sie in den Rücken. Sie war sich ganz sicher, dass sie sich das nicht einbildete.
Crollan schnitt Lederbeinschützer zurecht und umwickelte damit Rebbys Waden, umschnürte sein Werk mit Lederbändern und sah ungnädig auf sie herab. »Die haben dich im Kloster nicht genug gefüttert. Ich habe wirklich noch nie einen Hänfling wie dich in eine Rüstung verfrachtet.«
Und natürlich sah Orick auf, grinste und fragte: »Wie alt bist du eigentlich, mein Junge?«
»Neunzehn«, log sie, da sie einen Stalljungen in diesem Alter gekannt hatte, der nicht größer gewesen war als sie jetzt. Sie war sechsundzwanzig, aber wenn sie das diesen beiden Kerlen sagte, hielten die sie für noch kümmerlicher als ohnehin schon.
»Die Muttermilch noch nicht trocken auf den Lippen«, murmelte Orick.
»Du warst nicht viel älter, als du unter meinem Kommando in deine erste Schlacht gezogen bist, Orick.«
»War ich auch so ein Hänfling?«, empörte sich der Rotbart sofort.
Rebby folgte diesem Wortwechsel erheitert. Ihre beiden Beschützer wirkten auf einmal sehr viel offenherziger als bisher.
Wieder blitzte das Lächeln auf, das Rebby mittlerweile zu fürchten gelernt hatte, weil es ihr gefiel. Sie wiederholte im Geiste wieder einmal ihren Spruch, dass Crollan ein halbes Tier wäre. Es half nicht wirklich. Das schlagartig und ungebeten aufgetauchte warme Gefühl in ihrem Bauch ließ sich nicht durch die Litanei vertreiben.
Sie hatte schon mit Männern geschlafen, bevor ihre Eltern starben und sie zu ihrem Großvater fliehen musste. Ihren Großvater würde der Schlag treffen, wenn er das wüsste. In seiner Festung hatte sie vier Jahre Enthaltsamkeit durchleben müssen, um ihre Tarnung nicht zu gefährden. Und ausgerechnet das Lächeln des Halbelfen beschleunigte nun ihren Herzschlag in der gleichen Weise, wie es das Lächeln eines jungen Fürstensohnes früher geschafft hatte. Verdammt!
»Du warst ebenso klein und leicht. Also tu nicht so weise und väterlich. Das nervt langsam.«
Orick grinste. »Lass mich raten, du warst natürlich mit neunzehn schon so ein langer Kerl?«
»Ich bin Halbelf, Orick. Natürlich war ich das.«
»Wie konnte ich das nur vergessen?«, behauptete Orick immer noch grinsend.
Crollan zuckte die breiten Schultern und marschierte ab, offenkundig gereizt.
»Hätten wir dich in eine seiner Rüstungen gesteckt«, sagte Orick, während er die letzten Schnallen an Rebbys Lederrüstung schloss, »hättest du sie dir alle paar Augenblicke um die Beine gewickelt und wärst voll auf die Schnauze geflogen.«
Sie schlug die Hand vor den Mund und erstickte im letzten Augenblick ein Kichern.
Er grinste, schüttelte den Kopf und trat dann zurück, um Rebby von Kopf bis Fuß zu mustern. »Nie im Leben war ich so ein kleines Kerlchen. Rühr dich, mein Junge, und lass sehen, ob du dich noch bewegen kannst.«
Er schien zufrieden. Rebby fühlte sich wie eingewickelt. Das Leder stank nicht nur, es war auch starr, und sie hatte keine Ahnung, wie sie auf ihr Pferd kommen sollte. Hilfe anzunehmen war unmöglich, das wusste sie genau. Jeder Kerl, der ihren Hintern anfasste, würde Bescheid wissen.
Crollan beseitigte dieses Dilemma. Er fiel neben dem Pferd auf ein Knie, und so peinlich es ihr auch war, konnte sie seinen Oberschenkel als Tritt verwenden, um den linken Fuß in den Steigbügel zu bekommen und sich in den Sattel zu schwingen.
Manchmal hatte sie das sehr ungute Gefühl, dass der Kerl Gedanken lesen konnte. Irgendwie war er immer da, wenn sie ihn brauchte, und tat Dinge, die notwendig waren, damit ihre Tarnung nicht aufflog.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Konnte es sein, dass er die Maskerade schon lange durchschaut hatte?
Nein, unmöglich, sagte sie sich. Nicht einmal Montpar hatte in dem schlanken Jüngling eine junge Frau erkannt, und der Großvater hatte den Fürsten als Weiberhelden bezeichnet. Wenn Crollan jemals etwas anderes als eine teuer bezahlte Hure unter sich gehabt hatte, würde sie sich doch sehr wundern. Paladin hin oder her, keine anständige Frau würde sich mit so einem einlassen.
Rebby fasste die Zügel fester und sah dem Halbelfen nach, wie er zu seinem Pferd ging und sich in den Sattel schwang. Verdammt.
Es war eine Frechheit, dass Crollan sich trotz seiner Größe und Masse so leicht bewegte und überhaupt nicht plump wirkte. Das würde es irgendwie einfacher machen, ihn angemessen zu verabscheuen, fand Rebby.
Helme wurden aufgesetzt, Schilde angelegt, Schwerter, Äxte, Bögen und in Crollans Fall ein Streitkolben in bequeme Reichweite an die Sättel gehängt. Der Trupp war einsatzbereit und ritt langsam ab.
Rebby hielt sich gehorsam direkt vor den Bogenschützen, die die Nachhut der Reiterschar bildeten.
Sie war nervös. Warum hatte Crollan unbedingt etwas davon sagen müssen, dass eine Furt sich für einen Hinterhalt eignete? Warum hatte der Kerl nicht einfach die Klappe halten können? Weil er sie hoffentlich für einen jungen Mann hielt und somit als vollwertiges Mitglied seines Trupps ansah. Sie war unendlich erleichtert, dass sie ihm gesagt hatte, dass sie nicht kämpfen konnte. Sonst hätte er ihr bestimmt ein Schwert in die Hand gedrückt. Götter, in was für einen Schlamassel bin ich nur geraten?
Sie umritten das Dorf weiträumig, dennoch sah Rebby eine Tempelkuppe über den wogenden Getreidefeldern aufragen. Ein reiches Dorf, wenn es ein Heiligtum unterhalten konnte.
Sie folgten einem Pfad den Fluss entlang. Diesen Weg nahmen die Dörfler, wenn sie ihre Nutztiere auf Weiden oder zum Tränken treiben mussten. Rebby war froh, dass sie auf der Festung ihres Großvaters genügend von den Gebräuchen der einfachen Bauern mitbekommen hatte, um solche Sachen zu verstehen.
Die Furt war deutlich zu erkennen. Der Viehpfad endete vor ihr in matschig getretenem Ufersaum, und auf der anderen Flussseite ging er ebenso morastig weiter.
Ohne das geringste erkennbare Zögern lenkte Crollan seinen mächtigen Schimmel in das Wasser. Reiter und Pferd wirkten angespannt. Garantiert hielt der Halbelf das gegenüberliegende Ufer im Auge, um drohende Gefahren so rasch wie möglich zu erkennen.
Auch Rebby sah genau hin. Sie hatte Angst, und es tat gut, das vor sich selbst zuzugeben. Sie konnte nur den Viehpfad erkennen, der sich entlang eines Heckensaumes in Richtung von grünen Wiesen schlängelte. Nichts rührte sich dort auf der anderen Seite. Sie wagte nicht, erleichtert aufzuatmen. Wenn Crollan einen Hinterhalt befürchtete, dann wollte sie das auch tun und auf den schlimmsten Fall vorbereitet sein.
Die Bogenschützen blieben leicht zurück, um den Durchritt der anderen Krieger zu sichern. Rebby trieb ihr Pferd an, schloss dichter zu Crollan, Kerrick und Orick auf. Im Pulk fühlte sie sich etwas sicherer, auch wenn sie immer noch eine Art Nachhut bildete.
Der Fluss floss rasch dahin. Das Wasser war tiefer, als Rebby erwartet hatte. Sie zog die Füße aus den Steigbügeln und nach oben, damit sie nicht bis zu den Knien nass wurde.
Sie warf einen raschen Blick zu den anderen Männern, die alle schon nass waren – bis auf Crollan natürlich, dessen Pferd ebenso groß war wie der Reiter, sodass der Halbelf bislang nur nasse Füße bekommen hatte.
Sie sah wieder zum jenseitigen Ufer und hoffte, dass sie dort ganz schnell und sicher ankommen würde. Kein Wunder, dass eine Furt sich für einen Hinterhalt anbot: Ihre eigenen Pferde wateten durch tiefes Wasser, waren langsam und weniger wendig. Falls jemand auf der anderen Seite lauerte, musste er nur abwarten und konnte sie dann mit Pfeilen Mann für Mann dezimieren. Eine Gänsehaut prickelte auf ihrem Bauch und Busen, ihre Finger waren schweißfeucht.
Etwas sirrte an Rebbys Ohr vorbei, und ihr Pferd sprang mit einem schrillen Aufwiehern beiseite. Sie rutschte seitlich beinahe aus dem Sattel, klammerte sich verzweifelt fest. Sie keuchte auf, als ihr Oberarm von einem harten Schlag getroffen wurde. Im nächsten Augenblick brannte diese Stelle. Der Schmerz trieb Rebby Tränen in die Augen. Sie drohte, aus dem Sattel zu rutschen, und wurde mit einem Ruck von ihrem Pferd gerissen, als dieses vollkommen durchdrehte und ausbrechen wollte.
Sie stieß einen halb erstickten Schrei aus.
Hart wie eine Stahlklammer legte sich ein Arm um Rebbys Mitte und zerrte sie halb auf ein anderes Pferd.
»Verdammt, nimm das Bein über seinen Hals!« Crollans Stimme, heiser vor Anspannung. Er presste ihr fast die Luft ab, der untere Rand seines Schildes drückte schmerzhaft gegen ihren linken Oberschenkel. Sie keuchte und schwang das rechte Bein über den gebogenen Hals des Schimmels, fühlte sich an Crollan gedrückt, roch den Schweiß des Halbelfen, spürte seinen Atem im Nacken und begriff jetzt erst, dass sie angegriffen wurden und ihr Pferd verletzt worden war. Sie sah den Pfeil aus der Schulter des scheuenden Tieres ragen, und Mitleid überkam sie. Dazu kam Angst. Dieser Pfeil hätte in ihr selbst stecken können.
Das Tier floh zu seinen Artgenossen bei Crollans Bogenschützen. Rebby suchte Halt am Sattel des Schimmels, aber sie konnte sich in dem stählernen Griff des Paladins kaum rühren. Der Schild drückte sie an seine breite Brust und nahm ihr obendrein die Sicht. Sie tastete mit der rechten Hand um sich, berührte Crollans muskulösen Oberschenkel und bekam seinen Waffengurt zu fassen, an dem sie sich zumindest ein wenig festhalten konnte, während der Schimmel sich im tiefen Wasser drehte.
Wasser spritzte hoch auf, prasselte gegen den Schild, durchnässte Rebby vollkommen und lief ihr in den Kragen. An dem schützenden Metallrund vorbei konnte sie halb nach unten sehen und erkannte nur zu weißem Schaum getretenes Wasser.
Ihr wurde schwindelig, sie sah nicht wirklich etwas, und dann hörte sie Stahl auf Fleisch krachen. Ein ekelhaftes, leicht schmatzendes Geräusch. Sie spürte hinter sich Crollans Muskeln arbeiten, wie er seinen Oberkörper mit einem Ruck zur Seite drehte. Götter, er kämpfte mit ihr vor sich auf dem Sattel! Sie wollte hier weg! Stattdessen rang sie darum, nicht vom Pferd zu fallen, zog die Beine instinktiv an und machte sich noch kleiner hinter dem Schild. Sie konnte den linken Arm in der Enge ihres Schutzes heben und die Finger in Crollans Oberarm krallen. Als der Schimmel in eine neuerliche Drehung flog, um seinem Reiter einen weiteren Knochen brechenden Hieb zu ermöglichen, konnte sie ein leises Quietschen kaum unterdrücken. Des Halbelfen Kraft war erschreckend – und die Auswirkungen auf seine Gegner verheerend.
Sie roch Blut, Pferdeschweiß, das feuchte Leder von Crollans Rüstung. Rebby vernahm seine Atemzüge, das leichte Keuchen, wenn er Luft im Zuschlagen ausstieß. Sie hörte Männer schreien, Pfeile über sich hinwegsausen und stand entsetzliche Angst aus, während ein Teil von ihr bei jedem Treffer jubelte und ihren Feinden alles Schlechte dieser Welt wünschte. Diese Stimme forderte, dass Crollan alle Gegner niedermachte, obwohl sie selbst mitten im Kampfgetümmel steckte.
Dann blieb der Schimmel stehen. Der Arm um ihre Mitte lockerte sich.
»Bist du in einem Stück, Kleiner?«
Sie fühlte seinen Atem in ihrem Nacken.
»Ich glaube«, antwortete sie mit einem verräterischen Zittern in der Stimme. Sie ließ ihn los und krallte die Finger um die obere Kante des Schildes, damit sie etwas sehen konnte. Im nächsten Augenblick wünschte sie, das nicht getan zu haben, denn Crollan senkte zuvorkommend den Schild, als er verstand, was sie wollte.
Im Fluss trieben Leichen. Ein reiterloses Pferd trabte durch das tiefe Wasser, verfolgt von einem Mann, der es schließlich einfing und beruhigte. Das arme Geschöpf war von oben bis zur Wasserlinie rot bespritzt.
»Sag, wenn dir schlecht wird. Ich möchte nicht bekotzt werden«, erklang Crollans ruhige Stimme, die widerwärtig gelangweilt klang.
»Nein, es geht«, behauptete sie, obwohl sie mehrfach hart schlucken musste, damit ihr Mageninhalt wirklich da blieb, wo er sein sollte. Sie schmeckte Galle unter ihrer Zunge und zog geistesgegenwärtig den Kopf ein, um wieder hinter den Schild zu gelangen. Sie schloss kurz die Augen, hielt sich an Crollans Schildarm fest und kämpfte die Übelkeit mit reiner Willenskraft nieder.
»Gut.« Dann hob er die Stimme. »Fangt die Pferde ein, bergt die Verletzten und unsere Toten. Nehmt an feindlicher Ausrüstung nur mit, was ihr sofort erreicht. Wir müssen hier weg.«
Der Schimmel setzte sich wie von alleine in Bewegung und trug den Halbelfen und Rebby aus dem Fluss auf das jenseitige Ufer. Rebby wünschte sich, Crollan würde sie zu Boden lassen oder ihr ein anderes Pferd zuteilen. Sie fühlte sich leicht benommen und wollte dem Paladin einfach nicht länger so nahe sein. Es erschütterte sie, dass sie sich an seine Schulter lehnen und sich ausweinen könnte.
Das Pferd schüttelte sich, als es wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Rebby erhaschte einen Blick auf den Streitkolben, und ihr Magen hob sich.
»Runter!«, keuchte sie, und Crollan gab sie sofort frei. Sie riss das rechte Bein über den Hals des Schimmels und sprang zu Boden, rannte einige Schritte weit weg, bevor sie in die Knie brach und sich übergab.
Verdammt! Jetzt hielt er sie für einen Weichling. Aber sie konnte nichts dafür.
Sein Streitkolben war keine einfache Keule mit Dornen daran. Es war ein aufwendiger Waffenkopf mit radial angeordneten Schlagklingen, der nicht nur von ungefähr an eine Distelblüte erinnerte. Was auch immer Crollan damit zu ihrem Schutz angestellt hatte – der Anblick von Knochensplittern, Fleischfetzen, Haaren und Gehirnmasse zwischen den Klingen war zu viel für ihren Magen gewesen.
Sie würgte trocken und rappelte sich mühsam wieder auf, als Crollan den Schimmel neben sie lenkte.
»Wir müssen weiter. Wir haben Verletzte und brauchen ein sicheres Lager, damit wir sie versorgen können.«
Er gab einen Steigbügel frei, hielt ihr die Hand hin und zog sie mühelos auf das Pferd. Dieses Mal saß sie hinter ihm, konnte sich an ihm festklammern und die Wange gegen seinen Rücken pressen.
Nicht ein Wort des Vorwurfs – aber auch keine Sorge um sie, weil sie sich erbrach. Er nahm es einfach hin und sorgte sich im Augenblick nur um seine Männer – und damit nach wie vor um ihre Sicherheit.
Ihr Arm tat weh. Sie öffnete die Augen und sah auf ihrem Oberarm einen langen, tiefen Kratzer, aus dem träge Blut sickerte. Sie schloss verzweifelt die Augen, drückte den Kopf gegen Crollan und hielt sich fest, während sie darum kämpfte, sich kein zweites Mal zu erbrechen.
Wie gut, dass es nur der Oberarm war, sagte sie sich lautlos vor. An einem verwundeten Oberarm konnte niemand erkennen, dass sie ein Mädchen war. Sie brauchten sie nicht aus ihrer Rüstung und Kleidung schälen, um ihr einen Verband anzulegen. Sie sollte sich freuen, dass sie so viel Glück gehabt hatte. Aber sie sah vor ihren geistigen Augen nur die Klingen von Crollans Streitkolben, roch auch jetzt noch die Witterung von Blut und Fleisch und wollte sich irgendwo verstecken, wo der Tyrann sie nicht finden konnte.
Ein Reiter donnerte im gestreckten Galopp an ihnen vorbei. Kerrick, vermutete sie, der einen sicheren Lagerplatz ausfindig machen sollte. Unter ihr fiel der Schimmel in Trab, und sie klammerte sich an Crollan fest und hielt die Augen geschlossen.
Noch nie war sie so erschöpft gewesen.
Sie öffnete die Augen erst wieder, als das Pferd stehen blieb. Crollans Oberkörper bewegte sich ein wenig nach hinten, als er das Bein über den Pferdehals schwang. Sie ließ ihn rasch los, und er sprang zu Boden, drehte sich herum und streckte die Arme nach ihr aus. »Spring, ich fange dich.«
»Es geht schon.« Auf gar keinen Fall würde sie ihm in die Arme springen! Seine Rüstung und ihre sollten gemeinsam verhindern, dass er spürte, was er da auffing und an sich drückte. Aber sie dachte nicht im Traum daran, in seinen Armen zu liegen. Auf gar keinen Fall, im Leben nicht, niemals!
Er rollte kurz mit den Augen und sagte sehr bestimmt: »Es geht gar nicht. Du bist kreidebleich und kippst gleich um. Stell dich nicht an.«
Er war über und über voll Blut. Vor ihren Augen verschwamm alles, und sie rutschte vornüber vom Pferd, prallte gegen Crollan, der sie auffing und sofort auf ihre Füße stellte. Dabei bemerkte er die Wunde an ihrem Oberarm.
»Hat es dich also doch erwischt. Halt still, das ist gleich erledigt.«
Sie hatte nicht die Kraft, sich gegen ihn zu wehren, sog vor Schmerzen zischend Luft zwischen den Zähnen ein, als er seine große, blutige Hand auf ihren Arm – genau auf die Wunde – legte. Ein Keuchen entrang sich Rebby, als die Verletzung wärmer und wärmer wurde.
Unvermittelt ließ Crollan sie los. »Das war es schon. Setz dich hin, bevor du umfällst.« Er wandte sich um und ging zu seinen Kriegern, die einen weiteren Verletzten behutsam vom Pferd hoben.
Rebbys Knie gaben nach, als sie begriff, wie schwer der Mann verwundet war. Sie landete ungelenk auf ihrem Hintern und sah trotzdem wie gebannt auf den Verletzten: Ein Schwerthieb hatte ihn quer über der Bauchdecke getroffen, und Darmschlingen hingen aus der tiefen Wunde. Rebby schlug die Hände vor das Gesicht. Dabei bemerkte sie, dass sich etwas verändert hatte, lugte zwischen den Fingern hervor auf ihren Oberarm, der beschmiert von ihrem eigenen Blut und dem von Crollans schmutzigen Händen war, aber keine Wunde mehr aufwies.
Sie riss den Kopf hoch, starrte auf den breiten Rücken des Halbelfen, verdrehte sich, um ihren Arm besser sehen zu können, strich mit der freien Hand über die makellose Haut und erschauerte. Alleine der rotklebrige Riss in ihrem Hemd zeugte noch von der Pfeilwunde.
Crollan hatte ihre Verletzung geheilt, indem er seine Hand auf sie gelegt hatte. Götter! Kein Wunder, dass seine Männer ihn wie ihren Augapfel hüteten!
Wo kam eine solche Gabe her?
Sie rappelte sich auf, fiel einmal wieder auf ein Knie, stemmte sich erneut hoch und rannte Crollan nach zu dem Verwundeten, der am Boden lag und einen flehenden Blick auf seinen Paladin gerichtet hielt.
Jeder Heiler hätte hier nur bedauernd den Kopf geschüttelt. Aber Crollan war mehr als ein gewöhnlicher Heiler, verstand Rebby. Elfenblut war anscheinend doch zu mehr gut, als nur spitze Ohren zu haben.
Er kniete neben dem Verwundeten nieder, und wie nur kurz zuvor bei ihrer Verletzung legte er seine Hand genau auf die aufgerissene Bauchdecke, mitten auf die zuckenden Eingeweide.
Der Verwundete stieß ein lautes Stöhnen aus und warf den Kopf zurück. Seine Beine krampften unkontrolliert. Andere Krieger hielten ihn fest und drückten ihn zu Boden. Rebby sah Orick, der einen Arm des Gefährten umklammert hielt und seinen Paladin die ganze Zeit nicht aus den Augen ließ. Genau wie sie den Blick nicht abwenden konnte, auf die sehnige, blutbeschmierte Hand starrte, die auf den Eingeweiden lag.
»Ruhig, Velan. Es wird gleich besser«, murmelte Crollan.
Rebby sah, wie ihm der Schweiß in Bächen die Wangen hinab lief. Der Halbelf zitterte vor Anstrengung, seine Atemzüge klangen mühsam. Aber Rebby konnte erkennen, wie sich unter seinen Fingern der klaffende Riss schloss. Die Eingeweide zogen sich zurück, schienen sich aufzurollen, bis sie wieder in der Bauchhöhle lagen. Über ihnen schlossen sich Muskeln und Haut.
Rebby konnte kaum atmen. Es war ein Wunder. Und eine solche Gabe steckte in einem Bastard mit widerwärtigen Tätowierungen. Sie konnte es nicht fassen. Ein Priester, ein ausgebildeter Heiler – der sollte solch eine Kraft besitzen. Doch ausgerechnet in einem Halbelfen ruhte diese Gabe.
Der Verwundete hielt nun vollkommen still. Seine Lider flatterten.
Langsam hob Crollan die Hand, und darunter lag narbenfrei die geschlossene Bauchdecke. Alles troff vor Blut, aber es sah aus, als wäre der Mann am Boden niemals tödlich verwundet gewesen.
»Haben wir weitere Verletzte?« Er klang atemlos, und Rebby sah, wie sehr seine Hand zitterte.
»Ein paar Kratzer, Crollan. Nichts, was eilt«, antwortete Orick sofort. Seine Stimme klang besänftigend und ruhig.
»Rebbys Pferd.«
»Das Tier kann warten, Crollan. Ich habe den Pfeil entfernt. Wir waschen die Wunde aus. Du kannst nicht mehr.«
»Brauchen wir das Pferd?« Er klang außer Atem wie nach einem schnellen Lauf.
»Natürlich. Aber du benötigst eine Pause, wirklich.«
»Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen weiter. Du hast die Rüstungen der Angreifer gesehen. Das waren keine Wegelagerer. Wo eine Truppe ist, kann die nächste lauern. Wir müssen weiter.«
Niemand widersprach ihm. Aber Rebby hätte zu gerne Fragen gestellt, weil sie die Rüstungen nicht gesehen hatte. Und selbst wenn sie Einzelheiten zu Gesicht bekommen hätte, könnte sie keinesfalls die gleichen Schlüsse ziehen wie die Kriegerhorde um sie herum.
»Bereitet euch für den Abritt vor. Rebby, wo ist dein Pferd?«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte sie einfach. Wie oft sollte Orick dem Halbelfen denn noch sagen, dass das Pferd gerade unwichtig war? Die Kombination von Crollans Sturheit und plötzlicher Verwirrung schien ihr am besten mit vorgetäuschter Unwissenheit zu beantworten. Der große Kerl sollte brav noch einen Augenblick sitzen bleiben, bis die Gruppe abmarschbereit war, fand sie.
Er verdrehte ganz eindeutig genervt die Augen, stand auf, machte drei Schritte auf die Pferde zu und brach lautlos zusammen.
Sie hatte das Gefühl, dass der Boden bebte, als der große Mann aufschlug. Nur mit Mühe unterdrückte sie einen Schreckensruf, sprang auf und war sogar noch vor Orick bei dem gefallenen Halbelfen.
»Was ist los?«, fragte sie, während sie versuchte, Crollan auf den Rücken zu drehen. Sie musste irgendwie an seine Kehle kommen, um seinen Herzschlag ertasten zu können. Er war viel zu schwer, sie bekam ihn nicht bewegt, und ihre Angst wuchs.
»Nichts ist los. Er hat sich nur übernommen. Velan wäre tot ohne ihn. Es kostet ihn zu viel Kraft, das ist alles. Er hätte auf mich hören und sich brav ein wenig ausruhen sollen. Aber nein, er muss ja sofort wieder herumrennen.« Mit einem leisen Grunzen stemmte Orick seinen Anführer auf den Rücken, wischte Rebbys suchende Hand beiseite und herrschte sie an: »Wasser! Und dann holst du dein verdammtes Pferd. Vorher gibt mein störrischer Paladin keine Ruhe.«
Sie nickte, wandte den besorgten Blick von Crollans blassem Gesicht, sprang auf und rannte zu den Pferden. Warum zweimal laufen, wenn an ihrem Sattel eine Wasserflasche hing? Sie zerrte das schwer lahmende Tier hinter sich her und reichte Orick die geöffnete Wasserflasche.