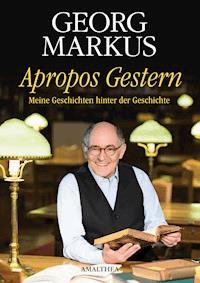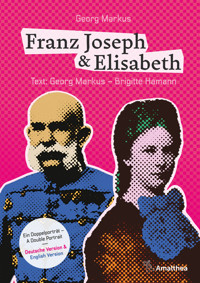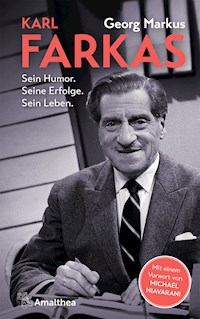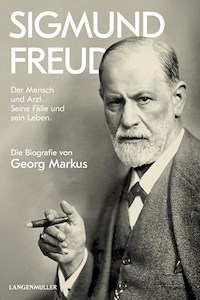Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In mehr als fünfzig historischen Reportagen führt uns Georg Markus in eine faszinierende Zeit, die 'nicht wiederkommt'. Wir begegnen Kaisern und großen Künstlern, Politikern, Ärzten und berühmten Mätressen. Legendäre Kriminalfälle werden noch einmal aufgerollt, und die Lebensgeschichte des letzten k.k. Scharfrichters Josef Lang wird erzählt. Wir sind überrascht, daß Mozart eigentlich kein Österreicher war, und erfahren Interessantes von Caruso, dem größten Tenor aller Zeiten. Der Autor kommt einem geheimnisvollen Skiurlaub Ernest Hemingways - der mit Ehefrau und Geliebter gleichzeitig in Österreich weilte - auf die Spur. Sagte Nostradamus vor vierhundert Jahren tatsächlich den Kennedy-Mord voraus? Welche Geheimnisse ranken sich um die Schönheit Kaiserin Elisabeths? Und welchen Einfluß hatten Krankheiten von Politikern auf den Lauf der Weltgeschichte? Diese 'Neuen Geschichten aus alten Zeiten' werden neben vielen anderen ebenso spannend wie amüsant erzählt und geben einen beeindruckenden Überblick über die Jahrhunderte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Markus
Das kommtnicht wieder
Neue Geschichtenaus alten Zeiten
Für Nicolein Liebe
Schutzumschlag-Motiv: Maximilian Lenz, Die Sirkecke auf der Ringstraße, um 1900 (Historisches Museum der Stadt Wien)
1. Auflage August 19972. Auflage September 19973. Auflage Januar 1998
© 1997 by Amaltheain der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,Wien • MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel, München,unter Verwendung eines Fotos der Museen der Stadt WienHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 10,5/13,5 Punkt Stempel GaramondDruck und Binden: Wiener Verlag, HimbergPrinted in AustriaISBN 3-85002-408-3eISBN 978-3-902998-45-3
Inhalt
Von einer Jahrhundertwende zur anderen
Vorwort
MEDIZINISCHES
Die erste Frau Doktor
Gabriele Possanner setzt sich durch
»So werde ich es machen …«
Große der Weltgeschichte begehen Selbstmord
Der liebe Gott unter den Chirurgen
Theodor Billroth
Sex gestern & heute
Vom Liebesleben im Wandel der Zeiten
»Schnee« von gestern
Wie die High-Society »high« wurde
KAISERLICH & KÖNIGLICHES
Beruf: Mätresse
Pompadour und Dubarry
Amor in der Hofburg
Seitensprünge im Kaiserhaus
Schön sein wie »Sisi«
Eine Kaiserin als Vorbild
Auf der Flucht
»Sisis« Schloß auf Korfu
Der Erzherzog und das Ballettmädel
Die Tragödie des Johann Orth
»Wie ein gewöhnlicher Matrose«
Erzherzog Ludwig Salvator
Hier ist der Kunde Kaiser
Die k. u. k. Hoflieferanten
KRIMINALGESCHICHTEN
»Ein gemütlicher Spezi«
Aus dem Leben des k. k. Scharfrichters Josef Lang
»Um ein freies Leben führen zu können«
Wenn Frauen töten
Massaker auf der Teufelsinsel
Die Ermordung österreichischer Expeditionsteilnehmer
Der berühmteste Gangster aller Zeiten
Al Capone
KÜNSTLERISCHES
Der Kampf mit den Windmühlen
War Cervantes der Mann von La Mancha?
Josef Meinrad
Das letzte Interview
Caruso & Co.
Große Tenöre
»Ich hab’ mich so an dich gewöhnt«
Auch der Kaiser ging ins Kino
Der alte Mann und die Affär’
Hemingways Doppelleben im Montafon
»Man hört mich zwischen Scheibbs und Palermo«
Die ersten Radioübertragungen
Der andere Leonardo
Die Erfindungen des Malers
OH, DU MEIN ÖSTERREICH
Unser »Steffl«
Der Dom und seine Geschichte
Der »Fenstergucker« erinnert sich
Ein Exklusivinterview mit Meister Pilgram
»Es wird a Wein sein …«
Der Wiener Heurige
Alles Walzer
Wien und seine Bälle
Der Kaiser war nie am Opernball
Eine Institution im ¾-Takt
»Volk der Freiheit, Volk der Brüder«
Die andere Bundeshymne
Dampfschiffahrt ohne Dampf
Vom Reiseverkehr auf der Donau
»Wir sind doch keine Lipizzaner«
Die Wiener Sängerknaben
Die Hofburg brennt!
Zwei Feuerkatastrophen, 1668 und 1992
Rubens, Bruegel, Tizian, Dürer
Österreichs Kunstschätze
POLITISCHES
Mozart war kein Österreicher
oder Es ist schwer, ein Nationalheld zu sein
Auf dem Weg zur Demokratie
Wieso die »Rechten« rechts und die »Linken« links stehen
»Es kann nur einen Kanzler geben«
Die Regierungschefs der Zweiten Republik
»No sports!«
Wenn Politiker krank sind
IN ZEITEN WIE JENEN
In welcher Epoche lebte Fred Feuerstein?
In gar keiner, denn eine solche Zeit hat es nie gegeben
Sechzehn Menschen auf 48 m2
Der Alltag im Jahre 1747
Beine auf den Bühnen helfen Bühnen auf die Beine
Wie wild waren die zwanziger Jahre?
Ein Revuegirl, das in die Jahre kommt
Der 100. Geburtstag eines vergessenen Stars
ZWISCHEN KRAKAU UND BAD ISCHL
Der Kaiser im Hawelka
K. u. k. Krakau
Tirol liegt in Brasilien
Als Österreich die Welt benannte
Mit dem Hofratszug in die Sommerfrische
Die Dichter von Reichenau an der Rax
»Es komponiert sich so leicht bei Regenwetter«
Von Ischler Salzprinzen und Operettenkönigen
KLEINE UND GROSSE WELTGESCHICHTE
Dichter und Tierfreund
Ignaz Castelli
»Die Welt steht auf kan’ Fall mehr lang«
oder Der Komet kommt!
Ein Kreuz auf dem Kalenderblatt
Was Nostradamus wirklich prophezeite
»Mein Gott, es spricht«
Wie Mr. Bell das Telefon erfand
Herr von Knigge benimmt sich schlecht
Der Ahnherr der feinen Sitten war nicht immer fein
Die Ahnen des Bischofs
Die siebenhundert Jahre alte Familie Schönborn
Das war der Schilling
Ein Nachruf
Ein Paar Würstel um drei Schilling
Was wann wieviel kostete
Wenn es in Dallas geregnet hätte
Wetter macht Weltgeschichte
»Mehr Licht!«
Letzte (und vorletzte) Worte
Quellenverzeichnis
Von einer Jahrhundertwende zur anderen
Vorwort
Das kommt nicht wieder.« Den Titel dieses Buches kann man aufatmend zur Kenntnis nehmen, denn so gut waren die Zeiten nicht, daß man sie gleich noch einmal erleben möchte. Andererseits pflegt man der »guten alten Zeit« wehmütig nachzuweinen. Im Zeitalter des Internet sind »Sisis« Schönheit und die Geschichten vom »alten Kaiser« Reminiszenzen an verklungene Epochen, die entweder verteufelt oder aber allzu verklärt dargestellt werden.
Wir wollen weder verteufeln noch verklären. Sondern aufzeigen, was einst geschah. Wenn etwa von einer jungen Frau erzählt wird, die zur Jahrhundertwende den steinigen Weg auf sich nahm, als erste Österreicherin ein akademisches Studium zu absolvieren. Oder wenn unter »Kriminalgeschichten« berichtet wird, wieso gerade der letzte k. k. Scharfrichter ein überaus populärer Mann gewesen ist. Oder wenn wir über die Erotik unserer Großeltern informieren.
Caruso und anderen großen Tenören ist das Kapitel »Künstlerisches« gewidmet. In dem wir auch frühe Stummfilmstars und Radiopioniere treffen. Eine Begegnung mit Josef Meinrad sollte zum letzten Interview seines Lebens werden. Anhand eines bislang unbeachtet gebliebenen Meldezettels erfährt man, daß Ernest Hemingway 1925/26 im Vorarlberger Montafon auf Skiurlaub war – und zwar mit zwei Frauen gleichzeitig! Die eine – seine Ehefrau – wohnte in Schruns, die andere – die Geliebte – im nahen Gaschurn. Der Dichter pendelte einen Winter lang zwischen den beiden hin und her. Bis es zur familiären Entscheidung kam.
Hemingway finden wir auch – neben Tschaikowsky, van Gogh, Ferdinand Raimund und Stefan Zweig – im Kapitel über Große der Geschichte, die Selbstmord begingen.
Wer schließlich hätte das gedacht: »Mozart war kein Österreicher«! Der Nachweis für diese betrübliche Tatsache wird in dem gleichnamigen Kapitel erbracht. »No sports« heißt ein Abschnitt, in dem es um kranke Politiker geht und um den Einfluß, den ihre Krankheiten auf die Weltgeschichte hatten.
Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, das Attentat auf Hitler, die Ermordung John F. Kennedys, das Unglück von Tschernobyl und vieles mehr hat Nostradamus – so wird seit Jahr und Tag verkündet – vor vierhundert Jahren schon prophezeit. Geht man den Vorhersagen des »größten Sehers aller Zeiten« auf den Grund, bleibt allerdings nicht viel übrig von alledem.
Die letzten Worte historischer Persönlichkeiten sind auch die letzten Worte dieses Buches. Wir erfahren, was Marie Antoinette, Franz Kafka, Egon Friedell, Beethoven, Gustav Mahler sagten, ehe ihr Leben ausgehaucht war. Und natürlich Goethe, dessen letzte Worte seit Generationen Anlaß zu Spekulationen geben.
So unterschiedlich die Themen der historischen Reportagen dieses Buches sein mögen, der Untertitel »Neue Geschichten aus alten Zeiten« ist ein Hinweis darauf, daß es in all seinen Kapiteln den Bezug zum Heute darstellen will. Von Jahrhundertwende zu Jahrhundertwende.
GEORG MARKUSWien, im August 1997
MEDIZINISCHES
Die erste Frau Doktor
Gabriele Possanner setzt sich durch
Die junge Frau hatte sich Unmögliches in den Kopf gesetzt. Sie wollte Ärztin werden, wie viele Mitglieder ihrer Familie – oder besser: wie viele männliche Mitglieder ihrer Familie. Denn Frauen gehörten vor hundert Jahren noch an den Herd, durften Fabrikarbeiterinnen oder Dienstmädchen werden.
Während heute mehr als ein Drittel aller österreichischen Ärzte Frauen sind, gab es knapp vor der Jahrhundertwende hierzulande keinen einzigen weiblichen Arzt. Erst im Jahre 1897 durfte die erste Frau an der Universität Wien zum Doktor der Medizin promoviert werden. Gabriele Possanner von Ehrenthal war damit auch die erste Frau überhaupt, die in Österreich einen akademischen Titel führen durfte. Und sie nahm dafür einen unglaublichen Kampf auf sich.
Das »schwache Geschlecht« hatte ab der Mitte des vorigen Jahrhunderts an den meisten europäischen Universitäten Einzug gehalten. Österreich und Preußen hingegen waren die letzten Staaten, in denen Frauen keine Studienerlaubnis erhielten.
Possanner entstammte einer im 17. Jahrhundert geadelten Kärntner Familie. Sowohl ihr Großvater als auch einer ihrer Onkel waren Ärzte, während es ihr Vater als Jurist zum Sektionschef im Finanzministerium brachte. Als eines von sieben Kindern in großbürgerlicher Atmosphäre, vorerst in Pest, später in der k. u. k. Haupt- und Residenzstadt aufgewachsen, maturierte sie 1887, bereits 27 Jahre alt, als zweite Absolventin in der Geschichte des Akademischen Gymnasiums in Wien. Denn auch die Erlangung der Reifeprüfung war für Mädchen in jenen Tagen mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und in ihrem Abschlußzeugnis fehlte der Passus »Erteilung der Reife zum Besuch einer Universität«, wie er für männliche Maturanten vorgesehen war.
Also mußte sie ihr Studium im Ausland absolvieren. Sie inskribierte an der Universität Zürich, wo sie 1893 mit einer Dissertation über eine besondere Form der Netzhautentzündung zum Dr. med. promovierte und einige Semester als Assistentin an der Universitäts-Augenklinik tätig war. Nach Wien zurückgekehrt, suchte sie im Ministerium für Kultus und Unterricht um Nostrifizierung* an. Ihr Antrag wurde aber »mit Rücksicht auf bestehende Vorschriften gar nicht in Verhandlung genommen«. Und das, obwohl in Österreich großer Bedarf an weiblichen Ärzten – vor allem an Schulärzten für Mädchen – herrschte.
Gabriele Possanner hatte einen eisernen Willen. Und den unbändigen Wunsch, in ihrer Heimat als Ärztin zu arbeiten. So sandte sie innerhalb von zweieinhalb Jahren eine Unzahl weiterer Gesuche an Universitäten, Kliniken, Ministerien, an den Verwaltungsgerichtshof, das Abgeordnetenhaus. Und obwohl die spätere Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner und die Hotelbesitzerin Anna Sacher als prominente Mitglieder des Vereins zur erweiterten Frauenbildung ihren Kampf unterstützten, wurden ihre Eingaben entweder
a) abgelehnt oder
b) nicht beantwortet bzw.
c) auf gut österreichisch: »schubladiert«.
Denn: Würden Mädchen studieren, hatte Wiens Akademischer Senat schon 1873 gewarnt, »müßten Docenten vieles, was sich für das Ohr der Männer eignet, erst jenem der Frauen, namentlich züchtiger Jungfrauen, anpassen«. Und Unterrichtsminister Paul Gautsch von Frankenthurn hielt »die Concurrenz der Frauen für eine volkswirtschaftliche Gefahr«.
Am 8. Juli 1895 wandte sich Gabriele Possanner (mittlerweile Baronin) von Ehrenthal in ihrer Not an den Kaiser, den sie um »gnadenweise« Ausübung der ärztlichen Praxis ersuchte, zumal »zahlreiche Mädchen und Frauen sich scheuen, beim Beginne einer Krankheit einem männlichen Arzte sich anzuvertrauen, infolgedessen solche Leiden sich steigern und oft unheilbar werden«. Ihrem Gesuch lag ein »Appell« ihres 73jährigen Vaters an den Kaiser bei: »Nun soll sie im Alter von fünf und dreißig Jahren vor die Alternative gestellt sein; entweder Familie und Vaterland zu verlassen oder ihren Beruf aufzugeben. Ihre durch so schwer errungene, durchgreifende Ausbildung gewährleistete Befähigung für ihren Beruf soll brach liegen bleiben, ihr langjähriges, so ausdauerndes und ehrenhaftes Streben nach einem der edelsten Ziele, welche im menschlichen Leben überhaupt erreichbar sind, soll vereitelt werden, die schweren Geldopfer an das Ausland, welche ich, da uns das Inland verschlossen blieb, bringen mußte, müßten fruchtlos hinausgeworfen bleiben – kurz das Alles soll knapp vor dem Gelingen scheitern – an Motiven, welche die Wissenschaft sowie die sämmtlichen Cultur-Staaten der Welt als werthlosen Ballast schon längst über Bord geworfen haben!«
Die dramatischen Worte des Vaters verfehlten ihre Wirkung nicht, und jetzt endlich kam die Sache in Bewegung. Kaiser Franz Joseph beauftragte den Innenminister, den Fall zu prüfen, worauf dieser eine Verordnung erließ, mit der »die Nostrifizierung ausländischer Doktordiplome auch für weibliche Ärzte geregelt« wurde.
Possanner trat an der Universität Wien innerhalb von neun Monaten zu 21 Prüfungen an, die sie alle mit gutem Erfolg bestand. Am 2. April 1897 feierte sie im Großen Festsaal der Alma Mater ihre (zweite) Promotion zum Doktor der gesamten Heilkunde, wobei der Rektor der Universität die inzwischen 37jährige Ärztin in seiner Ansprache als »muthige Vorkämpferin um die Erweiterung der Frauenrechte« würdigte. Ihr Bild fand sich in mehreren Zeitungen, »da an der Wiener Universität zum ersten Male eine Dame zum Doctor promovierte«.
Dr. Gabriele Possanner blieb unverheiratet und ließ sich in Wien IX., Günthergasse 2/1. Stock als praktische Ärztin nieder, wo sie »täglich von 15 bis 16 Uhr« ordinierte. Einige Jahre auch in Wiener Spitälern tätig, behandelte sie nach dem Ersten Weltkrieg von der Caritas betreute Kinder. 1928 wurde ihr von Bundespräsident Michael Hainisch – wieder als erster Frau in Österreich – der Titel Medizinalrat verliehen. Sie starb im März 1940 im Alter von achtzig Jahren.
Ihr Kampf hat sich gelohnt. An Österreichs Universitäten schlossen 1996 fast so viele Frauen (4768) wie Männer (5842) ein Studium ab. An den medizinischen Fakultäten promovierten sogar mehr Frauen (529) als Männer (480).
Nur bei den Lehrern herrschen heute noch Zustände wie beim alten Kaiser: unter den 128 ordentlichen Professoren, die an Österreichs Universitäten Medizin unterrichten, sind 125 männlichen Geschlechts.
Und 3 (in Worten: drei) sind weiblichen Geschlechts.
* Anerkennung der ausländischen Diplome
»So werde ich es machen …«
Große der Weltgeschichte begehen Selbstmord
Selbstmord. Die Tat der Verzweiflung, der letzte Aufschrei einer gequälten Seele macht vor keinem Stand halt. Auch vor den ganz Großen nicht. Tschaikowsky, van Gogh, Hemingway, Adalbert Stifter, Stefan Zweig sind unsterblich.
Und waren nicht fähig, zu leben.
Wie manch andere Künstler, wie Könige, Prinzen und Politiker.
Ferdinand Raimund hatte so viel Schwermut und Melancholie in sich, daß er sich das Leben nahm, nachdem sein Hund ihn gebissen hatte. Am 29. August 1836 ereignete sich ein zunächst unbedeutend erscheinender Vorfall: der Volksdichter und Schauspieler war, von einer erfolgreichen Gastspielreise aus Hamburg kommend, auf seinen Besitz im niederösterreichischen Gutenstein zurückgekehrt, wo ihn sein Hund liebevoll empfing. Das Tier hatte unglücklicherweise kurz vorher mit einem anderen Hund im Dorf gerauft und sich dabei eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Bei der Begrüßung berührte Raimund den geliebten Hund unabsichtlich an der Wunde, so daß dieser instinktiv nach seinem Herrchen schnappte und an der Hand verletzte.
Was noch lange kein Drama gewesen wäre, weitete sich infolge der angekränkelten Psyche des Dichters zur Katastrophe aus. Nachdem ihm eine Zigeunerin in jungen Jahren prophezeit hatte, er würde dereinst an den Folgen eines Hundebisses sterben, war Raimund nun überzeugt davon, er wäre durch die Verletzung an Tollwut erkrankt und müsse elendiglich zugrunde gehen. Zwar ließ er noch eine Kutsche anspannen, um seinen Arzt zu konsultieren, doch als er unterwegs von einem schweren Gewitter überrascht wurde und im Gasthof Zum Goldenen Hirschen in Pottenstein übernachten mußte, verlor er die Nerven.
Um vier Uhr früh schoß er sich mit seinem Revolver, den er immer bei sich hatte, eine Kugel in den Kopf. Ferdinand Raimund starb nach einer Woche qualvollen Leidens.
Und hatte damit im Alter von 46 Jahren wahrgemacht, was er den Tischler Valentin im Verschwender singen läßt: Da leg’ ich meinen Hobel hin und sag’ der Welt ade …
Vincent van Gogh hatte mehrere Selbstmordversuche hinter sich, ehe er tatsächlich starb: Nach einem Streit mit seinem Freund Paul Gauguin schnitt er sich einen Teil der linken Ohrmuschel ab, worauf er, da die Aorta durchtrennt war, fast verblutete. Wieder genesen, schluckte er mehrmals giftige Malutensilien und begab sich dann freiwillig in die Irrenanstalt von Saint-Rémy in der Nähe von Arles.
Auch – und gerade – in den schlimmsten Phasen der Selbstzerstörung und während seiner stationären Behandlungen in Nervenheilanstalten schuf van Gogh einige der bedeutendsten Werke der Kunstgeschichte.
Bis er am 27. Juli 1890 in Auvers-sur-Oise bei Paris zum Revolver seines Zimmerherrn griff, die Waffe gegen seinen Unterleib richtete und abdrückte. Er starb zwei Tage danach.
War es die Verzweiflungstat eines erfolglosen Genies, dessen Bilder zu seinen Lebzeiten unverkäuflich waren? (Während sein Porträt Dr. Gachet bei einer Auktion in New York vor einigen Jahren umgerechnet mehr als 800 Millionen Schilling erzielte.)
»Er hat mehr an seinem Innenleben gelitten als an der äußeren Erfolglosigkeit«, meint der Wiener Psychiater Dr. Stephan Rudas. »Auch wenn van Gogh seine Bilder verkauft hätte, hätte ihn das nicht geheilt.«
Der Fall Ernest Hemingway untermauert diese These, denn auch er wählte den Freitod, und das, obwohl er zu Lebzeiten überaus erfolgreich war. Freilich ist seine Familie in eine tragische Kette von Suizidfällen verstrickt. Nicht nur der Dichter selbst, sondern auch sein Vater, sein Bruder, seine Schwester und – erst im Juni 1996 – seine Enkelin Margaux endeten durch Selbstmord.
Ernest Hemingway hat in Anwesenheit mehrerer Zeugen vorgeführt, daß Suizidgefährdete tatsächlich dazu neigen, ihr tödliches Vorhaben – als Aufschrei, als letzten Hilferuf – anzukündigen. Auf Kuba »spielte« der Literaturnobelpreisträger einmal die Szene regelrecht durch. »Sehen Sie, so werde ich es machen«, sagte er, setzte sich barfuß auf einen Sessel und stellte den Gewehrkolben zwischen seine Beine. Dann beugte er sich vor, schob sich die Laufmündung in den Mund und drückte mit der großen Zehe auf den Abzug, bis es klickte. »So begeht man Harakiri«, erklärte er, »denn der Gaumen ist der weichste Teil des Kopfes.«
In seinem letzten Jahr sprach er immer häufiger vom nahenden Ende, stellte sich manchmal neben den Gewehrschrank, hielt seine Waffen in der Hand und starrte zum Fenster hinaus.
Trotz seiner schweren Depression wurde er wenige Tage vor seiner Verzweiflungstat als Patient der weltberühmten Mayo-Klinik entlassen. »Es ist nicht zu hart ausgedrückt, daß den Ärzten der Klinik hier ein entscheidender Fehler unterlaufen ist. Denn es war ja auch den medizinischen Laien aus Hemingways Umgebung bekannt, welches ausweglose Wahngebilde er aufgebaut hatte«, meint der Wiener Arzt und Medizinhistoriker Hans Bankl, der in seinen Büchern den Tod außergewöhnlicher Menschen analysiert.
Mehrmals konnte »Hem« durch Freunde und Angehörige von dem immer wieder angekündigten Schritt abgehalten werden, doch als er sich am Abend des 1. Juli 1961 mit den Worten »Gute Nacht, mein Kätzchen« von seiner vierten Frau Mary verabschiedete, dachte sie nicht an eine gefährliche Situation. Und mußte am nächsten Morgen im Flur des Landhauses in Ketchum im US-Bundesstaat Idaho seinen Leichnam entdecken, ein Gewehr zwischen den Beinen. Der Selbstmord war von ihm genauso durchgeführt worden, wie er ihn angekündigt hatte.
Ein Jahr nach Hemingway wurde die Welt durch den spektakulären Freitod Marilyn Monroes erschüttert. Sie hatte seit langem in einem fatalen Teufelskreis gelebt, nahm nachts Unmengen von Tabletten, um schlafen zu können, und pumpte sich tagsüber mit Aufputschmitteln voll, um wieder wach zu werden. Der 36jährige Filmstar war immer von Männern umgeben und doch allein, ein Sexsymbol, das kein Glück in der Liebe fand. Das belegen vier gescheiterte Ehen – zuletzt mit Arthur Miller – und zahllose Liebschaften – darunter die Brüder John F. und Robert Kennedy. Es war ein »chronischer Selbstmord«, meint Professor Bankl, der sich über viele Jahre hinzog.
Tatsächlich hatte auch sie sich mehrmals umzubringen versucht, was aber in der Glitzerwelt von Hollywood unterging, nicht ernst oder einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde.
Als die Haushälterin Eunice Murray am Sonntag, dem 5. August 1962, um 3.30 Uhr noch immer Licht in ihrem Schlafzimmer brennen sah, alarmierte sie Dr. Greenson, den Psychiater der Monroe, der sofort kam und durch das Fenster in den Raum stieg. »Ich erkannte aus etlichen Metern Entfernung, daß Marilyn nicht mehr am Leben war«, sagte er später. »Da lag sie, mit dem Gesicht nach unten und entblößten Schultern, und als ich näher trat, konnte ich erkennen, daß sie mit der rechten Hand das Telefon umklammert hielt.«
Als ob der Hörer ihr die Einsamkeit hätte nehmen können.
»Es gibt keine Krankheit namens Selbstmord«, sagt Dr. Rudas, »aber es gibt verschiedene Ursachen, die eine solche Verzweiflungstat auslösen können.« Diese sind:
Eine organische Krankheit, die unerträgliche Schmerzen bereitet oder ohne Überlebenschance erscheint. In diese Gruppe von Selbstmördern gehört der Dichter Adalbert Stifter, der an einer schweren Leberzirrhose litt, ehe er sich mit seinem Rasiermesser eine Wunde am Hals zufügte, an deren Folge er starb.
Der Betreffende zieht eine Bilanz, in der er das Ziel seines Lebens verfehlt sieht. Adolf Hitler, Joseph Goebbels und weitere Verbrecher, aber auch auf andere Weise gescheiterte Existenzen gehören hierher.
Oft führen – wie bei van Gogh – psychische Erkrankungen zum Suizid. Zwar paßt das Wort von »Genie und Wahnsinn« auf den großen Maler, doch ist er, laut Rudas, »eher eine Ausnahme, denn Genies sind selten wahnsinnig und Wahnsinnige fast nie genial«.
Auch momentane Ausweglosigkeit – wie eine unglückliche Liebe – kann ein Grund für den selbstgewählten Tod sein. »Das sind Situationen, die der Betreffende zehn Tage danach ganz anders sehen würde. Doch bis dahin ist es oft zu spät.«
Schließlich bilden Drogen-, vor allem aber Alkoholsüchtige die größte Risikogruppe. Sowohl die Monroe als auch Hemingway waren schwere Alkoholiker.
Den Freitod wählten auch die Dichter Heinrich von Kleist, Georg Trakl und Klaus Mann. Und Stefan Zweig, der am 22. Februar 1942 mit seiner jungen Frau Lotte im brasilianischen Exil eine Überdosis Veronal einnahm – aus Verzweiflung, weil für ihn als Österreicher jüdischer Herkunft die Heimat verloren war. In seinem Abschiedsbrief beklagt er, daß »die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet«.
Für einen Neuanfang mangelte es ihm, zermürbt durch die lange Zeit des Exils, an Energie: »Nach dem sechzigsten Jahr bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es für besser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen. Ich grüße alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus! Stefan Zweig.«
Wie er wollte auch Kronprinz Rudolf nicht alleine sterben, weshalb der Sohn Kaiser Franz Josephs am 30. Jänner 1889 auf Schloß Mayerling seine Geliebte Mary Vetsera mit in den Tod nahm. Bei dem Thronfolger waren gleich mehrere Gründe ausschlaggebend, daß es zu der schrecklichen Tat kam: er war organisch und psychisch krank, glaubte an die Ausweglosigkeit seines Daseins, und er war sowohl Alkoholiker als auch Morphinist.
Drei Jahre vor Kronprinz Rudolf hatte sich sein Cousin, Europas »schönster und jüngster König«, Ludwig II. von Bayern, in den Tiefen des Starnberger Sees ertränkt. »Die moderne Erbforschung hat zweifelsfrei festgestellt«, erklärt Professor Bankl, »daß bestimmte Familien* infolge einer genetischen Konstellation für Selbstmord ganz besonders anfällig sind.«
Suizide sind schon aus der Antike überliefert, der berühmteste betrifft Ägyptens schöne Königin Kleopatra, die sich durch einen Schlangenbiß den Tod gab, nachdem ihr Heer ruhmlos gescheitert war.
Zum Selbstmord gezwungen wurde schließlich der Spion Oberst Alfred Redl. Als der k. k. Generalstab ihm 1913 nachweisen konnte, daß er Österreichs Aufmarschpläne an Rußland verkauft hatte, legten ihm seine Vorgesetzten einen Revolver auf den Tisch.
Hochrangige Politiker, die in jüngerer Zeit »freiwillig« in den Tod gingen, waren Uwe Barschel, der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und der langjährige österreichische Verteidigungsminister Karl Lütgendorf, die – vermutlich beide – in dubiose Affären verwickelt waren.
So unverständlich es erscheinen mag, daß Prominente ihr Leben wegwerfen, obwohl es gerade ihnen so viel zu bieten hat, »kommt bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, hinzu, daß sie nicht nur mit ihren eigenen Gefühlen fertig werden müssen, sondern auch mit jenen, die von anderen auf sie projiziert werden«, meint der Psychiater Rudas. Dennoch seien Genies, Künstler und Reiche nicht mehr und nicht weniger gefährdet als der übrige Teil der Bevölkerung. »Prominente begehen, statistisch gesehen, genauso oft Selbstmord wie andere Menschen. Eines haben freilich alle, ob prominent oder nicht prominent, gemeinsam: Daß sie es verabsäumt haben, sich rechtzeitig helfen zu lassen.«
Das gilt wohl auch für einen der größten Komponisten aller Zeiten. Peter Iljitsch Tschaikowsky ging im Jahre 1893, aus Angst, daß seine homosexuellen Neigungen bekannt würden, von dieser Welt.
Tschaikowsky, Hemingway, van Gogh, Ferdinand Raimund, Stefan Zweig schufen Werke, die uns helfen, das Leben erträglich zu machen.
Ihr eigenes ertrugen sie nicht.
* Kronprinz Rudolfs Mutter, Kaiserin Elisabeth, entstammte dem bayerischen Geschlecht der Wittelsbacher.
Der liebe Gott unter den Chirurgen
Theodor Billroth
Therese Heller war eine einfache Frau aus dem Volke. Und doch ist ihr Name in die Geschichte der Medizin eingegangen. Denn die 43jährige, an Krebs erkrankte Wienerin war es, der Theodor Billroth einen Teil des Magens entfernen und damit das Leben retten konnte. Es war die erste Operation dieser Art, und sie revolutionierte die Chirurgie. Theodor Billroth zählt seit dem Tag dieser Operation – man schrieb den 29. Jänner 1881 – zu den bedeutendsten Ärzten aller Zeiten.
Hätte diese eine Leistung genügt, Billroths Namen in alle Welt zu tragen, so müßten Bücher geschrieben werden, um sein kolossales Gesamtwerk festzuhalten. Die an Frau Heller erstmals angewandte Operationsmethode – nach Entfernung des vom Tumor befallenen Organteiles verband Billroth den Magenrest mit ihrem Zwölffingerdarm – ging als Billroth I in die Geschichte der Medizin ein.
Der große Arzt war 1829 als Sohn eines Pastors auf der Insel Rügen zur Welt gekommen, wo er eine schwere Kindheit erlebte: Als er fünf war, starb sein Vater an Tuberkulose, danach raffte dieselbe Krankheit seine vier Brüder hinweg. Als er sein Medizinstudium begann, verlor er auch seine Mutter.
Während in Österreich-Ungarn damals in einigen Fächern die später weltberühmte Zweite Wiener Medizinische Schule heranreifte, waren in der Chirurgie immer noch Paris und London führend. Bis Billroth, 38jährig, nach Wien kam.
Schon als junger Arzt hatte er sich die Frage gestellt, warum so viele Patienten nach chirurgischen Eingriffen hohes Fieber bekamen und trotz »gelungener« Operation starben. Billroth war klar geworden, daß die Infektionen »an den Betten, an den Händen der Wärter und Ärzte haften« und daß man sich davor »nur durch übertriebene Reinlichkeit schützen« könne. Robert Koch, der schließlich die Ursachen der Infektionskrankheiten fand, wurde durch diese Studien Billroths beeinflußt.
Vier Jahre nach Billroth I entwickelte der Chirurg mit Billroth II eine weitere aufsehenerregende Operationsmethode. Diesmal stellte er nach Entfernung des vom Tumor befallenen Organteiles die Verbindung zwischen verbliebenem Magen und Dünndarm her. Bereits 1874 hatte er als erster Arzt einen krebsbefallenen Kehlkopf entfernt, er verbesserte auch die Operationstechniken an Leber, Milz, Harnblase, an den Eierstöcken und an der Gebärmutter.
Niemand vor ihm wagte sich an so komplizierte Operationen heran, Patienten, die von derartigen Leiden befallen waren, hatten bis dahin keine Überlebenschance. Billroths Operationsmethoden gehören aber auch heute noch weltweit zum Standardrepertoire jedes Chirurgen.
Alles andere als ein trockener Wissenschafter, war Theodor Billroth auch überaus gesellig und ein genialer Musiker. Johannes Brahms, einer seiner besten Freunde, widmete ihm sein Streichquartett in a-Moll, und der große Arzt komponierte auch selbst. Als man ihm einen Lehrstuhl in Berlin anbot, lehnte er ab, weil ihm »das künstlerische Leben in Wien viel zu lieb geworden« war.
Die heutige Chirurgie ist mit der in der Zeit vor Billroth nicht vergleichbar. Als er ein junger Arzt war, gab es noch nicht einmal die Narkose, Patienten litten unter unvorstellbaren Schmerzen. »Ich habe ihn operiert und verbunden, Gott wird ihn heilen«, sagten viele Ärzte. Junge Doktoren mußten ein zölibatäres Leben wie Priester führen, da sie Tag und Nacht für ihre Patienten da zu sein hatten. Billroth war die Heiratserlaubnis ausnahmsweise erteilt worden, weil sein erster Chef in Berlin nicht seinen tüchtigsten Assistenten verlieren wollte.
Ausgebildete Krankenschwestern im heutigen Sinn gab es damals nicht. Als Billroth während des deutsch-französischen Krieges in Lazaretten mitansehen mußte, wie Soldaten nach Amputationen starben, weil sie von ungelernten Pflegerinnen falsch behandelt wurden, schloß er seinem – von ihm gegründeten – Rudolfinerhaus Österreichs erste Schwesternschule an, womit er praktisch einen neuen Berufsstand ins Leben gerufen hat. Das Krankenhaus befindet sich in der heutigen Billrothstraße.
Billroth war eine unglaublich populäre Erscheinung. Vor seinem Sommerhaus am Wolfgangsee gab es eine Haltestelle Billroth, in der die Bahn nur für ihn hielt. Als er mit 58 Jahren an einer gefährlichen Lungenentzündung erkrankte, bangte ganz Wien um sein Leben. Wieder genesen, wurde ihm zu Ehren ein Fackelzug veranstaltet, an dem Tausende von Menschen teilnahmen. Billroth kommentierte den Aufmarsch mit den Worten: »Es war eine schöne Leich’«.
Der Arzt hatte Kontakt zu Kaiser Franz Joseph, der ihn ins Herrenhaus berief, und auch zu dessen Sohn. Der Kronprinz übernahm die Patronanz des – nach ihm benannten – Rudolfinerhauses und unterstützte viele seiner Forschungsprojekte.
Billroth starb am 6. Februar 1894 während einer Kur in Abbazia an Herzversagen. Als zufriedener Mann, denn sein Lebensmotto hatte gelautet: »Wer anderen hilft, verhilft sich selbst zum Glück.«
Sex gestern & heute
Vom Liebesleben im Wandel der Zeiten
Wie war das früher, als Großpapa sein Bett mit Großmama teilte? Noch ehe die sexuelle Revolution über uns hereinbrach.
In einem Punkt, das steht fest, hat sich im Lauf von Jahrtausenden nichts geändert: Die Sexualität des Menschen war, ist und bleibt Thema Nummer eins. Ob in der Steinzeit, im Mittelalter oder am Beginn unseres Jahrhunderts – es wurde nicht mehr und nicht weniger geliebt als heutzutage. Empfahl Martin Luther vor fast fünfhundert Jahren schon
In der Woche zwier,
Schadet weder dir noch mir,
so traf er damit exakt auch das Ergebnis heutiger Untersuchungen: Herr und Frau Österreicher lieben einander – statistisch gesehen – zweimal pro Woche.
Damals wie heute.
Der Unterschied liegt in der Qualität. Was sich bis vor einigen Jahrzehnten ausschließlich hinter verschlossenen Schlafzimmertüren ereignete, das ist mittlerweile in aller Munde.
»Bist Du von geschlechtlichen Vorstellungen erregt?« Diese Frage richteten die Berliner Sittenblätter im Jahre 1897 – nicht ganz ohne Vorwurf – an ihre jungen Leserinnen, die gerade ihre ersten sexuellen Gelüste verspürten. Um dann fortzufahren: »Morgens stehst Du an der Waschschüssel, züchtig in Anstandsunterrock und Untertaille, hältst Hals und Arme rein, doch mußt Du beschämt die Augen senken vor dem Toben in Deinem Mieder, ja in Deinem Beinkleid. Neugierde, auf das, was Dir als Weib bestimmt ist, erhitzt Dich. Was ist und wie ist der Mann beschaffen …?«
Auf all die Fragen, einmal in den Raum gestellt, wußte das Blatt eine ganz einfache Antwort: »So höre denn, wenn es Dir mit Deiner Gesundheit und Sittlichkeit ernst ist: Gehe zu Deiner Mama und erbitte von ihr eine alte Salatschüssel aus der Küche. Fülle sie mit kaltem Wasser und setze Dich hinein. Es ist dies ein modernes Heilverfahren, welches nur deshalb so wenig Anwendung findet, weil das wohlanständige Bürgertum sich des Umstandes, aus welchem es angebracht ist, geniert.«
Die verlogene Prüderie, damals vielfach noch schlimmer als in den Jahrhunderten davor, führte dazu, daß Mädchen die »Fleischeslust« als unangenehm und ekelhaft empfanden.
»Die Bedürfnisse der Frau blieben in früheren Zeiten so gut wie unberücksichtigt«, erklärt Österreichs Sex-Expertin Gerti Senger, »der sexuelle Umgang miteinander war ausschließlich auf die Wünsche des Mannes beschränkt.«
Seit sich das – gerade in den letzten beiden Jahrzehnten – geändert hat, liebt die Frau bewußter, intensiver, länger: Während noch Ende der sechziger Jahre die Hälfte der Frauen unter Orgasmusstörungen litt, finden heute 82 Prozent im Geschlechtsverkehr ihre Befriedigung. Laut Kinsey-Report dauerte der durchschnittliche Liebesakt in den Nachkriegsjahren ein bis zwei Minuten, in den Neunzigern liebt sich’s in Österreichs Betten (inklusive Vor- und Nachspiel) immerhin eine halbe Stunde lang. Die sexuelle Revolution war also in erster Linie eine Revolution zugunsten der Frau.
Für den Mann hingegen brachte das plötzlich partnerschaftlich ausgerichtete Sexualleben Probleme. Denn während Frauen einst, ehe sie vom Herrn Gemahl erstmals beglückt wurden, im allgemeinen keinen anderen intim kannten, haben sie heute Vergleichsmöglichkeiten. Wenn einer im Bett also nicht »so toll« ist, muß er damit rechnen, an den körperlichen und sonstigen Qualitäten seiner Vorgänger gemessen zu werden.
Ein kurzer Blick noch in die Schlafzimmer unserer Großeltern: Opa hatte es gut, der durfte sein Liebesleben von frühester Jugend an genießen. Entweder im Bordell oder in den Armen einer Geliebten, die freilich aus den unteren Ständen zu kommen hatte, denn »höheren Töchtern« war jegliche Form des Beischlafs strengstens untersagt. Vorehelicher Verkehr galt für Frauen nicht nur als unmoralisch, sondern auch als gefährlich (was er tatsächlich war: Ein »lediges Kind« raubte einem Mädchen jede Aussicht auf eine bürgerliche Zukunft).
Niemand schildert die Scheinmoral des Fin de siècle so treffend wie Arthur Schnitzler in dem Zyklus Reigen