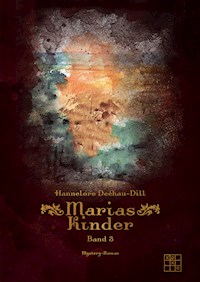Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maria-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wir begegnen noch einmal der 17-jährigen Maria, die im Februar 1988 in Seefeld zurückblieb. Am Ufer des Seefelder Sees steht eine einsame Mädchengestelt. Sie weiß nicht, wer sie ist, noch hat sie eine Erinnerung an ihre Vergangenheit. Sie stellt fest, dass sie ein Kind erwartet, weiß aber nicht, wer der Vater des ungeborenen Kindes ist. Warum streikt ihr Gedächtnis, und was hat sie hierher verschlagen, in das Städtchen Seefeld, das ihr doch ganz und gar unbekannt ist? Auf ihren verschiedenen Stationen hat sie oft das Gefühl verfolgt zu werden. Irgend jemand folgt ihrer Spur, aber stets ist sie ihm einen Schritt voraus. Wer ist es? Freund und Feind? Kommt es schließlich zu einer Begegnung? Auf der Suche nach ihrem alten Leben begegnet sie seltsamen Dingen und Menschen, und schließlich auch der Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Das Mädchen Maria
Teil 4 der Maria Reihe
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-061-3
E-Book-ISBN: 978-3-96752-561-8
Copyright (2020) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung einer Illustration der Autorin
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Zeit war – Zeit wird sein –
lasst das Stundenglas verrinnen;
wo aber ist das Jetzt in der Zeit?
- J.Q.Adams, 1767 – 1848
Was immer Zeit am Ende auch sein mag,
scheinen sich Ereignisse
auf ihrer Reise in die Vergangenheit
nicht einfach in »Nichts« aufzulösen,
sondern sozusagen auf Abruf
in der Raumzeit weiter zu existieren.
- J.v. Buttlar
Der Strand
Es war Februar 1988 und tiefster Winter.
Das Städtchen lag idyllisch in Schnee eingebettet. Die Luft war klar und frisch. Eine weiße Wintersonne schien von einem fast wolkenlosen Himmel herab und ließ den Schnee glitzern, so dass es die Augen blendete. Die mächtigen Arme der alten Kastanien am Weg waren nicht länger kahl und schwarz. Auf ihren ausladenden Ästen glitzerte ein dichtes Schneepolster wie weißes Spitzengewebe gegen das ungetrübte Blau des Himmels.
Auch die Eisdecke des Sees lag unter einer dicken Schneeschicht verborgen. Die Hügel am jenseitigen Ufer schimmerten glatt und unberührt. Alles ringsumher schien weiß und still und friedlich.
Eine einsame Gestalt stand regungslos am Strand, dessen gefrorene Schneedecke hart und krustig war unter ihren Füßen. Sie war eingehüllt in einen dunklen, weiten Mantel; die tief in die Stirn gezogene Kapuze verbarg das Haar und einen Teil des Gesichts. Über einer Schulter hing eine Umhängetasche. Die Hände hatte sie in die Manteltaschen vergraben, ihr Blick irrte über die weiß glitzernde Fläche des Sees. Wie benommen stand sie da, als versuchte sie sich zu erinnern, wie sie eigentlich hierhergekommen war.
Endlich rührte sich die Gestalt, riss mit einem Ruck die Hände aus den Taschen und wandte sich wie suchend um. Dabei rutschte ihr die Kapuze in den Nacken und gab ein blasses Mädchengesicht frei. Eine dunkle Haarflut quoll hervor und rieselte über Schultern und Rücken hinab.
Das Mädchen konnte kaum mehr als siebzehn Jahre alt sein. Verwirrt schaute es um sich. Sein Blick wanderte über den Strand und die verschneiten Gärten dahinter. Friedlich und schön lagen sie in ihrem winterlichen Kleid vor ihr, Büsche und Bäume verborgen unter der weißen Pracht. Schneebedeckte Hausdächer ragten dahinter empor, glitzernd im Sonnenschein.
In dem jungen Gesicht malten sich Bestürzung und Erschrecken. Nichts von alldem ringsumher kam ihr bekannt vor.
Wie um alles in der Welt war sie hierhergekommen?
An diesen Strand, den sie nie gesehen hatte, zu diesen Häusern und Gärten, die ihr allesamt fremd waren?
Es traf sie wie ein Schlag: Sie konnte sich nicht erinnern!
Wie war so etwas möglich? Lauschend hob sie den Kopf. Da war nichts als Stille um sie her bis auf den krächzenden Schrei einer einzelnen Möwe über dem See. War sie allein hierhergekommen?
Aber wie und warum?
Plötzlich flößte die verschneite, friedliche Landschaft ringsumher ihr Angst ein. Alles wirkte verlassen und unheimlich. Keine Menschenseele war zu erblicken. War sie in einem Traum? Einen verrückten Augenblick lang glaubte sie sich in die Fantasiewelt der Twilight-Zone hineinversetzt. Irgendwann in einer anderen Zeit hatte sie einmal einen Film gesehen, in dem sich eine junge Frau in einer Art Zwischenwelt wiederfand, unheimlich und furchterregend. Voller Angst war sie dort umhergeirrt, unfähig, wieder in ihre eigene Welt zurückzukehren.
Unsinn, schalt sie sich. Das war nur ein Film. So etwas gab es nicht in Wirklichkeit!
Aber war dies denn die Wirklichkeit?
Ein neuerlicher Schrecken packte sie und ihr Herzschlag setzte sekundenlang aus. Eine weitere entsetzliche Erkenntnis war ihr gekommen: Sie hatte auch vergessen, wer sie war!
Mit beiden Händen fuhr sie an ihr Gesicht, tastete über die Wangen, das Kinn, als ob es ihren Fingerspitzen möglich wäre, etwas Vertrautes in diesem Gesicht zu entdecken.
Da schien nichts Außergewöhnliches zu sein, alles war, wo es sein sollte. Und doch wusste sie nicht mehr, wie ihr Gesicht aussah! Ihre Finger berührten das lange Haar. Es war schwarz und zerzaust, reichte ihr weit über die Schultern herab. Sie starrte auf diese Hände, die eine der dunklen Strähnen hielt. Schmal und blass waren sie und ihr ganz und gar fremd.
Was um Gottes willen war geschehen?
War sie gestürzt und besinnungslos gewesen? Hatte ihr jemand etwas über den Kopf geschlagen und damit alle Erinnerungen ausgelöscht? Oder war ihr ganz einfach beim Spazierengehen ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen?
Alles konnte es sein oder nichts von alledem. Sie wusste es nicht. Das Einzige, was sie noch wusste war, dass sie sich an einem Strand vor einem zugefrorenen See befand.
Eine Woge von Furcht überflutete sie.
Ich weiß nicht, wer ich bin und wo ich bin, dachte sie.
Oh mein Gott, was soll ich tun?
Sie stand da, das Gesicht den fremden Gärten und Häusern zugewandt, und Panik wollte sich in ihr ausbreiten.
Ich muss ganz ruhig bleiben, dachte sie. Im Augenblick weiß ich nicht, was mit mir los ist. Mein Gedächtnis hat irgendeinen Schaden erlitten. Durch einen Sturz oder so etwas. Das wird vorüber gehen! Dann wird sich alles klären!
Während sie mit steifen, kalten Händen das Haar unter die Kapuze schob, rutschte der Lederriemen ihrer Handtasche herab. Voller Erleichterung griff sie danach.
Meine Tasche! Oh Gott, hier ist meine Tasche! Nun werde ich gleich wissen, wer ich bin.
Sicher würde sie doch Papiere darin finden, einen Ausweis, vielleicht gar einen Führerschein, Fotos, Adressbuch oder Terminkalender!
Ungeschickt nestelte sie an dem Verschluss. Es dauerte eine Weile, bis sie ihn geöffnet hatte. Erregt begann sie, mit klammen Fingern in der Tasche herumzuwühlen. Ihre Hände ertasteten eine Geldbörse, ein Paar Handschuhe, ein winziges Notizbüchlein. Das zerrte sie hervor, es rutschte ihr aus den zitternden Händen und fiel in den Schnee. Als sie sich hastig danach bückte, stürzte sie vornüber auf den gefrorenen Boden. Einen Augenblick lang drehte sich alles in ihrem Kopf, kalter Schweiß sammelte sich auf ihrer Stirn, und der Magen hob sich in nervösen, schlingernden Wellen, als wollte er sein Innerstes nach außen kehren.
Ich werde ohnmächtig, dachte sie, fast erleichtert über diesen Umstand. Und wenn ich dann zu mir komme, ist alles wieder in Ordnung.
Sie schloss die Augen und überließ sich dem taumeligen, flirrenden Schwindel, der ihr auf einmal ganz vertraut vorkam. Dann war es vorbei. Die Übelkeit war so plötzlich verschwunden, wie sie gekommen war, und auch das schwindlige Gefühl war fort. Ihr Kopf war wieder klar. Und doch immer noch so leer und ohne jegliches Erinnern.
Noch immer kauerte sie im gefrorenen Schnee. Dort lag das kleine Notizbüchlein neben der braunen Umhängetasche. Mit starren Fingern klaubte sie es vom Boden auf und schob es in die Tasche zurück. Sie fühlte sich außerstande, jetzt darin zu blättern, geschweige denn zu lesen!
Dann rappelte sie sich mühsam auf und wischte über ihre noch feuchte Stirn. Plötzlich spürte sie die Kälte. Ein eisiger Wind war aufgekommen, die Sonne war hinter Wolken verschwunden. Zitternd zog sie den Mantel enger um sich, schob sich den Riemen der Tasche wieder über eine Schulter. Ein flüchtiger Gedanke streifte die Handschuhe im Inneren der Handtasche, aber sie ließ sie, wo sie waren.
Ich muss ein Stück gehen, dachte sie unklar. Es ist zu kalt, um länger hier herumzustehen. Wenn ich mir Bewegung verschaffe, friere ich nicht so. Und vielleicht finde ich ein Café, in dem ich ausruhen und mich aufwärmen kann.
Dann würde sie bei einem heißen Kaffee den Inhalt der Tasche genauer untersuchen. Sie würde in dem Büchlein blättern und sicher irgend etwas zutage fördern, was ihr von Nutzen sein und ihre Identität verraten könnte.
Sie schob beide Hände in die Manteltaschen und setzte sich in Bewegung. Zunächst mit unsicheren, dann mit gezielten, schnellen Schritten wanderte sie über den hartgefrorenen Strand dahin.
Sie folgte einem schmalen Weg zwischen den Häusern hindurch, der auf eine größere Straße zu führen schien.
Kastanienweg las sie auf einem Straßenschild, und sie sah auch, woher der Weg seinen Namen hatte. Hohe alte Kastanien säumten ihn, deren mächtige Kronen dicht mit Schnee bedeckt waren. Diesen Weg wollte sie gehen, er würde sie sicher in die Stadt bringen, vielleicht zu Gegenden, Häusern und Menschen, die sie wiedererkannte. Und wenn ihr Gedächtnis sie dann immer noch im Stich ließ – vielleicht würde sie auf jemanden treffen, der sie erkannte! Dem ihr Gesicht nicht fremd war und der ihren Namen wusste, der sie dorthin zurück brachte, wohin sie gehörte!
Bevor sie in den Kastanienweg einbog, warf sie einen letzten Blick zurück auf den Strand und den zugeschneiten See dahinter. Und urplötzlich schoss etwas durch ihren Geist wie ein Lichtschein in der Dunkelheit oder ein scharfer Blitz in einer Gewitternacht, der eine Szene sekundenlang taghell beleuchtet. Vielleicht eine Erinnerung an etwas, das sie vor langer Zeit gesehen oder erlebt hatte.
Sie sah den See und es war Sommer!
Ganz deutlich war da dieser See vor ihren Augen – jedoch nicht verborgen unter Schnee und Eis wie heute, sondern blau und silbern funkelnd im Sonnenlicht, eingebettet wie in einer grünen Mulde. Golden der Strand und sanfte, teilweise bewaldete Hügel am jenseitigen Ufer, wo sich jetzt weite Schneeflächen unter einem tiefen Himmel entlang zogen.
Das Mädchen rührte sich nicht, stand ganz still da, und das Herz schlug ihr bis zum Hals. Was war das für ein Bild? So herrlich und vertraut und schön? Irgendwann hatte sie es gesehen, genauso wie in diesem kurzen Augenblick. Eine schmerzhafte Sehnsucht stieg in ihr auf und das Gefühl, als hätte sie etwas sehr Schönes verloren, und sie wusste nicht einmal, was das war.
Sie wusste nur, sie wollte es wiederhaben, und sie würde sich auf die Suche danach machen, sofort. Es musste zu ihrem Leben gehören, das doch sicher noch irgendwo auf sie wartete!
Und wer weiß, vielleicht fand sie es bald. In den Straßen dieser Stadt, die da vor ihr lag. Sicher war es da, ihr altes Leben unter den Menschen, die ihr nahe waren, die sie liebten und sicher schon vermissten!
Entschlossen richtete sie ihren Blick nach vorn. Jetzt wollte sie diesem Weg folgen, der sich Kastanienweg nannte, er würde sie auf eine andere Straße führen. Sie würde einfach immer weitergehen, bis sie auf irgend etwas stoßen würde, das ihr bekannt vorkäme.
Eine Gegend, ein Haus oder ein Mensch.
Ihre Erinnerungen würden wiederkommen und sie könnte dorthin zurückkehren, wohin sie gehörte!
Die Stadt
Die Sonne war endgültig hinter Schneewolken verschwunden. Ein eisiger Wind strich über sie hin. Bald würde es Abend sein.
Sie hatte den Kastanienweg hinter sich gelassen und wanderte nun auf dem Kirchweg dahin. Ein Schildchen an der Wegkreuzung hatte ihr seinen Namen verraten. Rechts am Weg erblickte sie auf einem Hügel eine kleine Kapelle, links begrenzten riesige Bäume den Weg. Das musste ein Park sein, er erstreckte sich den gesamten Kirchweg entlang. Hohe Tannen, deren gewaltige Zweige sich unter der Schneelast bogen, wechselten sich mit Birken, alten Buchen und Ahorn ab.
Hier und da führte ein schmaler Steg mitten hindurch, begrenzt von dichtem Unterholz und kleinen Kiefern, halbwegs unter tiefem Schnee verborgen.
Sie ging leicht gebeugt mit weit in die Stirn gezogener Kapuze dahin, den Blick aufmerksam in die Runde gerichtet. Auf der rechten Seite sah sie eine hübsche kleine Kirche, ein sauber gefegter Platz davor, ein schmuckloser, langgestreckter Backsteinbau schloss sich an. Nichts davon war ihr vertraut.
Wenn ich in diesem Städtchen wohne, müsste mir doch sicher etwas begegnen, das meinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft, dachte sie und wanderte weiter.
Der Kirchweg brachte sie in die Parkstraße. Vor einem imposanten Gebäude inmitten einer weitläufigen, parkähnlichen Anlage machte sie Halt. Dahinter waren weitere, kleinere und schlichtere Gebäude zu erkennen. Ihr Blick blieb auf dem Haupthaus haften und wanderte über Türmchen und Säulen einer vergangenen Epoche, über ein prächtiges Portal und hohe, hell erleuchtete Fenster.
Kuranlage las sie an der breiten Einfahrt.
Die erleuchteten Fenster wirkten sehr einladend, und am liebsten wäre sie hinein gegangen in die Wärme und ins Licht. Sicher hätte ihr doch niemand die Tür gewiesen!
Nach kurzem Zögern nahm sie ihre Wanderung wieder auf, ließ die Kuranlagen hinter sich und ging die Parkstraße weiter. Links erstreckte sich der Stadtpark, rechts erhoben sich ein paar größere Gebäude. Autos überholten sie im Schritttempo.
Es dämmerte schon, als sie den Marktplatz mit seiner Fußgängerzone erreichte. Ein paar altmodische Kandelaber warfen ihr mattes, gelbes Licht auf einen alten Brunnen, dessen sprudelnde Fontäne seit dem ersten Frost verstummt war. Eine rundliche, steinerne Maid mit einem gewaltigen Wasserkrug auf einer Schulter thronte in seiner Mitte. Eine dicke Schneehaube zierte ihre steinernen Locken.
Wege und Gässchen mündeten auf diesen Platz, auch der Stadtpark mit seinen schönen alten Bäumen begrenzte ihn an einer Seite. Ein paar Boutiquen und Lädchen, ein Kino und hübsche kleine Fachwerkhäuser umrundeten ihn.
Ihr Blick fiel auf die einladend erleuchteten Fenster eines kleinen Cafés. Auf einmal spürte sie ihre Müdigkeit.
Und nicht nur das! Jähe Erschöpfung und Mutlosigkeit überfielen sie mit Macht. Entschlossen steuerte sie das Café an. Sie musste unbedingt ausruhen und etwas Heißes trinken. So konnte sie nicht länger drauflos gehen.
Wärme und der überwältigende Duft nach Kaffee und Backwaren empfingen sie und hüllten sie ein, so dass ihr ganz schwach in den Knien wurde. Sie hatte gar nicht gewusst, dass sie so hungrig war. An einem runden Tischchen in einer halbdunklen Nische ließ sie sich auf ein Polsterbänkchen sinken. Erschöpft schob sie die Kapuze in den Nacken, schloss die Augen und lehnte sich zurück. Sie fühlte sich zum Sterben müde und wäre am liebsten für Stunden nicht mehr aufgestanden!
Als die nette junge Bedienung sie ansprach, fuhr sie erschreckt zusammen.
»Kaffee, bitte,« stammelte sie. »Und Kuchen auch, ja bitte.« »Wollen Sie den Kuchen am Büfett aussuchen?« lud die junge Frau sie freundlich ein. Sie schüttelte schnell den Kopf.
»Nein, bitte – irgendetwas - was haben Sie denn?«
Eine Aufzählung sämtlicher vorhandener Köstlichkeiten folgte, der sie kaum folgen konnte.
»Ja, Apfelkuchen bitte, zwei Stück,« sagte sie in den flüssigen Redeschwall hinein. Die junge Frau verschwand mit freundlichem Nicken und sie sank in die Polster zurück.
Gleich würde sie Kaffee bekommen, wunderbar duftenden heißen Kaffee mit viel Sahne und Zucker! Und etwas zu essen. Danach würde sie sich wohler fühlen, kräftiger, der Kopf würde sich ein wenig klären, so dass sie denken und planen könnte, was nun weiter geschehen sollte. Sie konnte doch unmöglich einfach so weiter durch die Stadt laufen!
Da schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Dass sie darauf nicht längst gekommen war!
Hier würde es sicher eine Toilette geben! Auf Toiletten hatte man gewöhnlich Waschbecken, und darüber pflegten in der Regel Spiegel zu hängen!
Und in diesem Spiegel würde sie sich erkennen!
Erst aber musste sie sich stärken, einen Schluck Kaffee trinken. Im Augenblick wäre es ihr ganz unmöglich, wieder aufzustehen und die Toilette aufzusuchen!
Da kam die nette Bedienung schon mit ihrer Bestellung. Sie stellte ein Kännchen Kaffee, Sahne und Zucker vor sie hin. Auf einem Teller lagen zwei ansehnliche Stückchen Apfelkuchen, mit dicken weißen Sahnehäubchen verziert.
»Ich wünsche einen guten Appetit,« sagte sie freundlich lächelnd.
Sie kennt mich nicht, dachte das Mädchen und musterte flüchtig die wenigen Gäste im Raum.
Und auch sonst niemand hier. Scheinbar bin ich diesen Menschen hier fremd. So fremd wie ich mir selber! Ich befinde mich unter lauten Fremden!
Dieser Gedanke brachte sie vorübergehend zum Lachen. Dann machte sie sich mit Heißhunger über Kaffee und Kuchen her.
Nach einer Weile lehnte sie sich aufatmend zurück.
So, das war schon besser! Wer weiß, wie lange sie nichts gegessen hatte! Es musste schon eine ganze Weile her sein.
Gleich wollte sie die Toilette aufsuchen. Dann würde sie sich im Spiegel betrachten. Sie würde sich erkennen und …
»Geht es Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen?«
Eine besorgte Stimme schreckte sie auf. Sie riss die Augen auf und blickte geradeswegs in die freundlichen blauen Augen der netten Bedienerin hinein.
Hatte sie geschlafen?
»Nein, nein. Vielen Dank,« stotterte sie. »Ich bin weit gegangen und nur ein wenig müde. Jetzt geht es schon wieder.«
Weit gegangen! Wie weit wohl?
Mit einem Ruck setzte sie sich auf.
»Wo finde ich Ihren Waschraum?« fügte sie eilig hinzu.
Das Mädchen deutete mit der Hand.
»Gleich hier um die Ecke, sehen Sie?«
Ein wenig mühsam schob sie sich vom Sofa hoch, ihr Blick fiel auf ihre Tasche.
Das Notizbuch, fiel ihr ein. Ich wollte doch nachsehen! Mein Gott, wie durcheinander ich bin!
Aber vielleicht war es ja gar nicht so verwunderlich, wenn man bedachte, dass sie möglicherweise irgend etwas auf den Kopf bekommen hatte!
Aber was? Schließlich fielen ja nicht so ohne weiteres Ziegelsteine vom Himmel!
Sie griff nach der Tasche und machte sich auf den Weg in den Waschraum. Hoffentlich war niemand darin! Sie schob die Tür auf und trat ein. Helle gekachelte Wände, zwei halboffene Türen dem Eingang gegenüber, die zu winzigen Toilettenräumen führten. Alles blitzte vor Sauberkeit und roch leicht nach einem Desinfektionsmittel.
Gott sei Dank, sie war allein. Sie schloss die Tür hinter sich und lehnte sich sekundenlang dagegen.
Dort! Dort drüben war das Waschbecken, ein breiter Spiegel hing darüber.
Gleich! Gleich würde sie sich in diesem Spiegel anschauen und sich erkennen!
Plötzlich wurde ihr über alle Maßen übel. Sie riss eine der Toilettentüren auf und beugte sich über eine makellos saubere Kloschüssel – gerade noch rechtzeitig.
Mit verschwimmendem Blick starrte sie auf das sprudelnde, wirbelnde Wasser hinunter, das soeben ihren gesamten Mageninhalt mit hinabgenommen hatte.
Der schöne Kuchen, dachte sie trübe und taumelte in den Waschraum zurück, drehte das kalte Wasser auf und hielt ihr heißes Gesicht darunter.
Was ist nur mit mir? Bin ich krank? Kommt wohl alles von dem Ziegelstein, dachte sie mit müder Ironie.
Mit geschlossenen Augen tastete sie nach der Papierrolle neben dem Becken, riss einen Streifen ab und trocknete ihr Gesicht. Dann öffnete sie langsam die Augen und blickte in den Spiegel. Erschrocken fuhr sie zurück.
Was hatte sie erwartet?
Vertraute Züge, plötzliches Erkennen, die Erinnerung und ein Ende dieses Albtraums, in dem sie sich befand?
Aber so war es nicht.
Das Mädchen, das sie aus dem Spiegel anblickte, war eine Fremde!
Sie sah in ein blasses, schmales Gesicht, umrahmt von wirren schwarzen Haaren, jetzt feucht an den Schläfen. Dicht und glatt fiel es über die Schultern herab, als sie den Kopf schüttelte. Ein Haarband, das in einer der Strähnen gehangen hatte, löste sich und fiel zu Boden. Ein Paar angstvoll aufgerissene, erstaunlich grüne Augen unter sehr dunklen Brauen starrten ihr entgegen. Das bin ich? flüsterten die vollen, blassen Lippen und starrten ungläubig in die seltsamen Augen des fremden Mädchens.
Aber wer bin ich? fragte der Mund der Fremden im Spiegel.
Um Gottes willen, wer bin ich?
Ein nervöses Schluchzen stieg ihr in die Kehle.
Ich muss ganz ruhig bleiben, ermahnte sie sich. Nur keine Panik und nur nicht ohnmächtig werden!
Langsam bückte sie sich und hob das Haarband vom Boden auf. Dann raffte sie mühsam das wirre Haar und band es im Nacken zusammen.
Ein letztes Mal warf sie einen Blick auf die Fremde im Spiegel, als könnte sie ihr nun endlich die Erinnerung an sich selbst zurück bringen. Fragende grüne Augen starrten sie an. Weiter geschah nichts. Der angstvolle Blick ihres Spiegelbilds zeigte ihr nur, wie verstört und erschöpft sie sich fühlte – das war alles.
Dann saß sie wieder in der Sofaecke und war froh über das Halbdunkel in ihrem Winkel. Die Gäste waren fast alle gegangen, nur eine alte Frau hockte über ihrem Teekännchen und starrte neugierig herüber.
Die freundliche Bedienerin stand vor ihr.
»Darf es noch etwas sein?«
Ich muss ihr wohl sehr merkwürdig vorkommen, dachte sie und überlegte, ob sie noch etwas bestellen sollte. Schließlich war ihr Magen nun wieder leer.
»Bitte, einen schwarzen Tee hätte ich gerne noch,« hörte sie sich sagen. Das war sicher keine schlechte Idee! Ein Tee würde gut sein.
Sie zog die braune Umhängetasche auf ihren Schoß und öffnete sie. Als ihr Blick auf die Geldbörse fiel, fuhr ihr ein Schreck durch die Glieder. Was wäre, wenn sich gar kein Geld darin befand? Ihre Sorge war unbegründet. Sie entdeckte allerlei Kleingeld und etliche Scheine. Gott sei Dank! Sie konnte leicht das hier bezahlen, und es bliebe noch einiges übrig.
Außer dem Notizbuch, den Handschuhen, einem Päckchen Papiertaschentücher, einem Kamm, einem Kugelschreiber und einer Tube Hautcreme war nichts darin. Kein Ausweis, keine Papiere, die ihr Aufschluss geben könnten, wer sie war und woher sie kam! Keine Schlüssel, kein Führerschein, keine Fotos!
Einen Führerschein habe ich wohl noch nicht, dachte sie. Vielleicht bin ich noch keine 18. Und wo ist mein Haustürschlüssel?
Sie sah die freundliche Bedienung mit ihrem Tee auf sich zu kommen und stopfte eilig alles in die Tasche zurück. Nur die Geldbörse und das Notizbuch ließ sie auf dem Tisch liegen.
»Ich möchte dann gleich bezahlen,« sagte sie und legte einen Geldschein auf den Tisch.
Als das Mädchen gegangen war, begann sie in dem Büchlein zu blättern. Es war ein Taschenkalender aus dem Jahre 1988.
Immerhin, also lebte sie jetzt im Jahre 1988.
Ein paar Namen sprangen ihr entgegen.
Daniellas sie unter dem 12. Mai. Das Geburtsjahr stand in Klammern dahinter: 1976.
Wer war Daniel? Ein Kind, das am 12. Mai Geburtstag hat und im Jahre 1988 zwölf Jahre alt wird.
Eine Henrike hatte im April Geburtstag. Weiter fand sie eine Leonore, die am 2. 12. ihren Geburtstag gefeiert hatte. Oder noch feiern würde?
Ihr kam in den Sinn, dass sie zwar wusste, dass Winter war, nicht aber welcher Monat.
Was macht das aus? dachte sie müde. Was ist das schon im Vergleich dazu, dass ich nicht einmal weiß, wer ich selber bin!
Da waren noch etliche Namen in dem Büchlein, jeweils eingetragen unter dem betreffenden Tag, der wohl ein Geburtstag sein musste. Es gab auch einen Martin, eine Beate, einen Magnus und eine Anna, aber all diese Namen sagten ihr nichts. Gar nichts! Kein Gesicht wollte sich den Namen zuordnen, keine vertraute Stimme in ihrem Kopf ertönte beim Lesen derselben. Nichts, gar nichts!
Eine Menge Namen, nur meiner nicht! dachte sie, als sie das Büchlein zuklappte. Da fiel ein Zettel heraus und auf ihren Schoß. Hastig griff sie danach und faltete ihn auseinander.
»Für C. von M.! Komm! Ich warte! In Liebe Maria« las sie dort in einfacher Druckschrift.
Sie starrte auf die wenigen Worte und das Herz schlug ihr bis zum Halse. Maria! Wer war Maria? Und wer war C.?
Als sie das Café verließ, war es draußen inzwischen völlig dunkel. Wie spät mochte es sein? Eine Uhr besaß sie nicht.
Es war ihr auch nicht wichtig. In ihrem Kopf kreisten die Worte: »Für C. von M.! Komm! Ich warte! In Liebe Maria.«
War sie C. und hatte sie diese Botschaft irgendwann bekommen und sich dann auf den Weg gemacht, um diese geheimnisvolle Maria zu treffen? Und hatte sie sie getroffen? Dort unten am See?
Und hatte dieses Treffen aus irgend einem Grund ihren Gedächtnisverlust zur Folge gehabt?
Was für einen mysteriösen Grund konnte es dafür geben?
Und wo war diese Maria jetzt?
Oder war sie selbst Maria und wollte das Zettelchen jenem unbekannten C. zukommen lassen, und es war nie dazu gekommen?
Das Zettelchen in ihrer Hand zitterte. Was hatte das alles zu bedeuten? Was war mit ihr geschehen?
Bin ich vielleicht verrückt und einer Anstalt entsprungen? Das könnte tatsächlich zutreffen, denn einen Sprung in der Schüssel habe ich zweifellos!
Darüber musste sie ein wenig lachen, obwohl ihr kein bisschen danach zumute war.
Eisig kalter Wind fuhr ihr ins Gesicht, als sie das Café verließ.
Langsam und in ihre wirren Gedanken versunken überquerte sie den Marktplatz. Ihr Blick fiel auf das Kino. Ein paar Jugendliche drängten sich davor. Und da war auch eine Uhr! 18.30 zeigte sie.
Sie bog in eine breite Allee ein, die von hohen alten Bäumen gesäumt wurde.
Ulmenallee las sie auf dem Straßenschild.
Nun also befinde ich mich in irgendeiner Ulmenallee an einem kalten Wintertag im Jahre 1988 um halb sieben Uhr abends, dachte sie mit einem Anflug von Galgenhumor.
Das ist doch schon etwas!Und in welcher Stadt befindet sich diese schöne Ulmenallee?
Wie eine Antwort auf ihre stumme Frage las sie an dem hohen Gebäude an der rechten Straßenseite: Seefelder Anzeiger .
Aha, dann ist das wohl Seefeld, dieses nette kleine Städtchen. Und was mache ich in einem Ort namens Seefeld? Wohne ich hier? Habe ich hier diese geheimnisvolle Maria getroffen?
Sie wanderte weiter die Ulmenallee hinunter, vorbei an alten Villen mit Licht hinter den Fenstern, das weich und einladend in die verschneiten Vorgärten fiel.
Maria! Bin ich vielleicht Maria? fragte sie sich und horchte lange in sich hinein. Aber da war kein Aufblitzen eines Erkennens, einer Erinnerung – gar nichts. Der Name brachte ihr kein Gesicht vor Augen, das dazu gehören könnte.
Fast war sie am Ende der Ulmenallee angelangt. Schon waren die letzten Häuser in Sicht. Wer weiß, wohin diese Straße dann weiterführte? Sie blieb stehen und wandte sich um.
Es hat keinen Sinn, dachte sie verzagt. Es hat alles keinen Sinn.
Ich weiß nicht, wer ich bin und werde bei diesem Herumirren nicht dahinter kommen.
Ihr Blick schweifte in die Runde. Sie musste sich ein Zimmer nehmen, irgendwo musste sie schließlich heute Nacht unterkommen. Und es durfte nicht zu teuer sein! Denn wer weiß, wie nötig sie ihr Geld noch brauchen würde.
Morgen früh dann, nach einer Nacht voller Ruhe und Schlaf, wäre vielleicht ihre Erinnerung wieder da!
Zielstrebig ging sie zur Stadtmitte zurück, ließ die feinen Villen in ihren gepflegten Vorgärten hinter sich. Endlich erreichte sie den Marktplatz. Suchend blickte sie sich um. Menschen eilten an ihr vorüber, mit aufgestellten Mantelkragen und ins Gesicht gezogenen Mützen. Flüchtige Blicke streiften sie.
Niemand stutzte bei ihrem Anblick oder rief freudig aus: »Ach Maria! Wie schön dich zu sehen!«
Ein kleines Mädchen mit roter Wollmütze und rotem Wollmäntelchen trippelte müde an der Hand der Mutter vorüber. Es blickte ihr ins Gesicht, und ein strahlendes Lächeln breitete sich darauf aus.
Sie erkennt mich, dachte sie und ein freudiger Schreck fuhr durch ihre Glieder. Der Blick der Frau glitt jedoch kühl und unbeteiligt über sie hinweg. Dann waren sie verschwunden.
Auch ihnen bin ich fremd. Niemand von all diesen Leuten kennt mich, dachte sie verzagt. Vielleicht bin ich wirklich nicht von hier.
Müde nahm sie ihre Wanderung wieder auf.
Sie musste eine weniger vornehme Straße finden, in der die Unterkünfte preiswerter waren. Dort war die Brunnenallee, klang eigentlich auch nicht billig, sah auch nicht so aus. Diese hübschen Fachwerkhäuser, die weitläufigen Anlagen mit ihre alten und neuen Brunnen.
Entschlossen bog sie in die Bahnhofstraße ein. Die wirkte weniger vornehm mit den einfachen Wohnhäusern und hohen Mietblocks. Hier gab es keine Villen in großzügig angelegten Vorgärten.
Langsam wanderte sie dahin. Nun spürte sie auch ihre Müdigkeit wieder. Nicht nur die Müdigkeit, es war eher schon eine unglaubliche Erschöpfung. Außerdem war der Hunger wieder da, ein nagender Hunger, der jetzt in ihrem Inneren zu rebellieren begann. Rechts erblickte sie eine weitläufige Parkanlage, die zum Kurgelände gehören mochte. Hohe alte Bäume und Buschwerk unter Schneepolstern, weiches Licht schimmerte hindurch, das Kurhaus.
Weiter und weiter marschierte sie die Bahnhofstraße entlang. Da war endlich der Bahnhof, hell erleuchtet, dort sogar ein Hotel, das Bahnhofshotel. Ein großes, ansprechendes Haus, sicher nichts für sie. Also weiter. Kaum trugen ihre Füße sie noch, mit Mühe schleppte sie sich voran. Ihr schien, als sei sie Kilometer um Kilometer gelaufen. Fast hatte sie das Ende der Bahnhofstraße erreicht. Hier gab es keine Mietblocks mehr, nur noch alte hohe Häuser mit finsteren, unfreundlichen Fassaden, spärlich das Licht hinter den Fenstern. Die Gegend wirkte ärmlich und trostlos. Schon wollte sie umkehren, da erblickte sie auf der anderen Straßenseite ein Schild an einem weitläufigen, düsteren Gebäude, ein Schild aus Metall mit einer Schrift darauf, nur mäßig von einer funzeligen Laterne beleuchtet.
Zielstrebig ging sie darauf zu.
Ein einstöckiges altes Backsteinhaus tauchte aus dem Dunkel vor ihr auf. Hinter einigen der Fenster brannte Licht. Stimmen drangen zu ihr heraus. Sie blieb stehen und las: »Zur roten Laterne« . Darunter hing ein kleineres Schildchen mit der Aufschrift: Inh. U. Barossow, Zimmervermietung.
Das ist genau das Richtige, dachte sie und blickte an der düsteren Hausfassade empor. Hotel konnte man das hier kaum nennen, eher eine etwas heruntergekommene Kaschemme. Sicher würden die Zimmer billig sein.
Bevor sie die Eingangstür aufstieß, kamen ihr einen Augenblick lang Zweifel, ob dieses wirklich das Richtige für sie war. Unschlüssig blickte sie sich um. Die Straße hinter ihr war leer wie ausgestorben, eine Ecklaterne warf ein trübes Licht auf den Schnee, weit und breit keine Menschenseele. Auf einmal wurde ihr recht beklommen und unheimlich zumute, und sie wollte schon auf dem Absatz kehrtmachen. Da wurde die Haustür mit einem Ruck aufgerissen.
»Zur Roten Laterne«
Erschrocken taumelte sie einen Schritt zurück.
»Hoho, wen haben wir denn hier?«
Eine vierschrötige Männergestalt erschien im Türrahmen. Seine riesige Silhouette stand gewaltig und dunkel in dem hellen Rechteck der offenen Tür, blaugraue Rauchschwaden drangen mit ihm nach draußen und stiegen ihr in die Nase.
»Berto! Hier kommt noch ein ganz besonderer Gast!« dröhnte seine Stimme ins Hausinnere hinein. Er trat einen Schritt beiseite, um ihr Platz zu machen.
»Nur herein spaziert, meine Süße! Hier findest du alles, was du brauchst. Mich einschließlich – wenn’s beliebt!« johlte er und eine breite Pranke griff nach ihr.
Erschrocken zuckte sie zurück und hätte fast die Flucht ergriffen, aber da wurde sie bereits am Arm gepackt und ins Innere des Hauses befördert.
»Nur keine Angst, mein Püppchen. Dir tut keiner was!«
Die polternde Stimme klang gutmütig und kaum furchteinflößend. Trotzdem spürte sie, wie ihre Knie zitterten, was aber auch von Hunger und Erschöpfung kommen mochte.
Tabakqualm, Küchendünste, Lärm und Halbdunkel drangen in einem dichten Schwall auf sie ein und drohten ihr die Luft zu nehmen. Der Boden unter ihren Füßen begann zu schwanken, das Gelächter und die Stimmen dröhnten durch ihren Kopf. Die Gesichter um sie herum verschwammen vor ihren Augen und verschwanden schließlich ganz in einem Nebel aus bläulichem Rauch. Und dann war es still, herrlich still.
Als sie wieder zu sich kam, kauerte sie in einem alten Lehnsessel, eine Hand hielt ihr ein Glas an die Lippen, und eine weibliche Stimme redete ihr gut zu.
»Nun trinken Sie, Kind. Das bringt Sie wieder auf die Beine.«
Gehorsam schluckte sie hinunter, was man ihr da einflößte. Es war scharf und stark und ließ sie husten, dann aber breitete sich eine angenehme Wärme in ihrem Inneren aus. Sie öffnete die Augen und atmete tief.
»Na, Kindchen, nun geht’s besser, was?«
Ein gutmütiges Frauengesicht lachte auf sie herunter, umrahmt von blondiertem Lockengewirr, ein Paar dunkel umrandete Augen musterte sie forschend, aber nicht unfreundlich.
»Ich bin Brenda und das da ist Umberto Barossow, der Chef hier im Hause.«
In ihrer Stimme klang respektvolle Bewunderung, eine kräftige Hand mit rot lackierten Nägeln wies auf den Mann hinter der Theke. Dieser war breit und riesig, mit einer dichten Mähne schwarzen Haares auf dem Kopf, die ihm in Stirn und Nacken hing. Er hatte buschige schwarze Brauen, die über der Nasenwurzel fast zusammen stießen. Seine dunklen Augen blickten mit einem eigentümlich lauernden Blick zu ihr herüber.
Über einem dichten, schwarzen Bart ragte herausfordernd der scharfe Boden seiner Nase empor, ein paar volle rote Lippen entblößten jetzt eine Reihe kräftiger weißer Zähne zu einem rätselhaften Lächeln, das gleichzeitig gefährlich und seltsam anziehend wirkte. Seine Haut hatte einen dunklen Olivton wie die Haut eines Südländers, seine Bewegungen wirkten trotz der mächtigen Gestalt katzenhaft und anmutig wie die eines Raubtiers. Er hatte etwas Zigeunerhaftes an sich und wirkte gleichermaßen faszinierend und furchteinflößend. Sein Alter war schwer zu schätzen, irgendwo zwischen Ende dreißig und fünfzig.
Jetzt betrachtete er sie forschend mit zusammen gekniffenen Augen. Die Gäste an den Tischen waren verstummt und starrten zu ihnen herüber.
»Gib ihr noch einen,« sagte er zu der blonden Frau. »Sie ist ja immer noch weiß wie ein Laken.«
Seine Stimme war tief und melodisch. Und noch etwas anderes schwang darin, etwas Forderndes, Herrisches, als sei der Mensch, zu dem diese Stimme gehörte, gewohnt Befehle zu erteilen und nicht bereit, eine Weigerung hinzunehmen.
Jetzt war er mit einer vollen Flasche zu ihr herüber gekommen und goss das Glas, das die Blonde noch in der Hand hielt, voll bis zum Rand.
Das Mädchen schüttelte den Kopf, aber er achtete nicht darauf.
»Trink,« befahl er und beugte sich zu ihr herunter, so dass seine dunklen Augen dicht über denen des Mädchens waren.
»Wo kommst du her und was willst du hier?« forschte er und blickte sie unverwandt an.
Sie gehorchte und nippte an dem Glas in der Hoffnung, dass ihr nun endlich besser werden möge.
»Ich suche ein Zimmer,« brachte sie dann hervor und erwiderte seinen Blick.
Er starrte ihr immer noch ins Gesicht. Plötzlich kam ihr ein Gedanke, sein forschender Blick hatte sie darauf gebracht.
Sie trank ihr Glas mit einem Ruck aus und fragte atemlos:
»Kennen Sie mich?«
Er schüttelte fast unmerklich den Kopf. Dann richtete er sich zu voller Größe auf und blickte sinnend auf sie hinunter.
»Wie kommt ein Mädchen wie du hierher?«
Misstrauen und Erstaunen schwangen in seiner Frage, aber sie hörte auch so etwas wie Neugier und Interesse heraus. Sie setzte sich auf und blickte ihm gerade ins Gesicht.
Der Alkohol tat seine Wirkung. Die Unsicherheit fiel von ihr ab. Was fiel ihm ein, sie zu duzen und auszufragen! Sie war nicht eine seiner Angestellten, sondern ein Gast.
»Ich brauche das Zimmer nur für ein paar Tage. Wenn Sie keines frei haben oder nicht vermieten wollen, brauchen Sie es mir nur zu sagen.«
Sie glaubte ein flüchtiges, belustigtes Aufblitzen in seinen Augen zu erkennen, aber bei diesem schummrigen Licht konnte sie sich auch getäuscht haben.
Der Wirt wandte sich zu der blonden Frau um.
»Führe sie nach oben, Brenda« und mit einem finsteren, spöttischen Blick über die Schulter: »Darf ich Ihren Namen wissen?«
Sie erschrak.. Ihr Name!
Ihr Blick flackerte zu Brenda hinüber, die sie neugierig musterte. Auch alle anderen im Raum starrten gespannt und neugierig herüber, als stünde ihnen eine interessante Eröffnung bevor.
Wie würden sie wohl reagieren, wenn sie antwortete: »Ich weiß meinen Namen nicht. Und auch sonst gar nichts von mir!«
Sie würde allesamt denken, ich spinne, dachte sie.
Was also sollte sie ihm sagen?
C. oder Maria?
»Cle – Cleo Cornells,« sagte sie und wunderte sich einen Augenblick, woher ihr dieser Name in den Kopf gekommen war.
»Also gut, Cleo Cornells,« sagte Umberto Barossow. »Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht.«
Es hörte sich an, als mache er sich lustig über sie. Er war hinter seine Theke zurückgetreten und betrachtete sie mit finsteren Blicken. Direkt furchterregend und gefährlich sah er aus.
Und sicher sieht er nicht nur so aus, dachte sie, als sie hinter Brenda den Raum verließ.
In ihrem Rücken setzte das Stimmengewirr wieder ein, Musik ertönte, das Gelächter von Männerstimmen.
Sie folgte Brenda einen halbdunklen Gang entlang bis zu einer steilen Treppe.
»Haben Sie kein Gepäck dabei?« forschte diese lauernd und zog an einer altmodischen Schnur an der Wand. Das Licht einer verstaubten Wandlampe erhellte den Gang nur spärlich, enthüllte mal gerade einen abgetretenen Treppenläufer auf den hölzernen Stufen, die beim Hinaufsteigen unter ihren Füßen knarrten.
»Nein, ich habe weiter kein Gepäck,« sagte das Mädchen, das sich nun Cleo nannte.
»Es – es hat sich so unvorhergesehen ergeben, dass ich ein Zimmer brauche.«
Sie waren im ersten Stock angelangt. Brenda blickte sich nach dem neuen Gast um und musterte ihn abschätzend im Schummerlicht.
»Es ist alles ein wenig alt hier bei uns,« meinte sie dann entschuldigend. »Der Chef hat keine Lust, noch viel in dieses Gebäude zu investieren. Es ist – nicht seine einzige Einnahmequelle, wie Sie sich denken können.«
Warum Cleo sich das denken konnte, blieb dahingestellt. Es war ihr auch einerlei. Sie wollte nur ein Zimmer mit einem Bett darin, in dem sie ungestört viele, viele Stunden lang schlafen konnte.
Sie folgte der blonden Frau den langen, düsteren Gang entlang, vorbei an mehreren Türen zu beiden Seiten, die wohl in die Gästezimmer führten. Auch hier bedeckte ein ausgeblichener Läufer den Holzfußboden. Etwas Drückendes lag in der Luft, ein dumpfes Gemisch von Gerüchen, das Menschen und Dinge im Laufe vieler Jahre darin zurückgelassen hatten, und das sich in dem dunklen Holz der Wandvertäfelung und Fußböden gesammelt und festsetzt hatte. Die Luft schien so schwer von Vergangenheit und Alter, dass selbst stundenlanges Lüften nichts dagegen ausrichten würde.
Endlich machte Brenda vor einer der Türen am Ende des Ganges Halt, zog ein Schlüsselbund aus einer Tasche und schloss auf.
Die Deckenleuchte mit dem altmodischen Fransenschirm verbreitete leidlich helles Licht im Raum. Er war mittelgroß mit einem einzigen Fenster zur Rückseite des Hauses, dessen dunkel gemusterter Vorhang zur Hälfte zugezogen war. Ein breites altmodisches Bett nahm den größten Teil des Zimmers ein, ein Nachtschränkchen daneben. An der gegenüberliegenden Wand stand ein Schrank aus sehr dunklem Holz. Alles in diesem Hause schien dunkel und alt zu sein.
Außerdem gab es ein Tischchen mit zwei Sesseln, einen schweren Lehnstuhl, der einige Jahrzehnte auf dem Buckel zu haben schien, und einen Teppich mit ehemals prächtigem Rosenmuster. Brenda öffnete eine schmale Tapetentür zu einem angrenzenden Raum. Eine Dusche und ein winziges Waschbecken befanden sich darin.
»Da sind Handtücher, und die Toilette ist am Ende des Ganges,« erklärte sie kurz.
»Um diese Jahreszeit haben wir kaum Gäste,« fügte sie hinzu und zupfte an der befransten Bettdecke.
»Die meisten Zimmer im Hause stehen leer.«
Die Frau trat ans Fenster, zog die Vorhänge zu und wandte sich um. Ihr geblümtes Hauskleid war in der Taille eng gegürtet und so kurz, dass es einen beachtlichen Blick auf die immerhin recht wohlgeformten Beine zuließ.
Sie schob den Bauch vor, kreuzte die Arme über der Brust und musterte Cleo nun eingehend.
»Sie sehen müde aus,« sagte sie dann. »Schlafen Sie sich aus. Ihr Frühstück können Sie haben, wann Sie wollen. Ich werde morgen früh auch da sein.«
Sie blickte Cleo lauernd an.
»Hat der Chef Ihnen Angst gemacht? Auf Fremde wirkt er oft so. Und nicht nur auf Fremde! Aber ich komm’ gut mit ihm aus – wenn ich tue, was er sagt! Sonst kann er schon sehr schwierig werden. Er ist ein unberechenbarer Mann.«
Ihr Blick wanderte abschätzend über Cleos schlanke Gestalt, die immer noch unter dem dunklen Mantel verborgen war.
»Aber nicht nur das -«
Sie lachte anzüglich und schob eine ihrer blondierten Locken hinters Ohr.
»Er mag Frauen – und die Frauen mögen ihn. Auch solche, die Angst vor ihm haben.«
Selbstgefällig zupfte sie an ihrem Ausschnitt herum, der eine Menge ihres üppigen weißen Busens freigab.
»Er ist schon ein Typ für sich,« sagte sie. »Und schlau. Dem macht keiner was vor! Kann auch ganz schön gewalttätig werden, wenn er getrunken hat. Und er versteht was vom Geldmachen.«
Ihr Blick landete wieder abwägend auf Cleo.
»Und von Frauen,« fügte sie vielsagend hinzu, als wollte sie abschätzen, inwieweit in dieser Hinsicht Konkurrenz von dem hereingeschneiten Gast zu erwarten war.
»Von reifen Frauen,« kam es dann.
Das alles war Cleo über alle Maßen gleichgültig. Sie wollte endlich ihre Ruhe haben, sich in das breite Bett dort drüben vergraben und hundert Stunden schlafen.
Cleo zog ihren Mantel aus und warf ihn über das Bett.
Sie hoffte, dass Brenda nun endlich das Zimmer verlassen möge. Sie war so müde, dass ihre Knie zitterten. Der Alkohol hatte sie außerdem ganz benommen gemacht, so dass sie alles um sich herum wie durch einen Schleier wahrnahm. Matt ließ sie sich in einen der Sessel sinken, das hübsche Gesicht der plappernden blonden Frau verschwamm fast vor ihren Augen.
»Er ist oft unterwegs,« hörte sie nun. »Sie werden also nicht viel von ihm zu sehen kriegen und können ganz beruhigt sein.«
Cleo schlüpfte aus den Schuhen und wunderte sich sekundenlang, warum sie bei dieser Witterung keine Winterstiefel trug. Ihre Füße waren eiskalt, ihr Magen meldete sich wieder. Der Gedanke an Essen jedoch bereitete ihr Übelkeit.
Eine Tasse Tee, dachte sie. Schöner heißer Tee, das wäre herrlich.
Sie sagte jedoch nichts. Sie war zu müde und wollte so schnell wie möglich diese blonde Frau loswerden.
Was wollte sie noch von ihr?
»Sie können Ihr Zimmer abschließen, wenn Sie wollen. Ich lasse Ihnen einen Schlüssel hier,« sagte sie jetzt.
Das werde ich sofort tun, wenn du nur erst draußen bist, dachte Cleo müde.
Aber immer noch stand Brenda vor ihr im Zimmer, vielleicht in der Hoffnung, endlich etwas Aufschlussreiches über den neuen Gast zu erfahren.
Cleo fühlte ihre neugierigen Blicke auf sich ruhen und hörte die muntere Stimme über sich hinwegrieseln, aber sie war kaum noch fähig zuzuhören. Sehnsüchtig schaute sie zum Bett hinüber. Sie wollte nur noch schlafen.
»Das Zimmer kostet 20,-- DM pro Nacht mit Frühstück,« hörte sie die Frau sagen. Das machte sie wieder munter.
Richtig, der Zimmerpreis! Der war ja nicht so ganz unwichtig! Schließlich war sie aus dem Grunde in dieser muffigen Spelunke gelandet.
»Ich hoffe, die Heizung funktioniert,« sagte Brenda und drehte daran herum. »Manchmal hat sie so ihre Mucken.«
Cleo überlegte. 20,-- DM, das war schon in Ordnung.
»Ich hoffe, Sie haben einen guten Schlaf,« sagte Brenda und ging endlich zur Tür. »Es kann nämlich sein, dass von da unten noch eine Menge Lärm herauf dringt. Das geht manchmal bis in den Morgen hinein – wie Sie sich denken können.«
An der Tür drehte sie sich noch einmal um.
»Musik und ein paar Betrunkene, verstehen Sie?«
Endlich war sie draußen, steckte den Kopf noch ein letztes Mal durch den Türspalt und meinte abschließend: »Hier oben sind Sie ja sicher. Außerdem können Sie abschließen. Also – gute Nacht.«
Damit war sie fort.
Cleo hörte sie den Gang entlang trippeln, dann die Treppe hinunter. Einen Moment später klappte unten eine Tür. Sie vernahm Musik und Stimmen, die gedämpft aus dem Erdgeschoss heraufdrangen.
Cleo atmete auf. Endlich allein. Ihre Müdigkeit war für den Augenblick verflogen. Sie trat ans Fenster, zog die Vorhänge zurück und öffnete es. Draußen war es nicht ganz dunkel. Der Himmel war voller Sterne. In der Ferne erblickte sie Hügel, sanft wie Dünen. Das Band einer baumgesäumten Straße zog sich hindurch. Dort hinten war die Stadt zu Ende.
Wo mochte es liegen, dieses Seefeld?
Zwischen Hügel und Wolkenfetzen warf der Mond sein kaltes, weißes Licht auf das stille Land. Ihr Blick fiel in einen Hof, der von zwei Seiten durch Nebengebäude begrenzt wurde.
Matter Lichtschein fiel durch ein Fenster nach draußen. Stimmen und Musik waren nun deutlicher zu hören. Undeutlich erkannte sie eine Bewegung in den Schatten übereinander gestapelter Kisten und Gerümpel. Sie vernahm Rascheln und Quieken wie von kleinen Tieren, die zwischen altem Kram und Mülltonnen auf der Suche nach Nahrung herum huschten. Sicher nur Mäuse, dachte sie flüchtig.
Bei dem Gedanken an Ratten schauderte es Cleo. Dann erblickte sie den sich geschmeidig heranschleichenden Schatten einer Katze, der mit einem mächtigen Satz hinter den Kisten verschwand; ein lautes Quieken ertönte, Geräusche, wie nach erfolgreich beendeter Jagd, dann Stille.
Eisige Kälte drang herein. Cleo atmete tief die klare Schneeluft ein. Die frische Luft war so angenehm, sie machte ihren Kopf wieder klar und vertrieb die abgestandene Luft im Raum.
Sie wandte sich ins Zimmer zurück und musterte die Ausstattung. Alles wirkte zwar alt, aber sauber. Sie trat ans Bett und zog die Fransendecke fort. Weiße, saubere Bezüge und Laken kamen zum Vorschein. Sie schloss das Fenster, ließ aber die Vorhänge offen, so dass es nicht ganz dunkel im Zimmer war.
Die Luft im Raum war nun angenehm frisch. Hier roch es zum Glück nicht so merkwürdig wie in den Gängen des Treppenhauses.
Cleo begann sich auszukleiden. Schlagartig kam ihr wieder zu Bewusstsein, in welch unglaublicher Situation sie sich befand. Sie betrachtete den grünen Pullover, die dunkle Hose, die sie angehabt hatte. Darunter trug sie schlichte weiße Unterwäsche. Sie ging ins Bad und stellte sich vor den Spiegel.
Wieder durchfuhr sie ein Schreck bei ihrem Anblick. Sie starrte der grünäugigen Fremden in das blasse Gesicht, beugte sich vor und musterte jeden Zug, jeden Zentimeter darin. Sie zog das Band aus den Haaren und wunderte sich über die gewaltige dunkle Flut. Warum hatte sie diese unpraktische Mähne nicht längst abgeschnitten. Es war doch ganz unmöglich, sich täglich damit zu befassen.
Ihr Blick glitt über ihre Schultern, den Hals und weiter über die Brust, die voll und straff war. Mehr konnte sie in dem Spiegel nicht sehen. Sie blickte an sich herunter, um ihren nackten Körper in Augenschein zu nehmen. Es war nicht schlecht, was sie da sah. Sie war sehr schlank, aber wohlproportioniert, eine schmale Taille, nette Hüften, wohlgeformte Beine. Ihre Größe schätzte sie auf 1,67 m, eher weniger.
Ihr Blick kehrte zu dem Gesicht im Spiegel zurück. Fremd und rätselhaft schaute es zurück.
»Wer bist du?« flüsterte sie der Unbekannten zu.
Und die Fremde antwortete: »Weißt du es nicht? Du bist nun Cleo. Cleo Cornells, 17 oder 18 oder 19 Jahre alt.«
Besser 18 oder 19 – wenn man sie fragte. Denn schließlich – war es nicht so, dass man erst mit 18 mündig war? Mit 17 hatte man noch nicht das Recht, über sich selbst und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Also war 18 entschieden günstiger.
Was soll mir das nützen, dachte Cleo müde.
Ich kann weder das eine noch das andere beweisen, denn ich habe keinerlei Papiere. Und behaupten kann man viel.
Sie begann zu frieren, und die Müdigkeit war auch wieder da. Sie wusch sich flüchtig und ging ins Zimmer zurück. Dann löschte sie das Licht, und nur mit ihrem Hemdchen bekleidet kroch sie ins Bett. Die Daunendecke war leicht und roch nach Lavendel. Gott sei Dank, sie musste sich nicht ekeln, darin zu schlafen.
Immer noch war ihr kalt, die Heizung schien nicht in Ordnung zu sein. Sie zog die Decke bis über die Ohren hinauf, aber es nützte nicht viel. Sie klapperte mit den Zähnen, ihre Hände und Füße waren wie erstarrt. Schließlich stand sie wieder auf und zog ihren Pullover über das Hemd. Dann kroch sie wieder unter die Decke und lag zusammen gekauert da. In der Ferne hörte sie eine Tür schlagen, Stimmen und Musik drangen gedämpft herauf. Nichts davon störte sie, nur ihre eigenen wirren Gedanken ließen sie nicht zur Ruhe kommen.
Ich muss nun schlafen, sagte sie sich energisch.
Heute kann ich nichts mehr tun. Aber morgen! Morgen wird alles wieder in Ordnung sein. Und wer weiß – vielleicht wache ich auf und stelle fest: Es war alles nur ein Traum!
Im Morgengrauen war sie dann wieder am See.
Es war nun aber Sommer, die Sonne schien und es war warm. Weit draußen auf dem Wasser blähten sich die weißen Segel einiger Boote im leichten Sommerwind. Weiße Wölkchen spiegelten sich im Wasser und zerflossen in silbernen kleinen Wellen an seiner Oberfläche.
Sie spazierte unter riesigen Kastanien wie unter einem grünen Tunnel dahin. Die alten Bäume warfen große, schützende Schatten, dunkel und krass gegen das glänzende Gold des Sonnenscheins. Da waren Weiden am Ufer, und im Schilf blühten Lilien.
Cleo kannte diesen See, und sie kannte den Weg, auf dem sie wanderte. Sie wusste, wenn sie immer weiter ginge, käme sie an eine Stelle im Schilf, da fiel das grüne Ufer sanft zum See hin ab. Der See war dort flach, man konnte durch das hohe Gras gehen und dann ins Wasser hinein waten. Es gab weiße Seerosen, und selten kam ein Mensch hin. Sie aber war sehr oft schon hier gewesen, sie wusste es genau. In der Mittagspause war sie hergekommen, um zu schwimmen, Tag für Tag den ganzen Sommer lang – so wie heute.
Gleich würde sie den Weg am See zurück gehen, in die Stadt hinein, die sie kannte…
Sie wandte sich um auf ihrem Weg, und da vorn waren sie schon, die ersten Häuser dieser Stadt, und sie kamen ihr ganz vertraut vor…
Cleo erwachte vom Klappern der Fensterläden, an denen der Wind rüttelte. Sie schreckte im Bett hoch und wusste im Moment nicht, wo sie sich befand. Dann fiel ihr Blick auf das matte Rechteck des Fensters, von dem sie spät am Abend die Vorhänge zurück gezogen hatte und hinter dem jetzt der Morgen graute. Vom Hof her hörte sie Scheppern und Scharren und eine männliche Stimme, die jemanden rief. Cleo verstand die Worte nicht, und auch die Stimme war ihr fremd.
Nun erkannte sie das Zimmer wieder, in dem sie sich gestern Abend zur Ruhe begeben hatte, und mit einem Schlage war der gestrige Tag wieder da. Mit einem Ruck setzte sie sich im Bett auf und horchte in sich hinein.
War sie wieder da, die Erinnerung an ihr bisheriges Leben?
An ihren Namen, an ihr eigentliches Ich?
Sie entsann sich deutlich ihres Umherirrens in einer fremden Stadt. Sie sah sich wieder durch abendliche Straßen wandern, müde, erschöpft und mutlos. Sie schloss die Augen und beschwor die Bilder des gestrigen Tages herauf.
Endlose, unbekannte Straßen im Schein der Laternen, Häuser in verschneiten Gärten, in die das Licht aus den Fenstern fiel, ein hübscher Marktplatz mit einem Brunnen in seiner Mitte, riesige alte Bäume in einem verschneiten Park. Und dann die düstere Bahnhofstraße mit den Wohnblocks im funzeligen Laternenschein. Schließlich dann das Ende ihres Wegs und ihr Ziel: Diese finstere Kaschemme »Zur roten Laterne«.
All das war da in ihrem Kopf, in ihrer Erinnerung. Und das war alles. Mochte sie ihr Hirn noch so anstrengen, ihr Gedächtnis wollte keine anderen Bilder hervorbringen als die des vergangenen Tages!
Und dann der See, richtig! An diesem See hatte alles angefangen. Von da an begann ihre Erinnerung.
Plötzlich stockte ihr Herzschlag. In der Nacht hatte sie von einem See geträumt, und es war nicht dieser See gewesen!
Cleo setzte sich im Bett auf. Es war eiskalt im Zimmer, aber das kümmerte sie im Augenblick nicht. Sie wollte sich die nächtlichen Traumbilder wieder in Erinnerung rufen, ganz genau!
Sie war unter Bäumen am Seeufer gewandert. Es war aber nicht der Kastanienweg, auf dem sie gestern gegangen war! Ganz deutlich hatte sie nun die Bilder ihres Traums wieder vor sich, und sie wusste, diesen See hatte sie nicht nur geträumt! Sie hatte ihn irgendwann in ihrem vergangenen Leben gesehen, war an seinem Ufer entlang spaziert. Ja, sie hatte auch darin gebadet.
Immer in der Mittagspause!
Danach war sie zurückgegangen in die Stadt auf diesem Weg unter den Bäumen. Sie sah das Stück des Wegs vor sich, den sie in der Nacht gesehen hatte. Da vorn waren schon die Häuser jener Stadt zu sehen!
Cleo schloss die Augen und beschwor die nächtlichen Bilder herauf in der verzweifelten Hoffnung, dass nun auch der Rest sich dazugesellen möge. Der Rest dieses Weges in die Stadt hinein, dann die Stadt selbst, ihre Straßen und Häuser. Und endlich auch das Haus, in das sie hineinzugehen hatte.
Weil sie darin wohnte oder weil sie dort arbeitete.
Zu Menschen, zu denen sie gehörte!
Aber ihr Gedächtnis ließ sie im Stich.
Da waren nur ihre Bilder aus dem Traum und die Bilder des Tages und Abends zuvor, weiter nichts.
Sie ließ sich in die Kissen zurücksinken und spürte das klamme Bettzeug auf ihrer Haut. Komisch, gestern Abend war es ihr doch ganz in Ordnung erschienen. Nun aber schien es ihr feucht. Von unten drangen Stimmen an ihr Ohr. Türen schlugen und ein Auto fuhr an.
Cleo lag regungslos, die Decke bis zum Hals hochgezogen. Sie blickte auf das Fenster, hinter dessen staubiger Scheibe der Morgen heraufkroch.
Ich muss aufstehen, dachte sie. Dann überkam sie eine derartige Mutlosigkeit und Resignation, dass sie einfach liegen blieb und an die Decke starrte.
So lag Cleo lange Zeit. Irgendwann glitt sie in ein seltsames Halbdämmern hinein. Ein Gefühl von Entrücktheit und Schwerelosigkeit erfasste sie. Sie verlor jeden Sinn für Zeit und Raum. Ihr war, als schwebte sie in einem bodenlosen Nichts dahin, ohne Ende und ohne Ziel. Ein Zustand zwischen Schlafen und Wachen und ihr nur halb bewusst. Hinter ihren Lidern drängten die Ereignisse des vergangenen Tages sich wirr durcheinander.
Sie sah Männergesichter verschwommen hinter blauen Rauchschwaden, das hübsche, geschminkte Gesicht Brendas. Die finstere, bärtige Miene des Wirts, seine schwarzen Augen unter drohend zusammengezogenen Brauen.
Und dann seine raue Stimme, die sie anbrüllte, dass sie zusammenzuckte und mit einem Schlage hellwach war.
Cleo fuhr mit einem Schrei aus den Kissen hoch und stellte fest, dass sie allein im Zimmer war. Diese Stimme jedoch, seine Stimme, hallte noch durch das Haus. Es war die Stimme von Umberto Barossow, die sie aus ihrem Dämmerschlaf gerissen hatte und nun von unten heraufschallte.
»Verdammt, wo steckst du wieder!« schrie die Stimme erneut, drohend und voller Wut und dermaßen laut, dass Cleo das Gefühl hatte, die Wände würden dabei erzittern. Es war, als stünde der Mann vor ihrer Tür und brüllte nach ihr.
Ohne zu überlegen, sprang sie mit einem Satz aus dem Bett. Taumelnd in Hemd und Pullover stand sie da und starrte auf die Tür, als würde im nächsten Moment die mächtige Gestalt des bärtigen Wirts in ihrer Öffnung erscheinen.
Das Schlagen einer Tür im Erdgeschoss brachte sie zur Besinnung. Niemand stand vor ihrer Tür, und niemand brüllte nach ihr. Die Stimme war von unten heraufgeschallt. Erleichtert atmete sie auf und sank auf die Bettkante. Plötzlich wurde ihr über alle Maßen übel. Ihr Magen schlingerte in nervösen Wellen, und im Kopf wurde ihr sehr leicht. Gerade konnte sie noch das Waschbecken in dem winzigen Duschraum erreichen. Sie würgte und spuckte, während ihr der Schweiß auf die Stirn trat. Ihr Magen war jedoch leer, sie hatte seit wer weiß wie langer Zeit nichts gegessen. Der Kuchen vom Vortag fiel ihr ein, aber den hatte sie ja auch wieder von sich gegeben.
Matt stützte sie sich mit beiden Armen auf das Waschbecken und wagte kaum einen Blick in den Spiegel. Dann aber schaute sie doch hinein und sah ein bleiches Gesicht mit dunklen Schatten unter riesigen grünen Augen.
Zum Gotterbarmen sehe ich aus, dachte sie, ging langsam ins Zimmer zurück und schlüpfte in Schuhe und Mantel.
Sie musste sich auf die Suche nach der Toilette begeben.
Inzwischen wurde das Licht hinter den Fensterscheiben heller, die Geräusche im Hause verstärkten sich.
Diese ganze Geschichte nimmt mich doch ganz schön mit, stellte sie fest.Aber war es ein Wunder?
Mit unsicheren Schritten schlich sie den Gang entlang. Wieder drangen Stimmen und Türenknallen zu ihr herauf.
Die Toilette fand sie am Ende des Ganges.
Ich muss nachdenken, dachte Cleo, während sie unter der Dusche stand, deren Wasser zum Glück warm, wenn auch nicht heiß war.
Und ich muss die Ruhe bewahren. Nun werde ich gleich zum Frühstücken nach unten gehen, und dann muss ich überlegen, was weiter zu tun ist.
Sicher würde doch jemand sie vermissen! Man würde sie suchen, ihre Eltern oder die Menschen, bei denen sie lebte, vielleicht Freunde. Oder diese Maria?
Ging sie auf eine Schule oder hatte sie irgendwo eine Arbeit, einen Chef, Kollegen und Kolleginnen, die bei Dienstantritt nach ihr Ausschau hielten? Einen Ehemann würde sie kaum haben in ihrem Alter.
Wie suchte man eigentlich jemanden, der verloren gegangen war?
Man rief Bekannte an, Verwandte, möglicherweise den Freund – irgendwelche Menschen, bei denen man die Verlorengegangene vermutete. Wer weiß? Vielleicht war es ja öfter vorgekommen, dass sie eine Nacht von zu Hause wegblieb, bei einem Freund oder einer Freundin.
Es war früher Morgen. Ganz sicher würden die Menschen, denen sie nahe stand, bei denen sie lebte, in wenigen Stunden mit ihrer Suche beginnen. Und wie dann weiter? Bestimmt würde doch niemand sie hier in der »Roten Laterne« vermuten.
Irgendwann würde man sich wohl an die Polizei wenden und eine Vermisstenanzeige aufgeben.
Die Polizei! Warum ging sie nicht einfach zur Polizei!
Die Polizei, dein Freund und Helfer!
Sicher konnte man ihr da irgendwie helfen! Vielleicht lag schon eine solche Anzeige vor. Bestimmt würde man von dort aus Nachforschungen unternehmen können.
Natürlich, das war eine Möglichkeit! Gleich nach dem Frühstück wollte sie sich auf den Weg machen. Und vielleicht traf sie auf diesem Weg doch noch jemanden, der sie erkannte.
Oder ihre Erinnerung kehrte zurück!
Sie kleidete sich rasch an, band das Haar mit dem Band im Nacken zusammen und beschloss, bei nächster Gelegenheit eine Schere zu besorgen, um es zu schneiden.
Dann verließ sie das Zimmer und trat auf den Gang hinaus.
Die Polizei, dein Freund und Helfer
Cleo saß allein am Frühstückstisch.
Sie hatte mühelos den Raum wiedergefunden, den Brenda die »Bar« nannte und in dem der gestrige Tumult sich abgespielt hatte. Sie hatte eine Weile gewartet, dann an eine der Türen im unteren Flur geklopft, hinter der sie Geschäftigkeit und Stimmen vernahm. Es war die Küche gewesen, in der Brenda dabei war, einen großen Lebensmittelkarton auszupacken und zu kontrollieren, den ein Junge soeben gebracht hatte.
Die Küche war riesig, mit einem gewaltigen Herd an einer Seite, Stühlen und einem Holztisch in der Mitte. Schränke standen an den Wänden, Geschirr stapelte sich auf Wandborden, das breite, vorhanglose Fenster blickte auf den Innenhof hinaus. Es war warm im Raum und duftete einladend nach Kaffee und gebratenem Speck.
Brenda hatte sie freundlich in einen Nebenraum geführt, den sie »Aufenthaltsraum« nannte.
Cleo hatte großen Hunger, und der Duft des Specks ließ ihr das Wasser im Munde zusammen laufen. Als er dann aber vor ihr stand, zusammen mit Spiegeleiern und Toast, war es, als wollte sich ihr Magen wieder umdrehen.
Schweiß sammelte sich auf ihrer Stirn, und betrübt betrachtete sie das Essen vor sich auf dem Teller.
Um Gottes willen, sollte denn jedes Mal, wenn sie zu essen gedachte, ihr Magen derart rebellieren?
Cleo blieb still auf ihrem Stuhl sitzen und atmete tief. Langsam wurde ihr besser. Sie trank den Kaffee in kleinen Schlucken, knabberte an dem trockenen Toast und zog schließlich den Teller mit den Eiern und dem Speck wieder zu sich heran.
Und dieses Mal klappte es. Sie konnte essen. Langsam und in aller Ruhe aß sie den Teller leer und trank etliche Tassen Kaffee dazu. Danach war ihr besser. Ihre Mutlosigkeit und Verzagtheit waren verschwunden.
Der Gedanke an die Polizei, die ihr sicher helfen konnte, beflügelte sie geradezu. Gleich nachher wollte sie sich auf den Weg zum nächsten Polizeipräsidium machen!
Hin und wieder spähte Brenda in den Raum, um nachzusehen, ob alles nach Wunsch war. Zeit zum Schwatzen schien sie heute Morgen nicht zu haben. Scheinbar war der Chef da, und sie hatte ihre Arbeit zu tun.
Bei dem Gedanken, der finstere Wirt mit der dröhnenden Stimme könnte hier neben ihr auftauchen, begann Cleos Herz ängstlich zu klopfen. Was war das für ein furchteinflößender Mann. Wie hatte Brenda gesagt?
»Er kann recht gewalttätig werden, wenn er getrunken hat… .«
Außer Brenda ließ sich jedoch niemand blicken.
Nach dem Frühstück ging Cleo in ihr Zimmer hinauf, um Mantel und Tasche zu holen. Dann verließ sie das Haus.
Der Wind hatte ein wenig nachgelassen. Der Himmel war bewölkt, Schnee lag in der Luft.