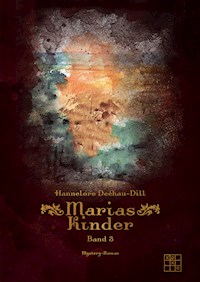Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Leute vom Kastanienweg
- Sprache: Deutsch
Den Leuten im Kastanienweg ergeht es wie allen anderen Menschen auf der Welt: Sie leben im Heute und sie planen ihr Morgen - mehr oder weniger. Doch was ist mit dem Gestern? Hat nicht ein jeder seine eigene Leiche im Keller? Manchen Leuten geht es ausgezeichnet mit ihrem Gestern. Sie haben eine ruhige, friedliche Vergangenheit, auf die sie gerne zurückblicken. Andere aber haben Gespenster, die manchmal aus den Schatten hervorkriechen. Sie scheinen sich aus dem Gestern zu lösen und in das Heute hineinzustehlen. Für eine Weile kann es gelingen, sie zu vertreiben, aber irgendwann kommen sie wieder ... In diesem Buch geht es um Veränderungen und Verwicklungen, um Irrungen und Wirrungen, um alte und neue Lieben, um Verstörendes und Beängstigendes, um Mysteriöses und Alltägliches. Ein Roman aus dem Kastanienweg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
GESTERN ist nie vorbei
Die Leute vom Kastanienweg
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-065-1
E-Book-ISBN: 978-3-96752-565-6
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 1699203565
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Melinda
Unter der Brücke
Das dunkle Band der Straße wand sich durch das ineinander verschmelzende Grün und Braun der Hügel. Darüber wölbte sich still und blau der Himmel, und ein paar weiße Wolken hingen bewegungslos über dem blaugrünen Tannengürtel am Horizont.
Der Motor des Wagens hatte ein angenehm leises Geräusch. Die Bäume flogen vorbei, die Landstraße kam ihm eilig entgegen.
Warum habe ich es so eilig? fragte sich der Mann am Steuer. Habe ich nicht Urlaub und alle Zeit der Welt?
Einem plötzlichen Einfall folgend, verließ er die Hauptstraße und bog in einen holperigen Feldweg ein, der sich zwischen blühenden Hecken hügelabwärts schlängelte.
Er fuhr scharf rechts heran und wäre um ein Haar in dem von Wiesenschaumkraut und dichten grünen Farnen überwucherten Graben gelandet.
Er stieg aus, reckte beide Arme in die Luft und hielt sein Gesicht der Sonne entgegen. Er drehte sich um und blickte über das Land. Über die weiten grünen, vom Goldgelb der Butterblumen gesprenkelten Wiesen, über die sanften Hügel, durch die sich hier und dort das im Sonnenlicht blitzende Band eines Baches schlängelte.
Wie schön war diese Landschaft! Sanft, still und beruhigend.
Und so ganz anders als jene, die er vor wenigen Tagen verlassen hatte.
Und dann die Luft! Trotz der Wärme einer Nachmittagssonne im Mai erschien sie ihm leicht, belebend und frisch.
Und sie duftete nach Jasmin und Weißdorn und wildem Flieder. Er schloss die Augen und atmete tief ein.
War das hier seine Heimat? Oder war sein Zuhause dort, wo er die letzten Jahre seines 26-jährigen Lebens verbracht hatte? Er würde es herausfinden.
Der Mann war groß und schlank, hatte breite Schultern, dunkles Haar, einen ebenso dunklen Bart und dunkelblaue Augen. Zur beigefarbenen Cordhose trug er ein weißes Sporthemd.
Er war tief gebräunt und bewegte sich ruhig und sicher, so dass man ihn älter einschätzen mochte, als er wirklich war. Im Ganzen wirkte er ein wenig fremd in dieser Umgebung. Als hätte er die Atmosphäre des anderen Landes mit sich gebracht, des Landes, aus dem er gekommen war. Der Heimat seines Vaters!
Als er dort aufgebrochen war, herrschte bereits ein trocken heißes Sommerklima. Da gab es keine weiten grünen Wiesen mit Butterblumen und Klee. Nach Bächen, auf dessen kühler Wasserfläche das Sonnenlicht Funken sprühte, würde man vergeblich suchen. Und Gräben, in denen saftige, grüne Farne und Sauerampfer wucherten, gab es ebenso wenig wie Knicks mit blühenden Heckenrosen und Kühe auf einem Hang.
Dafür gab es herrliche Wein-, Zitronen-, Oliven- und Orangenhaine. Es gab eindrucksvolle Gebirgsmassive und im Osten einen 3300 m hohen Vulkan.
Und dann war da das Meer!
Das vor allem anderen hatte er geliebt. Das Meer und seine Weinberge.
Aber nun war er hier und jetzt wollte er dieses Land kennen lernen. Die Heimat seiner Mutter!
Er stieg in seinen Wagen und zuckelte weiter den Feldweg hinunter, der ihn auf eine schmale, von Birken gesäumte Landstraße brachte. Unter dem grünen Dach der Baumkronen fuhr er eine Weile dahin, dachte an alles Mögliche und nichts Bestimmtes. Er blickte über das stille Land, das da vor ihm lag in einem warmen, sinkenden Mainachmittag.
Hin und wieder kam er durch kleine verschlafene Ortschaften mit einem Kirchlein in der Mitte und Kopfsteinpflaster auf den Straßen. Das war ihm nicht fremd. So etwas kannte er auch von der Insel her, sowohl die alten, verschlafenen Dörfchen als auch das graue, holprige Pflaster.
In einem Zustand träumerischer Zufriedenheit fuhr er dahin. Keine Menschenseele, kein Auto weit und breit störte das friedliche Bild. Einige Abhänge am Horizont schimmerten rot vom Heidekraut. Die schmale Straße führte durch ein Wäldchen und machte eine Biegung.
Und dann sah er sie!
Weit vorn erblickte er eine kleine Brücke, die über ein Bahngeleise führte. Die von Gras, Büschen und Gestrüpp fast zugewachsenen Hänge zu beiden Seiten der Geleise führten steil hinauf. Die Schienen glänzten in der Sonne.
Sie saß auf dem Brückengeländer, leicht vorgeneigt, mit baumelnden Beinen, das Gesicht dem blitzenden Schienenstrang zugewandt.
Der Mann im Auto erstarrte vor Schreck, wenige Sekunden lang. Dann ging alles sehr schnell. Er fuhr an den Straßenrand, sprang aus dem Wagen und warf die Tür hinter sich zu. Er blickte zum Brückengeländer hinüber. Es war leer! Das Summen eines herannahenden Zuges erfüllte die Luft, eine Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben. Mit wenigen Sätzen war er an der Stelle, wo eben noch das Mädchen gesessen hatte, aber da war niemand mehr. Unter der Brücke surrte der Zug vorbei. Wenige Sekunden später war alles still.
Der Mann stand wie versteinert mit klopfendem Herzen. Er wagte nicht, über das Geländer in die Tiefe zu schauen, aber dann tat er es doch. Die silbernen Schienenbänder blitzten unverändert in der Sonne, der Zug war nicht mehr zu sehen. Es war sehr still.
Er blickte zu den Hängen hinunter, die steil und grün überwuchert an beiden Seiten der Geleise aufstiegen. Und da sah er sie!
Sie kauerte unter der Brücke oben auf dem Abhang neben einem Brombeerstrauch und blickte zu ihm auf.
Der Mann fuhr sich mit der Hand über die Stirn und spürte, dass sie feucht war. Er blickte auf seine Hände und sah, dass sie leicht zitterten.
»Verdammt!« sagte er leise. Dann sprang er mit wenigen Sätzen den Abhang hinunter zu dem Mädchen, das ihm unbeweglich entgegen sah. Er ließ sich neben sie ins hohe Gras fallen.
»Mein Gott,« stieß er hervor. »Hast du mir einen Schrecken eingejagt!«
Das Mädchen antwortete nicht, strich sich nur mit beiden Händen das helle Haar aus dem Gesicht und schlang die Arme um die angezogenen Knie.
Er musterte sie mit gerunzelter Stirn und wartete auf eine Antwort. Sie war hübsch, sehr blass und zart, mit einem Grübchen im Kinn, das helle blonde Haar reichte ihr bis auf die Schultern. Es war glatt und dicht und glänzte matt. Jetzt hob sie die Augen zu ihm auf und er sah, dass sie grau waren, von dunklen Wimpern eingerahmt. Sie blickte ihn an mit düsterem, trübem Blick.
»Was hatte das zu bedeuten?« forschte er ungeduldig.
»Wolltest du etwa da hinunter springen? Vielleicht sogar vor den Zug?«
Sie zuckte die Achseln, blickte von ihm fort über die Schienen und antwortete nicht. Er spürte, wie er ärgerlich wurde. Vor wenigen Augenblicken hatte er noch gedacht, wie friedlich und schön alles ringsumher wäre. Und dann das. Ein halbes Kind, das von einer Brücke springen wollte!
Da waren immer noch die Wiesen, der Himmel, die blühenden Hecken und die Hügel, sanft wie Dünen. Neben sich im Gras erblickte er ein Büschel wilde Stiefmütterchen, die zarten kleinen Gesichter zur Sonne empor gereckt – gerade neben ihrer Hand, die sie dorthin gelegt hatte.
Es war eine schmale, gebräunte Hand mit kurzen geraden Nägeln ohne Nagellack. Eine kräftige Hand, die auch zupacken konnte, und sie gefiel ihm. Er nahm sie in seine große Männerhand und hielt sie fest.
Und da endlich sprach das Mädchen.
»Es tut mir leid,« sagte sie leise. »Ich wollte Sie nicht erschrecken.«
Das wiederum fand er nun ausgesprochen seltsam.
»Das ist doch jetzt unwichtig,« sagte er und hielt ihre Hand immer noch in seiner.
»Wolltest du es wirklich tun?«
Und dann war es, als würden alle Dämme brechen. Sie weinte so sehr, dass es sie nur so schüttelte. Ihre Schultern bebten, Tränen strömten ihr übers Gesicht, die sie mit einer Hand fort zu wischen versuchte, während die andere immer noch in seiner Hand gefangen war.
Was konnte er anderes tun, als das schluchzende Mädchen in den Arm nehmen!
So hielt er sie eine ganze Zeit, wischte ihr hin und wieder mit seinem Taschentuch übers Gesicht und murmelte ein paar tröstende Worte, über die er gar nicht nachdachte. Schließlich beruhigte sie sich und löste sich aus seinen Armen.
»Es tut mir leid,« wiederholte sie und blickte ihn aus verschwollenen Augen an.
»Was um Gottes willen hat dich so verstört?« forschte er. »Willst du es mir nicht sagen?«
Das Mädchen zuckte mit den Schultern.
»Wozu? Das ist etwas, damit muss ich allein fertig werden. Sie können mir nicht helfen.«
»Wahrscheinlich nicht, aber manchmal ist es ganz gut, einfach nur darüber zu reden.«
Sie antwortete nicht. Eine Weile saßen sie schweigend nebeneinander. Ein leichter Wind war aufgekommen. Ein buschiger Ahorn, der sich irgend wann einmal selbst gesät hatte, klammerte sich zu ihren Füßen an den steilen Hang. Ein Windhauch ließ einen Augenblick seine Blätter wie Regentropfen rauschen.
Der Mann begann ruhig und gleichmäßig zu sprechen.
»Da, wo ich herkomme, gibt es das nicht,« sagte er und zeigte über die grünen Hügel am Horizont.
»Dort ist es um diese Jahreszeit schon heiß. Wir haben nicht so herrliche Wälder, in die man vor der Hitze flüchten könnte. In ein, zwei Monaten ist es im Inneren der Insel unerträglich. Dann hält man es nur in klimatisierten Häusern aus. Oder man geht ans Meer. Und das ist wunderbar.«
Das Mädchen hatte mit wachsender Aufmerksamkeit zugehört. Jetzt wandte sie sich ganz ihm zu und musterte ihn. Sekundenlang flackerte das Gefühl in ihr auf, ihm schon einmal begegnet zu sein.
»Sie sind also nicht von hier. Sie sehen auch ganz anders aus als die jungen Männer aus dieser Gegend. Woher kommen Sie?«
Der Mann setzte sich ein wenig aufrechter hin und lächelte sie an.
»Ich bin Enrico Barossow. In den letzten Jahren habe ich auf Sizilien gelebt. Es ist die Heimat meines Vaters.«
»Auf Sizilien! Dort lebt also Ihre Familie? Und was machen Sie nun hier? Und wie ist es möglich, dass Sie so gut Deutsch sprechen?«
Enrico lachte leise. Es war ihm also gelungen, das Mädchen für diesen Augenblick aus ihrer Trostlosigkeit heraus zu reißen.
»So viele Fragen auf einmal,« sagte er munter.
»Aber ich will sie dir gern beantworten, wenn du mir auch deinen Namen sagst.«
Ein mattes Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Melinda,« sagte sie. »Ich heiße Melinda Bergmann und wohne in Seefeld. Das ist ein hübsches kleines Städtchen etwa 6 km von hier.«
Enrico nickte.
»Ich kenne das Städtchen. Wir haben hier in der Nähe ein Haus, in dem ich als kleiner Junge ein paar Jahre zusammen mit meinem Vater und ein paar Dienstboten gewohnt habe. Ein Familienleben im üblichen Sinne kenne ich nicht. Ich habe so lange ich denken kann mit meinem Vater allein gelebt. Er stammt von Sizilien, ist aber immer viel herum gereist und ich mit ihm, soweit es meine Schule und Ausbildung zuließ.«
»Und Ihre Mutter?«
»Meine Mutter stammt von hier. Wir haben nie zusammen gelebt. Sie ist fortgegangen, als ich noch sehr klein war. Damals wohnten wir in dem Haus in den Hügeln. Bald darauf ging mein Vater fort und nahm mich mit.«
Er schwieg und seine Miene verschloss sich.
»Mein Vater und ich – wir hängen sehr aneinander,« fügte er abschließend hinzu. »Ich bin wohl der einzige Mensch, der für ihn wichtig ist.«
»Und warum sind Sie zurück gekommen?«
»Ich habe Urlaub,« sagte Enrico und sein Gesicht hellte sich auf. »Einen sehr langen Urlaub. Ich möchte die Heimat meiner – meiner Mutter kennen lernen.«
Er zuckte mit den Schultern.
»Vielleicht um herauszufinden, wo meine eigentliche Heimat ist. Ganz fremd ist mir dieses Land nicht. Wir sind ja immer wieder für einige Zeit hierher gekommen.«
»Ein aufregendes Leben müssen Sie gehabt haben,« meinte Melinda und blickte über die grünen Hügel.
»Ich habe ein paar Mal Urlaub im Ausland gemacht und war anschließend immer froh, wieder hier zu sein. Ich lebe gern in dieser Gegend. Bis auf jetzt,« fügte sie hinzu und ihre Stimme zitterte leicht. »Jetzt möchte ich am liebsten fort. Auf und davon! Weglaufen und all das hinter mir lassen, was hier…«
»Es wird nicht viel nützen,« sagte Enrico.
»Ist es nicht so, dass man seine Probleme immer mit sich nimmt?«
Melinda ließ die Schultern hängen.
»Ja, so ist es wohl.«
»Sicher findet sich für dein Problem eine Lösung. Die gibt es immer. Nichts ist ganz und gar aussichtslos, und keine Situation ist so verfahren, dass es keinen Weg hinaus gibt.«
»Erzählen Sie mir von Sizilien. Was haben Sie dort gemacht?«
»In erster Linie bauen wir Zitrusfrüchte und Wein an. Viel Wein. Mein Vater besitzt Olivenhaine, die von seinen Vorfahren stammen. Außerdem hat er seine Finger überall drin, sei es in der Küstenfischerei, der Lederindustrie oder im Getreideanbau. Er ist der geborene Geschäftsmann. So bin ich nicht. Ich will nicht nur für die Arbeit leben.«
»Tut er das denn? Hat er nie geheiratet?«
»Nein. Er ist ein rastloser Mensch, viel unterwegs. Eine Frau hat keinen Platz in seinem Leben, sagt er immer.«
»Und doch hat es mal eine gegeben,« sagte Melinda. »Ihre Mutter.«
»Ja, meine Mutter. Aber es war ja, wie du siehst, auch nicht von Dauer. Obwohl …«
»Obwohl?«
»Ach, ich weiß nicht. Mein Vater spricht nicht darüber. Das ist ein Kapitel, das hat er tief in sich vergraben.«
Wieder war es Melinda, als hätte sie ihn schon einmal gesehen. Oder war es eine zufällige Ähnlichkeit mit einem Menschen, den sie kannte?
»Und Sie möchten anders leben als Ihr Vater?« forschte sie interessiert. Sie schien ihre eigenen Sorgen vorübergehen vergessen zu haben.
»Ja, ich bin im Grunde kein Einzelgänger wie er. Ich brauche ein festes Zuhause, Freunde.«
»Und eines Tages vielleicht eine eigene Familie,« ergänzte Melinda.
»Sicher, das auch.«
»Und wenn Sie sich nun entscheiden, nicht nach Sizilien zurück zu gehen, was werden Sie dann hier tun?«
Enrico kaute auf einem Grashalm.
»Vielleicht von meinen fernen Gütern und Weinbergen leben und den lieben Gott im übrigen einen guten Mann sein lassen,« lachte er. Dann wurde er ernst.
»Das Nichtstun liegt mir nicht. Irgend etwas wird sich da schon finden. Immerhin hat mein Vater dafür gesorgt, dass ich das Gymnasium und ein Studium auf dem Sozialhistorischen Feld erfolgreich abgeschlossen habe.«
Enrico streifte sie mit einem fragenden Blick.
»Und du? Was machst du? Inzwischen kennst du fast meine ganze Lebensgeschichte, und von dir weiß ich nur, dass du schrecklichen Kummer hast. So schrecklich, dass du um ein Haar eine Dummheit begangen hättest.«
»Ich hab’s ja nicht getan,« sagte Melinda leise.
»Und nun muss ich sehen, dass ich da irgendwie heraus komme.« Sie fröstelte und schlang beide Arme um sich.
»Es gibt nicht viel über mich zu sagen. Ich gehe noch aufs Gymnasium, ein gutes Jahr – dann bin ich fertig. Und danach…«
Sie verstummte abrupt, als sei ihr plötzlich etwas eingefallen.
»Ja, und was danach?«
Sie hob die Schultern. Dann legte sie die Arme auf die angezogenen Knie, stützte den Kopf darauf und schloss die Augen.
»Ich weiß nicht,« flüsterte sie erstickt. »Ich weiß nicht.«
Das leise Summen eines herannahenden Zuges durchbrach die Stille. Das Mädchen hob den Kopf und blickte ihm entgegen. Enricos Augen folgten ihrem Blick, dann schaute er zu dem Geländer hinauf.
»Da oben hast du gesessen,« sagte er leise. »Es sah furchtbar für mich aus. Ich sah dich in Gedanken schon hinunter stürzen.«
»Es war dumm von mir,« sagte sie heiser. »Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich meinen Eltern damit antun würde. Ich hatte nur mich und meinen Kummer im Kopf.« Sie blickte ihn offen an. Dann begann sie leise zu erzählen.
»Ich hatte das alles geplant. Schon seit Tagen. Meinen Eltern sagte ich, eine Freundin aus Breitenbach hätte mich für das Wochenende eingeladen. Ich fuhr mit dem Bus in den Ort und ging das Stück hier herauf zu Fuß. Es geschah alles ganz automatisch, ich hatte keinen anderen Gedanken im Kopf, nur das, was ich tun wollte.«
Sie schwieg und sann einen Augenblick darüber nach, wie es gewesen war. Dieser Morgen, als sie sich von den Eltern verabschiedete, wie sie ihre Tasche genommen hatte, die ihr so lästig gewesen war. Wozu brauchte sie die noch? Es war nur unnütze Schlepperei.
Und dann die Busfahrt. Sie saß am Fenster und blickte hinaus und sah gar nichts. Verschwommen erinnerte sie sich, doch irgend wann die Sonne gesehen zu haben, das dunkle Band der Straße, die sich durch die Hügel schlängelte.
Es wird warm heute, hatte sie gedacht und weiter nichts.
Mit der Tasche in der Hand und der Jacke über dem Arm war sie dann die Straße entlang gewandert. Immer einen Fuß vor den andern setzend, ohne einen Gedanken im Kopf. Nur das Ziel vor Augen: die Brücke über den blanken Schienen, auf denen zweimal stündlich ein Zug vorüber fuhr.
»Ich war wie betäubt. Erst als ich auf dem Geländer dort oben saß und das Auto hörte, kam ich zu mir. In der ganzen Zeit davor war ich wie benommen, ganz ohne Gefühl. Ich hatte keine Angst.«
Sie blickte ihn mit aufgerissenen Augen an.
»Ich hatte überhaupt keine Angst. Aber dann, als ich da oben kauerte, auf der Brücke – da hörte ich ein Auto kommen, Ihr Auto. Und da kam ich plötzlich zur Besinnung. Ich blickte hinunter auf die blitzenden Schienen, es ging so tief da hinunter und auf einmal war sie da, die Angst. Ich spürte, wie meine Zähne aufeinander schlugen und meine Hände, die das Geländer umklammerten, wurden nass. Mit einem Satz sprang ich auf die Straße und lief unter die Brücke. Da haben Sie mich dann gefunden.«
Melinda schwieg erschöpft. Sie atmete schnell und zitternd, als habe sie all das soeben ein zweites Mal erlebt. Und so war es wohl auch. Enrico streichelte behutsam ihren Arm.
»Und jetzt? Soll ich dich nach Hause bringen?« fragte er.
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, ich werde mir in dem kleinen Gasthof im Ort ein Zimmer nehmen und am Sonntagabend heimfahren, wie ich es vorgehabt habe. Meine Eltern sollen das alles nie erfahren.«
»Und deine Freundin in Breitenbach? Oder gibt es die gar nicht?« »Nein,« sagte Melinda leise. »Die gibt es gar nicht. Ich tue nur so als ob.«
»Dann wirst du also dieses ganze Wochenende allein in dem Gasthof verbringen? Was wirst du tun? Grübeln und weinen und erneut auf dumme Gedanken kommen? Hast du keine Freunde, an die du dich wenden kannst?«
Sie schwieg.
»Und deinen Eltern willst du dich auch nicht anvertrauen?«
»Ich will erst in Ruhe nachdenken,« flüsterte sie.
»Nachdenken? Wird es nicht so sein, dass du dich in Gedanken wieder und wieder im Kreise drehst? Das Grübeln für sich allein bringt einen oft nicht weiter. Wenn du also jemanden zum Zuhören und Reden brauchst, und sei es nur bis Sonntag Abend – ich bin da,« sagte Enrico.
Melinda hob die Schultern.
»Ich weiß nicht,« flüsterte sie verzagt. »Wir kennen uns noch gar nicht und…«
»Ein wenig kennen wir uns doch schon. Außerdem ist es mitunter viel leichter, mit einem halbwegs fremden Menschen – oder sagen lieber wir mit einem Außenstehenden – zu reden als mit jemandem aus der vertrauten Umgebung.«
Melinda wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, die bereits wieder geströmt waren. Dann straffte sie den Rücken und sagte steif: »Ich möchte Sie nicht mit meinen Problemen belästigen. Sie haben Besseres zu tun, als sich mit mir und meinen Sorgen abzugeben.«
»Mir fällt nichts ein,« sagte Enrico munter und legte seine Hand auf ihren Arm.
»Außerdem – sagtest du nicht vorhin, mein Auto hätte dich zur Besinnung gebracht? Du hörtest mich kommen, und da erst sei dir bewusst geworden, was du tun wolltest! Und dann tatest du es nicht. War es nicht so?«
Melinda nickte langsam.
»Nun also. Dann habe ich dich sozusagen vor diesem üblen Schritt bewahrt und bin für dich verantwortlich. Ist es nicht so? Sagt man nicht, wenn man jemandem das Leben rettet, ist man ein Stückchen für ihn mitverantwortlich?«
Sie fing erneut an zu weinen. Enrico legte wieder einen Arm um ihre Schulter und ließ sie weinen. Er hatte das Gefühl, als ob es nicht mehr gar so schrecklich verzweifelt klang. Eher so, als sei sie erleichtert.
»Ist es nicht ein gutes Gefühl, nicht mehr so allein und ein Stückchen Verantwortung los zu sein?« fragte er.
»Wie wär’s, wenn du mich nun endlich mit du und Enrico anreden würdest.«
Sie nickte unter Tränen und wischte sich das Gesicht.
»Also komm,« sagte Enrico munter und richtete sich auf. »Machen wir uns auf den Weg.«
Er reichte ihr die Hand, Melinda nahm sie und ließ sich hochziehen. Als sie aufgerichtet neben ihm stand, hatte sie das sonderbare Gefühl, als würde sich etwas auf ihre Schultern legen, dass sie vor Stunden – als sie auf das Geländer gestiegen war – abgeworfen hatte.
Diese schreckliche, unerträgliche Bürde, die sie hierher getrieben, hatte sie abgestreift wie man einen schweren Rucksack abstreift und neben sich legt.
Nun aber war sie wieder da. Mit aller Deutlichkeit spürte sie die erdrückende Last ihres ganzen Kummers erneut auf ihren Schultern. Die düsteren letzten Wochen ihres Lebens wurden wieder in ihr lebendig. Sie erschienen ihr wie ein schwerer Traum, aus dem sie sich nun mühsam herausarbeiten musste. Sie wusste nur noch nicht wie.
Aber jetzt, in diesem Augenblick, war sie nicht mehr allein. Vielleicht hatte sie tatsächlich einen neuen Freund gefunden. Sie fühlte sich ein wenig getröstet.
Melinda sah ihn von der Seite an. Was war da in seinem Gesicht, das ihr so bekannt vorkam?
Sie blickte auf ihre ineinander verschlungenen Hände. Schon immer hatte sie bei einem Menschen auf die Hände gesehen. Und diese hier gefielen ihr. Sie waren kräftig und groß, mit feinen dunklen Härchen auf dem Handrücken. Sie erschienen ihr vertrauenerweckend und zuverlässig. Hände, die zupacken und festhalten konnten.
Still standen sie einander gegenüber, und als hätte er ihre Gedanken erraten, hob er die andere Hand und strich ihr sanft übers Haar.
»Es gibt für alles eine Lösung! Man darf sich nur nicht unterkriegen lassen. Ich jedenfalls bin stets Optimist. Und wie ist es mit dir?«
»Ich werde mir Mühe geben,« flüsterte sie.
Unter der Brücke summte leise der nächste Zug dahin, während in dem niedrigen buschigen Ahornbäumchen ein kleiner Vogel sein Lied anstimmte.
Cristina
Die Wandelbarkeit der Gefühle
Maria Scheffler stand am Fenster ihrer Werkstatt und blickte in den Garten hinaus. Das tat sie nun schon eine ganze Weile, allerdings mit Unterbrechungen. Immer wieder war sie vom Fenster weg und an ihre Arbeit gegangen, um immer wieder festzustellen, dass sie sich nicht darauf konzentrieren konnte.
Auf dem Arbeitstisch stand die noch unvollendete Büste eines jungen Mannes, fast noch ein Kind. Daneben lag ein Stoß Skizzen mit dem Gesicht dieses Jungen. Es fiel Maria unerwartet schwer, seine Züge in Ton festzuhalten. Sie waren erfüllt von zarten, verfließenden Ecken, die Wangen kindlich gerundet, der Mund eigenwillig und hart, trotz der weichen vollen Lippen schon der Mund eines jungen Mannes.
Nun trat sie wieder an den Tisch und blickte darauf hinunter.
Es geht nicht, dachte sie. Ich brauche das Original.
Ein Sonnenstrahl fiel schräg durchs Fenster und warf einen flüchtigen Schein auf das Gesicht in Ton, so dass es vorübergehend zum Leben erwachte. Maria drückte mit den Fingerspitzen eine letzte, feste Linie in die Masse. Dann wischte sie sich die Hände ab und trat erneut ans Fenster.
Sie wusste längst, warum sie sich heute nicht auf ihre Arbeit konzentrieren konnte. Ein anderes Gesicht schob sich ständig dazwischen, das vertraute, sehr verstörte und traurige Gesicht eines lebendigen Jungen.
Oder sollte man ihn schon als Mann bezeichnen? Immerhin war er 20 Jahre alt.
Maria kannte ihn seit so vielen Jahren, seit seiner Kinderzeit, Matthias Winterstein, der Sohn von Pastor Winterstein, Nachbar und Freund.
Seit fast zwei Stunden war er da draußen im Garten, zusammen mit ihrer Tochter Cristina. Zuerst waren sie über den Rasen gewandert, stets mit einem Abstand zwischen sich, der Maria fremd und unnatürlich erschien. Schließlich war das viele Jahre lang ganz anders gewesen. Da hatte man die beiden nur nah beieinander, oft eng umschlungen, gesehen. Nun aber war da dieser Abstand. Auf einmal kam es Maria so vor, als sei er im Laufe der letzten Tage – oder Wochen? – immer größer geworden. Immer ein klein wenig mehr, bis er sich heute auf nahezu einen Meter verbreitert zu haben schien.
So also waren sie über das frisch gemähte Gras nebeneinander her gegangen, dann waren sie ein Stück am Strand entlang gewandert. Schließlich hatten sie sich in den hölzernen Pavillon zwischen den Fliederbüschen verzogen, wo sie inzwischen seit einer Stunde saßen.
Maria starrte hinaus in ihren blühenden Garten. Es war wieder Mai, die Sonne schien, ein paar weiße Federwölkchen spiegelten sich auf dem See, der still und friedlich dalag.
Maria sah das alles gar nicht. Sie dachte an einen anderen Sommer, der nun vier Jahre zurück lag. Cristina saß neben ihr im Wagen, sie waren auf dem Weg nach Waldhagen.
Sie hörte wieder ihre Stimme, die Stimme der jungen 13-jährigen Cristina. Sie sagte: »Viele Leute denken, mit 13 ist man noch ein Kind. Aber das bin ich wirklich nicht mehr. Und außerdem – wir lieben uns und wollen später heiraten. Nur – es ist noch so unendlich lange bis dahin.«
Das war zu Beginn ihrer Freundschaft mit Matthias gewesen. Sie waren so verliebt, halbe Kinder noch!
Was habe ich ihr damals gesagt? überlegte Maria.
Einen endlosen Vortrag habe ich ihr gehalten! Über Gefühle, die sich ändern können, so wie die Zeit und die Menschen sich verändern.
»Zeit und die Dinge, die passieren, verändern die Menschen und deren Gefühle.«
Cristina hatte sich alles aufmerksam und geduldig angehört, ihren ganzen langen Sermon, den Maria einfach loswerden musste.
Und Martin?
»Vater will mich am liebsten in einen Glaskasten setzen,« hatte Cristina gejammert.
»Er sorgt sich um dich. Eltern möchten ihre Kinder vor schlimmen Erfahrungen und Enttäuschungen bewahren. Außerdem bist du wirklich noch sehr jung,« versuchte Maria ihr zu erklären.
Endlose Phrasen und Litaneien, sie wusste es selbst, aber sie sagte es trotzdem.
Martin hätte wohl gesagt: »Werde du erst einmal erwachsen, bevor du an solche Geschichten denkst! Und damit Schluss!«
Maria aber war sehr klar, dass Verbote nichts nützen würden. So tat sie, was sie für richtig hielt.
Sie lächelte, als sie an das Theater dachte, dass Martin gemacht hatte. Maria hatte ihm unverblümt gesagt, dass sie Cristina wegen eines Gesprächs über Verhütung zu einem Gynäkologen schicken würde.
Damals hatte sie nicht gelächelt. Sie hatte dagesessen und ihren Mann betrachtet, der brüllend und mit wildem Blick im Zimmer hin und her gerannt war.
»Du willst mir also damit sagen, dass meine 13-jährige Tochter demnächst die Antibabypille bekommt, damit sie mit ihrem 16-jährigen Liebhaber schlafen kann?« hatte er geschrien.
Es war dann noch eine ganze Weile so weiter gegangen. In der Regel war Maria nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, aber an diesem Abend hatte sie die Geduld verloren. Plötzlich war sie seines Gebrülls und ihrer endlosen Beschwichtigungsmanöver überdrüssig geworden, hatte ihn kühl angesehen und gesagt: »Weißt du was? Jeder kann immer nur das tun, was er für richtig hält. Und das habe ich getan. So! Und nun tue du, was du für richtig hältst. Aber mich lass in Frieden.«
Dann war sie aufgestanden und hatte das Haus verlassen. Zum ersten Mal in ihrer damals 13-jährigen Ehe hatte sie ihn in seinem brodelnden Zorn stehen lassen und war gegangen.
»Verlasse dich nicht auf die Unwandelbarkeit eurer Gefühle,« hatte sie damals zu Cristina gesagt. »Der Tag kann kommen, an dem einer von euch beiden feststellt: es ist vorbei!«
Und nun war es soweit. Es war vorbei!
Cristina würde sich von Matthias trennen.
Schon am Vortag hatte sie mit ihm gesprochen, viele Stunden lang. Heute war er dann wiedergekommen, verstört und ganz und gar fassungslos. Als könnte er nicht begreifen, was da geschah, und als sei das für ihn das Ende aller Tage.
Bis jetzt hatte Maria regungslos am Fenster gestanden, jetzt kam Leben in sie. Cristina und Matthias hatten den Pavillon verlassen und gingen langsam über den Rasen auf das Gartentürchen zu, das zum Grundstück des Pastors führte. Davor blieben sie stehen, der Abstand zwischen ihnen war geringer geworden. Sie reichten einander die Hand, Cristina mit ernster Miene, Matthias mit derart hoffnungslosem Blick, dass Maria schon glaubte, er würde jeden Moment in Tränen ausbrechen.
Das tat er jedoch nicht. Er straffte die Schultern in einer rührenden, hilflosen Geste und sagte irgend etwas, dann wandte er sich um und trat durch das Türchen in den angrenzenden Garten.
Maria wollten fast selbst die Tränen kommen, als sie seinen schmalen Rücken im wuchernden Grün des Nachbargartens verschwinden sah.
Sie hatte ihn sehr gern, den jungen Matthias Winterstein. Cristina hätte sich keinen besseren Gefährten für ihre Zukunft wünschen können.
Maria dachte sekundenlang: Mein Gott, wie konnte sie ihn einfach so fortschicken!
Einfach so? Einen Augenblick später wusste sie, dass es nicht »einfach so« geschehen war. Da hielt sie ihre weinende und schluchzende 17-jährige Tochter im Arm.
»Er muss es doch längst gespürt haben,« schluchzte Cristina an ihrer Schulter. »Es war doch schon lange nicht mehr wie früher.«
Nun ja, dachte Maria, vielleicht von deiner Seite. Seine Gefühle haben sich scheinbar nicht geändert.
»Er will es nicht glauben, Mama,« fuhr Cristina kläglich fort. »Er glaubt, es ist nur so eine Laune von mir und alles renkt sich wieder ein. Ich konnte ihm nicht begreiflich machen, dass ich nur noch so etwas wie Kameradschaft für ihn empfinde.«
Maria zog sie neben sich auf die kleine hölzerne Bank. Cristina klammerte sich an die Mutter und sprudelte all ihren eigenen Kummer aus sich heraus.
Maria ließ sie reden, murmelte hin und wieder ein paar tröstende Worte, und dabei dachte sie an den traurigen, verlorenen Ausdruck in Matthias’ Gesicht.
Jaja, meine Kleine, dachte sie. So ist das nun. Der arme Junge tut dir leid, und vielleicht fühlst du dich sogar ein wenig schuldig. Sicher ist es dir schrecklich, ihn nun so wegzuschicken. Immerhin hattet ihr vier sehr schöne Jahre, und er war deine erste Liebe. Aber dein Kummer wird schon in ein paar Stunden vergessen sein. Nämlich in dem Augenblick, wenn du den Anderen wiedersiehst, deine neue Liebe!
Maria konnte nicht umhin, so etwas wie leisen Groll auf ihre Tochter zu empfinden. Es tat ihr nun mal um den armen Jungen Matthias so leid!
Hoffentlich musst du nicht irgendwann einmal am eigenen Leibe erfahren, was du heute Matthias antust, dachte sie bitter.
Aber dann schämte sie sich für ihre Gedanken und drückte ihre Tochter reuevoll an sich. Konnte Cristina denn etwas dafür, dass ihre Gefühle sich geändert hatten?
Hatte sie selbst ihr nicht vor vier Jahren gepredigt: »Verlasst euch nicht auf die Unwandelbarkeit eurer Gefühle. Der Tag kann kommen….«
Und nun war er gekommen, dieser Tag. Es hatte Matthias getroffen, genauso gut hätte es Cristina sein können, die traurig und verlassen zurück blieb.
Ihre Gedanken gingen in Worte über.
»Armer Matthias! Dieser Kummer, den er jetzt erlebt, ist dir für dieses Mal erspart geblieben, meine Kleine,« sagte sie. »Es hätte auch anders herum sein können.«
»Es war so schwer, Mama,« flüsterte Cristina heiser. »Du glaubst gar nicht, wie schrecklich schwer es war. Ich musste all meinen Mut zusammen nehmen, um ihm das sagen zu können.«
Ja, das konnte Maria sich sehr gut vorstellen. Es musste schrecklich schwer gewesen sein. Auf einmal konnte Maria die Sache aus einer anderen Warte betrachten. Cristina war ein aufrichtiges, ehrliches Mädchen. Sie konnte nichts dafür, dass ihre Gefühle sich gewandelt hatten. Nun war es an ihr, Klarheit zu schaffen und Matthias so gut sie es konnte reinen Wein einzuschenken.
Sie hatte sich alle Mühe gegeben, ihn nicht zu sehr zu verletzen. Nur war das für Matthias ganz und gar unwichtig. Cristina wollte sich von ihm trennen, das allein zählte.
»Ich habe Stunden und Stunden geredet,« murmelte Cristina erschöpft. »Stunden und Stunden, aber er wollte es nicht begreifen.«
»Er konnte es nicht,« sagte Maria. »Es ist schlimm für ihn. Lass ihm Zeit. Er wird nun fortgehen, ins Studium. Das ist das Beste, was er jetzt tun kann. Eine fremde Umgebung, Ablenkung, Arbeit und Zeit werden ihm helfen. Er ist jung, 20 Jahre alt. Du wirst sehen, er wird sich in sein Studium vergraben, wird arbeiten und andere Menschen kennen lernen. Und eines Tages sicher auch ein anderes Mädchen. Wenn ihr euch wiederseht – wer weiß, vielleicht könnt ihr dann schon wie gute alte Kameraden aufeinander zugehen.«
So redete Maria auf ihre Tochter ein und spürte, wie diese sich nach und nach entspannte.
Gleich wirst du deine Tränen trocknen und nach oben laufen, um dich für dein neues Rendezvous schön zu machen, dachte sie müde und blickte auf das zerzauste schwarze Haar ihrer Tochter hinunter.
Und es wird gar nicht so lange dauern, dann gehst du mit dem Anderen über den Rasen zum Pavillon hinunter.
Wer mag es wohl sein?
Insgeheim war Maria davon überzeugt, dass Cristina es nicht besser hätte treffen können als mit Matthias. Aber was nützte das alles.
Jetzt löste sie sich aus den Armen ihrer Mutter.
»Ich kann doch nichts dafür,« sagte sie ein wenig trotzig. Sie strich sich das Haar aus der Stirn und setzte sich aufrecht hin.
»Ich liebe Remo. Oh Mama, du glaubst gar nicht, wie sehr! Er ist ganz anders als Matthias, ein ernsthafter, reifer Mann!«
Damit sprang sie von der Bank auf und rannte zur Werkstatt hinaus. Das war nur gut so, denn sonst hätte sie sich doch noch eine sehr zornige Antwort der Mutter anhören müssen.
Als Maria ihr eine Weile später ins Haus folgte, kam ihr eine veränderte Cristina entgegen. Sie hatte ihr Haar zu einer eleganten Frisur hoch gesteckt. Die Lippen waren leicht geschminkt, weiße Clips schmückten die Ohren. Ihr grünes Kleid war eng und sehr kurz und ließ lange schlanke Beine frei, die Füße steckten in weißen Sandalen mit schwindelnd hohem Absatz.
Sie drehte sich einmal kurz vor Maria. »Wie sehe ich aus, Mama? Alles in Ordnung?«
Maria betrachtete ihre hübsche Tochter mit gemischten Gefühlen. Dann gab sie sich einen Ruck und lächelte sie an.
»Du bist sehr hübsch, meine Kleine. Ich wünsche dir viel Spaß,« sagte sie ruhig.
Cristina musste sich ein wenig hinunter beugen, als sie ihrer Mutter einen Kuss zum Abschied gab.
»Danke, Mama. Und auch für vorhin. Du weißt schon, Verständnis und Tröstungsaktion und so weiter.«
Damit war sie zur Tür hinaus.
Verständnis und Tröstungsaktion und so weiter – nun ja!
Maria trat ans Fenster und blickte hinaus. Ein schwarzer Mercedes stand vor dem Haus, dem jetzt ein dunkelhaariger Mann entstieg. Er beugte sich zu Cristina hinab, um sie auf die Wange zu küssen.
Dann sprachen sie miteinander. Der Fremde blickte zum Haus hinüber, Cristina schüttelte den Kopf. Vermutlich hatte er sie gefragt, ob er die Eltern begrüßen müsse, und Cristina hatte verneint.
Nein, heute noch nicht. Nicht heute schon und nicht gerade jetzt. Es ist zu früh, denn… nebenan Matthias… der arme Matthias… Nur schnell, schnell fort!
Maria hörte fast die Gedanken ihrer Tochter in ihrem eigenen Kopf. Nun blickte sie dem davonfahrenden Wagen nach und seufzte laut.
Sie ging in die Wohndiele zurück, blieb stehen und blickte sich unschlüssig um. Dann setzte sie sich auf die Treppe, die in den ersten Stock hinauf führte, stützte den Kopf in die Hände und schloss die Augen. Das Haus war so still. Bald würden die Kinder heimkommen. Und auch Martin. Martin.
Als er über die Terrasse das Haus betrat, dachte er im ersten Augenblick, das Haus sei leer. Still und wie ausgestorben lag es vor ihm. Nicht einmal die Hündin Senta kam ihm zur Begrüßung entgegen. Jenny hatte sie zu einem Ausflug mitgenommen.
Er wanderte durch den Wintergarten, die Wohndiele, dann in die Küche.
»Maria!« rief er ungeduldig. Und dann drängender: »Maria!«
Maria schrak in die Höhe. Im ersten Moment wusste sie gar nicht, wo sie sich befand. Ringsumher herrschte kühles Dämmerlicht.
»Maria?« ertönte der Ruf ein drittes Mal, nun schon recht beunruhigt. Dann stand er vor ihr.
»Martin,« sagte sie und blickte verwirrt zu ihm auf.
»Mein Gott, Maria, was ist los? Warum sitzt du hier auf der Treppe und siehst mich an wie einen Geist?« Martin Scheffler hockte sich neben seine Frau auf die Stufen und legte einen Arm um sie.
»Maria, nun rede doch, was ist denn passiert?«
»Ach, weiter nichts,« sagte sie. »Ich war nur plötzlich so müde. Und ich habe nachgedacht.«
»Du hast nachgedacht, weiter nichts! Na, Gott sei Dank. Und worüber hast du nachgedacht, wenn man fragen darf?«
»Über die Wandelbarkeit der Gefühle.«
Martin blickte seine Frau aufmerksam an. Ihre Augen schimmerten in dem diffusen Dämmerlicht der Diele grün wie die Augen einer Katze.
»Die Wandelbarkeit der Gefühle. Ich hoffe doch sehr, dass du nicht von deinen Gefühlen mir gegenüber redest,« lachte er und drückte sie an sich.
Wie seltsam, dachte Maria. Niemals würde er darauf kommen, dass es tatsächlich so sein könnte.
Und recht hat er!
Daniel
Vergangenheit und Gegenwart
Gerade eben setzte die Morgendämmerung ein. Eigentlich liebte er diese Stunde, wenn die Hügel in der Ferne rötlich im Dunst schimmerten und der Rasen unter seinem Fenster silbrig vom Tau glänzte. Oft hatte er sich dann in seinen Jogginganzug geworfen und war aus dem Hause geschlichen. Mit leichten Schritten war er über das feuchte Gras zum Strand hinunter gelaufen. Dann weiter den Strand entlang, gleichmäßig und leichtfüßig. Das hatte er lange nicht mehr getan. Warum eigentlich nicht? Sicher würde es ihm gut tun. Er hatte ohnehin zu wenig Bewegung.
Mir fehlen Disziplin und Ausdauer, dachte Daniel, warf seinen Morgenmantel über und blickte flüchtig auf Isabels dunklen Kopf in den Kissen.
Dann verließ er leise das Zimmer. In der Küche setzte er Kaffee auf und hockte sich an den Tisch.
Jeglicher Schwung ist mir abhanden gekommen, verdammt noch mal! dachte er verdrossen und stützte den Kopf auf die Ellbogen. Die Kaffeemaschine röchelte vor sich hin, der Bäckerjunge lief draußen am Fenster vorbei, hängte die Brötchentüte an die Tür und verschwand pfeifend um die Hausecke.
Daniel erhob sich, um die Brötchen herein zu holen. Er warf die Tüte auf den Tisch und starrte auf sie herunter. Er verspürte nicht den geringsten Appetit darauf. Stattdessen ging er in den Flur hinaus und begann in den Taschen seiner Jacke zu wühlen, die dort an der Garderobe hing. Endlich fand er, was er suchte. Mit der halbvollen Zigarettenpackung ging er in die Küche zurück, goss sich einen großen Becher Kaffee ein und zündete sich eine Zigarette an.
Nun rauchte er also wieder. Wie lange war es her, seit er die letzte Zigarette geraucht hatte vor dieser hier?
Plötzlich wusste er es! Vier Jahre lag das zurück. Und nun fiel ihm auch der Anlass dazu wieder ein. Es war ähnlich gewesen wie jetzt auch. Damals war ihm sein Leben wie eine Sackgasse vorgekommen.
Nach außen hin schien alles gut und in Ordnung, aber so war es nicht. Oh nein, so war es ganz und gar nicht!
Er hatte ein Gefühl von Nutzlosigkeit und Hoffnungslosigkeit gehabt – genauso wie jetzt auch.
Damals war ihm sein Leben sinnlos und leer erschienen. Besaß er nicht alles, was er angestrebt hatte? Erfolg im Beruf, Freunde, ein schönes Haus, auch eine liebe Familie. Zwar war es die Familie seines Vaters, aber er liebte sie wie seine eigene. Da war auch die Frau seines Vater, und er liebte sie – nur war es nicht seine eigene. Und würde es nie sein!
Zu der Zeit hatte er mit dem Rauchen begonnen. Und für kurze Zeit auch mit dem Trinken. Er hatte jedoch bald begriffen, dass es ihm nichts nützte. Im Gegenteil, es brachte ihn nur tiefer in seine Depression hinein.
Und dann war Isabel gekommen. Sie waren sehr verliebt gewesen und hatten bald geheiratet. Eine ganze Zeit schien alles gut. Aber dann, zunächst kaum merklich, dann immer schneller, schlichen sich seine alten Gefühle wieder ein. Die Gefühle von Leere und Überdruss.
Er grübelte unaufhörlich darüber nach, woran das liegen könnte. Liebte er Isabel nicht mehr? Und wenn das so war, warum nicht? Und seit wann war es so?
Immer weiter ging er mit seinen bohrenden Fragen und horchte in sich hinein. Bis er eines Nachts auf den Ursprung all dessen kam: Jahrelang hatte er nur Maria geliebt. Warum hatte er sich plötzlich in Isabel verliebt? Es hatte so viele andere gegeben. Was war an Isabel, das sie anders machte als all die anderen, deren Gesichter er allesamt vergessen hatte?
Und dann kam er dahinter! Isabel erinnerte ihn an Maria!
Sie hatte etwas an sich, im Aussehen, in ihrem Gang, im Wesen – was auch immer das war, es war nicht zu leugnen: Isabel hatte Ähnlichkeit mit Maria.
Als Daniel soweit in seinen Analysen und Grübeleien gekommen war, wurde ihm noch etwas anderes klar: Er liebte Isabel nicht. Es war immer noch Maria!
Diese Erkenntnis traf ihn wie ein Schock.
Anfangs versuchte er seine Verwirrung zu verbergen. Er stürzte sich in die Arbeit, verbot sich alles Grübeln und redete sich ein, all das seien unsinnige Spinnereien, die ihm bald vergehen würden. Dann würden die anfänglichen Gefühle für Isabel zurück kehren, und sie könnten endlich an ein Kind denken. Das wünschte Isabel sich schon so lange.
Die anfänglichen Gefühle für Isabel kamen aber nicht zurück. Sie waren unwiederbringlich fort, und so hübsch und reizend Isabel auch war, es half alles nichts. Er verschloss sich mehr und mehr, vergrub sich in seine Arbeit und begegnete allen Fragen Isabels ausweichend und mit Beschwichtigungsversuchen.
Isabel spürte sehr deutlich, was da vorging, nur konnte sie sich nicht erklären, warum das so war.
Was hatte sie falsch gemacht? Daniel hatte sie doch geliebt, als sie heirateten. Warum hatte sich das geändert? Sie war doch die Gleiche geblieben.
Es kam zu unerklärlichen, kleinlichen Streitereien zwischen ihnen, die beide unglücklich und elend machten, zumal es nie einen triftigen Grund dafür zu geben schien.
Von Kindern sprachen sie gar nicht mehr.
Es war nicht zu leugnen: Ihre Ehe steckte in einer schlimmen Krise.
An diesem Morgen nun saß Daniel mit der Zigarette in der Hand am Küchentisch, starrte in seine volle Kaffeetasse und wünschte sich einen Augenblick lang, es wäre hochprozentiger Schnaps. Dann packten ihn Wut und Verzweiflung. Verdammt, warum konnte er keine Ruhe finden! Ging das alte Dilemma von neuem los?
Hatte er nicht die beste aller Frauen nebenan in seinem Bett? Warum lechzte er sein Leben lang hinter der einen her, die er nie haben würde!
Hass loderte in ihm auf, Hass auf Maria, auf seinen Vater, auf sich selbst.
Ich muss mein Leben ändern, dachte er.
So kann es nicht weitergehen. Ich kann Isabel so ein Leben nicht länger zumuten. Das hat sie wahrhaftig nicht verdient!
Er stand auf, schob seinen erst zur Hälfte geleerten Kaffeebecher von sich und ging unter die Dusche.
Ich werde von hier fortgehen, dachte er, Isabel kann in diesem Haus bleiben. Aber ich werde weggehen.
Als er diesen Entschluss gefasst hatte, fühlte er sich besser. Sein Kopf war einigermaßen klar und er konnte an seinen künftigen Arbeitstag in der Klinik denken.
Gott sei Dank, dass er die Arbeit hatte. Sie lag ihm, er war ein guter Chirurg.
Schnell machte er sich fertig und blickte auf die Uhr. Es war immer noch sehr früh, aber das machte nichts. Er würde gleich ins Krankenhaus fahren. Dort gab es immer genug für ihn zu tun. Leise schlich er sich ins Schlafzimmer und beugte sich über das Bett. Isabel öffnete die Augen und blinzelte ihn an.
»Schlaf nur weiter, mein Schatz,« sagte er liebevoll. »Es ist noch zu früh für dich, aber ich muss jetzt gehen. Also bis heute Abend dann.«
Er küsste sie auf die Wange, da schlang Isabel beide Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich herunter.
»Bis heute Abend, Liebling,« flüsterte sie und küsste ihn auf den Mund.
Als Daniel die Haustür hinter sich zuschlug, wischte er sich mit dem Handrücken über die Lippen, ohne dass es ihm bewusst wurde. Als er am Hause seines Vaters vorüber fuhr, sah er Licht hinter den Fenstern von Marias Atelier. War sie schon an der Arbeit? Sekundenlang kam ihm in den Sinn anzuhalten und zu ihr hinein zu gehen. Sicher würde sie ganz allein sein. Er hätte sie ein paar Minuten für sich, könnte ganz nah neben ihr stehen, sie berühren.
Um Gottes Willen, ich bin ja verrückt! dachte er erschrocken und schüttelte grimmig den Kopf.
Langsam fuhr er weiter den Kastanienweg entlang und bog in den Kirchweg ein.
Plötzlich kam ihm ein Erlebnis aus der Vergangenheit in den Sinn: Er war eben über 20 und steckte gerade im Studium. Sein Vater und Maria hatten geheiratet und wohnten schon in Seefeld. Das Haus in Heydholm war verkauft, und Daniel hatte sich ein Zimmer genommen, um sich lange Fahrzeiten zu ersparen.
Eines Morgens hatte er seine Vorlesungen geschwänzt und war zu Maria gefahren. Er wusste, dass sie allein im Haus war. Es zog ihn mit aller Macht zu ihr, schon damals war er heillos verliebt in sie gewesen. Tag und Nacht hatte er sie nicht aus seinem Kopf bringen können. An diesem Morgen war er einfach zu ihr gefahren.
Und dann hatte er vor ihr gestanden.
Es hatte ihn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, sie so nah und ganz allein vor sich zu haben. Sein Verstand war gänzlich ausgeschaltet. Er war jung und heißblütig und bis über beide Ohren verliebt. Das war alles, was in diesem Augenblick zählte. Er hatte sie an sich gerissen und geküsst.
Maria war völlig überrumpelt gewesen. Sie hatte ihn schließlich wiedergeküsst! Es war ein überwältigendes Erlebnis für ihn gewesen, das er nie vergessen hatte.
Eine Zeitlang danach hatte er sich sogar zu der Vorstellung verstiegen, sie könnte ihn eines Tagen so lieben wie er sie. Das hatte sich dann jedoch als Irrtum erwiesen.
Damals war er 20 Jahre alt gewesen und Maria knappe sieben Jahre älter. Und Martin 42.
Ach Gott, es war so unendlich lang her.
Was sollen die alten Geschichten, rief Daniel sich unwillig zur Ordnung.
Aber diese alte Geschichte, die sich vor 18 Jahren zugetragen hatte, sollte sich in seinem Geist einnisten und eine andere Erinnerung zurück holen.
Eine Erinnerung, die noch länger zurück lag.
17 Jahre um genau zu sein!
In der folgenden Nacht hatte Daniel einen Traum:
Es ist ein windstiller, sonniger Tag, aber der Sommer ist fast vorbei, und die Luft riecht schon nach Herbst.
Daniel ist zehn Jahre alt. Er hat seine Schularbeiten fertig und ist mit seinem Fußball nach draußen gegangen.
Auf der Einfahrt darf er nicht Fußball spielen, der Ball könnte auf die Straße vor ein Auto rollen. Beate ist da sehr ängstlich und Daniel will ihr keinen Ärger machen. Er liebt Beate, sie ist wie eine Großmutter für ihn. Eine liebe Oma, wie er nie eine hatte.
Die Mutter ist fort, die Eltern leben nicht mehr zusammen. Sie vertragen sich nicht mehr, hat man ihm gesagt. Er vermisst die Mutter kaum.
Nun ist ihm der Fußball doch tatsächlich über die Einfahrt hinweg gerollt, obwohl er so achtgegeben hatte!
Er blickt ihm nach, und gerade in diesem Augenblick kommt ein Mädchen daher. Der Ball rollt ihm vor die Füße, das Mädchen bückt sich danach und hebt ihn auf.
Dann steht sie ganz nah vor ihm und blickt voller Verblüffung und ungläubigem Staunen in sein Gesicht.
Es ist Maria und er sieht sie zum ersten Mal.
Im Traum weiß er, dass sie zum Vater will, denn sie sucht ihn seit langem. Den Grund dafür weiß er nicht, aber ihm wird klar, warum sie ihn, Daniel, so erstaunt angesehen hat. Er sieht seinem Vater, den Maria von irgend woher bereits kennt, unglaublich ähnlich.
Sie stehen einander gegenüber, der 10-jährige Daniel und die 17-jährige Maria. Es ist ihre erste Begegnung.
Als Daniel früh am Morgen erwachte, war er ganz verwirrt. Was war das? Ein Traum?
Nein, dachte er verstört. Es schien doch eher eine Erinnerung zu sein. Aber wie war das möglich? Hatte er Maria nicht erst kennen gelernt, als er schon im Studium war?
Das war sehr merkwürdig und er fand keine Erklärung dafür. Schließlich hakte er die ganze Sache für sich ab, indem er sich sagte, es könne nur ein Traum gewesen sein. So lebendig das Ganze ihm auch vorgekommen sein mochte!
Im Laufe des Tages jedoch tauchte dieses kleine Erlebnis immer wieder in seinem Kopf auf. Ja, mehr noch, es gesellten sich andere Dinge hinzu, an die er sich plötzlich zu erinnern glaubte.
Es war, als hätte sich in seinem Gedächtnis plötzlich ein Türchen aufgetan und ließ ihn einen Blick auf vereinzelte kleine Erlebnisse aus seiner Kinderzeit tun.
Er sah sich zusammen mit dem Vater in dem Haus in Heydholm, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Er lebte zu dieser Zeit schon mit dem Vater und Beate allein. Und irgend wann war auch Maria dabei gewesen. Es war am Ende eines Sommers – er wusste es jetzt genau!
Er erinnerte sich!
Einen ganzen Tag und eine Nacht lang hatte es geregnet.
»Der Sommer ist endgültig vorbei,« hörte er Beate sagen. »Nun werden wohl bald die Herbststürme kommen.«
Und dann war da Marias Stimme:
»Nein, noch nicht,« sagte sie. »Wenn dieser Regen vorbei ist, wird es noch einmal schön. Ganz warm und sonnig wird es sein, eine ganze Weile. Dann kommt ein milder Herbstwind und danach die Stürme.«
Sie alle hatten Maria ganz erstaunt angesehen.
»Woher weißt du das?« hatte der kleine Daniel sie gefragt. Maria zuckte die Achseln.
»Ich weiß es eben. Und nun komm, Daniel. Der Regen wird gleich aufhören. Da hinten kommt schon die Sonne heraus, siehst du? Gleich werden wir einen herrlichen Regenbogen sehen.«
Und tatsächlich, so war es.
Noch jetzt hatte Daniel in seiner Erinnerung ganz deutlich diesen Regenbogen vor Augen. Zu dritt standen sie im Garten, der schon so herbstlich aussah, und bewunderten die farbige Pracht.
»Was ist das eigentlich, ein Regenbogen?« hatte er gefragt und Martin hatte geantwortet: »Eine Lichterscheinung, die sich auf einem Vorhang niedergehenden Regens in Form von einem oder mehreren Kreisbögen zeigt, deren Mittelpunkt im sogenannten Gegenpunkt der Sonne liegt. Von diesem sieht man den Hauptregenbogen, der innen violett und außen rot gefärbt ist, unter einem Winkel von 42 Grad, den Nebenregenbogen…«
Maria hatte ihn lachend unterbrochen: »Ein Regenbogen entsteht durch Brechung und Spiegelung des Sonnenlichts in den Regentropfen.«
Dann hatten sie alle zusammen gelacht.
»Das hört sich schön an,« sagte Daniel.
Ein anderes Erlebnis tauchte in seinem Geist auf.
Es war Weihnachten und tiefster Winter. Maria wohnte bei ihnen in dem Haus in Heydholm. Der Vater fuhr täglich in die Klinik nach Bernburg, wo er damals beschäftigt war. Beate war bei ihren Kindern zu Besuch und er war den ganzen Tag über mit Maria allein. Sie arbeitete zu der Zeit nicht. Irgendetwas Schreckliches in der Klinik war vorgefallen, das sie krank werden ließ. Und nun war sie bei ihnen in dem Haus in Heydholm.
Es war eine wunderschöne Zeit für Daniel gewesen, dieses Weihnachtsfest und die Wochen danach.
Am Tag vor Heiligabend begann es zu schneien. Zu dritt gingen sie in den Wald und schlugen einen Baum, der am Abend, als Daniel schlief, von Maria und dem Vater geschmückt wurde.
Am nächsten Tag wurde das »Weihnachtszimmer« abgeschlossen, und es war absolut geheimnisvoll, bis am späten Nachmittag bei Kerzenschein und Weihnachtsmusik die Bescherung stattfand. Später wurde gesungen, vorgelesen, gespielt, gegessen und getrunken und um Mitternacht wanderten sie zu dritt in die kleine Kirche zum Weihnachtsgottesdienst.
Als diese Erinnerung in Daniels Geist auftauchte, saß er gerade vor einem großen Becher Kaffee in der Cafeteria der Klinik. Es warf ihn geradezu um, als diese alten Bilder aus der Vergangenheit in seinem Kopf lebendig wurden.
Verdammt, wie konnte es sein, dass er all diese Dinge bis heute vergessen hatte! In welchem Geheimfach seines Gehirns hatten sie geschlummert?
Er saß regungslos und starrte in seinen Kaffeetopf, ohne ihn zu sehen. Ein Kollege sprach ihn an, aber er hörte und sah ihn nicht.
Das Herz schlug ihm plötzlich bis zum Hals.
Was ging hier vor? Hatte er Visionen? Halluzinationen?
Wie sonst sollte es möglich sein, dass er sich an etwas erinnerte, das er doch niemals erlebt haben konnte!
Dieses Weihnachtsfest zu dritt – es war so lebendig in seinem Geist, als wäre es gestern gewesen!
Und auch die Zeit danach, den ganzen Januar hindurch waren Martin und Daniel sehr viel mit Maria zusammen gewesen. Sie wohnte nicht mehr in Heydholm, aber sie war oft zu Besuch gekommen.
Oder sie hatte Daniel zu sich geholt und sie hatten gemeinsam etwas unternommen.
Er war ein glückliches Kind gewesen in jener Zeit!
Plötzlich hörte er den 10-jährigen Daniel in seinem Kopf, als stünde er neben ihm: »Darf ich Mama zu dir sagen, wenn du Papa geheiratet hast?«
»Hey, Kollege,« ertönte nun eine andere Stimme neben ihm, eine sehr laute männliche Stimme aus der Gegenwart.
»Du wirst am Telefon verlangt! Was ist los, geht’s dir nicht gut?«
Daniel schreckte hoch.
»Nur leichte Kopfschmerzen,« sagte er und strich sich mit der Hand über die Stirn. »Zum Glück habe ich gleich Feierabend.«
Eine Stunde später war er auf dem Heimweg.
Die Bilder der Vergangenheit wirbelten durch seinen Kopf.
Er konnte immer noch nicht begreifen, was ihm da geschah. Nun kam ihm plötzlich ein neuer Gedanke!
Was war danach geschehen?
Nach diesem Januar 1988? Da versiegten seine Erinnerungen. Sein Kopf gab einfach keine mehr her. War Maria danach fortgegangen?
Daniel bremste scharf und fuhr an den Straßenrand.
Was war damals passiert?
Er stützte die Arme auf das Lenkrad und legte sein Kinn darauf. Er starrte auf die stille Straße, ohne etwas zu sehen.
Plötzlich erinnerte er sich auch an die Zeit danach.
Maria war verschwunden, an einem Samstag im Februar! Er verbrachte gerade das Wochenende bei seiner Mutter, und als er am Sonntagabend heimkam, war sie fort.
Er entsann sich der schrecklichen folgenden Zeit.
Zunächst warteten sie. Es schien ihnen unbegreiflich und unmöglich, dass Maria fortgegangen war, ohne sich zu verabschieden.
Dann unternahm der Vater alles Mögliche, um sie zu finden, jedoch vergeblich.
Daniel hatte viel geweint, der Vater war völlig verstört. Daniel hatte damals vage vermutet, dass es irgendetwas zwischen seinem Vater und Maria gegeben hatte, das sie fortgehen ließ.
Es war ihm alles so verwirrend und kompliziert erschienen, diese Verhältnisse, in denen sie lebten. Er bekam nur einen Teil davon mit. Er wusste, seine Mutter wollte sich nicht scheiden lassen, also konnte Martin nicht wieder heiraten.
Außerdem war Maria erst 17 Jahre alt und steckte noch mitten in der Ausbildung. Es schien ihm damals ein fürchterliches Durcheinander zu sein, unter dem der Vater sehr litt. Er brauste oft auf, wurde jähzornig und schrie herum. Dann wieder warf er sich in seinen Wagen und fuhr davon wie ein Wilder, so dass der Junge manchmal große Angst hatte, er würde den Vater kaum lebend wiedersehen.
Es war eine furchtbare Zeit.
Irgendwann aber wurde es besser. Es schien, als würde sich über diese ganze Zeit mit Maria eine Art Grauschleier legen, ein »Nebel des Vergessens« – wie ihm heute vorkam.
Anfangs sprachen sie noch von Maria und trösteten sich gegenseitig. Sie würde wiederkommen. Sicher würde sie das – eines Tages. Dann wäre die Scheidung ausgesprochen, Maria 18 Jahre alt und mündig und sie würden heiraten. Und endlich, endlich wären sie zusammen für immer!
So kam es jedoch nicht. Die Gespräche wurden seltener, die Erinnerungen nebelhafter. Schließlich verschwanden sie ganz. Und eines Tages war es, als sei das alles nie geschehen.
Nadine und Yannis
Metamorphose
Vor Nadines Fenster wuchs eine gelbe Kletterrose.
Nadine selbst hatte sie dort vor zwei Jahren gepflanzt. Das war in jenem Sommer, als die Mutter monatelang ohne Bewusstsein in der Seefelder Klinik gelegen hatte.
Inzwischen war die Rose munter drauflos gewachsen. Es erging ihr prächtig an dieser geschützten Wand. Sie hatte Sonne in Hülle und Fülle, und Nadine ließ ihr eine ausgezeichnete Pflege angedeihen. In jedem Herbst und Frühjahr wurde sie kräftig beschnitten, und inzwischen rahmte sie Nadines Fenster ganz ein.
Heute war Sonntag. Es war sehr früh am Morgen.
Nadine lag noch im Bett und überdachte den kommenden Tag. Der Himmel versprach viel Sonnenschein. Heute brauchte sie schönes Wetter, denn sie war am Nachmittag zu einem Ausflug verabredet.
Gestern Abend sah es ganz und gar nach Regen aus. Sie hatte lange nicht einschlafen können, hatte am offenen Fenster gesessen und hinaus geblickt. Eine kleine Brise, die von Zeit zu Zeit ein paar Regenwolken vor das Mondlicht schob, hatte die Schatten ihrer gelben Rose immer wieder über Wand und Decke geworfen. Sie flatterten und zitterten über die Wände wie Blüten im Wind, schwankende kleine Blumengesichter.
Dann waren die Regenwolken weiter gezogen und der Mond hatte am Himmel freie Bahn. Er warf sein Licht ungehindert auf die blühenden Pflaumen- und Apfelbäume und verwandelte sie in duftige, blasse Blütenzelte.
Als Nadine endlich eingeschlafen war, spazierte sie an Yannis Seite unter diesen wunderbaren Blütenbäumen dahin, vom nachtblauen Himmel blickte ein silberner Mond auf sie herab und Yannis legte einen Arm um sie. Er flüsterte: »Nadine, ich liebe dich.«
Es war so ein wunderschöner Traum gewesen, dass Nadine fast Angst bekam. Hoffentlich war das kein ungutes Vorzeichen!
Sie reckte sich wohlig in ihrem Bett und lauschte dem Gesang der Vögel vor ihrem Fenster.
Ein anderer Morgen kam ihr in den Sinn. Er lag zwei Jahre zurück. Es war der Anfang ihrer Freundschaft mit Yannis gewesen. Nadine sah sich wieder im kurzen Hemdchen vor dem Spiegel stehen und ihr kindliches Spiegelbild kritisch mustern. Was sie sah, war ein zwölfjähriges, unscheinbares kleines Mädchen mit zotteligem Lockenhaar und Stupsnase.
Wie sollte sie dem wunderbaren, nahezu erwachsenen Yannis gefallen – kindlich und schusselig wie sie war! Das hatte sie sich damals gefragt.
Was war ich für ein Kindskopf, dachte die jetzt 14-jährige Nadine. Dagegen kam sie sich heute geradezu erwachsen vor.
Sie sprang aus dem Bett und lief ins Badezimmer. Und dann stand sie wie damals mit kritischen Blicken vor dem Spiegel und betrachtete sich.
Aus dem kurzgeschnittenen braunen Lockenkopf war eine leicht gewellte Ponyfrisur geworden, die ihr bis auf die Schultern reichte. Das »Babygesicht« hatte sich in ein schmales, sanftes Mädchengesicht verwandelt.
Die Stupsnase hatte sich zum Glück ein wenig zurecht gewachsen. Der Mund – ihr damals größtes Ärgernis, weil er ihr zu klein erschien – hatte sich zwar nicht in einen üppigen Schmollmund verwandelt, wie es Mode war, aber er war doch recht hübsch und wohlgeformt, wie sie selber zugeben musste.
Am schönsten waren immer noch die Augen, dunkelblau und mit langen dunklen Wimpern. Was hatte Yannis damals am Ende jenes Sommers gesagt?
»Bei deinen Augen und den Wimpern wirst du niemals Wimperntusche nötig haben. Und das, was die Mädchen sich als Make-up ins Gesicht schmieren, auch nicht. Du hast so eine schöne Haut.«
Nadine beugte ihr Gesicht ganz nah an den Spiegel heran. Haut konnte sich verändern, das wusste sie. War ihre heute noch so glatt und zart wie damals?
Prüfend musterte sie ihre gebräunten Wangen. Sie schienen ihr ganz in Ordnung zu sein. Jedenfalls so etwas wie Pickel oder Akne waren da nicht zu sehen.
Und wie stand es mit der Figur?
Nadine blickte an sich herunter. Sie sah eine hübsche, feste Brust, eine schmale Taille, die Arme ein bisschen zu dünn. Und wie stand es mit den Beinen? Sie drehte sich hin und her, um sie von allen Seiten betrachten zu können. Immer noch waren sie sehr schlank, aber doch nicht mehr die »Storchenbeine« von einst. Immerhin zeichneten sich bereits Waden ab.
Sicher würde das alles im Laufe der Zeit noch schöner werden, sie war schließlich erst 14 Jahre alt. Aber alles in allem fand sie sich doch ganz ansehnlich.
Wenn doch Yannis genau so denken würde!