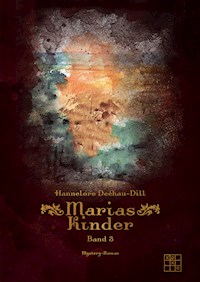Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maria-Reihe
- Sprache: Deutsch
Maria lebt mit Mutter und Tante in scheinbarer Harmonie und Zufriedenheit in einem Haus in einer idyllischen Kleinstadt. Jäh wird sie in ihrem Alltagsfrieden aufgestört. Eine unheimliche Autofahrt bei Unwetter setzt eine Kette seltsamer, mysteriöser Ereignisse in Gang. Albträume und unheimliche Visionen verfolgen sie. Maria entdeckt mehr und mehr Lücken in ihrer Erinnerung. Was war da so Schreckliches in ihrer Kindheit, das sie weit in die entferntesten Winkel ihres Bewusstseins verdrängen musste? Um jeden Preis will sie diesem Geheimnis auf die Spur kommen und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Unheimliche Begegnungen und beklemmende Erlebnisse begleiten sie auf ihrem Weg. Seltsame Visionen und Halluzinationen stellen sich, so dass sie zeitweise an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt. Sie entdeckt ein alptraumhaftes Geheimnis, das sie bis an den Rand des Wahnsinns bringt, und das ihre gesamte Zukunft bedroht. Der einzige Lichtblick in dieser Zeit ist die unerschütterliche Liebe eines Mannes, der sie auch in ihren schlimmsten Stunden nicht allein lässt. Alle Teile der Maria-Reihe Teil 1 - Marias Fluchtwege Teil 2 - Marias Spurensuche Teil 3 - Marias Kinder Teil 4 - Das Mädchen Maria
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Marias Fluchtwege
Teil 1 der Maria Reihe
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-058-3
E-Book-ISBN: 978-3-96752-558-8
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung einer Illustration der Autorin
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Mai 1996
»Es wird Regen geben!«
Maria schaute beunruhigt zum Himmel hinauf, als sie auf die Straße trat. Auftürmende Wolken kündigten Sturm an. Aprilwetter - dabei war es doch schon Mai.
Als sie am Morgen das Haus verlassen hatte, schien sich ein leuchtender Frühlingstag anzukündigen. Maria liebte diese Tage, an denen ein Wind, dessen Frische man riechen kann und der die Wärme des nahenden Sommers ahnen lässt, am blassblauen Himmel kleine zarte Wölkchen vor sich herjagt. Der überraschende Wunsch war in ihr erwacht, tief Atem zu schöpfen und loszurennen, nach Herzenslust über die Wiesen hinterm Haus zu laufen bis hin zum Bach, der sich wie ein glänzendes Band durchs hohe Gras wand.
Fast glaubte sie, sein leises Murmeln zu hören. Ob die gelben Speere der Schwertlilien an seinem Ufer schon aufgeblüht waren?
Ach, einmal keine Pflichten zu haben! Einfach alles hinter sich lassen können, auf niemanden Rücksicht nehmen müssen! Wie gern hätte sie sich ins Gras geworfen, zum blauen Himmel emporgeschaut und auf den morgendlichen Gesang der Vögel gelauscht – wie in Kindertagen.
Wie in Kindertagen? Maria schüttelte unwillig den Kopf angesichts dieser ungewohnten, seltsamen Ideen.
Wann hatte sie je so einen Wunsch verspürt? Sie konnte sich nicht einmal daran erinnern, als Kind im Gras gelegen und in den Himmel hinauf geblickt zu haben!
Dann hatte sie all diese Gedanken kurzerhand abgeschüttelt, hatte die Haustür hinter sich geschlossen, ihren Blick zu einem der oberen Fenster des Hauses empor gewandt und dem ernsten, blassen Gesicht hinter der Scheibe einen letzten Gruß zugewinkt, so wie sie es immer tat – seit vielen Jahren an vielen Morgen.
Sie war in ihr Auto gestiegen, um zum Dienst in die 2o km entfernte Kreisstadt Bad Bernburg zu fahren, ebenfalls wie an vielen anderen Morgen. Und während die Mutter nach dem kurzen Gruß durch die Scheibe ins Zimmer zurücktrat, begab sich Maria zu ihrem Arbeitsplatz, um ihren Arbeitsalltag in Angriff zu nehmen.
Maria arbeitete seit fast 2 Jahren als Geschäftsführerin und Sekretärin in Bad Bernburg im Vorzimmer des Amtsarztes beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung. Ihr unmittelbarer Chef, der Amtsarzt Obermedizinalrat Dr. Marcus Sydon, war ein freundlicher, verständnisvoller Mann von 50 Jahren, der es gern hatte, wenn Maria ihm unliebsame und unbequeme Menschen und Angelegenheiten vom Halse hielt.
Er liebte außer seinen Kindern das Segeln und Angeln über alle Maßen und war stets bestrebt, seinen Arbeitstag zugunsten dieser zeitaufwen-digen Freizeitgestaltungen abzukürzen.
Das war durchaus möglich, da hin und wieder Hausbesuche anstanden und niemand – außer wahrscheinlich Maria - so recht nachforschen konnte, ob, wann und wie viele denn davon nötig waren. Im Übrigen hatte auch niemand im Amt ein besonderes Interesse daran, herauszufinden, wie viele Stunden täglich der Chef im Hause weilte und wie viele er tatsächlich mit Arbeit verbrachte.
Außer vielleicht sein Stellvertreter, Dr. Martin Scheffler, dem die laxe Handhabung aller Dienstgeschäfte zuwider war. Außerdem waren beide Ärzte – wenn auch nicht im üblichen praktizierenden Sinne - und ihm schien, als sei diese Einstellung des Chefs den Menschen und der Arbeit gegenüber absolut nicht in Ordnung. Ganz abgesehen davon, dass er oft das Gefühl hatte, einen Teil dessen Arbeit mit erledigen zu müssen.
Ob das nun wirklich so war, ließ sich schlecht nachweisen. Maria bemühte sich nach Kräften, alle Untersuchungen und Gutachten, die anstanden, gerecht auf beide Ärzte zu verteilen. Da aber der Amtsarzt außer seinem Arbeitsgebiet auch Leiter der Abteilung war und somit alle Chef- bzw. Leitungsangelegenheiten ihm oblagen, war und blieb die ganze Sache eben doch undurchschaubar.
Hin und wieder rauschte dann noch die überaus elegante und aufwendig gestylte Gestalt der Gattin desselben Nachmittags herein, gewaltige Wolken von Parfumduft um sich verbreitend, um ihr wichtig erscheinende Vorkommnisse ihres Tagesgeschehens mit ihrem Mann durchzusprechen.
Der Chef hatte es in all seinen Dienstjahren nicht zustande gebracht, seiner Frau diese mitunter doch sehr unpassenden Besuche, die den Dienstplan störten und durcheinanderbrachten, abzugewöhnen. Er war wohl ihr und ihrem Temperament nicht recht gewachsen.
So wurde hinter seinem Rücken gutmütig gemunkelt, dies sei wohl Grund und Ursache für seine aushäusigen Hobbys, denn auf den ausgedehnten Segel- und Angeltouren begleiteten ihn stets nur seine heranwachsenden Söhne, niemals aber seine Frau. Diese Sportarten waren ihr zu unbequem oder zu rau, wurden aber trotz all ihren Nörgelns nicht eingestellt. Das war die einzige Angelegenheit, in die ihr Mann sich nicht hineinreden ließ.
Saß die duftende Dame erst einmal im Besuchersessel des Chefs, so verließ sie diesen selten, bevor sie losgeworden, weswegen sie gekommen war. Wenn es bisher überhaupt gelungen war, sie schnell hinauszukomplimentieren, so war das nicht dem Durchsetzungsvermögen ihres Mannes zu verdanken, sondern einzig und allein Marias Erfahrung, Diplomatie und Geschicklichkeit.
All diese Vorkommnisse erfüllten seinen Stellvertreter mit anfänglich leisem Missmut, der sich im Laufe der Zeit zu einem heftigen Groll auswuchs und in gelegentlichen Wutausbrüchen auf die Häupter seiner Untergebenen entlud.
Maria kannte deren Ursache wohl als Einzige zur Genüge und wusste damit umzugehen, zumal Dr. Scheffler ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl besaß und ihm seine Ausbrüche sofort leidtaten. Auf rührend ungeschickte Weise und ohne viele Worte zu verlieren, versuchte er diese seine »Ausrutscher« wieder gutzumachen, indem er Maria Konfekt oder Lilien aus seinem eigenen Garten brachte, die leider schlimmer noch rochen als das Parfum der Chefgattin.
Er hatte zu Hause niemanden, der ihm in diesem Dingen raten konnte, denn er lebte seit seiner Scheidung vor zwei Jahren allein mit seinem studierenden Sohn und einer Haushälterin, die ein paar Mal in der Woche kam.
Maria fühlte sich sehr wohl auf ihrem Arbeitsplatz, kam mit allen Kolleginnen und Kollegen gut aus. Sie galt als zuverlässig, gleichbleibend freundlich, überaus tüchtig und jeder Situation gewachsen, jedoch war bisher niemand mit ihr richtig vertraut geworden.
Zwar hielt man sie nicht gerade für abweisend und unnahbar, so doch für recht ernst und zurückhaltend. Auch ihr Äußeres trug dazu bei. Die weißen Kittel, die sie im Dienst trug, waren stets hochgeschlossen. Das glatte schwarze Haar, in der Mitte streng gescheitelt, war zu einem Knoten im Nacken zusammengenommen.
Kühle grüne Augen blickten unter dichten, sehr dunklen Brauen forschend, oft sogar misstrauisch, in die Welt; der etwas zu breite Mund wirkte allzu beherrscht und farblos und verzog sich fast nur zu einem freundlichen, kaum einmal zu einem herzlichen Lächeln.
Niemand im Amt hatte sie in all den Jahren mit geschminkten Lippen, geschweige denn mit Make-up, gesehen.
Und doch täuschte der äußere Eindruck bis zu einem gewissen Grad. Hinter aller Ernsthaftigkeit verbarg sich eine gute Portion Humor und hinter ihrer ruhigen Sachlichkeit und Zurückhaltung menschliche Wärme und Herzlichkeit. Vor allem aber eine große Scheu, sich anderen Menschen zu öffnen!
♦♦♦
Am späten Nachmittag nun, als Maria Feierabend hatte und nach Hause fahren wollte, in ein – hoffentlich friedliches - Wochenende hinein sah der Himmel völlig anders aus als am Morgen. Besorgt musterte sie die heraufziehenden düsteren Wolken. Eine leise Unruhe verscheuchte ihre Müdigkeit.
Vielleicht würde es sogar ein Unwetter geben. Maria hasste das Autofahren bei Regen und Sturm, zumal es bereits dunkel zu werden begann. Von plötzlicher Angst erfasst, erledigte sie so schnell es eben ging ihre wichtigsten Einkäufe für das Wochenende, während vereinzelt die ersten schweren Tropfen fielen. Es war später geworden, als sie gedacht hatte! Voller Eile machte sie sich auf den Heimweg.
Während ihre Gedanken anfangs noch bei der Arbeit weilten, wurde ihre Aufmerksamkeit zunehmend mehr vom Autofahren in Anspruch genommen. Sturm und Wolken schienen ihr auf den Fersen zu folgen.
Kaum war sie aus der Stadt heraus, schlug der Regen bereits prasselnd gegen die Scheiben. Es war nun fast dunkel. Maria konnte nur sehr langsam fahren. Der Sturm trieb die Regenmassen schräg üben den schwarzen Asphalt des Fahrdamms. Die Lichter des Scheinwerfers spiegelten sich in der dunkeln Nässe und der helle Schein entgegenkommender Fahrzeuge blendete sie.
Nach wenigen Kilometern musste sie von der Schnellstraße auf eine schmalere, wenig befahrene Landstraße einbiegen, die zumindest den Vorteil hatte, dass niemand ihr entgegen kam. Angespannt und mit verkrampften Schultern saß sie hinter dem Steuer und versuchte angestrengt ihren Weg zu erkennen.
Das saugende Geräusch der Scheibenwischer, die kaum eine Sichtfläche klärten, zerrte an ihren Nerven. Unvermindert strömte das Wasser an den Scheiben herunter, die Luft im Wagen war stickig, das Auto dampfte förmlich. Maria fühlte sich wie in Regenmauern eingeschlossen. Ihre Schultern schmerzten. Mühsam zwang sie sich zur Ruhe.
»Ich habe Zeit genug! Ich könnte anhalten und den stärksten Regen abwarten,« sagte sie sich, aber dann würden sie sich zu Hause Sorgen machen.
»Das tun sie sowieso,« dachte sie müde.
Langsam im Schritttempo nur kam sie voran.
Es kam ihr vor, als kauerte sie, blind und taub von donnernden Kaskaden, hinter einem herabstürzenden Wasserfall. Als sei sie gefangen in einem Albtraum aus Dunkelheit, Dampf und Wassermassen und da draußen lauerte etwas Unbekanntes, Schreckliches auf sie.
Maria glaubte, ersticken zu müssen. Die Wände des geschlossenen Wagens schienen auf sie einzudrängen.
»Es gibt gar keinen Grund, Angst zu haben«, suchte sie sich zu beruhigen.
»Es sind nur Wind und Wasser da draußen. Weiter nichts.«
Sie fuhr an den Straßenrand, das Auto geriet ins Rutschen, aber schließlich kam es zum Stehen. Minutenlang saß sie ganz still, die kalten Hände verkrampft im Schoß.
Sie wischte sich über die schweißnasse Stirn und lockerte Schultern und Arme.
»Mein Gott, was ist nur mit mir?« Maria hätte gern das Fenster geöffnet. Ihr war übel und sie fühlte sich verschwitzt. Ein vertrautes Hämmern hinter den Schläfen kündigte sich an.
»Nur das nicht!« Sie schloss die Augen und atmete tief ein und aus. Das Hämmern wich einem dumpfen Schmerz, der sich gnadenlos hinter ihrer Stirn ausbreitete. Vor ihren geschlossenen Augen begann es in Streifen und Zacken zu flimmern und die Übelkeit verstärkte sich. Und dann war da noch etwas anderes! Sie hörte Musik! Fetzen einer Melodie drangen an ihr Ohr, seltsam vertraut und schwermütig.
Mit einer klammen Hand tastete sie blind nach dem Schaltknopf des Radios, aber es war ja gar nicht eingeschaltet!
Sie hob lauschend den Kopf. Woher kam diese Musik? Von draußen? Das war unmöglich. Da war weit und breit nichts außer Landstraße, Büschen, Bäumen und Feldern! Oder war sie in ihrem Kopf? Wurde sie nun tatsächlich verrückt?
Panik wollte in ihr aufsteigen. Am ganzen Leibe zitternd, presste sie ihre kalten Hände auf beide Ohren, dann an ihre glühend heißen Wangen. Ruhig, nur ruhig! Es ist nichts! Nur die rasenden Kopfschmerzen und dieses entsetzliche Donnern und Getöse da draußen!
Auf einmal verstummte die geisterhafte Musik, so plötzlich und unerklärlich, wie sie aufgetaucht war.
Sie legte die Arme auf das Steuerrad und den schmerzenden Kopf darauf.
So blieb sie eine ganze Weile regungslos sitzen. Jegliches Gefühl für die Zeit war ihr verloren gegangen.
Was war das eben gewesen?
Nichts, gar nichts! Nur ihre Kopfschmerzen, die sie doch schon hundertmal in allen Variationen erlebt hatte, und dieses schreckliche Unwetter da draußen!
Schließlich hob sie den Kopf und blickte nach draußen. Es schien ihr, als ob die Dunkelheit immer schwärzer würde, aber war der Regen inzwischen nicht etwas schwächer geworden?
Sie machte sich klar, dass sie auf keinen Fall hier im Auto übernachten wollte.
Mühsam raffte sie sich auf und fuhr langsam weiter. Dabei spähte sie angestrengt nach einem Anhaltspunkt aus, der ihr anzeigen könnte, wo sie sich befand, aber sie sah nur schwankende Büsche und windgepeitschte Bäume am Straßenrand.
Sie kam nur Meter um Meter voran, kämpfte gegen die Dunkelheit, den Sturm, die Regenmassen und die nasse, schwarze Straße, die in den Lichtkegeln der Scheinwerfer undeutlich vor ihr flimmerte. Und außerdem gegen den hämmernden Schmerz und eine aufkeimende, atembeklemmende Furcht, die ihr den Nacken herauf kroch.
Es war, als würde sie niemals heimkommen.
Nach langer, langer Zeit aber sah sie durch die Regenschleier hindurch doch Lichter von Häusern auf sich zukommen. Sturm und Regen waren endlich schwächer geworden.
Aufatmend erreichte Maria die ersten Häuser von Waldhagen. Angst und Schmerz ließen etwas nach, die Übelkeit verschwand. Sie fühlte sich wie befreit, als sie in die vertraute Straße einbog. Schon von Weitem erblickte sie die hellerleuchteten Fenster ihres Hauses, auch der Vorplatz lag in hellstem Lampenlicht. Sie wusste, Mutter und Tante wollten sie nach einem langen Tag und dieser entsetzlichen Fahrt im Regen auf diese Weise willkommen heißen, und ein warmes Gefühl der Geborgenheit stieg in ihr auf.
Als sie auf den Hof einbog, fegten die mächtigen Zweige der Fichten an der Einfahrt im Vorbeifahren die Wagenfenster, sodass das Regenwasser verstärkt daran herunterströmte.
Kaum hatte sie den Hof erreicht, wurde mit Schwung die Hintertür aufgerissen. In ihrem warmen Lichtschein erschien die zierliche Gestalt ihrer Mutter. Einen aufgespannten Regenschirm in beiden Händen schickte sie sich an, Maria bis zum Auto entgegen zu stürzen.
Maria hatte ihre Taschen ergriffen und kämpfte sich aus dem Wagen. Wind und Regen schlugen ihr ins Gesicht. »Bleib nur da. Der Schirm hat ja gar keinen Sinn!« schrie sie und rannte auf das Haus zu.
Die Tante tauchte aus der Küche auf, als die Tür hinter ihnen zuschlug.
Wie auf Kommando begannen beide zu lamentieren und umständlich um Maria herum zu tanzen. Die Mutter griff nach ihrem Mantel, die Tante erschien mit einem Handtuch, um ihr das Haar zu trocknen. Maria unterdrückte ihre Ungeduld und schob beide lachend zur Seite.
»Lasst nur, ich mach das schon selbst. Nehmt ihr nur die Einkäufe! Mein Gott, war das eine Fahrt! Ich hoffe, ihr habt Euch keine Sorgen gemacht!«
Und nun setzte sich das Zetern und Jammern fort, mit dem Unterschied, dass jetzt sie beide Gegenstand und Mittelpunkt aller Sorgen und Ängste waren, die in den letzten Stunden ausgestanden werden mussten, und dass nun Maria beruhigen und trösten musste.
Nach einem großen Becher heißen Kaffees konnte sie endlich in ihr Zimmer flüchten. Unter der heißen Dusche umfing sie ein Gefühl von Stille und Frieden. Sie meinten es gut, Mutter und Tante, und doch waren sie alle beide so anstrengend – und meistens unglaublich ichbezogen! Sofort verscheuchte Maria schuldbewusst diesen unfreundlichen Gedanken.
Im Zimmer war es stickig heiß.
Sie drehte die Heizung aus und öffnete das Fenster einen Spalt. Der Mond war aufgegangen. Nur noch sanfter Regen rauschte in silbrigem Schleier vor ihrem Fenster herab. Maria wusste, man erwartete sie unten, um den Abend gemeinsam zu verbringen. Also musste sie sich anziehen und hinunter gehen!
Während sie ihr glattes langes Haar mechanisch mit dem Föhn bearbeitete, schweifte ihr Blick gedankenverloren durch den Raum.
Die Einrichtung ihres Zimmers war eher unharmonisch, die Möbel allesamt alt und schienen wie zufällig hier gelandet zu sein.
Maria konnte sich gar nicht erinnern, wer diese plumpen, altmodischen Sessel mit dem Glastischchen davor einmal ausgesucht oder gekauft hatte. Ebenso verhielt es sich mit dem schweren Kleiderschrank und der Vitrine in der Fensternische.
Wahrscheinlich stammten diese Sachen noch aus dem Hause der Großeltern und waren beim Umzug der Familie mit hierher genommen worden. Die Großeltern hatten Unmengen von Möbeln auf ihrem Bauernhof gehabt, sodass diese Möglichkeit unbedingt denkbar war. Oder man hatte sie zusammen mit dem Haus vor Jahren erworben. Sie hatten jedenfalls hier gestanden, solange Maria denken konnte.
Eigentlich war ihr nie bewusst gewesen, dass sie weder schön waren, noch ihrem eigenen Geschmack entsprachen. Das alte Bett mit dem verrosteten Messingrahmen – weiß der Himmel, wo es einst hergekommen war – hatte sie vor kurzem erst hinausgeworfen und durch ein schmales Französisches Bett ersetzt.
Die einzigen wirklich schönen Stücke waren ein Bücherschrank und ein Sekretär; beides hatte Maria vor zwei Jahren in einem Antiquitätengeschäft aufgestöbert. Monatelang hatte sie dafür einen Kredit abzahlen müssen – sehr zum Ärger von Mutter und Tante, die noch heute gelegentlich in Gezeter ausbrachen, wenn sie Marias Zimmer betraten und ihnen vielleicht gerade einfiel, wie viel die Sachen gekostet hatten.
Inzwischen war ihr Haar fast trocken und sie schaltete den Föhn aus. Die plötzliche Stille summte seltsam in ihrem Kopf und auf einmal beschlich sie – sicherlich bedingt durch Müdigkeit und Abgespanntheit – ein seltsames Gefühl von Unwirklichkeit.
Sie blickte um sich, als spürte sie plötzlich die Schatten der Vergangenheit, die sich hier für alle Ewigkeit eingenistet zu haben schienen. Das Licht der Stehlampe, die sie beim Heimkommen angeschaltet hatte, warf ihren bizarr verzerrten Schatten bis hoch zur Decke hinauf.
Sie versuchte das eigenartig beklemmende Gefühl abzuschütteln, ging ans Fenster und blickte in den Garten hinaus. Der Mond tauchte hin und wieder hinter einer Wolke auf, und zwischen den im Wind schwankenden Zweigen fiel sein weißes Licht mit huschendem Strahl über Büsche und Gartenwege.
Während sie hinabstarrte, glaubte sie schemenhafte Gestalten in den zitternden Schatten zu erkennen, sah sie ihr zuwinken, um dann mit der Dunkelheit zu verschmelzen. Sie schauderte und legte beide Hände auf die Stirn.
»Mein Kopf ist immer noch nicht in Ordnung. Diese Fahrt durch den Regen bei Dunkelheit hat mir scheinbar doch zugesetzt,« dachte sie und wandte sich ab.
Sie ließ die Lampe brennen, als sie nach unten ging, und beschloss, alle Misshelligkeiten dieses Tages abzuschütteln, aber einige der Schatten folgten ihr und legten sich auf ihre Seele wie eine bange Vorahnung.
Winter 1969
November
Niemals hatte er geglaubt, dass ihm dieses passieren könnte! Und doch war es so! Nichts war mehr rückgängig zu machen. Könnte er doch die Zeit zurückdrehen und alles wäre wie gestern um diese Zeit, wie einfach wäre das: Er wäre ruhig und zufrieden und wüsste nicht, dass es noch ein ganz anderes Leben geben könnte für ihn – und für sie! Jetzt aber war es zu spät! Er fühlte sich aufgestört in seinem Alltag wie ein glattes Wasser unter einem plötzlichen Windstoß.
Und doch: Er könnte immer noch handeln wie er es gestern um diese Zeit getan hätte, aber etwas Entscheidendes hatte sich verändert: sein Gefühl! Und heute wollte er nicht mehr handeln wie gestern. Es gab plötzlich Wünsche, die stärker waren als alles, was vorher für ihn wichtig gewesen war.
Als Maria die Treppe hinunterging, erfasste unvermutet eine bleierne Müdigkeit all ihre Glieder und sie wäre am liebsten umgekehrt und hätte sich in ihr Bett verkrochen. Die Kopfschmerzen meldeten sich wieder. Sie hoffte sehr, die beiden da unten hätten sich bereits vor dem Fernsehapparat niedergelassen, um irgendeine Show oder einen Film anzusehen anstatt all ihre Aufmerksamkeit auf sie, auf Maria, zu lenken. Sie hätte dann ungestört in einem bequemen Sessel vor sich hindösen können.
Ihre Hoffnung erfüllte sich nicht. Beide Frauen saßen im Wohnzimmer und sahen ihr erwartungsvoll entgegen. Die Mutter saß wie stets auf dem hochlehnigen Stuhl in ihrem bevorzugten Eckchen nahe dem Fenster, eine Handarbeit auf dem Schoß – eines ihrer unzähligen Häkel- oder Stickdeckchen, die bereits in ganzen Stößen in irgendwelchen Schubkästen vor sich hin lagerten und darauf warteten, als Präsent für einen besonderen Anlass, etwa zu einem Geburtstag in der Nachbarschaft, hervor geholt zu werden.
Die Tante ließ von ihren Tarotkarten ab und wuselte beflissen herbei, als sie Marias Schritt auf der Treppe vernahm.
»Komm nur, mein Kind, und mach es dir gemütlich.« Sie folgte Maria zu dem Tischchen vor Marias Lieblingssessel, wo ihr Abendessen bereitstand: ein Teller mit appetitlich zurechtgemachten Broten, Obst und ein Glas Milch. Sie tätschelte Marias Arm und führte sie wie eine Schwerkranke zum Sessel.
Plötzlich erschienen Maria die kommenden gemeinsamen Stunden wie eine einzige große Anstrengung, der sie sich kaum gewachsen fühlte. Während sie sich in den alten Sessel fallen ließ, griff sie unwillkürlich mit der Hand in ihren Nacken, eine Gebärde, die Mutter und Tante sehr wohl zu deuten wussten. Es hieß, dass Maria wieder einmal Kopfschmerzen, ihre Migräne, hatte. Zu ihrer Müdigkeit gesellte sich eine sonderbare Mischung von Überdruss und Auflehnung, aber sie bezwang sich und lächelte die Tante an.
»Lasst mich bitte nur ein wenig in Ruhe hier sitzen. Dann geht es mir wieder gut. Essen möchte ich im Augenblick gar nicht«, wehrte sie ab. Die Tante wich zurück. Ihre magere Gestalt straffte sich, ihr Kopf zuckte überrascht zurück, während sie die schmalen Lippen zusammenzog und mit eingezogenem Kinn gekränkt vor sich hinsah.
♦♦♦
Tante Henrike war noch nicht einmal 50, wirkte aber älter mit ihrem grau melierten, stets zerzausten Haar, das in der Jugend einmal so schwarz wie das von Leonore und Maria gewesen war, ihrem pergamentfarbenen Teint und ihrem altjüngferlichen Gebaren. Aus einem kecken hübschen Mädchen war ein spitznasiges, verdrossenes Geschöpf geworden, dünn wie ein Stock und meistens sich und das Leben im allgemeinen bejammernd. Sie brauchte stets jemanden, der geduldig ihren rührseligen Klagen lauschte, ohne sogleich mit ganz unerwünschten Vorschlägen für Abhilfe zu kommen.
Sie hatte nie eigene Kinder gehabt. Ihr Mann, Bernhard Sarnow, hatte sie nach kurzer Ehe verlassen, angeblich wegen einer jüngeren Frau.
Maria war da nicht so sicher. Sie vermutete eher, dass er es nicht länger mit ihr ausgehalten hatte. Sie war schon immer ein wenig schwierig gewesen, eigensinnig, intolerant und eifersüchtig auf jedes andere Wesen in seiner Nähe, das einen Rock trug. Vielleicht war Bernhard fortgegangen in der Blüte seiner Jahre, um noch einmal sein Leben unbeschwert und fröhlich zu genießen.
Als dann vor 9 Jahren Marias Vater fortging, zog Henrike zu ihnen ins Haus. Nun waren die Schwestern wieder beieinander. Und scheinbar hatten sie etwas, das sie auf alle Zeiten verband: ihre Enttäuschung, ihre schlechten Erfahrungen mit Ehen und Männern.
Nur gingen die Frauen unterschiedlich damit um. Während Henrike ihren Groll auf ihren Mann hegte und pflegte, hatte Leonore sich eine Schein-Vergangenheit zurecht gelegt, die nur in groben Zügen der Wirklichkeit entsprach. Sie sah ihre Ehe und ihren ehemaligen Mann in einem von ihr verliehenen, tragischen Licht. Niemand – außer vielleicht ihr selbst - trug an irgend etwas die Schuld und niemand hätte etwas verhindern können, alles war vom Schicksal vorher bestimmt!
Marias Vater war nicht so stilvoll verschwunden wie Onkel Bernhard, mit Erklärungen, Abschiedsdiskussionen, Scheidung und großzügigem Unterhalt für die Zurückgebliebene, sondern hatte sich sang- und klanglos von heute auf morgen aus dem Staub gemacht. Da gab es keinen Abschied, keine Scheidung und keinen Unterhalt – soweit Maria wusste. Tränen und Dramatik allerdings – die gab es danach auch, und das nicht zu knapp.
Maria hatte davon nicht mehr allzu viel in Erinnerung. Sie wusste fast alles nur aus den Schilderungen der Mutter. Eines Tages kam der Vater von seinem Dienst nicht nach Hause. Er war in den letzten Jahren Polizist in den umliegenden Gemeinden gewesen, hatte für Recht und Ordnung auf den Straßen, in den Gasthöfen, auf den Tanzsälen zu sorgen, und was sonst noch so zu den Aufgaben eines »Dorfpolizisten« gehörte.
Die Mutter hatte sich zunächst keine allzu großen Sorgen gemacht. Clemens Cornelius war nie der pünktlichste und zuverlässigste Gatte gewesen, war immer seine eigenen, geheimen – oft vielleicht auch krummen - Wege gegangen. Er hatte so allerlei Interessen außer Haus, von denen seine Frau nicht viel wusste. Er hatte mit Glücksspielen und Wetten zu tun und wer weiß, was sonst noch so alles. Leonore wollte es gar nicht so genau wissen.
Geld hatte er immer, von dem er Leonore reichlich gab. Seine Geschäfte außerhalb seines Berufes – so wenig sie auch davon wusste - machten ihr ein wenig Angst, als ahnte sie, dass viele davon sich am Rande der Legalität bewegten. Sie beruhigte sich dann stets selbst, denn er war immerhin Polizist, also konnten nicht allzu krumme Touren dahinter stecken.
Andererseits – wer konnte das so genau wissen! Schließlich war er schon einmal in Schwierigkeiten geraten. Damals war er noch als Polizeibeamter in der Kreisstadt angestellt. Als Maria fast 11 Jahre alt gewesen war, hatte es im Dienst Probleme gegeben, irgendwelche Übergriffe, möglicherweise wegen seines Jähzorns, vielleicht auch wegen Alkohol. Leonore war angeblich nie dahinter gekommen, was da seinerzeit vorgefallen war.
Nach jenen Vorfällen war dann seine Versetzung »aufs Land« erfolgt und er wurde Polizist in Waldhagen und für die umliegenden Gemeinden, hatte dort »für Recht und Ordnung zu sorgen« – wie er sich gern und wichtig ausdrückte. Er hatte dann das alte Haus gekauft und sie waren umgezogen. Von da an musste Maria mit dem Bus in die Stadt aufs Gymnasium fahren, aber das hatte sie ganz gern getan.
Maria hatte sich immer gefragt, was ihn und Leonore einmal verbunden haben mochte. Sie waren in Wesen und Lebensauffassung so verschieden wie zwei Menschen nur sein konnten. Das Sprichwort »Gegensätze ziehen sich an« könnte anfangs zutreffend gewesen sein. Ihre Schüchternheit und Unsicherheit mochten mädchenhaft und reizvoll auf einen Mann gewirkt und möglicherweise seine Beschützerinstinkte geweckt haben. Außerdem war Leonore in ihrer Jugend eine schöne Frau gewesen, zierlich und schlank, mit prachtvollem schwarzem Haar und dunklen Augen.
Zwar war das Haar noch immer schwarz, die Augen aber blickten ein wenig wässrig und resigniert drein mit einem vorwurfsvollen Ausdruck darin, als sei das Leben ihr etwas schuldig geblieben.
Als sie Clemens kennen lernte, musste er ihr imponiert haben. Vielleicht hatte sie seinem unbekümmerten, etwas leichtfertigen Charme nicht zu widerstehen vermocht. Er sah gut aus mit seinem blonden Lockenkopf, den breiten Schultern, den blauen Augen. Leider neigte er zur Unbeherrschtheit und seine gelegentlichen Ausbrüche von Jähzorn versetzten Leonore in Angst und Schrecken. So war es ihr nur recht, wenn er oft – sei es aus dienstlichen Gründen, die er oft als Entschuldigung anführte, oder wegen seiner vielen »privaten Geschäfte« – außer Haus war.
Maria konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie die Mutter es hingenommen hatte, als er vor 9 Jahren verschwand. Sie wusste es nur aus Erzählungen. Maria selbst war es damals gar nicht gut gegangen. Wegen ihrer verstärkten Ohnmacht- und Migräneanfälle hatte sie wochenlang in einer Psychiatrie zugebracht. Solange Maria denken konnte, hatte sie unter Kopfschmerzen und Schwindelanfällen gelitten.
»Das hast du von deiner Urgroßmutter geerbt,« war der knappe Kommentar ihrer Mutter auf Marias Fragen, warum denn ausgerechnet sie von all ihren Freundinnen und Mitschülerinnen so oft und so schreckliche Kopfschmerzen hatte. Aber irgendwann akzeptierte sie es und die »Zustände« – wie Mutter und Tante die Schmerzattacken nannten - gehörten zu ihrem Leben und ihrem Alltag.
So gab es Zeiten, da sie stunden-, manchmal auch tagelang in verdunkeltem Zimmer lag, nicht essen konnte, und nur aufstand, um ins Badezimmer zu wanken und qualvoll wieder und wieder zu erbrechen, schließlich nur noch würgend den hämmernden Schädel mit beiden Händen zu halten.
Bereits mit zehn Jahren war Marie zu einer stationären Behandlung wegen dieser Probleme fort gewesen. Danach ging es ihr besser. Die Anfälle waren seltener und schwächer. Maria lernte damit umzugehen. Sie trieb Sport, machte Entspannungsübungen.
Im Laufe der folgenden Jahre jedoch wurden sie wieder häufiger und steigerten sich schließlich derart, dass ein weiterer Klinikaufenthalt nötig wurde, als Maria 17 Jahre alt war.
Das war fast genau zu dem Zeitpunkt, als der Vater die Mutter verließ. Leonore glaubte fest, dass Clemens das Leben zu Hause mit einem kranken, schwierigen Kind wie Maria es war, und einer Frau, die so gar nicht zu ihm passte, zu reizlos und eintönig geworden war. Sie war davon überzeugt, dass er eine jüngere und flottere Frau gefunden hatte, mit der er auf und davon ging.
Als Maria aus der Klinik heimkam, hatte ein völlig neuer Alltag in ihrem Heim Einzug gehalten. Die Tante war zu ihnen gezogen. Das schien naheliegend, da beide Schwestern nun allein waren und das Haus groß genug für alle drei. Im Grund war es eine Notgemeinschaft, da beide Frauen nicht allein sein konnten. Sie hingen aneinander auf eine säuerliche, widerspruchsvolle Art, die manch einem unverständlich gewesen wäre.
Maria konnte sich nicht erinnern, den Vater vermisst zu haben. Sie gewöhnte sich rasch an das Leben mit Mutter und Tante, zumal sie mit den Fahrten in die Stadt zum Gymnasium, der Arbeit für Schule und Abitur genug zu tun hatte. Dazu kamen ihre zeitweiligen krankheitsbedingten Ausfälle, die immer wieder mit zusätzlicher Arbeit ausgeglichen werden mussten.
Nachdem Maria endlich das Abitur geschafft hatte, begann sie gegen den Willen der Mutter ein Psychologiestudium, das sie nach 4 Semestern aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen abbrach.
Mutter und Tante waren froh, als Maria, die während des Studiums in der 60 km entfernten Großstadt ein möbliertes Zimmer bewohnt hatte, wieder nach Hause kam.
Sie begann eine Lehre als Krankenschwester in Bad Bernburg, die sie ohne Komplikationen mit Erfolg abschloss.
Die Arbeit im Krankenhaus strengte sie jedoch körperlich und seelisch derart an, dass sie diese nach Beendigung der Lehre aufgab, obwohl man ihre Tüchtigkeit und ihr freundliches, hilfsbereites Wesen schätzen gelernt hatte und sie gern als Krankenschwester behalten hätte.
Aufgrund einer Anzeige in einer Fachzeitung bewarb sie sich für die Anstellung im Vorzimmer des Gesundheitsamtes, die sie sofort bekam. Dort war sie nun seit fast 2 Jahren und die Arbeit gefiel ihr gut. Auch gesundheitlich ging es so leidlich. Sie lebte mit den gelegentlichen Kopfschmerzen und deren Begleiterscheinungen, die etwa ein- bis zweimal im Monat auftraten. Damit hatte sie sich abgefunden. Andere Leute hatten andere Probleme; das war nun einmal so.
♦♦♦
Maria saß mit geschlossenen Augen in ihrem Sessel.
Ihr Abendessen hatte sie kaum angerührt. Mutter und Tante saßen auf der Couch und starrten auf den Bildschirm. Hin und wieder warfen sie ihr einen scheuen Blick zu.
»Geht’s schon besser?« wagte schließlich die Mutter zu fragen.
Maria öffnete die Augen. Sie war in Gedanken weit fort gewesen.
Sie nickte. »Viel besser. Ich bin nur müde. Der Tag war anstrengend und in der vorigen Nacht hab ich auch nicht viel geschlafen.«
Im gleichen Moment bereute den letzten Satz. Schon waren auch zwei besorgte Mienen auf sie gerichtet.
»Hattest du wieder Albträume?« kam es auch schon.
»Nein, nein. Zumindest weiß ich nichts davon,« beeilte sich Maria zu versichern.
»Es war weiter gar nicht. Ich habe nur unruhig geschlafen.« Das stimmte zwar nicht, aber sie verspürte nicht die geringste Lust, endlose und ermüdende Diskussionen über ihren Gesundheitszustand zu führen.
Sie war aufgestanden und schickte sich an, das Geschirr ihres Abendessens aus dem Zimmer zu tragen. Die Tante wuselte herbei und nahm es ihr aus der Hand.
»Das kann ich doch machen. du musst dich ausruhen.« Sie legte Maria den Arm um die Schultern.
»Setz dich noch ein bisschen zu uns. Morgen kannst du doch ausschlafen. Sicher kommt Ronald morgen?«
»Er wird mich irgendwann anrufen. Wir haben bisher nichts verabredet. Entschuldigt mich, ich möchte mich lieber schon hinlegen.«
Sie ging schnell zur Tür, um dem zu entgehen, was nun kommen musste.
»Wenn Du ihn heiraten würdest, könntest du es dir leichter machen,« ertönte die Stimme der Mutter hinter ihrem Rücken, und die Tante fiel ein: » Ich weiß gar nicht, warum du immer noch warten willst. Er ist so ein tüchtiger, gut aussehender Mann, und er mag dich sehr. Ihr passt doch so gut zueinander. Was willst du noch? Schließlich bist du kein Teenager mehr und wenn du noch Kinder willst …«
Maria zwang sich zu Ruhe und Freundlichkeit und schluckte alles hinunter, was es dazu zu sagen gab. Es war auch längst alles hundertmal gesagt worden.
»Ja, ich weiß,« sagte sie müde. »Und ich weiß auch alles, was ihr noch dazu sagen könntet: dass ich mir keinen besseren Mann als ihn wünschen könnte, dass er fast zu gut für mich ist, dass ich bald 30 bin …und ….. ach, und was noch alles! Aber schließlich – wir kennen uns noch nicht einmal ein Jahr. Ich bin einfach noch nicht soweit. Lassen wir doch das Thema für heute, ja?« Marie rieb sich mit den Fingern beide Schläfen.
Die Mutter sah erschrocken in Marias abgespanntes, blasses Gesicht.
»Du hast Recht, mein Kind. Geh und schlaf dich aus,« sagte sie begütigend.
»Mach dir keine Gedanken. Es ist nur - du weißt ja, wir sorgen uns um dich.«
Mutter und Tante folgten Maria in den Flur und sahen ihr sorgenvoll nach, während diese die Treppe hinauf nach oben flüchtete.
In ihrem Zimmer jedoch konnte sie trotz der Müdigkeit lange nicht zur Ruhe kommen.
Wie widersinnig war es doch, dachte sie. Da betonten Mutter und Tante ständig, wie sie sich um sie, Maria, sorgten, wie sie sich verantwortlich fühlten, was für ein Stein ihnen vom Herzen genommen wäre, wenn Maria endlich verheiratet und »versorgt« wäre.
Dabei war es eher anders herum. Beide Frauen klammerten sich in einer Art und Weise an Maria, die ihr mitunter die Luft zum Atmen nahm. Zwar wurde für sie gesorgt, was die häuslichen Dinge anbelangte, man kochte, wusch und putzte für sie.
Alle übrigen Angelegenheit des täglichen Lebens jedoch schob man bereitwillig Maria zu, angefangen bei den Einkäufen bis hin zu den Dingen, die Haus, Handwerker, Finanzen, Versicherungen und dergleichen betrafen. Es war ihnen gar nicht recht bewusst.
Maria war der Dreh- und Angelpunkt der beiden Frauen. Um sie drehte sich ihr ganzes Leben. In ihrer »Sorge« um sie verbarg sich ein großer Teil Sorge um die eigene Person. Was sollte aus ihnen werden, wenn Maria nicht mehr für sie da wäre?
Leonore und Henrike waren sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Beide erwarteten von anderen, dass sie ihnen den Alltag, das Leben im allgemeinen, lebenswert machte. Früher hatten ihre Männer diese Aufgabe übernommen, davor die Eltern. Nun war es Maria.
Zwar war ihnen das nicht so klar und sie hätten es vehement abgestritten, wenn es ihnen jemand direkt ins Gesicht gesagt hätte. Taten sie nicht alles für das Kind?
Insgeheim hofften beide, Maria würde Ronald Simon heiraten. Ronald war stets zuvorkommend und galant zu beiden Frauen.
Sie mochten ihn und hegten die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass er ihnen Maria nicht fortnahm, sondern dass er beide Frauen in das zukünftige Familienleben einbeziehen würde.
Ronald war Fahrlehrer und besaß eine eigene, ausgezeichnet florierende Fahrschule mit einigen Angestellten. Über den Geschäftsräumen hatte er seine geräumige, komfortabel und modern eingerichtete Wohnung, in der Maria ihn hin und wieder besuchte.
Wiederholt hatte er erwähnt, ein Haus für Maria zu bauen, sobald sie sich entschließen könnte, mit ihm zusammen darin zu leben.
Das hatten Mutter und Tante mit Genugtuung vernommen. Er hatte schließlich Geld genug und wer weiß – vielleicht hätten Leonore und Henrike ebenfalls in diesem Haus Platz - oder ganz in ihrer Nähe.
Für beide Frauen stand unverrückbar fest, dass Maria sie niemals allein lassen würde – und dürfte! Und wenn Ronald das Mädchen heiratete, übernahm er automatisch die Verpflichtungen für die allein stehende Mutter und deren Schwester. Das war ihre unangefochtene Meinung.
Leonore arbeitete zwar stundenweise als Stenotypistin in einer ortsansässigen Holzhandlung und war somit sehr stolz darauf, Geld ins Haus zu bringen, aber es war im Grunde so wenig, dass sie davon allein nicht hätte leben können. Henrike dagegen war gut versorgt und trug ihren Teil zum Haushalt bei.
Es ging jedoch nicht nur um die finanzielle Unterstützung, um die beide Frauen in der Zukunft bangten. Vielmehr ging es um ihre Einsamkeit, ihre Unfähigkeit, ihr eigenes Leben zu führen. Beide ahnten, dass eine Lücke in ihrem Leben entstehen würde, die sie nicht in der Lage wären, aus eigener Kraft zu schließen – sollte Maria einmal nicht mehr für sie da sein.
Ihnen wäre ihr Lebenszweck genommen.
Sie hätten dann weiter nichts als einander. Das war für beide Frauen unvorstellbar und die unbestimmten Ängste, die diese Vorstellung bei beiden herauf beschwor, wollten sie gar nicht genauer untersuchen.
Maria stand am Fenster und dachte an Ronald.
Sie kannte ihn seit Monaten; im Sommer wurde es bereits ein Jahr. Also noch gar nicht einmal so lange, um es mit einer Heirat so eilig zu haben. Überhaupt – Heirat!
Maria schüttelte den Kopf. Für sie gab es immer noch den Begriff »alte Jungfer«. Ein Mädchen, das über 25 Jahre alt war, gehörte längst »unter die Haube«. Sonst stimmte etwas nicht mit ihr!
Und im Grunde war es genau das, was Mutter und Tante von ihr dachten: mit Maria stimmte etwas nicht! Sie mit ihren Macken, die sie schließlich sogar bis in die Psychiatrie gebracht hatten!
Es war richtig, dass Ronald sie liebte und dass er sie lieber heute als morgen heiraten würde. Maria verstand eigentlich gar nicht, warum auch er so zu einer Heirat drängte. Und sie war auch gar nicht davon überzeugt, dass sie so gut zueinander passten. Sicher, sie verstanden sich gut, hatten gemeinsame Interessen und Ansichten.
Aber war das genug?
»Liebe ich ihn denn überhaupt?«, ragte sie sich zum ersten Mal. Sie hatte nie ernsthaft darüber nachgedacht.
»Ich weiß es nicht,« dachte sie überrascht. »Ich weiß es wirklich nicht. Und ich will auch noch nicht heiraten. Wenn überhaupt – und vielleicht auch gar nicht Ronald.«
Zum ersten Mal wurde ihr klar, dass sie gar nicht bereit war für eine feste Bindung.
Ihr wurde recht unbehaglich zumute, wenn sie daran dachte, wie Mutter und Tante diese neue Eröffnung auffassen würden. Sie spürte die Erwartungen und Hoffnungen der beiden Frauen auf ihren Schultern wie eine Last, der sie sich nicht zu entziehen wusste.
Es war nicht nur ein starkes Verantwortungsgefühl für beide, das sie empfand - verbunden mit einem schlechten Gewissen, wenn sie sich dem entziehen würde - es war, als wäre sie ihnen etwas schuldig.
Sicher war sie der Mutter und der Tante auch etwas schuldig. Aber was? Doch nicht, dass sie ihr ganzes Leben auf die beiden ältlichen, lebensuntüchtigen Frauen ausrichtete! Sie hatte doch auch ein Recht auf ihr eigenes Leben. Aber wie sollte das eigentlich aussehen?
Diese unvermittelte Frage warf Maria jählings aus der Bahn. Sie war aus dem Nichts ganz plötzlich aufgetaucht und versetzte sie in einen erstaunlichen Schrecken.
Sie ließ sich auf den Sessel am Fenster sinken, stützte die Ellbogen auf die Fensterbank und legte ihr Kinn auf die gefalteten Hände. Sie starrte in den mondbeschienenen Garten hinaus ohne etwas wahrzunehmen.
»Warum habe ich nie darüber nachgedacht? Immer nur so in den Tag hinein gelebt! Als hätte ich mein Leben »immer so vor mir hergeschoben!« Sie staunte über diese seltsame Formulierung, die ihr da eingefallen war. Hinter den Schläfen meldete sich das vertraute Hämmern. Es war doch ihr Leben! Sie musste doch wissen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen wollte.
»Ihr« Leben – das war immer ein »Später« gewesen. Später würde es beginnen – später! Aber wann? Und wie? Hatte sie bisher gar nichts hinterfragt, weder ihre Gefühle noch ihre Gedanken oder Pläne? Oder hatte sie es vergessen? Sie hatte ja schon so vieles vergessen! Immer wieder musste sie das feststellen.
Sicher hing es mit den Migräneanfällen zusammen, die sie in Abständen überfielen. Eine beklemmende Unruhe breitete sich in ihr aus. Plötzlich stieg aus ihrem Innern ein ebenso überraschender wie inbrünstiger Wunsch auf.
»Ich wünsche mir einfach nur Ruhe, Frieden und Sicherheit,« dachte sie und begriff nicht, woher dieses Bedürfnis auf einmal gekommen war..
»Frieden? Mein Gott, ich habe doch Frieden! Und Sicherheit auch!« Im gleichen Augenblick aber tauchten Zweifel auf, beängstigend und rätselhaft.
Schließlich – es gab vielleicht noch einen anderen Frieden, nach dem sie sich unbewusst sehnte! Einen »inneren Frieden«?
Und wie stand es mit der Sicherheit?
Ihr war, als würde eine kalte Hand sie berühren.
Gleichzeitig krochen Ärger auf sich selbst und ein merkwürdig ungewohntes Hadern mit dem Schicksal in ihr hoch. Es war unglaublich! Da war sie - eine junge Frau im schönsten Alter, müsste eigentlich Pläne machen, mit Freundinnen ausgehen, mit Männern flirten, Reisen machen, sollte in vollen Zügen ihr Leben genießen! Und sie konnte sich nicht einmal recht vorstellen, wie es wäre: »das Leben genießen!«
Sie hätte gar nicht gewusst, wie sie es anstellen sollte, dieses »Leben genießen«. Außerdem - sie hatte gar keine Lust dazu! Und wenn dieses alles für sie schon nicht infrage kam, so sollte sie doch wenigstens verheiratet sein und Kinder haben! Aber auch danach stand ihr absolut nicht der Sinn! Sie wollte nichts von alledem!
Sie hatte das Gefühl, als wollte ihr der Kopf platzen von all dem zähen Gewirr trübsinniger Gedanken, die da unvermutet aufgetaucht waren.
»Mein Leben ist in Ordnung so wie es ist! Ich muss heute nicht mehr darüber nachdenken und ich muss heute auch nichts entscheiden, weder ob ich Ronald heirate, noch was ich sonst will. Ich habe alle Zeit der Welt ,« sagte sie sich energisch und verbannte alles Bedrängende aus ihrem Sinn.
Ihr Blick glitt über den Garten im Mondlicht. Es war so schön und still draußen. Sie lauschte den Geräuschen der Nacht, die aus dem geöffneten Fenster hereindrangen. Ein leichter Windhauch trug den Geruch von Erde ins Zimmer. Und dann war da noch ein anderer Geruch, ein Duft nach irgendwelchen Blüten, die ihr vertraut vorkamen, die sie aber nicht erkannte.
Und von irgendwoher wehten ein paar Töne einer melancholischen Melodie zu ihr herauf, die sie an etwas lang vergessen Geglaubtes erinnerte. Maria schreckte auf.
Da waren sie wieder, diese eigenartigen Melodienfetzen. Vor wenigen Stunden erst waren sie aus dem Nichts in ihrem Kopf aufgetaucht – im Auto in der tosenden Dunkelheit.
Ihr Herz begann schwer zu schlagen und sekundenlang fühlte sie sich wie in zwei Wesen gespalten.
Für den Bruchteil eines Augenblicks war ihr, als hätte ein sehr heller Blitz ihren Augen etwas gezeigt, das im nächsten Moment wieder ins Grau geglitten war; wie eine Blitzlichtfotografie an einem dunklen Tag. Als hätte sie einen Blick auf eine nur sekundenlang beleuchtete Szene geworfen, die einer anderen Zeit angehörte und sogleich wieder verschwand. Eine Szene aus einem Traum, aus der Vergangenheit?
Maria fuhr sich über die Augen. Sie kam sich vor wie eine Schlafwandlerin.
Sie versuchte, die Bruchstücke der mysteriösen Melodie zu erfassen, sich zu erinnern, aber sie war fort! Wie weggeblasen aus ihrem Kopf. Was war das nur für ein Lied? Sie mühte sich, sie in ihr Gedächtnis zurück zu zwingen, aber es gelang ihr nicht.
»Morgen ist ein neuer Tag und ich bin wieder in Ordnung,« dachte sie und warf einen letzten Blick in den nächtlichen Garten. Der Regen hatte aufgehört. Morgen würde die Sonne aufgehen über einer gereinigten, neu ergrünten Landschaft.
Sie würde die Wasserpfützen in den ausgewaschenen Gartenwegen in allen Regenbogenfarben schillern lassen und den Tau auf Hecken und Gräsern in einen zarten, nebligen Dunst verwandeln.
Und vielleicht würde Maria über die nassen Wiesen zum Bach laufen, um an seinem Ufer im Schilf gelbe Irisblüten zu entdecken. Da stieg aus der Tiefe ihrer Seele ein ganz starker Wunsch empor: »Wie ein Kind sein möchte ich – fröhlich und ganz und gar unbeschwert!«
Winter 1969
November
Nicht nur seine Gefühle hatten sich gewandelt! Nein, die ganze Welt schien ihm verändert seit heute Nacht. Er stand am Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit, in der sie soeben verschwunden war. Fichten und Unterholz standen dicht und düster in den Schatten des weißen Mondlichts. Erst wenige Augenblicke war sie fort und er sehnte sie sich bereits zurück mit all seiner Kraft. Aber sie würde ja wiederkommen – hierher in diesen Unterschlupf, den er für sie beide gefunden hatte. Ihr Liebesnest – für wie lange?
♦♦♦
Maria erwachte, es war es Nacht. Sie spürte ihr Herz schwer und dumpf gegen die Rippen schlagen, ihre Stirn war feucht. Sie horchte in die Stille des Hauses hinein. Sie blickte zum Fenster und sah den Mond durch das Spitzengewebe der Äste scheinen, eine helle Scheibe auf dem Himmel, der schwarz war wie Tinte.
Was hatte sie nur geweckt? Am Rande ihres Bewusstseins huschten schemenhafte Bilder vorüber, die ihr sofort entglitten, sobald ihr Geist sie fassen wollte.
Plötzlich schien es ihr, als senke sich die Decke auf sie herab und als rückten die Wände immer näher. Sie spürte den gespenstischen Drang zu schreien und sprang so hastig aus dem Bett, dass sie gegen einen Stuhl taumelte, der polternd zu Boden fiel. Sie ließ ihn, wo er war, rannte ans Fenster und stieß es auf. Während sie lange und tief atmete, versuchte sie sich zu erinnern. War es wieder der alte Traum gewesen?
Seit langer Zeit gab es diesen Traum, der sie in unregelmäßigen Abständen heimsuchte. Er war banal genug und dennoch versetzte er sie immer wieder in größte Angst und Schrecken. Darin wurde sie von einem Unbekannten im Dunkeln verfolgt, während sie über regennasse, schwarze Asphaltstraßen rannte und im strömenden Regen kaum ihren Weg erkennen konnte. Sie lief so schnell sie konnte, die Luft drohte ihr auszugehen. Irgendwann wurde der Zwang, sich umzudrehen, übermächtig, sie wandte den Kopf – und erwachte.
Manchmal schien in dem Traum auch die Sonne und sie lief über die Wiesen zum Bach. Und dann ganz plötzlich verdunkelte sich der Himmel, Wolken schoben sich vor die Sonne, ein schiefergraues Licht zog über den Horizont. Und während die Wolken sich zusammen ballten und auftürmten, kam Sturm auf.
Sie rannte und wusste, dass jemand sie verfolgte, wagte aber nicht, sich umzudrehen. Dann tat sie es doch, strauchelte und fiel, und zwar gerade in dem Moment, als sie in den Augenwinkeln den Schatten des Verfolgers wahrnehmen, ihn jedoch nie erkennen konnte.
Maria fröstelte in der kühlen Nachtluft. Eine leichte Brise schob von Zeit zu Zeit die Regenwolken vor das Mondlicht, warf unregelmäßige, bizarre Schatten über Wand und Decke. Der dunkle Garten unter ihrem Fenster wirkte wie eine fremde Landschaft und sie glaubte ein Wispern und Raunen zu hören. »Es ist der Wind,« dachte sie. »Vielleicht habe ich geträumt, vielleicht auch nicht. Es ist ja ganz gleich.«
In der Ferne vernahm sie den Ruf einer Eule wie einen Widerhall unter der dunklen Kuppel des Nachthimmels. Die Laken und Kissen waren angenehm kühl, als sie sich niederlegte. Sie schlief traumlos bis zum Morgen.
Beim Erwachen spürte sie die Wärme der Sonnenstrahlen auf den geschlossenen Lidern. Der Morgen war voll von Vogelgezwitscher, das aus dem zarten Grün der Birke vor ihrem Fenster ertönte, der Himmel ganz ohne Wolken. Eine goldene Sonnenbahn zog sich quer durchs Zimmer. Es würde ein schöner Tag werden.
Maria stand am offenen Fenster und lauschte den Küchengeräuschen, die von unten herauf drangen. Die Mutter war sicher dabei, das Frühstück herzurichten, das sie zusammen in der geräumigen Wohnküche einnehmen würden. Sie würde duschen, Jeans und einen Pulli anziehen und hinunter gehen. Alles würde harmonisch und friedlich sein.
Später würde Ronald kommen und vielleicht könnten sie an den Bernburger See fahren.
»Es müsste schön sein, am Wasser zu wohnen,« dachte sie plötzlich. »Ein kleines Haus am See mit einem großen alten Garten dabei!«
Immer schon hatte sie das Wasser geliebt, sie war auch eine gute Schwimmerin.
Nur mit Teichen hatte sie nichts im Sinn! Teiche waren ihr unheimlich! Das Wasser ist nicht klar und man weiß nie, was auf seinem Grund verbogen ist! Außerdem lebten Blutegel in Teichen. Ekel erfasste Maria und sie schüttelte sich.
Irgendwann hatte es da mal eine Geschichte mit Blutegeln gegeben – früher, als sie Kind war. Sie waren mit mehreren Kindern zum Baden gewesen an irgend einem Teich. Sie konnte sich nicht erinnern, wann und wo das gewesen war. Sie wusste nicht einmal, ob sie auch ins Wasser gegangen war. Wahrscheinlich nicht, denn sie hatte da so eine widerliche, graubraune Brühe in Erinnerung, die ihr heute noch Ekel verursachte.
Aber die Jungens waren ins Wasser gegangen. Und dann mit den Blutegeln am Körper wieder herausgekommen! Ihnen hatte es nicht so viel ausgemacht, sie hatten gelacht und sich das scheußliche, schwarze Gewürm von der Haut gepflückt. Maria aber hatte sich, verborgen vor den Blicken der anderen, im hohen Schilf wiedergefunden, wo sie sich übergeben musste.
Das alles hatte sie ganz vergessen gehabt. Jetzt war es wieder da. Ganz deutlich ertönten die Kinderstimmen von damals in ihrem Kopf und sie spürte wieder die heiße Sonne auf dem nackten Rücken, während sie im Schilf kniete und würgte.
Und heute wie damals spürte sie unbeschreiblichen Ekel bis hin zu diffusen Angstgefühlen, wenn sie an Teiche dachte, deren Wasser undurchsichtig war wie eine ekelhafte braune Brühe. Es könnten Blutegel und andere Gräuel dort verborgen sein und auf seinem schlammigen Grund lauern!
In den letzten Tagen hatte Maria hin und wieder an die Zukunft gedacht. Sie tat es ungern und stets beschlich sie dabei ein Gefühl von Beklemmung, die sie sich nicht erklären konnte. War es die Angst, Entscheidungen zu treffen, oder Angst vor Veränderungen? Sie fühlte sich bedrängt, ja geradezu in die Enge getrieben, als müsse sie irgendwelche Erwartungen erfüllen, die sie nicht erfüllen konnte – oder wollte.
Und auf einmal wurde ihr klar: sie sah nicht Ronald an ihrer Seite, wenn sie an die Zukunft dachte. Sie sah sich nur ganz allein ohne andere Menschen, vielleicht in diesem Häuschen am See mit dem großen Garten, in dem sie frei schalten und walten konnte. Ein alter Garten müsste es sein, mit alten Obstbäumen, Hecken und Rosen.
Ronald hatte in diesen Zukunftsträumen gar keinen Platz, ebenso wenig wie Mutter und Tante.
Sie taten ihr alle beide leid und sie fühlte sich für sie verantwortlich. Sicher hatten sie nicht das vom Leben bekommen, das sie sich gewünscht und erhofft hatten. Und sie erwarteten selbstverständlich, Maria würde alles in ihrer Macht stehende tun, um ihnen das zu verschaffen, die armen alten Seelen, vom Leben so stiefmütterlich behandelt!
Nach altgewohnter Weise unterdrückte Maria ihre hässlichen Gedanken und schämte sich dafür.
Aber dann tauchten erstaunlich rebellische Gedanken in ihr auf und sie erkannte plötzlich, dass beide Frauen schließlich noch im besten Alter standen, und dass sie ja alle beide nicht allzu große Mühen auf sich genommen hatten, um zu erreichen, was sie haben wollten. Sie hatten sich keineswegs angestrengt, immer nur alles von anderen erwartet. Immer hatten sie sich auf andere verlassen. Es war so am bequemsten gewesen.
Und heute und gestern und jeden Tag auf sie, auf Maria!
Sie fühlte sich ganz überrumpelt von diesen ungewohnten Gedanken, die ihr nie zuvor in den Sinn gekommen waren. Verblüfft überdachte sie diese neuen Erkenntnisse.
»Es macht ja nichts,« dachte sie. Sie hatten es nie anders gekannt, sie waren dazu erzogen worden, andere für sich sorgen zu lassen.
»Ich bin denn wohl dazu erzogen worden, die Erwartungen anderer zu erfüllen,« dachte sie bitter. Ein warnendes Klopfen in den Schläfen stellte sich ein.
Sie ertappte sich dabei, dass sie auf der Bettkante saß und den Kopf auf ihre kalten Hände stützte.
Was war nur los? Warum nur gingen ihr auf einmal so verquere Gedanken durch den Kopf? Es war doch alles in Ordnung gewesen bisher.
Im Gesundheitsamt war alles gut gelaufen, wie immer, mit dem Chef war alles o.k., mit den Kolleginnen und Kollegen ebenso.
Sie hatte sogar ein nettes Erlebnis mit Dr. Scheffler gehabt. In der Mittagspause hatte er sie ganz unerwartet zum Essen in ein nahegelegenes Restaurant eingeladen. Er hatte begonnen, Maria versteckte Komplimente zu machen. Unter anderem hatte er ihre Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit und ihr Einfühlungsvermögen gelobt.
Maria hatte schließlich begriffen, dass er nicht zu ihr als Kollegin sprach, sondern von Mann zu Frau. Dann hatte er von sich erzählt, von seiner ersten Ehe und seinem Sohn. Auch sein Alter hatte er erwähnt. Er war 15 Jahre älter als Maria.
Weiter war er nicht gekommen. Er hatte es wohl auch nicht vorgehabt, noch nicht.
Sollte dies etwa der Beginn einer vorsichtigen, ernsthaften Werbung um sie sein? Maria sah ihn im Geist vor sich, sein dunkles Gesicht unter dem ungebärdigen schwarzen Haarschopf. Er war ganz anders als Ronald, nach dem sich die Frauen umsahen, der stets elegant und nach neuester Mode gekleidet daher kam.
Martin Scheffler würde neben ihm recht salopp, eher nachlässig wirken in Kleidung und Auftreten. Er wirkte meistens so, als sei ihm gar nicht recht bewusst oder auch gleichgültig, was er gerade anhatte.
Er war groß, breitschultrig und muskulös, wirkte eher massig, nicht so mager und drahtig wie Ronald, der streng auf Diät achtete und seine Fitnessprogramme nie vernachlässigte.
Das schwarze Haar war an den Schläfen bereits leicht ergraut. Ein schmaler, sensibler Mund, dessen Mundwinkel sich zuweilen in Ironie und Spott nach unten verzogen, braune Augen unter dunklen Brauen.
Er hatte etwas an sich, das Maria manchmal verlegen und unsicher werden ließ, besonders, wenn er auf private Dinge zu sprechen kam.
Trotz Ruhe und Gelassenheit, die er in der Regel ausstrahlte, schlummerte unter dieser Oberfläche ein unvermutetes Temperament, das gelegentlich hervorbrach, wenn ihm der Kragen platzte, fast einem Jähzorn gleich. Geduld gehörte nicht unbedingt zu seinen Tugenden.
Er würde sicher in allen Lebenslagen ein guter Kamerad und zuverlässiger Freund sein, dachte Maria. Sie seufzte. Hoffentlich würde sich das nicht zu kompliziert entwickeln, so dass ihr gutes kollegiales Verhältnis darunter leiden müsste.
Marias Gedanken kehrten zu ihrem Ausgangspunkt zurück.
Was gingen ihr für seltsame Dinge durch den Kopf!
Und zeitweise fühlte sie sich so durcheinander!
Sie dachte an die letzte Nacht. Sie hatte am Fenster gestanden und in den Himmel geblickt. In einen sehr hellen Himmel, der wie eine elfenbeinfarbene Vision über den Feldern geleuchtet hatte. Sie hatte sich gewundert über sein seltsames Licht und die Helligkeit am Horizont. Deutlich entsann sie sich der bleichen Mondbahnen, die sich über das schwarze Feld jenseits der Häuser und Gärten zogen.
»Kann es denn in der Nacht so hell sein?« überlegte sie. Warum nicht, es war Mondschein gewesen, oder war es ein Frühlingsmorgen bei Sonnenaufgang im Mai? Diesen Himmel hatte sie gesehen, das wusste sie genau. Oder war das vorher gewesen, an einem anderen Morgen oder in einer anderen Nacht? Oder in einem Traum?
Sekundenlang hatte sie das Gefühl, dass sich da Erinnerungen an verschiedene Nächte übereinander schoben.
Etwas in ihr erinnerte sich, warf einen sekundenlangen Blick auf eine verschwommene Szene, die ihr Herz schneller schlagen ließ und sie auf unerklärliche Weise mit Furcht erfüllte.
Bedrohliche Bilderfetzen, die genau so schnell aus ihrem Kopf verschwanden, wie sie aufgetaucht waren.
Sie fühlte sich ganz benommen und hatte Mühe, sich in den hellen Tag der Gegenwart zurückzufinden.
Eine Tür klappte demonstrativ im Erdgeschoss. Man wartete auf sie mit dem Frühstück, das an den Wochenenden gemeinsam eingenommen wurde, einem Ritual, das seit Jahren fortbestand in seiner mehr oder weniger aufgesetzt harmonisch-herzlichen, aber schließlich doch nett gedachten Atmosphäre.
Maria fuhr erschreckt zusammen, als das Telefon im Flur unten klingelte. Ronald! Sicher, das musste er sein. Alles in ihr sträubte sich. Sie wollte keine gemütlichen Spaziergänge zu zweit, auch keine gewollt fröhlichen Plauderstündchen zu viert und genau so wenig ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant oder am häuslichen Herd mit der Familie.
Sie schlüpfte in den Morgenrock, lief in den Flur hinunter und griff nach dem Telefon.
Es war Ronald, unbeschwert und fröhlich wie fast immer. Maria gab sich Mühe, ungezwungen und heiter zu erscheinen. Er würde am Nachmittag kommen. Gut! Dann hatte sie den Vormittag für sich. Mutter und Tante standen hinter der halb geöffneten Küchentür und gaben sich den Anschein, mit ihrer Arbeit zu tun zu haben, aber das Frühstücksgeschirr klirrte nur verhalten und ihre Stimmen waren verstummt.
Sie waren gut informiert über alles, was sich tat, zwischen Ronald und Maria am Telefon. Sie mussten sich über gar nichts Sorgen machen – Maria war scheinbar wieder in Ordnung!
Und da schob sie auch schon die Küchentür auf und rief ihnen ein fröhliches »Guten Morgen« zu.
Nach dem Frühstück lief sie in langen Hosen und leichter Jacke durch die Hintertür nach draußen.
Endlich! Wie schön war der Tag! Die frühe Sonne lag strahlend über den nassen Hecken und Knicks. Das Gras der Wiese hinter dem Haus war hoch und glänzte vom Tau, der so dicht an seinen Halmen hing wie Raureif.
Maria lief durch das nasse Gras zum Bach hinunter, der sich träge durch die grünen Wiesen wand.
Sie hielt ihr Gesicht den wärmenden Sonnenstrahlen entgegen, blauer Himmel und Sonne über sich, in der Ferne rief ein Kuckuck. Für eine Weile hatte sie alles andere vergessen.
Winter 1969
November
Voller Ungeduld wartete er auf sie!
Das Knistern des Feuers im Kamin übertönte das Rauschen des Regens draußen und verschluckte das Geräusch ihrer nahenden Schritte.
Würde sie kommen? Da öffnete sich leise die Tür, sie trat ein und all seine Sorgen und Bedenken schwanden dahin wie Rauch, der durch den Schornstein entweicht.
♦♦♦
Er stand am Fenster - eine Hand locker in der Hosentasche - und blickte ihr entgegen, als sie den Raum betrat. Sonnenschein durchflutete das Zimmer, sein Gesicht lag im Schatten.
Überrascht blieb Maria in der geöffneten Tür stehen.
»Ach, du bist schon da!«
Ronald war das, was man einen sehr gut aussehenden Mann nennen konnte. Er war groß und sehr schlank, hatte blondes, glattes Haar und blaugraue Augen. Ein schmales bartloses Gesicht, helle Haut, die sich auch in der Sonne kaum bräunte, und ein schmallippiger, verschlossener Mund, der auf Wachsamkeit und unerschütterlich Selbstbeherrschung schließen ließ.
Er wirkte selbstsicher, zuverlässig und tüchtig, als würde er auch als Geschäftsmann stets einen kühlen Kopf bewahren und durchaus jeder Lage gewachsen sein. Er war gekleidet, als ginge es zu einem Essen in ein gepflegtes Restaurant. Hemd und Krawatte waren in auf einander abgestimmten Grautönen gehalten. Über der Stuhllehne hing ein taubenblauer Blazer. Ein Mann, der wusste, was er wollte. Und er wollte Maria.
Als er sie erblickte, machte er ein paar rasche Schritte auf sie zu, seine Hände schlossen sich um ihre. Er war einen Kopf größer als Maria und sah nun forschend in ihr Gesicht hinunter.
»Hallo, mein Schatz! Wie schön, dich zu sehen! Deine Mutter sagte mir, du wärst spazieren gegangen. Geht es dir wieder besser?«
Er zog sie an sich und küsste sie. Maria ließ es geschehen, ohne ihm entgegen zu kommen. Dann lächelte ein wenig gezwungen zu ihm empor und trat einen Schritt zurück, so dass seine Arme herabfielen.
»Haben sie dir vorgejammert, wie schlecht es mir wieder einmal ging?« Sie musterte seine gepflegte Erscheinung.
Ronald überhörte den Ärger, der in ihrer Stimme klang, und ignorierte ihre kühle Haltung. Er kannte Maria und »ihre Launen«.
Er machte es sich in dem alten Lehnstuhl bequem und zog ein Zigarettenetui hervor. Gelassen steckte er sich eine Zigarette an und blies den Rauch vor sich hin.
»Nicht sehr. Nur dass du gestern einen anstrengenden Tag und eine scheußliche Heimfahrt hattest, die dir etwas zu schaffen machte.« Seine Stimme klang ruhig und sachlich.
»Im übrigen schienen sie sich zu freuen, mich zu sehen.« Maria legte beschämt eine Hand auf seinen Arm.
»Entschuldige, Ronald. Ich freu’ mich ja auch, dass du da bist. Und sie hatten Recht, es ging mir nicht so besonders. Aber nun ist alles o.k.«
Sie setzte sich neben ihn auf die Kante eines Stuhls.
Besorgt musterte er ihr ernstes Gesicht, das unter dem schwarzen Haar sehr blass aussah. Behutsam legte er eine Hand auf ihre im Schoß verkrampften Hände.
»Wollen wir irgend wohin fahren, wo es schön ist und wir miteinander allein sein können? Meinst du nicht, dass es uns beiden gut tun würde, ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen? Wir könnten irgendwo übernachten, morgen früh zurückkommen und danach zum Segeln gehen.« Ronald besaß eine kleine Segeljacht, die in einem eigenen Bootsschuppen am Bernburger See lag.
Sie zögerte nur kurz. Möglicherweise erwartete die Mutter, dass sie alle zusammen zum Essen gehen würden. Aber – zum Kuckuck! Außerdem – ein Gespräch und ein Zusammensein zu zweit wären vielleicht das, was sie beide brauchten. Auf jeden Fall besser als ein gemeinsamer Tag mit Mutter und Tante!
Kurz entschlossen stand sie auf. »Ja, lass uns das tun. Es ist so schön draußen. Bitte warte einen Moment. Ich zieh‘ mich schnell um und packe ein paar Sachen zusammen.«
Im Flur stieß sie fast die Tante um, die ein wenig erschrocken zurückfuhr.
»Wir machen einen Ausflug und kommen wahrscheinlich erst morgen Abend zurück.« sagte sie kurz.
Die Tante folgte ihr bis zum Fuß der Treppe.
»Aber – wo wollt ihr hin? Ihr habt ja gar nichts geplant.«
Maria unterdrückte den Ärger, der in ihr hochschoss.
»Nein, wir brauchen auch nichts zu planen. Wir fahren einfach ins Grüne oder ins Blaue – wenn du so willst. Und morgen gehen wir segeln.«