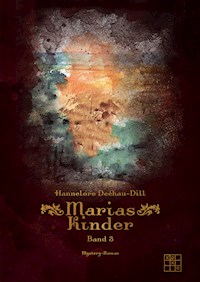Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Leute vom Kastanienweg
- Sprache: Deutsch
Celina fühlt sich schuldig am Tod ihrer kleinen Nichte Alexa. Sie ist ängstlich, gehemmt, von Albträumen und Schuldgefühlen heimgesucht, vergräbt sich in ihrem Haus am Kastanienweg. Gerade als sie sich nach langer Zeit wieder unter Menschen traut, erscheint ihre Zwillingsschwester Myriam, die den Tod ihres Kindes nicht verkraften kann. Eine grauenvolle Zeit beginnt für Celina. Sie fühlt sich verfolgt und bedroht. Eines Tages ist sie verschwunden. Ein Roman aus dem Kastanienweg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Absturz
Die Leute vom Kastanienweg
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-062-0
E-Book-ISBN: 978-3-96752-562-5
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock
Nummer 1248674752
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Es kommt alles wieder,
was nicht bis zu Ende gelitten und gelöst wird
(H. Hesse)
Kapitel 1
Der Traum begann wie all die unzähligen Male zuvor.
Es war Sommer. Celina fuhr friedlich durch die schattige Allee dahin. Sie war auf dem Weg zum See. Es war ein herrlicher warmer Tag, und die Sonne schien. Am See würde sie Alexa treffen! Alexa war klein und süß; ihre Haare waren so hell wie der Sand am Ufer des Sees und ihre Augen so blau wie der Himmel an diesem Nachmittag.
Nun also war Celina auf dem Weg zum See und zu Alexa!
Sie musste sich nicht eilen, denn sie hatte noch viel Zeit.
Während sie so dahin fuhr, packte sie unversehens eine seltsame Unruhe. War es vielleicht schon später als sie dachte?
Oh mein Gott, wo hatte sie ihre Uhr? Müsste sie nicht längst dort sein? Alexa! Sie war ganz allein da am Wasser, und sie war noch nicht einmal drei Jahre alt!
Panische Angst packte Celina, es war, als bliebe ihr das Herz stehen vor plötzlichem Schrecken. Wie wild trat sie aufs Gaspedal und jagte den letzten Kilometer in halsbrecherischer Geschwindigkeit voran. Endlich, da vorn war der See! Nur schnell! Irgend eine Gefahr war im Verzuge – sie spürte es ganz deutlich.
Celina riss die Autotür auf, sprang aus dem Wagen und hastete zum Strand hinunter.
Badende Menschen da unten, kleine Kinder in Strandanzügen, mit Eimerchen und Schaufel, Mütter mit großen, in die Stirn geschobenen Sonnenbrillen, auf Badetüchern hockend, ihre im Sand spielenden Kinder im Auge.
Wo war Alexa? Celinas Blick irrte verzweifelt suchend über die friedlich im Sonnenschein lagernde Menge.
Endlich, da vorn ein kleines, blondes Mädchen in Rot!
Aber um Gottes willen - was machte das Kind da? Es spielte mit seinem Ball im Wasser, und zwar dort, wo es gefährlich wurde, wo der Untergrund des Sees steil abfiel! Wo das Wasser grün und kalt und tief wurde, von schwärzlichem Kraut und Schlingpflanzen durchsetzt.
Celina schrie gellend auf, hastete in wilder Angst durch weichen, sonnenwarmen Sand.
Sie sah, wie der Ball der Kleinen von einer Welle fortgetrieben wurde, wie das Kind noch einen Schritt weiterging - dann war es verschwunden!
Celina schrie und schrie und rannte, stolperte durch den Sand auf das Kind zu. Es war verschwunden und tauchte nicht wieder auf.
Und Celina weinte und schrie, stürzte, fiel in den Sand! Rappelte sich auf und schrie und rannte weiter. Mein Gott, wie breit war dieser Strand. Er schien kein Ende zu nehmen! Und dieser Sand! Er wich unter ihren Schritten zur Seite, brachte sie ins Rutschen, ins Stürzen, schien ihr nahezu knietief zu sein. Kam sie überhaupt voran?
Und dann endlich war sie angelangt!
Endlich hatte sie die Stelle erreicht, wo das Kind im Wasser verschwunden war. In Panik und Verzweiflung begann sie wie wild im Wasser nach ihm zu suchen, schreiend und weinend wie eine Wahnsinnige!
Niemand half, kein Mensch sah ihr verzweifeltes Bemühen. Sie schauten alle an ihr vorbei, als ob sie unsichtbar wäre!
Und da war keine Alexa! Herrgott im Himmel, lass mich sie finden! Und bitte, lieber Gott, lass sie am Leben sein!
Und dann – wie ihr schien nach endlos langer Zeit - fand sie das Kind, leblos und tot! Es war zu spät.
Sie war zu spät gekommen!
Celina kauerte im warmen Sand unter einer gnadenlosen, sengenden Sonne und wimmerte.
Entsetzen, Verzweiflung und Schmerz packten und schüttelten sie, als sollte für sie die Welt untergehen!
Und da war noch etwas Anderes, das auf eine unheimliche Weise von innen her an ihr zerrte, grausam und unerbittlich.
Kummer mochte vergehen und Wunden heilen, und irgendwann verblasste sicher jeder Schmerz. Aber das Andere, das würde nicht vergehen! Es würde an ihr nagen, sie quälen und verfolgen!
Das war die Schuld!
Kapitel 2
Celina erwachte, und mit ihr erwachte der Schmerz. Er schien schwer auf ihrer Brust zu hocken wie ein Tier, das seine Krallen in sie geschlagen hatte und nicht locker ließ.
Krallen in meiner Haut - oh nein, dachte sie bitter; viel tiefer, bis in meine Seele hinein!
Ihr Gesicht war nass von Tränen so wie das Kopfkissen. Auch im Wachsein konnte sie ihr Schluchzen nicht unterdrücken und die Tränen nicht aufhalten.
Dieser Traum, wann würde er aufhören sie zu quälen! War es nicht genug, dass sie ihren Kummer durch den Tag zu schleppen hatte? Musste er sie auch noch durch die Nacht begleiten?
Celina setzte sich fröstelnd auf und schob die Füße über den Bettrand. Es war kalt im Zimmer. Gestern Abend hatte sie die Heizung ausgedreht, erinnerte sie sich. Ihr war so heiß gewesen. Aber nun war ihr kalt. Sie erhob sich schwerfällig und schleppte sich ins Badezimmer. Im Bademantel trat sie ans Fenster und zog die Vorhänge zurück. Ein bleicher Novembermond schien ihr ins Gesicht.
Sie blickte auf den Kastanienweg hinunter. Das Fenster ihres Schlafzimmers führte zum Garten von Pastor Winterstein hinaus. Dort drüben war alles dunkel und still. Natürlich, ein jeder schlief um diese Zeit! Wie spät mochte es sein?
Celina hielt ihre Armbanduhr ins fahle Mondlicht. Noch nicht einmal vier Uhr. Ihr Blick wanderte erneut nach draußen. Wie still und friedlich draußen alles war. Von hier aus konnte sie den Garten und einen Teil des Schefflerhauses sehen. Dort brannte in einem der Fenster Licht. Sicher machte Dr. Scheffler sich für einen Krankenbesuch fertig. Und das um diese Zeit! Was für ein strapaziöser Beruf! Ob das jeder praktizierende Arzt so machte?
Celina glaubte es eigentlich nicht. Aber dieser Dr. Scheffler war ein guter Arzt, wie man immer wieder hörte.
Vielleicht sollte ich einmal zu ihm gehen, dachte sie.
Aber was soll ich da? Mir etwas gegen Albträume verschreiben lassen? Oder gegen Depressionen?
Was würde er mir sonst noch sagen können?
»Die Zeit heilt alle Wunden. Warten Sie ab, es wird alles gut.«
Und vielleicht hatte er ja Recht. Schließlich war es noch gar nicht so lange her. In diesem Sommer war es gewesen, im Juli!
Alexa! Ein unschuldiges, süßes kleines Mädchen, noch nicht einmal drei Jahre alt und tot. Kalt und tot und begraben, noch bevor ihr Leben so recht begonnen hatte! Und sie trug die Schuld daran! Sie war zu spät gekommen, und darum war das Kind ertrunken.
Celina konnte die Tränen nicht zurückhalten, die ihr erneut über das Gesicht strömten.
Es tut mir so leid! Oh mein Gott, es tut mir so leid! Verzeih mir, liebes Kind, dass ich dir dein Leben genommen habe!
Celina lag wieder in ihrem Bett, aber sie hatte Angst vor dem Schlaf. Obwohl der Traum sie selten ein zweites Mal in der Nacht heimsuchte.
Eigentlich ist es auch schon besser geworden, redete sie sich ein. Ich träume gar nicht mehr jede Nacht. Es gibt auch die anderen Nächte. Nächte, in denen der Schlaf gar nicht kommen wollte. Dafür kam etwas anderes! Es kamen die Gedanken, das Grübeln, die Vorwürfe. Immer im Kreis herum, immer wieder von vorn.
Wenn ich früher da gewesen wäre, dort am See …
Wenn es geregnet und wir uns gar nicht verabredet hätten -
Wenn, wenn, wenn!
Was sollte all das Grübeln nützen! Alexa war tot, und sie trug die Schuld daran.
Kein Wunder, dass Alexas Eltern sie, Celina, aus ihrem Leben verbannt hatten und nie mehr sehen wollten.
Dabei hatten sie sich immer so nahe gestanden, die Zwillinge Celina und Myriam. Besonders früher, als sie Kinder waren. Unzertrennlich waren sie gewesen! Alles hatten sie gemeinsam getan, obwohl sie ganz verschieden waren. Bis ins Teenager-Alter hinein. Dann waren die Männer gekommen.
Mein Gott: Männer, dachte Celina bitter. So viele waren es schließlich nicht, jedenfalls bei mir nicht. Bei Myriam war es schon anders. Genau genommen gab es nur einen für mich, an dem mir etwas lag. Und ihr auch! Peter Syberg! Sie hat ihn schließlich bekommen – und auch das Kind! Sie hatte alles, ich hatte nichts. Ich hatte die kränkelnde, unzufriedene, ewig nörgelnde Mutter! Und meine Liebe zu ihm, unvermindert und ungebrochen, bis heute!
Sie seufzte. All das zählte nicht mehr.
Die Mutter war Anfang des Jahres gestorben. Sie war allein in diesem kalten großen Haus zurückgeblieben, das Louise Vanderborg im Herbst 2009 unvermutet nach dem Tode ihres Bruders geerbt und das sie im November gleichen Jahres bezogen hatten. Dann im Juli der Tod Alexas. Und danach war sie ganz allein. Niemand wollte mehr etwas von ihr!
Jetzt zählte nur noch die schreckliche, grauenvolle Gegenwart, der Schmerz und die Schuld! Und die Einsamkeit! Wie sinnlos war das doch alles!
Plötzlich kam Celina ein seltsamer neuer Gedanke. Wenn ich Myriam wäre und meine Schwester trüge die Schuld am Tode meines einzigen Kindes, ich würde es nicht einfach so hinnehmen!
Ich würde meine Schwester nicht nur im Stillen hassen!
Kapitel 3
Der Morgen begann kalt und grau und sonnenlos.
Celina erwachte, also musste sie doch wieder eingeschlafen sein.
Der Traum war nicht wiedergekommen. Nun lag sie fröstelnd im Bett und starrte an die Decke. Sie hatte Zeit, nichts und niemand wartete auf sie.
Morgen muss ich wieder arbeiten, dachte sie. Ihr Urlaub war schnell vergangen, trotz des öden, trostlosen Ablaufs all ihrer Tage.
Aber öde und trostlos war für sie inzwischen auch ihre Arbeit beim Finanzamt. Monoton und stumpfsinnig. Komisch, früher hatte es ihr doch gefallen!
Ich hasse die Arbeit dort, dachte sie auf einmal voll Inbrunst. Ich möchte etwas Anderes machen! Aber was? Früher einmal hätte sie gern eine Arbeit mit Kindern gehabt. Sie hatte Kinder schon immer gemocht. Wie oft hatten Myriam und sie sich ausgemalt, was sie einmal werden wollten.
Celina hatte davon geträumt, Lehrerin oder Heilpädagogin zu sein, Myriam wäre für ihr Leben gern »Künstlerin« gewesen, Malerin! Malerin allerdings wären sie beide gern geworden, Talent zum Zeichnen und Malen hatten beide gehabt, eine der wenigen Eigenschaften, die sei gemein hatten. Mal abgesehen von ihrer Verliebtheit in Peter Syberg!
Die Mutter hatte sie beide ausgelacht. Der Vater war zu der Zeit schon lange tot. Louise Vanderborg war es vor allem daran gelegen, dass ihre beiden Töchter möglichst rasch ans Geldverdienen kamen, dann am besten »eine gute Partie« machten und nur arbeiten »mussten«, wenn der Ehemann einmal ausfiele – was Gott verhüten möge.
So absolvierten beide Schwestern nach dem Abitur eine Lehre bei Behörden, wonach Celina beim Finanzamt anfing und Myriam bei der Stadtverwaltung in Werningen.
Mit 23 Jahren hatten die Zwillingsschwestern ihn dann kennen gelernt, den Mann, in den sich beide verliebten: Peter Syberg, 3 Jahre älter als sie. Und damit hatte alles begonnen: Myriams Ehe und Celinas Einsamkeit!
Drei Wochen Urlaub hatte Celina gehabt. Sie musste ihn nehmen, da sie zum Arbeiten nicht in der Lage gewesen war.
Ich hätte mich auch krankschreiben lassen können, dachte sie.
Der nette Dr. Scheffler hätte es sicher getan, wenn ich ihm von meinen Beschwerden erzählt hätte. Seit einiger Zeit litt Celina unter Konzentrationsschwäche, unter Übelkeit und Appetitlosigkeit. Fast ständig fühlte sie sich müde, zerschlagen und elend.
In der ersten Zeit nach Alexas Tod war sie wie betäubt gewesen, ganz ruhig und kalt. Seltsamerweise hatte sie bald darauf wieder arbeiten können, ganz automatisch hatte sie funktioniert. Alles war nahezu wie von allein gegangen.
Wie unter Schock, wenn der Körper alles tut, was getan werden muss, ohne dabei zu fühlen und zu denken. Von einer Stunde zur anderen hatte sie gelebt und gearbeitet und all die Dinge getan, die sie auch vorher getan hatte.
Eine ganze Weile ging das so. Aber irgendwann wollte es nicht mehr klappen. Plötzlich kam das Denken, die Albträume und – was am schlimmsten war: das Fühlen! Der Schmerz, der Kummer und die Verzweiflung. Und dann noch das Andere: das Schuldgefühl. Es nagte und fraß an ihr, und es gab keine Linderung!
Mühsam setzte Celina sich auf.
Ich muss aufstehen, dachte sie. Ich muss etwas tun. Irgendetwas. Aber was? Zum Frisör gehen, das Haus putzen, Wäsche waschen! All die Dinge, die Hunderte von Frauen täglich verrichteten, hatte sie doch auch zu tun! War sie nicht auch eine von ihnen? Von all den Frauen, die morgens aufstanden und ihren Tag in Angriff nahmen?
Auf dem Weg zum Badezimmer fand sie sich unversehens vor dem hohen Ankleidespiegel wieder und blieb abrupt davor stehen.
War sie das, diese bleiche Fremde, die sie mit riesigen, umschatteten grauen Augen anstarrte? Sie trat einen Schritt näher heran und musterte sich mit kritischem Blick.
Elend und krank sah sie aus, mit hohlen Wangen und blassen, aufgesprungenen Lippen, als hätte sie Fieber gehabt. Das dunkelblonde halblange Haar hing ihr spröde und strähnig auf die mageren Schultern herab.
Wie eine Vogelscheuche, dachte sie müde. Eigentlich war es ihr ganz gleich, wie sie aussah, aber morgen musste sie immerhin zur Arbeit. Da sollte sie doch wenigstens einigermaßen gepflegt ausschauen.
Plötzlich flößte ihr der Gedanke an die morgige Arbeit Angst ein.
Ich kann unmöglich arbeiten, dachte sie voller Schrecken. Allein die Vorstellung, früh aufzustehen, sich anzukleiden, das Haar zu richten machte sie müde.
Und dann die Menschen, die Arbeit selbst - nein! Sie war absolut nicht fähig dazu!
Celina taumelte. Auf einmal war ihr sehr schwindlig geworden. Konnte es nicht sein, dass sie tatsächlich krank war?
Sicher, das musste es sein. Irgend so eine Grippe, ein Virus, hatte sie befallen, und nun war sie krank. Durfte krank sein!
Sie wankte zurück in ihr Bett und zog die Decke über sich.
Es war sehr kalt im Zimmer, in der Nacht hatte es Frost gegeben, und die Heizung war immer noch ausgeschaltet. Aber Celina spürte es nicht mehr. Ihr war heiß und fiebrig zumute. Sie wollte nur schlafen, endlich schlafen. Tief und traumlos. Und alles vergessen! All das Schreckliche, das da draußen im Leben und in der Gegenwart auf sie lauerte – sie wollte es vergessen.
Und Celina schlief.
Als sie wieder erwachte, dämmerte es bereits.
Mühsam hob sie den Kopf aus den Kissen, er schien ihr ungewohnt schwer und groß, und es hämmerte und dröhnte darin.
Ich habe Fieber, dachte sie benommen und ließ sich wieder zurückfallen. Mit trüben Augen blickte sie zum grauen Rechteck des Fensters hinüber, durch das der letzte schwache Schein Tageslicht drang.
Sie zog die Bettdecke bis zum Kinn herauf und blinzelte in den Raum. Sessel und Tisch schienen seltsam unwirklich in der halbdunklen Höhle ihres Zimmers, riesig und schwarz ragte der Schrank an der Wand empor, und die kleine Kommode in der Ecke hockte da wie ein Tiger auf dem Sprung.
Sie schloss die Augen und horchte in die Stille des Hauses hinein. Es war doch gar nicht so ganz still. Knackte da nicht eine Stufe im Treppenhaus? Und ein Rascheln war dort in jenem Winkel wie von welkem Laub, in das der Wind hineinfegt.
Welkes Laub, raschelnd und knisternd unter ihren Füßen bei jedem Schritt. Ein Raunen des Herbstwindes in den alten Tannen am Waldweg und ein paar goldene Sonnenstrahlen, die zaghaft durch das kahle Geäst der Buchen blitzen. Und der Mann an ihrer Seite! Sein Arm auf ihrer Schulter, so beschützend und liebevoll. So war die Liebe zu ihr gekommen, und für kurze Zeit auch das Glück.
Und dann kam Myriam, und es war vorbei.
Aber für einen Sommer lang war alles noch einmal wiedergekommen – sehr viel später. Dann war auch das vorbei! Aber ihre Liebe war geblieben – und dauerte.
Kapitel 4
Jenny Scheffler schlug mehrmals kräftig mit dem Löwenkopf aus Messing gegen die schwere Eichentür. Dann ließ sie den Arm sinken und wartete. Nichts. Sie trat einen Schritt zurück und ließ den Blick zum Haus hinaufwandern.
Hatte sich dort oben am Fenster nicht soeben der Vorhang bewegt? Sie klopfte erneut. Da entdeckte sie einen ziemlich verrosteten Klingelknopf zwischen den staubigen, zotteligen Efeuranken neben der Tür. Sie legte zweifelnd einen Finger darauf und drückte ihn mit aller Kraft nieder. Er sah doch reichlich rostig aus, als sei er durch Witterungseinflüsse und andere äußere Umstände seit langer Zeit seiner Bestimmung und Brauchbarkeit enthoben, aber siehe da – es schrillte laut und anhaltend im Innern des Hauses.
Na also! Das musste doch einen Toten aufwecken.
Jenny spähte erneut zum Fenster hinauf, dessen Vorhang sich vorhin leicht bewegt hatte. Ganz deutlich erkannte sie nun ein Gesicht. Bleich und gramvoll starrte es zu ihr herunter. Jenny erschrak. Wer war denn das? Doch nicht etwa Celina Vanderborg! Sie sah ja so merkwürdig aus. Als ob sie gerade aus dem Bett gestiegen wäre, dazu so blass und mager.
Sie ist krank, dachte Jenny plötzlich. Sicher, das musste es sein.
Sie winkte hinauf und rief: »Ich will Ihnen nur was geben. Eine Einladung!«
Das Gesicht da oben verzog keine Miene, nur der Kopf mit dem Zottelhaar wackelte ein wenig hin und her, wie verneinend, als wollte der dazugehörige Mensch nicht öffnen oder sei nicht in der Lage dazu.
»Können Sie nicht herunterkommen? Sind Sie krank?« schrie Jenny hinauf. »Mein Vater ist Dr. Scheffler, Sie wissen doch! Soll er zu Ihnen kommen?«
Reglos starrte das Gesicht zu Jenny hinab. Dann fiel der Vorhang herab. Jenny stand einen Augenblick unschlüssig, dann steckte sie ihre Einladung zum »gemütlichen Abend am Kamin bei Schefflers« in einen roten, zerbeulten Briefkasten, der inmitten der Efeuranken an der Wand hing. Gerade wollte sie den Heimweg antreten, da öffnete sich die Haustür sehr langsam, und das bleiche Gesicht von Celina Vanderborg erschien im Türspalt.
Jenny wandte sich erfreut um und erschrak.
»Guten Tag, Frau Vanderborg,« sagte sie artig und musterte besorgt die jammervolle Erscheinung in der halboffenen Tür.
»Ich habe Ihnen gerade eine Einladung in den Kasten gesteckt. Wie ich sehe, sind Sie krank, Grippe sicherlich, nicht wahr? Mein Papa sagt, kaum ist der eine Infekt abgeklungen, steht der nächste vor der Tür. Er hat sehr viel zu tun, wie Sie sich denken können. Sogar in der Nacht ist er unterwegs. Ich werde ihm sagen, dass er einen Besuch bei Ihnen machen soll. Ist das recht?«
Jenny schwieg ein wenig betreten. Hatte sie wieder so drauflosgeplappert, dass dem Gegenüber die Spucke wegblieb? Das waren mitunter Beates Worte, wenn sie Jennys Redeschwall kommentierte. Oder sie pflegte zu sagen: du schwatzest alles und jedes ohne Punkt und Komma in Grund und Boden!
Da mochte etwas Wahres daran sein, aber Jenny konnte durchaus auch sehr aufmerksam und ruhig zuhören, wenn es darauf ankam. Nun stand sie still da und wartete. Endlich kam auch etwas von der kranken Frau Vanderborg dort in ihrem Türspalt.
»Ja,« sagte sie mit leiser, heiserer Stimme. »Ja bitte, sag ihm das. Ich kann nicht zur Arbeit gehen und er müsste mich krankschreiben. Wenn er so gut sein will – und wenn er irgendwann Zeit hat – ja bitte.«
»Oh, die Zeit nimmt er sich schon, wenn ich ihm sage, wie schlecht es Ihnen geht,« versetzte Jenny voll Überzeugung. Inzwischen war ihr eine Ahnung gekommen, wie krank und allein die arme Frau Vanderborg in dem großen Haus sein musste.
»Sind Sie denn ganz allein? Haben Sie niemanden, der Ihnen etwas kocht, Tee oder Suppe? Oder Ihnen das Bett frisch bezieht?« wollte sie wissen.
Abwehrend schüttelte die Frau den Kopf.
»Ich brauche niemanden. Ich komme allein ganz gut zurecht. Aber bitte, sag deinem Vater, dass er kurz kommen möchte – nur wegen der Krankschreibung. Ich kann, fürchte ich, nicht in seine Sprechstunde -«
»Nein, nein,« unterbrach Jenny ihr krankes Gegenüber. »Sie sollen doch auch gar nicht in seine Sprechstunde kommen. Er kommt zu Ihnen. Ich sag’s ihm gleich. Seien Sie nur ganz ruhig. Er wird lange klingeln, damit Sie es auch hören, falls Sie gerade schlafen sollten -«
Jenny verstummte abrupt.
»Gehen Sie nur schnell wieder ins Bett. Es ist so kalt hier draußen in der Tür,« schloss sie fürsorglich und trat nun endgültig den Rückzug an, damit die kranke Frau Vanderborg endlich wieder in ihr Bett käme.
»Auf Wiedersehen, Frau Vanderborg. Ich wünsche Ihnen gute Besserung.«
Sie wollte noch hinzufügen: »Ich komme Sie dann mal besuchen,« aber sie verkniff es sich. Irgendwie hatte sie das Gefühl, dass ihr Besuch möglicherweise nicht so ganz erwünscht sein könnte.
Kapitel 5
»Du hättest sie nur sehen müssen, Papa,« berichtete Jenny zu Hause. »Ganz bleich und elend sah sie aus.«
Sie sann einen Augenblick stumm vor sich hin. Dann sah sie ihrem Vater betrübt ins Gesicht.
»Und so traurig und einsam, das kannst du dir gar nicht vorstellen.«
Martin Scheffler blickte seine kleine Tochter erstaunt an. Zwar kannte er Jenny und ihr mitfühlendes Herz, aber jetzt schien sie ihm so bedrückt und kummervoll wie selten.
Er zog sie zu sich heran. »Nanu, meine Kleine,« meinte er tröstend. »Was ist denn? Sie scheint dir ja besonders leid zu tun.«
»Ich glaube, sie ist sehr einsam und - und so - traurig.«
Jenny suchte sichtlich nach Worten für etwas, das sie nicht so recht benennen konnte. Dann fügte sie hinzu: »Wir wissen gar nichts von ihr, nicht wahr, Papa? Sie lebt da so ganz allein in diesem großen Haus und hat vielleicht keinen Menschen. Und nun ist sie krank, und keiner ist bei ihr. Stell dir das nur mal vor! Krank sein und dann noch allein!«
Fast wollten ihr die Tränen kommen bei der Vorstellung eines solch trübseligen Daseins. Martin strich ihr über den zerzausten Haarschopf.
»Nicht jeder hat das Glück, in einer Familie zu leben, meine Kleine. Es gibt viele Menschen, die allein sind, und viele, die sich einsam fühlen.«
»Ich würde sie gern besuchen, wenn sie es wollte,« überlegte Jenny. »Aber weißt du, was ich glaube, Papa? Ich glaube, sie will gar keinen Besuch. Fast ist es so, als ob sie Angst vor anderen Menschen hat.«
»Im Augenblick ist sie scheinbar ja recht krank. Heute werde ich erst einmal einen Krankenbesuch machen. Dann sehen wir weiter,« sagte Martin abschließend. »Und nun komm, Beate hat das Essen fertig.«
Celina lehnte sich erschöpft an den Türrahmen. Ihre Knie zitterten. Flüchtig blickte sie dem Kind durch das Flurfenster nach.
Was für eine muntere Kleine! Und so ein liebes Gesichtchen. So ähnlich hätte Alexa aussehen können in dem Alter, nur hatte sie blaue Augen, und dieses Kind grüne. Seltsame grüne Augen. Noch nie hatte sie solche gesehen – außer bei der Mutter, Maria Scheffler, die sie vom Ansehen kannte!
Ihr Kopf dröhnte und hämmerte.
Irgendwo muss ich doch Tabletten haben, überlegte sie, Schmerztabletten, sicher im Badezimmer. Aber dann muss ich erst nach oben gehen. Oh Gott, all die Stufen wieder hoch! Aber ich muss ja wieder ins Bett. Oder lege ich mich gleich hier unten auf die Couch?
Der Arzt würde ja nachher kommen, dann musste sie ohnehin wieder runter! Und oben im Schlafzimmer sah es so wüst aus … sollte sie nicht lieber …
Was hatte das Kind von einer Einladung gesagt?
Egal! Sie ging ohnehin nie zu diesen Einladungen, die ab und zu ins Haus flatterten. Einladungen zu Grillfesten in den Sommermonaten, Einladungen zu Raclette- oder Fondue-Essen in den Herbst- und Wintermonaten und Einladungen zu Advents- und Kaminabenden – wie dieser nun wohl!
Immer reihum ging es hier im Kastanienweg. Nur sie und ihre Mutter hatten nie an solchen Festen teilgenommen. Louise Vanderborg hatte keine Lust gehabt und sie, Celina, schließlich auch nicht mehr.
Celina wäre anfangs ganz gern zu diesem oder jenem Nachbarn hingegangen, hätte den einen oder anderen gerne kennengelernt. Die meisten schienen doch so nett zu sein. Und sicher hätte man unter ihnen Freunde gefunden!
Aber sobald das Thema auf den Tisch beziehungsweise die Einladung aus dem Briefkasten kam, ging das Gezeter Louises los: All diese Menschen – sie waren doch nur neugierig, wollten einen aushorchen und dann klatschen, einer über den anderen.
Und dann, wenn man einmal damit angefangen hatte, musste man sich revanchieren, musste irgendwann auch Gastgeberin sein, ebenfalls einladen.
Na, und das war erst etwas! Einkaufen, Geld ausgeben, Kochen und Bewirten! Und dann kamen sie ins Haus, in Scharen. Spähten in jeden Winkel, um hinterher darüber zu tuscheln, sich vielleicht sogar lustig zu machen! Und das war noch das Mindeste! Was denn das Schlimmste war, sagte sie nie. Celina wusste nicht, was ihr dabei durch den Kopf ging.
Vielleicht wusste Louise es selbst nicht! Wer weiß? Aber sie hatte ja immer so verquere Fantasien! Auf jeden Fall war keinem Menschen zu trauen, sie wünschten einander nur Schlechtes.
Und das Gerede immer hinter dem Rücken des Anderen! Und niemals etwas Gutes. Und wenn es einem schlecht ging, freuten sich die anderen, lachten gar über ihn!
Nur niemandem trauen! Besser war es, ein »gesundes Misstrauen« an den Tag zu legen. Damit fuhr man ohnehin immer am besten!
Nein, das alles – diese ganze Nachbarschaftsklüngelei - kam gar nicht infrage!
Außerdem, war man erst einmal in diesem Kreislauf des Einladens drin, gab es kein Entrinnen: man steckte dazwischen und konnte nicht mehr damit aufhören! Um Gottes Willen, nur das nicht!
Besser, man blieb für sich, hielt sich aus allem raus und hatte seine Ruhe, und Geld sparte man noch obendrein!
Fertig, Schluss! Celina hatte da nicht mitzureden!
Und Celina redete dann auch nicht mehr mit. Sie hatte ihren eigenen Kummer, in den sie sich vergrub. Und wer weiß, vielleicht hatte Louise recht, möglicherweise gab es das ja auch gar nicht: gute Nachbarschaft und liebe Freunde. Obwohl – diese Maria Scheffler, sie hatte ihr gut gefallen, wenn sie ihr hin und wieder begegnet war.
Aber was soll’s, Celina hatte weder Mut noch Kraft, sich groß mit der Mutter anzulegen. Sie hatten immer eng zusammengelebt, Celina hatte sich an den Lebensstil Louises und an ihr Misstrauen gegenüber der gesamten übrigen Welt so gewöhnt, dass sie es nahezu für normal hielt.
So schwieg sie still und fügte sich. Wie so oft in ihrem bisherigen Leben.
Damit war es aber nicht gut. Louise hatte viele Dinge zu bemängeln an ihrer Tochter.
»Sieh dir Myriam an,« sagte sie zum Beispiel. »Sie hat es richtig gemacht. An dem Mann ist nichts auszusetzen, er hat Geld und einen guten Beruf. Sie hat es geschafft! Du dagegen …«
Die ruhige Zurückhaltung Celinas war der Mutter von jeher ein Dorn im Auge gewesen.
»Wie minderwertig still du da sitzt,« pflegte sie zu nörgeln, wenn sie unter Menschen gewesen waren – was sich in der Vergangenheit mitunter nicht vermeiden ließ, wenn es hieß, die Töchter an den Mann zu bringen.
Minderwertig still – das war ein Lieblingsausdruck von ihr, was immer er bedeuten mochte.
»Sieh nur deine Kleidung an, dein Haar! So wirst du nie einem Mann gefallen! Und wie du dich benimmst! Hockst da und redest keine drei Worte. Und wenn, dann so kühl und sachlich, da muss ja jeder Mann Reißaus nehmen! Sieh dir Myriam an, sie lacht, sie plaudert so fröhlich und ihre Blicke -! So mögen es die Männer!«
Ja, sieh dir Myriam an! Sieh sie dir an!
Celina lachte bitter auf. Sieh sie dir an, wie glücklich sie jetzt ist!
Denn sie war keineswegs glücklich, ist es nie gewesen in ihrer Ehe! Und nun das Kind – ach Gott, das ist ja meine Schuld!
Das Kind habe ich ihr genommen!
Und schon war Celina wieder angelangt in ihrem ewig gleichen Kreislauf des unfruchtbaren Grübelns und der Selbstanklagen.
Es hatte sie wieder eingeholt, das Andere!
Aber Louise war tot!
Nun konnte sie nie mehr in ihr Leben hineinpfuschen, nicht mehr nörgeln und meckern! Nie mehr sagen: sieh dir Myriam an!
Und Celina konnte tun, was sie wollte. Konnte Einladungen annehmen oder es bleibenlassen, ihre Stellung beim Finanzamt zum Teufel jagen, das Geld vom Onkel, die kleine Erbschaft, einfach verleben. Auf den Putz hauen, das Leben genießen!
Aber wie, dachte Celina?
Ist es für all das nicht längst zu spät! Ich werde bald 30. Und ich kann sicher gar nicht mehr anders leben als bisher!
Ich habe meine Mutter so tief drinnen in mir, dass ich sie immer noch höre, auch jetzt, da sie tot ist!
Sieh dir Myriam an! Ja, sieh sie dir an!
Celina musste lachen. Denn das war ein Witz. Myriam!
Oh Gott, das war wirklich zum Lachen!
Dann aber begann sie zu weinen.
Ich kann doch nichts mehr ändern, dachte sie verzagt und mutlos. Ich habe mein Leben verpfuscht, ich habe Alexa auf dem Gewissen!
Nie, nie werde ich fertig mit dieser Schuld!
Habe ich denn noch ein Recht auf ein bisschen Glück?
Trotz allem?
Kapitel 6
Als Martin Scheffler das Grundstück Celina Vanderborgs verließ und sehr langsam zu seinem Haus hinüberging, kamen ihm allerlei Gedanken in den Kopf. Einige davon ließen ihn voll Besorgnis die Stirn runzeln. Diese Celina – sie wirkte eigentlich kränker als sie seiner Diagnose nach sein konnte. Sicher hatte sie sich da einen grippalen Infekt eingefangen, aber der war kaum so schlimm, um so ein elendes, erbarmungswürdiges Aussehen zu rechtfertigen.
Ihr musste viel Schlimmeres auf der Seele liegen. Richtig, das war es! Auf der Seele! Ihre eigentliche Krankheit steckte nicht in ihrem Körper, so krank und mager er auch aussehen mochte. Ihre Krankheit schwelte in ihrer Seele. Irgend ein Kummer nagte an ihr, da war sich Martin sicher.
Ich hätte ihr die Betreuung durch einen Psychologen vorschlagen sollen, dachte Martin. Aber er wusste sogleich, wie sie darauf reagiert hätte. Er hörte sie geradezu sagen: »Vielen Dank, Herr Doktor, ich werde es mir überlegen« - und dann würde sie niemals hingehen.
Sie wirkte überaus menschenscheu und ängstlich. Zurückhaltend war sie eigentlich immer gewesen. Beide Frauen hatten stets sehr zurückgezogen gelebt, seitdem sie in den Kastanienweg gezogen waren. Niemand wusste viel von ihnen. Im Januar war Louise Vanderborg nun gestorben, und die Tochter Celina lebte allein in dem Haus. Hin und wieder war die Zwillingsschwester Myriam mit Mann und Kind zu Besuch gekommen. Die beiden Schwestern sahen sich recht ähnlich, nur wirkte Myriam sehr anders als die ruhigere Celina. Sie war hübsch zurecht gemacht, flott gekleidet und trat sicher und gewandt auf.
Und dann dieses Haus! Auf Martin hatte es wie eine Gruft gewirkt, mit seinen hässlichen alten Möbeln, plump und geschmacklos, die düsteren Vorhänge, die dunklen Tapeten an den Wänden. Ihm schien im Nachhinein, als sei nichts Helles und Freundliches im ganzen Hause gewesen; alles wirkte dumpf, düster, ungemütlich und so ganz ohne Leben.
Nun ja, er war natürlich nicht im ganzen Haus herumgegangen. Genaugenommen war er nur im Flur gewesen, dann in dem riesigen, kalten Wohnzimmer, das wie unbewohnt erschien. Celina hatte auf einem alten Sofa unter ein paar Wolldecken gelegen. Angeblich habe sie auf ihn gewartet, die Treppen wären ihr so schwergefallen, darum hätte sie sich dort unten hingelegt. Das mochte stimmen, sie war recht klapprig und zitterig auf den Beinen gewesen.
Martin fröstelte, wenn er an dieses düstere, nahezu unheimliche Haus dachte. Ohne Licht, ohne Wärme, ohne eine einzige Pflanze oder Blume, trübselig und bedrückend.
Was mochte Celina Vanderborg für einen Kummer mit sich herumschleppen? Der Tod der Mutter im Januar konnte es kaum sein. Aber was dann?
Was hatte Jenny gesagt? »Sie lebt ganz allein und hat keinen Menschen, der sie lieb hat. Sie sieht so einsam und traurig aus.«
Der Gedanke an seine kleine Tochter Jenny vertrieb ihm die trüben Gedanken. Sie war so ein kleiner Schatz! So fröhlich, unbeschwert und voller Leben.
Und jederzeit bereit zu allerlei Unternehmungen und Streichen!
Und dann diese andere Seite! Sie ertrug es nicht, jemanden traurig oder leiden zu sehen; sei es nun ein Tier oder ein Mensch. Es war mitunter verblüffend, wie gut sie sich in Andere hineinversetzen konnte. Sie ging ohne Scheu auf die Menschen zu, war erstaunlich direkt und unverblümt, und doch fand sie für jeden das rechte Wort. Und sann auf Abhilfe, wenn irgend ein Notstand ihr in die Augen stach!
Man sollte sich der jungen Frau wirklich annehmen, überlegte Martin und beschloss, mit Maria darüber zu reden. Vielleicht wusste sie einen Weg.
Im Übrigen – »der gemütliche Abend am Kamin bei Familie Scheffler« stand ins Haus. Man müsste sie dazu bringen daran teilzunehmen. Das könnte doch ein erster Schritt sein.
Dann kam ihm sein eigenes Heim in den Sinn, großzügig, warm und gemütlich, voller Licht und Lebendigkeit! Seine Kinder darin, ihre munteren Stimmen, ihr Lachen, ihr Rennen treppauf und treppab, Klaviermusik und Gitarrenklänge.
Und als Mittelpunkt Maria, seine Frau, die ihm noch immer das Wichtigste in seinem Leben war.
In seinem Hause angelangt, begab er sich sogleich auf die Suche nach ihr. Er fand sie in der Küche, wo sie das Abendessen vorbereitete. Sie stand am Herd und rührte in einem Topf herum. Der lange schwarze Zopf hing ihr über eine Schulter.
Martin trat von hinten an sie heran und schlang beide Arme um ihre schlanke, kräftige Gestalt.
Sofort wandte sie sich zu ihm um und erwiderte die Umarmung. Einen Augenblick standen sie so, ganz still und engumschlungen. Es war so, wie ihr ältester Sohn Yannis oft mit gutmütigem Spott bemerkte: Ihr seid nach 15 Jahren immer noch ein Liebespaar.
Martin pflegte lachend zu sagen: »Ja, da hast du recht, mein Sohn. Und Gott sei Dank!«
Nun blickte Maria ihm ins Gesicht.
»Was haben diese Falten auf deiner Stirn zu bedeuten?« wollte sie wissen und strich mit der Hand darüber.
»Ist Frau Vanderborg so schwer krank?«
»Ach, ihr körperlicher Zustand ist nicht gerade glänzend, aber das ist es nicht eigentlich, was mir zu denken gibt,« erwiderte Martin und entledigte sich seiner Jacke, indem er sie durch die geöffnete Tür quer durch den Raum in Richtung Flurgarderobe schleuderte. Natürlich fiel sie kurz davor zu Boden, wo sie in einem unordentlichen Häuflein liegen blieb.
Maria nahm keine Notiz davon, wäre jedoch Beate da gewesen, so hätte sie sich unverzüglich und unter Schnaufen und Knurren in Bewegung gesetzt, um diese Jacke ordentlich auf einen Bügel zu hängen.
Maria hatte da andere Methoden. Sie tat gar nichts. Schließlich begab Martin sich stillschweigend selbst in den Flur, bückte sich und hob die Jacke auf.
Er hielt eine Menge vom »guten Vorbild« als Erziehungsmethode für seine Kinder, also konnte die Jacke nicht am Boden liegen bleiben. Da sie aber niemand für ihn aufhob, musste er es wohl oder übel selber tun. Maria bediente ihn sehr gern hin und wieder, aber niemals räumte sie ihm hinterher, so wenig wie hinter ihren Kindern.
Sie vertrat den Standpunkt, ein jeder wüsste selbst, wie es sein müsse und trug auch selber die Verantwortung für seine Sachen. Ebenso verhielt es sich mit den Kinderzimmern. Maria hatte ihre Kinder in frühen Jahren geduldig und konsequent zur Ordnung erzogen, und nun hatten sie selbst für eine solche zu sorgen.
Es funktionierte auch, zwar nicht immer sofort und möglicherweise anders als sie es tun würde, aber es klappte.
»Jeder hat ein Recht auf seine eigene Ordnung und seine eigene Methode, diese herzustellen,« pflegte sie zu sagen.
»Also was macht dir Sorgen, wenn nicht die physische Verfassung von Celina Vanderborg?« forschte Maria.
Martin sprach mit Maria oft über seinen Beruf und die Menschen, mit denen er zu tun hatte. Er brauchte diesen Austausch und hielt nichts von der Schweigepflicht zwischen Eheleuten. Er wusste, dass alles, was er seiner Frau erzählte, unter ihnen beiden bleiben würde. Maria war selbst Krankenschwester gewesen, sie wusste viel von den Menschen und ihrer Psyche, und ihre Meinung und ihr Rat waren Martin unentbehrlich.
»Jenny hat es schon ganz richtig geschildert,« sagte er.
»Sie wirkt nicht nur krank und elend, sondern einsam und traurig. Das sind die treffendsten Formulierungen ihres Zustands. Ich habe sie krankgeschrieben wegen ihres grippalen Infekts. Sie kann natürlich nicht arbeiten. Aber da muss noch etwas anderes sein, irgend ein Kummer, der sie belastet.«
»Und du glaubst nicht, dass es der Tod ihrer Mutter ist, den sie noch nicht verwunden hat? Schließlich ist das noch kein Jahr her.«
Martin schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht.«
»Vielleicht steckt ein Mann dahinter,« vermutete Maria. »Wir wissen ja so wenig von ihr. Ich habe auch seit langem die Schwester mit Familie nicht mehr bei ihr gesehen. Vielleicht hat es da etwas gegeben.«
»Wir sollten dafür sorgen, dass sie am 1. Advent zu unserem Kaminabend kommt. Kannst du da nicht irgendwie nachhelfen?« Vertrauensvoll blickte Martin seine Frau an.
»Ich werde drüber nachdenken,« sagte Maria.
Kapitel 7
Celina lag in ihrem Bett im kalten Schlafzimmer des ersten Stocks und dämmerte zwischen Wachen und Schlafen dahin. Sie konnte es sich leisten, denn Dr. Scheffler hatte sie krankgeschrieben.
Und sie konnte sich gehenlassen, denn niemand war da, der ihr sagte: Nun liege nicht herum und spiele die Kranke. Steh auf und tu was!
Ach, es tat gut, so dazuliegen, die Ruhe zu genießen, und die Gedanken schweifen zu lassen.
Sie befand sich in einem merkwürdigen, dämmrigen Schwebezustand, als hätte sich die Schwere ihres irdischen Körpers verflüchtigt, als sei ihr Geist aus ihm herausgetreten und wanderte nun schwerelos dahin, ohne behindert zu sein durch Wände und Schwerkraft. Die Wirklichkeit hatte ihre beängstigende Schärfe verloren, alles schien so warm und still und friedlich.
In ihrem fiebernden Kopf drehten und vermischten sich schemenhafte Bilder der Gegenwart und der Vergangenheit. Gesichter und Gestalten huschten durch ihren Geist, aber nichts davon beunruhigte sie oder konnte ihr zu nahekommen, denn sie war unerreichbar wie in einem Kokon verborgen und geschützt vor allem, was ihr wehtun konnte.
Und dann schwebte sie davon, hoch oben über der Welt und allen Menschen und Dingen, fort von allem Kummer und Schmerz. Sie war dort oben über den Wolken, wo es warm und sonnig war, und wohin nichts und niemand ihr folgen konnte. Und niemals wieder musste sie zurück – es sei denn, sie wollte es selbst!
Irgendetwas musste sie dann aber doch zurückgebracht haben, denn plötzlich fand sie sich auf der Erde wieder. Sie war nicht länger schwerelos und des Fliegens mächtig, im Gegenteil!
Sie befand sich irgendwo in einem sonderbaren grünen Dschungel inmitten von Bäumen und dornigem Buschwerk. Sie kämpfte sich durch federndes Unterholz und wild wuchernde Efeuranken, die sich wie Fallstricke um ihre Füße wanden, durch kniehohe Brennnesseln und dürres, knorriges Geäst, das ihren Weg versperrte.
Sie wusste nicht, was jenseits des Dschungels auf sie wartete, sie wusste nur, sie musste hier hindurch, um zu ihrem Ziel zu kommen. Plötzlich veränderte sich der Boden unter ihren Füßen, er wurde weich und schlammig, und jeden Moment drohte sie zu versinken. Aber sie gab nicht auf. Mit beiden Händen zerrte sie an dem dornigen Gestrüpp auf ihrem Weg, riss an den Efeuranken, die ihre Füße behinderten.
Dann auf einmal öffnete sich das wüste Dickicht vor ihr, und sie stand in dem grünlich-schwarzen Tunnel einer Eibenallee. Das flach getretene, verfilzte Moos unter ihren Füßen dämpfte ihren Schritt, sie ging dahin, und kein Laut durchdrang die Stille.
War es Nacht oder Tag? Immer weiter wanderte sie, ohne ein Gefühl für Raum und Zeit. Und nach schier endloser Wanderung tat sich plötzlich eine Lichtung vor ihr auf, eine von goldenem Sonnenschein überflutete, bunte Blumenwiese. Wilde weiße Margeriten, rote Mohnblumen und blauer Männertreu wucherten üppig inmitten von Klee und hohem Gras.
Endlich, sie war am Ziel! Sie blickte sich suchend um. Und da kam er! Peter! Er trat aus der schattigen Kühle eines Wäldchens auf sie zu. Winkend hob er die Hände, dann breitete er beide Arme aus und Celina lief. Sie lief auf ihn zu und mitten in seine ausgebreiteten Arme hinein. Endlich war sie nach Hause gekommen, und alles war gut!
Während ihrer langen Schlaf- und Dämmerstunden war Celina jegliches Zeitgefühl abhandengekommen. Als sie erwachte, war sie sehr verwirrt. Was für ein Tag war heute? Wie lange lag sie hier schon?
Noch geisterten Traumfetzen durch ihren Kopf.
Peter war gekommen und sie waren zusammen.
Aber das war nicht Wirklichkeit gewesen, nur ein Fiebertraum.
Celina seufzte. Hätte sie doch bis in alle Ewigkeit so weiterschlafen und träumen können!
Ob es wohl so war, wenn man Drogen genommen hatte? Immerhin, sie konnte beinahe jene Menschen verstehen, die das Zeug nahmen und abhängig davon wurden.
Sie setzte sich auf und stellte fest, dass sie sich besser fühlte, ihr Kopf war verhältnismäßig klar, das Fieber musste nahezu verschwunden sein. Sie zog die Decke bis zum Kinn hoch. Wie kalt es hier drinnen war! Wie in einer Eishöhle.
Celina beschloss, nach unten in die Küche zu gehen und sich einen heißen Tee zu kochen. Plötzlich verspürte sie Hunger. Vielleicht fand sie irgendwo im Küchenschrank eine Dosensuppe. Später wollte sie unter die Dusche gehen und sich die Haare waschen. Mit Staunen stellte sie fest, dass ein wenig Tatendrang in ihr erwacht war. Allerdings reichte der gerade mal bis zur Dusche und zum Aufwärmen einer Dosensuppe. Allein die Vorstellung, sich anziehen zu müssen und vielleicht gar das Bett neu zu beziehen, machte sie schon wieder müde.
Aber das muss ich ja auch nicht, sagte sie sich.
Sie krabbelte langsam aus dem Bett und ging ins Bad, wobei sie feststellte, dass ihr doch noch recht schwindlig zumute war.
Ich kann tun, was mir passt und soweit meine Kräfte reichen, dachte sie trotzig.
Dann saß sie in ihrem Bademantel in der riesigen, kalten Küche und schlürfte ihre Hühnersuppe. Vor ihr auf dem Küchentisch lag die Einladung der Schefflers. Celina starrte sie an. Am 1. Advent war dieser Abend am Kamin, also in drei Wochen.
Celina blickte grübelnd zum Küchenfenster hinaus. Vielleicht sollte sie hingehen? Warum nicht? Wenn es ihr nicht gefiele, könnte sie einfach früh heimgehen.
Es würden allerdings viele Menschen dort sein, alle Leute vom Kastanienweg. Diese Vorstellung machte ihr schon wieder Angst. Aber warum eigentlich? Celina horchte in sich hinein. Die widerstreitendsten Gefühle waren in ihr. Im Grund war sie gespannt auf diese Menschen hier, unter denen sie bereits seit zwei Jahren lebte. Gleichzeitig flößten sie ihr Furcht ein.
Mein Gott, dachte sie, seit zwei Jahren wohne ich nun hier und kenne sie allesamt nur vom Ansehen. Einige von ihnen möchte ich gern kennen lernen. Aber so viele auf einmal -
Sicher werden sie mich anstarren. Niemals zuvor habe ich an so etwas teilgenommen, es wird merkwürdig sein.
Ich habe ja noch Zeit, es mir zu überlegen, sagte sie sich schließlich und stapfte die Stufen hinauf ins Bad.
Als Martin Scheffler kam, hatte Celina geduscht und sich die Haare gewaschen. Sie hatte sogar ihr Bett frisch bezogen und ein wenig aufgeräumt.
»Sie sehen ja schon viel besser aus,« begrüßte Martin sie und drückte ihr die Hand.