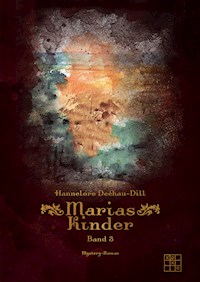
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maria-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wir befinden uns im Jahre 2010 und wieder in Seefeld. Wir lernen die Leute vom Kastanienweg kennen, und mit einigen werden wir vielleicht sogar Freundschaft schließen. Maria lebt seit 14 Jahren glücklich mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern im Haus am Güldbodener See. Einen Sommer lang begleiten wir die Familie Scheffler und teilen ihre großen und kleinen Sorgen. Nichts stört die friedliche Idylle eines Sommers am See. Eines Tages tauchen Schatten am Horizont auf. Das Unheil naht in Gestalt eines bedrohlichen Gerüchts. Und dann geschieht ein Mord, der zunächst nicht aufgeklärt werden kann. Lebt ein Mörder in ihrer Mitte? Ein unheimliches ETWAS aus der Vergangenheit bricht in Marias Leben ein und stellt sie vor eine schwerwiegende Entscheidung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Marias Kinder
Teil 3 der Maria Reihe
Teil der Serie »Die Leute vom Kastanienweg«
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-060-6
E-Book-ISBN: 978-3-96752-560-1
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung einer Illustration der Autorin
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Die Leute vom Kastanienweg
Nummer 10: Familie Vanderborg
Louise (ca. 50), verwitwet
Celina, ihre Tochter (28), Angestellte beim Finanzamt in Bernburg
Nummer 11: Familie Winterstein
Leonardo Winterstein (54), Pastor
Lisa Winterstein (50), seine Frau
Kinder: Matthias (16)
Astrid (13)
Nikolai (6)
Nummer 12: Familie Scheffler
Martin Scheffler (55), Arzt
Maria Scheffler (40), seine Frau, Bildhauerin
Kinder: Cristina (13)
Yannis (12)
Jonathan (Jona), (10)
Jennifer (Jenny), (4)
Nummer 13: Familie Tauber
Anita Tauber (42), Lehrerin, unverheiratet
Paul Tauber (66), ihr Vater
Nummer 14: Familie Meinhardt
Monika Meinhardt (45), verw., Inh. »Boutique Am Marktbrunnen«,
Kinder: Petra (14)
Ronny (12)
Freund: Ronald Simon (43)
Nummer 15: Familie Scheffler
Daniel Scheffler (34), Sohn von Martin Scheffler aus 1. Ehe, Chirurg in d. Seefelder Kliniken
Isabel Scheffler (22), seine Frau, Fotografin m. Atelier in Seefeld
Oben im Hause:
Geschwister Bernice (77) und Wanda (75) Hagen, beide unverheiratet
Nummer 16: Familie Sanders
Marcus Sanders (45), Zahnarzt m. Praxis in Waldstraße
Angela Sanders (38), seine Frau, Hausfrau
Kinder: Jeremy (12)
Nadine (10)
Nummer 17: Familie Wolters
Lucas Wolters (49), Zeitungsverleger »Seefelder Anzeiger« in der Ulmenallee
Marlies Wolters (46), seine Frau, Hausfrau
Kinder: Eileen Wolters (16)
Tim Wolters (15)
Nummer 18: Familie Bergmann
Edgar Bergmann (55), Buchhandlung und Archiv i. d. Waldstraße
Almut Bergmann (49), seine Frau
Kinder: Frederic (30)
Elmar (17)
Melinda (14)
Waldweg:
Amanda Kosczinsky (69)
Kapitel 1
Ein strahlend blauer Himmel wölbte sich wie eine Kuppel über dem Land. Dies war einer der goldenen Tage am Beginn eines neuen Sommers. Dichter gelber Sonnenschein tauchte alles in sein warmes Licht.
Noch war die Sonne warm und nicht gleißend, noch war die Frische des Frühlings in der Luft, das Grün der Büsche noch ohne Staub und nicht verblasst. Noch war nicht der Wunsch erwacht, ihrer Glut zu entkommen und in schützende, kühle Schatten zu flüchten.
In einem Meer von Grün und Gold flirrten silbrige Blitzer, das war der See, dessen spiegelnde Fläche durch die Stämme der Bäume schimmerte, und über dessen glattem Spiegel sich dicke, grauweiße Möwen krächzend erhoben.
Der Geruch von Blumen und sommerlicher Erde lag in der Luft.
Das ungemähte Gras war weich und glatt. Es war gesprenkelt vom Weiß der Gänseblümchen und hier und dort gründlich durchsetzt vom satten Goldgelb der Butterblumen, deren kräftige, zackenförmige Blätter zielstrebig das Grün des Rasens durchbohrten.
Zwei Kinder rollten den grasigen Abhang hinunter, jauchzend und kreischend. Sie hielten einander mit beiden Armen eng umschlungen; mit den Beinen versuchten sie es ebenfalls, aber die gerieten ihnen immer wieder auseinander, vielleicht bedingt durch eine Welle des Bodens oder ein Zappeln des anderen.
Sie kullerten, rollten und kreischten, einmal war ein blonder Haarschopf oben, dann wieder das braune Gelock des anderen. Das Rot und Gelb ihrer Pullover verschmolz ineinander und verwischte sich zu einem rot-goldenen Farbfleck inmitten des grünen Grases.
Beinchen ragten in die Luft, wurden herumgewirbelt, um gleich darauf im hohen Gras zu verschwinden.
Nur die Arme hielten fest; unbeirrt und tapfer umklammerten sie den anderen, als gelte es, ihn durch Dick und Dünn fest umklammernd zu Tal zu befördern.
Und dann waren sie angekommen, in ihrem Tal.
Der grüne Grashang lief sanft aus in eine duftende Blumenwiese, dem ungemähten Rasen des Pastor Winterstein.
Hahnenklee und Sternblumen empfingen sie mit gerunzelten Stirnen, bogen ihre weichen, zarten Stängel unter ihnen, um sich nach der flüchtigen Last seufzend wieder emporzurecken.
Das Kreischen und Jauchzen der Kleinen ebbte aus in fröhlichem Lachen.
Einen Augenblick lang lagen sie nebeneinander im Gras, noch mit den Armen umschlungen und einander anblickend, während die Beinchen schon voneinander fortstrebten.
Zwei runde Kindergesichter ruhten sekundenlang nah beieinander, die eine gebräunte Wange nahe der anderen, blaue Augen, die in grüne schauten, die rosigen, offenen Münder verstummt.
Ein, zwei Sekunden nur, als hätten sie einen Augenblick der Ewigkeit eingefangen, um ihn ganz kurz zu betrachten.
So flüchtig wie er gekommen war, würde er vorbei sein.
Aber vielleicht würde er eines Tages wieder auftauchen, in einem anderem Moment, einem Moment der Erinnerung an eine glückliche, viel zu kurze Zeit der Kindheit.
Und dann sprangen sie wie auf ein Kommando auf, stolperten, plumpsten wieder ins Gras, um endlich doch in die Höhe zu kommen, zerrauft, zerzaust und glücklich, mit wirrem Haar und leuchtenden Augen.
»War das schön!« sagte das eine Kind zum anderen.
Das war Jenny, 4 Jahre alt, mit grünen Augen und braunem Haar.
Nikolai, 6 Jahre alt, kam ein paar Sekunden später auf die Beine. Er strahlte die kleine Freundin an, voll verhaltener Freude, mit ganz zärtlichen Augen und einer Spur Besorgnis darin.
»Hast du dir auch nicht weh getan?«
»Nein, hab ich nicht! Du hast mich ja sooo fest gehalten!«
♦♦♦
Ein niedriger Zaun, dem ein Pinsel samt einem Eimer Farbe gutgetan hätte, trennte den Garten der Pastorenfamilie vom Grundstück der Familie Scheffler.
Johannisbeeren, Ginster und Hortensien wucherten in paradiesischer Eintracht unter dem Halbschatten der Kirsch-, Pflaumen- und Apfelbäume, von seinem Besitzer stolz Obstplantage genannt.
Im Grunde war es eher ein absolut verwilderter, aber gerade darum ungemein reizvoller alter Garten mit einem Sammelsurium der verschiedensten Obstsorten. Bis auf die Obstbäume, die vom Pastor in jedem Herbst mit mehr Begeisterung als Fachkenntnis beschnitten wurden, wuchs alles wie es wollte.
Da gab es lauschige Ecken und Winkel, zum Teil zugewachsen mit wilden Rosen, ein Bänkchen darin ganz versteckt; eine Laube halb verborgen zwischen Jasmin und Holunder, überwuchert von Geißblatt und Klematis.
Und es gab diesen Hügel, niemand wusste, wie er zustande gekommen war, aber wie geschaffen für zwei Kinder, die auf seinem grünen Rasenpolster herabzurollen gedachten.
Neben einem Tannengrüppchen zwischen Flieder und Kirschlorbeer versteckten sich einige Reihen Erdbeerpflanzen, die Pastor Winterstein in einem anfallsartigen Drang von Gärtnerberufung dorthin gepflanzt und dann vergessen hatte. Aus irgendeinem Grunde erging es den Pflänzchen auch ohne jegliche Pflege großartig in ihrem windstillen, halbschattigen Eckchen. Sie bekamen gerade so viel Sonne, wie sie brauchten, um jeden Sommer herrliche süße Beeren hervorzubringen. Wenige nur, aber immerhin genug für zwei kleine Kindermünder, die sie jedes Jahr heimlich – wie sie glaubten – ernteten.
Noch war es nicht soweit, es war gerade erst Mai, und vorerst blühten Flieder und Maiglöckchen, aber die beiden Kleinen behielten ihre Erdbeerpflanzen bereits scharf im Auge, damit ihnen bis zur Ernte nichts zustoßen möge oder ihnen nicht etwa jemand anders mit der Ernte zuvorkäme.
Diese beiden Kleinen, das waren Pastor Wintersteinsjüngster Sohn Nikolai, genannt Nicki, und Doktor Schefflers jüngste Tochter Jennifer, genannt Jenny.
Sie waren die allerbesten Freunde solange sie denken konnten. Sie hingen sehr aneinander, und es stand fest, dass sie sich nie, niemals trennen würden – komme, was da wolle!
Das Pastorengrundstück war das vorletzte der Seegrundstücke am Kastanienweg. Hier verwandelte sich der Kastanienweg in einen schmalen, moosigen Waldweg ohne Namen, der um den ganzen See herumführte, um an seinem anderen Ende wieder als Kastanienweg anzukommen.
In einem rechten Winkel zum Waldweg setzte sich der Kastanienweg in dem Kirchweg fort. Links begrenzte dieser den Stadtpark, an seiner rechten Seite auf einer Anhöhe lag die Seefelder Kirche St. Marien, Backsteingotik und einer spätgotischen Hallenkirche nachempfunden.
Neun bebaute Grundstücke gab es am Kastanienweg, mit mehr oder weniger - je nach Belieben und Geschmack seines Besitzers gestaltet - sanft zum See abfallenden Garten- oder Rasenflächen. Ein jeder hatte seinen Strand für sich mit einem Streifen wahrhaft goldgelben Sandes.
Die Grundstücke waren seltsamerweise nummeriert von 10 bis 18. Niemand wusste, warum das so war. Und niemand entsann sich, jemals Häuser mit den Hausnummern 1 bis 9 gekannt zu haben.
Im Hause Nr. 10 wohnten seit einigen Monaten 2 Frauen, Mutter und Tochter. Man wusste nicht viel über sie, denn sie lebten sehr zurückgezogen. Louise Vanderborg war etwa 50 Jahre alt und man vermutete, dass ihr Mann verstorben war. Sie ging scheinbar keiner Arbeit außer Haus nach, und man sah sie nur bei Einkäufen in der Stadt. Die Tochter Celina war 28 Jahre alt, arbeitete in Bad Bernburg beim Finanzamt. Sie fuhr täglich mit ihrem kleinen Golf zur Arbeit. Celina hätte eine hübsche Frau sein können, wenn sie sich selbst diese Chance gegeben hätte. Das dunkelblonde Haar trug sie kurz und glatt an den Kopf frisiert, die grauen Augen blickten ernst und scheu in die Welt. Niemand hatte sie jemals mit einem Mann gesehen. Celina hatte eine Zwillingsschwester, die mit ihrem Mann in Werningen wohnte und selten zu Besuch kam.
Das Haus der Vanderborgs war das letzte in der Reihe. Hier war der Kastanienweg bereits zu einem schmalen Pfad zusammengeschmolzen. Wenn man ihn überquerte, kam man einen sandigen Hügel hinauf zur kleinen Kapelle. An die Kapelle schloss sich der Seefelder Friedhof an.
Spazierte man auf dem Kirchweg weiter, so gelangte man auf die Parkstraße, die wiederum - in einem spitzen Winkel zur Lindenallee sozusagen - zum Marktplatz führte.
Wir wollen jedoch vorerst nicht dorthin weiterspazieren, sondern wenden uns wieder den Bewohnern des Kastanienwegs zu.
Das Haus Nr. 11 gehörte dem Pastors Winterstein und seiner Familie. Es war groß und alt, ein einstöckiger roter Backsteinbau mit grünbemoostem Schieferdach, schlicht und solide anzusehen. Sträucher, Rasen und Plattenwege umrundeten es. Die Ligusterhecke, die das Grundstück vom Kastanienweg trennte, wurde von Pastor Leonardo Winterstein mit Absicht recht niedrig gehalten, vielleicht um Rat- und Trostsuchenden das Eintreten leicht zu machen und nicht den Eindruck von Distanz und Abgeschlossenheit zu vermitteln.
Der Pastor war 54 Jahre alt, mittelgroß, mit rundem Bäuchlein und roten Wangen. Er war nicht schön, aber gütig und freundlich, geradeso wie man sich einen Pastor wünscht oder vorstellt. Ein dichter, graublonder Haarkranz umrahmte die glatte Fläche des Schädels, blaue Augen strahlten zuversichtlich in die Welt. Er war ein unbedingter Optimist, glaubte nicht nur an Gottes grenzenlose Güte, sondern auch an die der gesamten Menschheit. Lediglich bei seinen Kindern zweifelte er zuweilen an dem Vorhandensein einer solchen.
Er war mit Leib und Seele Pastor und manchmal auch Gärtner. Er sah sich anfallsweise dazu berufen, Gottes Erde mit Bravour zu beackern, indem er spontan und mit Inbrunst Kohl oder Blumen pflanzte, um sie sogleich nach dem Pflanzen dem Himmlischen Vater anzuvertrauen, was deren Gedeihen und Wuchs anbelangte. Was danach daraus wurde, war sehr unterschiedlich und hing weitgehend von Zeit und Wohlwollen seiner Frau Lisa ab.
Lisa war 50 Jahre alt und die Praktische in der Familie. Sie liebte ihren Mann wie er war, musste ihn nur manchmal ins Irdische zurückführen, wenn er sich allzuweit davon entfernte.
Sie hatten drei Kinder: Matthias, 16 Jahre alt, Astrid, 13 und Nikolai, 6 Jahre alt, den wir schon kurz kennen gelernt haben.
Wir wollen uns nun den anderen Familien am See zuwenden. Vielleicht fürs Erste nicht zu ausführlich, das mag später kommen.
In Nummer 12 am Kastanienweg wohnte seit fast 14 Jahren die Familie Scheffler. Martin Scheffler war Arzt, 55 Jahre alt, und seit 14 Jahren in zweiter Ehe verheiratet mit Maria, 40 Jahre alt.
Sie hatten 4 Kinder. Cristina, 13 Jahre alt, war fast das Ebenbild der Mutter mit ihrem schwarzen Haar und den ungewöhnlich grünen Augen, ein ernsthaftes, verträumtes, kluges Kind und insgeheim der Liebling des Vaters, wahrscheinlich wegen der großen Ähnlichkeit mit der Mutter. Sie spielte Klavier und las alles, was ihr vor die Augen kam. Sie schrieb regelmäßig Tagebuch, versuchte sich an Kurzgeschichten und heimlich auch an Gedichten. Eines Tages wollte sie Schriftstellerin werden.
Yannis, 12 Jahre alt, hatte Martins dunkle Augen und sein dunkelbraunes Haar. Er glich im Wesen dem Vater, hatte jedoch nicht dessen unseligen Jähzorn geerbt, unter dem Maria früher zuweilen gelitten hatte. Er spielte Gitarre und Klavier, hatte eine besondere Begabung für Sprachen und wollte - so wie der Vater – Arzt werden. Sein Verhältnis zum Vater war das eines Kameraden und er sah sich heimlich neben diesem als Beschützer der weiblichen Familienmitglieder.
Jona, der 10-Jährige, war nach seinem Großvater Jonathan Scheffler benannt, hatte das schwarze Haar der Mutter, die braunen Augen des Vaters und wie es schien, auch dessen jähzornige Ader. Jona war selten mit Gleichaltrigen zusammen. Das lag sicher teilweise daran, dass er recht gescheit war und bereits in der Grundschule eine Klasse übersprungen hatte. Nun besuchte er das Gymnasium in der gleichen Klasse wie seine 12-jährigen Freunde Jeremy und Ronny, die beide einmal in ihrer schulischen Laufbahn eine Ehrenrunde absolviert hatten.
Er war sehr sportlich, spielte Fußball, ruderte und schwamm und war nun dabei, Tauchen zu lernen. Von Anstrengungen in der Schule – ausgenommen beim Sport – hielt Jona wenig. Was ihm nicht von allein zufiel, mochte wegbleiben.
Martin hatte einmal geäußert, wenn er nur eine Spur Ehrgeiz entwickeln würde, könnte er noch ganz andere Leistungen und Noten zustande bringen. Jona hatte ihn verständnislos, sogar ein wenig mitleidig angesehen und gefragt: »Wozu? Was hast du gegen gute, zum Teil sogar sehr gute Zensuren einzuwenden?«
»Nun,« meinte Martin. »Du könntest es mindestens in allen Bereichen zu sehr guten Noten, wenn nicht gar zu lobenswerten bringen.«
»Wozu?« kam wieder die Frage. »Mit dem, was ich habe, bin ich ganz zufrieden und erreiche alles, was ich will, ohne mir großartig Stress zu machen.«
Martin schwieg. Ihm fiel kein rechtes Gegenargument ein. Maria hatte amüsiert dieser Debatte zugehört. Sie liebte es, ihrem Mann und den Kindern bei etwaigen Debatten und Diskussionen zuzuhören, und selten schaltete sie sich ein.
Dieser »Hang zur Faulheit« – wie Martin sich gern ausdrückte – störte sie an Jona nicht. Sie übersah niemals – was andere offenbar taten - , dass er erst 10 Jahre alt war. Sie fand, er habe durchaus noch viel Kindliches, ja sogar Naives an sich. Und so beobachtete sie mitunter ein wenig sorgenvoll seine Freundschaften zu älteren Jungen.
Jenny, das jüngste der Scheffler-Kinder, war 4. Sie hatte Marias grüne Augen und braunes Haar mit einem roten Schimmer darin. Sie war der erklärte Liebling der ganzen Straße, keck, gewitzt und voll von kindlichem Charme, dem niemand widerstehen konnte; der Grund, warum ihr wieder und wieder sämtliche absichtlichen und unabsichtlichen Streiche verziehen wurden.
So ernsthaft und besonnen die beiden älteren Geschwister waren, so temperamentvoll und ungebärdig waren die beiden Jüngsten, wobei Jennifer den Bruder Jonathan bei weitem noch übertraf an Übermut und Einfallsreichtum in Bezug auf bestimmte Unternehmungen, die sie laufend und haufenweise im Schilde führte.
Martin dachte manchmal, dass man dem Kind doch Zügel anlegen müsse, es könne nicht gut sein, ihm soviel durchgehen zu lassen. Aber oft, wenn er sich anschickte, Jenny ins Gewissen zu reden und recht streng dabei vorgehen wollte, befielen ihn Lachlust und Zärtlichkeit angesichts dieser gewitzten kleinen Person mit den rotbraunen Locken, so dass er in seinem Vorhaben meistens scheiterte.
Dr. Martin Scheffler praktizierte in einem geräumigen Anbau, der vor fast 14 Jahren an das Wohnhaus angefügt wurde. Er war als Arzt beliebt und galt als tüchtig und gewissenhaft.
In diesem Anbau lebte außerdem in einer separaten Wohnung Beate Bergström, 66 Jahre alt, seit 13 Jahren geliebte und geschätzte Perle des Hauses. Seit kurzem wohnte ihr Enkel Franco, 19 Jahre alt, bei ihr. Er hatte eine Lehre in der Computerbranche in Seefeld begonnen.
Dann gab es noch Vincent Abraham, 75 Jahre alt, den guten Geist und Gärtner des Hauses, ein alter Freund von Marias Vater. Besonders Maria hatte er ins Herz geschlossen, und manchmal hatte sie ihn liebevoll ihren eigentlichen Vater genannt. Er wohnte seit vielen Jahren in einem Holzhäuschen am anderen Ende des Gartens.
Nun aber zu Kastanienweg Nr. 13. Hier lebte Marias gute Freundin Anita Tauber, 42 Jahre alt, allein mit ihrem Vater Paul, der hin und wieder gern mal einen »zur Brust nahm«. Sie hatte nie geheiratet und war demzufolge mit Leib und Seele Lehrerin an der Grund- und Hauptschule in Seefeld. Der kleine Nikolai ging bei ihr in die Schule, und bald würde auch Jenny sich ihm anschließen. Die »Taube« war eine beliebte Lehrerin, die noch an den Schicksalen ihrer kleinen Schutzbefohlenen Anteil nahm, was in diesen Zeiten eine Seltenheit war.
Im Hause Nummer 14 wohnte die Familie Meinhard. Sie bestand aus Mutter und zwei Kindern. Monika Meinhard, 45 Jahre alt, war eine hübsche Frau und seit vier Jahren Witwe. Seit einiger Zeit war sie ihres Solodaseins überdrüssig und hielt Ausschau nach Männern, die für eine künftige Eheschließung – oder auch nur als Lebensabschnittsbegleitung – in Frage kamen. Insgeheim schwärmte sie sehr für Martin Scheffler. Er war so, wie sie sich ihren Traummann vorstellte.
Die Kinder Petra, 14, und Ronny, 12, waren oft mit den Schefflerkindern zusammen. Monika Meinhard besaß eine Boutique für Damen- und Herrenmode in der Fußgängerzone, Am Marktbrunnen 13.
Das Haus Nummer 15 wurde bewohnt von Daniel Scheffler, dem Sohn Martins und seiner ersten Frau Iris. Er war 33 Jahre alt und unverheiratet. Er hatte das Haus von zwei alleinstehenden Schwestern gekauft, die bis zu ihrem Tode im ersten Stock leben durften, Bernice Hagen, 77, und Wanda, 75 Jahre alt. Sie waren reichlich schrullig und sonderbar, aber harmlos.
Was niemand wusste außer Maria: Daniel litt an hoffnungsloser Liebe zu seiner »Stiefmutter« Maria. Jedenfalls war das am Anfang ihrer Ehe mit Martin so gewesen. Ob es nun heute noch zutraf, war schwer zu sagen, aber Maria hatte Grund genug, es mit Bedauern zu vermuten. Sie hätte ihm von Herzen eine Familie gewünscht, zumindest eine Frau, mit der er glücklich und zufrieden leben würde.
Das Haus Nummer 16 war erst vor wenigen Wochen wieder bezogen worden, nachdem es ein halbes Jahr leer gestanden hatte. Nun wohnte darin ein Zahnarzt mit seiner Familie, der seine Praxis in der Waldstraße hatte. Markus Sanders war 45 Jahre alt, seine Frau Angie 38. Sie hatten zwei Kinder, Nadine, 9, und Jeremy, 12 Jahre alt. Man wusste noch nicht viel über diese Leute, außer dass sie freundlich und anpassungsfähig waren und sehr gern dazu gehören wollten.
In Nummer 17 lebte Lukas Wolters, 49, Zeitungsverleger des »Seefelder Anzeigers«, der seine Druckerei in der Ulmenallee hatte. Seine Frau Marlies, 47 Jahre alt, war ein höchst mondänes Persönchen, das sich eigentlich zu gut dünkte für die Kleinstadt Seefeld. So pflegte sie ihren Vergnügungen oft außerhalb Seefelds nachzugehen; worin diese bestanden und ob da andere Männer im Spiel waren, war nicht bekannt, wurde aber unbedingt vermutet. Der Ehemann Lukas litt unter dieser Situation, aber er war nicht der Mann, etwas Entscheidendes zu unternehmen. Er war schwach und ratlos und suchte gelegentlich Trost im Alkohol. In der Nachbarschaft war er nicht unbeliebt und gute Freunde hatten ihm oft geraten, doch zu Hause mal mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, aber er war nicht der Mann dafür. So ließ er die Dinge laufen in der Hoffnung, eines Tages käme seine aushäusige, unternehmungslustige Frau von allein zur Ruhe.
Im Hause Nummer 18 wohnte die Familie Bergmann. Edgar, 55, und Ehefrau Almut, 49, hatten 3 Kinder. Melinda, 15, Elmar, 20, und Frederic, 30 Jahre alt.
Sie besaßen eine Buchhandlung mit bemerkenswerten Antiquariat in der Waldstraße, ein absolutes Paradies für Leseratten und bevorzugte Stätte zum gelegentlichen gemütlichen Schmökern für Cristina und deren Freundin Petra.
Für heute wollen wir es genug sein lassen mit unserer Vorstellungsrunde, denn wir wissen ja alle, wie es ist: Nie kann man alles behalten, wenn man mehrere Leute auf einmal kennenlernt. Und da wir diesem oder jener in dieser Straße noch häufiger begegnen werden, ergibt sich das Kennenlernen von ganz allein.
Zu erwähnen wäre noch Frau Amanda Kosczinsky, 68 Jahre alt. Sie lebte allein mit ihren Tieren im Waldweg.
Der Waldweg war ein Nebensträßchen des Kastanienwegs. Er führte am Waldrand entlang und es gab dort nur dieses einzige Haus. Frau Kosczinsky war für alle Kinder faszinierend und unheimlich. Sie trug stets lange Röcke und exotisch gemusterte Schultertücher, sammelte Kräuter, konnte »Besprechen«, Karten legen, aus der Hand lesen, Liebestränke brauen und – da waren sich die Kleinsten einig – zaubern!
Kapitel 2
Die Zeit hatte es gut gemeint mit Martin Scheffler.
Mit seinen 55 Jahren war er immer noch ein ansehnlicher Mann, groß, mit sehr breiten Schultern, sehr dunkel in Haut und Haarfarbe mit braunen Augen und schwarzen Brauen, die sich unheilvoll zusammenzuziehen pflegten, wenn sein Jähzorn im Anmarsch war.
Sein volles Haar, das schon vor 14 Jahren, als er Maria heiratete, graue Strähnen an den Schläfen aufwies, hatte sich seither nicht verändert. Ebenfalls nicht verändert hatte sich seine Figur, aber er tat auch etwas dafür. Das mochte vor allem in seiner heimlichen Sorge begründet sein, die nur Maria kannte. Er war 15 Jahre älter als sie, und das war von jeher ein Stachel in seinem Fleisch gewesen. Zumal sein Sohn Daniel als sein jüngeres Ebenbild herumlief und nur sieben Jahre jünger als Maria war.
Er war ein sehr guter Arzt, ein liebevoller Vater und geschätzter Freund und Nachbar. Er liebte seine Kinder und war über alle Maßen stolz auf sie. Er lebte für seine Familie und tat für sie, was in seiner Macht stand.
Dreh- und Angelpunkt seines Lebens aber war Maria, seine Frau.
Er liebte sie wie nie zuvor eine Frau, ihr langes schwarzes Haar, das ihr in jungen Jahren weit bis über die Taille reichte, ihre grünen Augen, ihren vollen, immer ein wenig blassen Mund. Sie hatte nie viel von Schminke gehalten, und das hatte sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Bis auf die wenigen Ausnahmen, wenn sie einmal ausgingen, ins Theater oder in ein Konzert.
Lange Zeit hatte Maria sich Martin zuliebe mit der Last ihrer langen Haare abgeplagt. Während der schwierigen Schwangerschaft des dritten Kindes jedoch hatte sie die Geduld verloren, was bei ihr etwas heißen wollte.
An einem heißen Nachmittag im August hatte sie kurzerhand eine Schere in die Hand genommen und fast einen halben Meter heruntergeschnitten. Danach hing das Haar ihr immer noch über die Schultern herab, aber sie fühlte sich so frei und leicht, als habe ihr jemand einen Sack Zement vom Kopf genommen, mit dem sie bis dahin herumbalanciert hatte.
Als Martin am Abend heimkam, war sie ihm mit stummem Trotz entgegengetreten. Sie wusste, wie sehr er ihre lange Mähne geliebt hatte. Und sie kannte seine Unberechenbarkeit und seinen Jähzorn. Aber sie fürchtete ihn nicht mehr, sie hatte gelernt damit zu leben.
Er hatte sie verdutzt angesehen, wie sie da vor ihm stand, erschöpft von Hitze und Schwangerschaft, mit der gekürzten, ein wenig zipfeligen Frisur. Dann hatte er gelacht, sie an sich gezogen und an ihrer Wange geflüstert:
»Ich bin ein grenzenloser Egoist, nicht wahr?«
Maria hatte ernsthaft genickt.
»Ein jähzorniger, ungeduldiger, rücksichtsloser Macho – das bist du!«
Martin seufzte mit gespielter Zerknirschung.
»Ich weiß, es ist nicht leicht, mit mir zu leben! Und niemand könnte es außer dir. Ich werde dir bis an mein Lebensende dafür dankbar sein, dass du mich nicht vor die Tür setzt und stehe somit für immer in deiner Schuld.«
Maria nickte wiederum mit todernster Miene und meinte nachdrücklich: »So ist es! Und vergiss es nicht!«
Seitdem Martin am Anfang ihrer Ehe sein Haus in Heydholm verkauft hatte, um nach Seefeld zu Maria in deren Haus zu ziehen, war dies ein beliebtes Thema für ihre scherzhaften Plänkeleien.
»Nun bin ich obdachlos. Also wie ist es, nimmst du mich auf?«
Maria tat, als müsste sie gründlich überlegen und runzelte die Stirn. »Nun ja,« sagte sie. »Ich denke, du hast einen Haufen Geld in der Tasche, das du für dein Haus bekommen hast. In dem Falle könnte das was werden.«
Immer noch war Maria schlank und zierlich, dabei aber äußerst kräftig.
»Wie eine ihrer Statuen,« sagte Martin manchmal in einer Anwandlung romantischer Schwärmerei.
Kräftig musste sie sein, denn sie bildhauerte. Nach der Geburt von Yannis hatte sie 4 Jahre lang eine Fachschule für Bildhauerei besucht, danach war sie ein paar Monate zu einem Bildhauer in die Lehre gegangen. Sie modellierte, aber sie arbeitete hin und wieder auch in Marmor.
Sie hatte sich als freischaffende Künstlerin einen Namen gemacht, hatte erfolgreiche Ausstellungen hinter sich, einige Stücke an Museen verkauft und erhielt mehr Aufträge, als sie bereit war anzunehmen.
Maria hatte eine schlimme Kindheit hinter sich, bei deren Bewältigung Martin ihr weitgehend beigestanden hatte.
Eine Zeitlang hatten sie geglaubt, nie in ein normales, glückliches Leben hineinfinden zu können, aber es war ihnen doch gelungen. Zwar neigte Maria zur Schwermut als Folge ihrer Vergangenheit, aber sie trat im Laufe der Jahre immer seltener auf.
Ein Schatten allerdings lag auf ihrem Leben, und das war ihr verschollener Stiefvater Clemens Cornelius. Er hatte Maria in der Kindheit und Jugend das Leben zur Hölle gemacht. Nun war er seit vielen Jahren verschwunden, und niemand wusste etwas von ihm.
Lebte er noch oder war er schon tot?
Würde er eines Tages wieder auftauchen, um ihren so mühsam erworbenen Frieden zu stören?
Sie hofften sehr, dass er für immer verschwunden bleiben möge, aber Maria hatte da ihre Zweifel.
Um es genau zu sagen: Sie glaubte eher daran, dass er irgendwann wiederkommen würde. Wenn er noch lebte!
Maria glaubte nicht an dauerhaftes Glück, denn sie war Pessimistin, und das gründlich!
♦♦♦
Es war Samstag. Der stille Glanz der Nachmittagssonne lag auf dem frischen Grün des Rasens.
Am Vormittag hatte Vincent ihn gemäht. Der Geruch des Grases lag noch in der Luft und mischte sich mit dem Duft des Flieders, den sie in ihrem ersten Jahr in diesem Haus am Pavillon angepflanzt hatten. Seine Äste bogen sich unter seinen üppigen Dolden, die wie weiße und violette Wolken bis zur Erde herab hingen.
Eine friedliche, sommerlich geschäftige Wochenendstimmung herrschte in den Gärten. Gerade war das Summen eines Rasenmähers hinter einer der Hecken verstummt. Das Klappern einer Heckenschere drang aus dem Nachbargarten herüber und zeugte vom gärtnerischen Fleiß des Pastors.
Martin spazierte gemächlich und vollkommen einig mit sich und seinem Dasein über den Rasen zum See hinunter. Er fühlte die Sonnenwärme weich und angenehm auf seinem Gesicht, während er seinen Blick über den See und die Wiesen dahinter schweifen ließ.
Dann wandte er sich um, und sein Blick wanderte zu den Fenstern der niedrigen Werkstatt hinüber, in der seine Frau zu arbeiten pflegte. Er hatte es sich zum Vorsatz gemacht, sie dort nur in Notfällen zu stören, aber oft fiel es ihm schwer.
So wie jetzt, da er mit seiner Sprechstunde und allen Hausbesuchen für heute fertig war und sie sehen und bei sich haben wollte.
Was machte sie noch so lange?
Aber er wusste ja, wenn sie in eine Arbeit vertieft war, vergaß sie Raum und Zeit.
Martin runzelte die Stirn, schob beide Hände in die Hosentaschen und schickte sich an, mit langen Schritten zur Werkstatt zu marschieren. Gerade in dem Moment sah er Maria aus der Tür zum Gang treten, der Wohnhaus und Arbeitsräume miteinander verband. Einen Augenblick stand sie regungslos im Sonnenschein, in ihrem schlichten grünen Kleid, das ihr bis zu den Waden reichte, Sandalen an den Füßen, die sie in diesem Augenblick von den Füßen schleuderte, das Haar - inzwischen reichte es ihr schon wieder bis zur Taille - glatt über die Schultern fallend.
Martin beobachtete sie fasziniert, wie er es häufig und gerne tat, besonders wenn sie sich unbeobachtet glaubte.
Wie sie nun mit nach oben gereckten Armen auf Zehenspitzen im Gras stand, mit nach hinten geneigtem Kopf, so dass ihr schwarzes Haar weit über den Rücken hinab fiel, das Gesicht mit geschlossenen Augen der Sonne zugewandt, sah sie aus wie eine Tänzerin.
Wie eine ihrer Statuen, dachte Martin wieder. Oder wie eine heidnische Göttin!
Verdammt, dachte er, ich hab Gedanken im Kopf wie ein unreifer Primaner!
Wie immer, wenn er sie so unverhofft vor sich hatte, begann sein Herz schmerzhaft zu schlagen. In all den Jahren war er nie so ganz mit der Furcht fertig geworden, sie könnte vielleicht wieder von einem Tag zum anderen aus seinem Leben verschwinden, wie es vor 13 Jahren einmal geschehen war.
Nun hatte sie ihn erspäht, winkte und lief mit bloßen Füßen über den Rasen auf ihn zu. Er ging ihr mit geöffneten Armen entgegen und fing sie auf, als sie bei ihm angelangt war. Dann schwenkte er sie herum, als hätte er Jenny im Arm.
»Ich bin es tatsächlich,« flüsterte er in ihr Haar.
»Was bist du?« Maria sah ihm ins Gesicht.
»Immer noch verliebt wie ein Primaner, meine heidnische Göttin,« sagte er grinsend.
»Donnerwetter,« war die Antwort. »Das gefällt mir. Eine heidnische Göttin hat mich noch niemand genannt.«
»Und du? Bist du es auch?« Martin drückte sie an sich und wühlte sein Gesicht in ihr Haar.
Maria wusste sogleich, was er meinte. Sie sah ihn an und sagte:
»Ja, ich bin es auch! Und was möchtest du lieber hören: mein Romeo oder mein griechischer Gott?«
In diesem Moment traten Cristina und Yannis durch eine Holzpforte, die das Tauber- vom Scheffler-Grundstück trennte.
Sie kamen gerade recht, um das übermütige Gebaren ihrer Eltern mitzubekommen. Kopfschüttelnd blieben sie stehen.
»Man sollte es nicht glauben,« ließ Yannis sich mit gutmütigem Spott vernehmen.
»Das sind nun meine Eltern! Reife, angesehene Persönlichkeiten – teilweise schon ein wenig angejahrt – (mit einem Blick auf Martin) und dann dieses alberne Benehmen am helllichten Tag!«
Maria lachte ihn an, nun wieder Boden unter den Füßen.
Wie sah er Martin doch so unglaublich ähnlich! Gerade wie er jetzt die Brauen hochzog und es in seinen Mundwinkeln zuckte. Sie nahm ihn liebevoll beim Arm und drückte ihn an sich. Mannhaft befreite er sich aus ihrem Griff, jedoch nicht ohne die Umarmung hastig und verschämt zu erwidern. Maria kannte ihren Sohn, seine Beschützerinstinkte in Bezug auf sie und seine seit kurzem auftretenden Hemmungen im Austausch von Zärtlichkeiten.
Cristina schaute zärtlich auf die Eltern. Ihr gefiel es, wenn die beiden so fröhlich und übermütig waren, denn sie sorgte sich oft um die Mutter. Zwar ging es ihr in der letzten Zeit sehr gut, und nur selten hatte sie Angst oder Schwermut bei ihr beobachtet, aber sie hatte einen besonderen Draht zur Mutter und fühlte sofort, wenn Maria etwas belastete; fast eher noch als Martin, der einen zusätzlichen Sinn für seine Frau hatte – womit er sich oft brüstete.
Cristina kannte, wie auch der ältere Bruder, Marias schreckliche Vergangenheit – bis auf jene mysteriösen Erlebnisse mit den Zeitrissen. Davon wussten nur Beate und Vincent.
»Was habt ihr bei Anita gemacht?« fragte jetzt der Vater zu Yannis gewandt.
»Beim Rasenmähen geholfen,« war die knappe Antwort.
»Aha,« staunte Martin. »Natürlich aus purer Hilfsbereitschaft und ohne jegliches Entgelt oder heimliches Spekulieren darauf!«
Die beiden sahen sich ertappt an.
»Wir haben bestimmt nichts dafür haben wollen,« verteidigte sich Cristina eilig.
»Die Taube hat uns freiwillig was gegeben,« stimmte der Bruder zu.
»Na, das will ich doch hoffen!« meinte Martin lachend. »Ich möchte mir nicht vorstellen müssen, dass ihr sie dazu gezwungen habt.«
Lautes Gelächter schallte über den Rasen. Sie waren inzwischen beim Haus angekommen. Der Pastor stand am Zaun und winkte herüber.
»Maria, wie ist es? Möchtet ihr Rhabarber haben?«
Maria und Martin traten zu ihm an den Zaun, um die prächtigen roten Rhabarberstangen zu bestaunen, die er ihnen stolz entgegen hielt.
»Nein, nur das nicht!« ertönte eine energische Kinderstimme aus dem Hintergrund von Pastors Garten.
»Sie sind entsetzlich sauer. Der Mund tut einem davon weh. Wir haben es gerade vorhin probiert,« sagte Jenny und tauchte neben dem Pastor im grünen Dickicht auf, Nikolai im Schlepptau, der ihr galant ein halbvertrocknetes Maiglöckchensträußchen trug.
»Ach,« wunderte sich Martin und blickte erfreut über den Zaun. »Da ist ja auch meine Jüngste! Hat sie auch nichts angestellt dort drüben?« Das Letzte kam ein wenig abwehrend heraus, als wolle er am liebsten gar nicht hören, wenn es denn doch so gewesen sei.
»Aber nein, Papa,« verteidigte sich Jenny. »Was denkst du denn! Wir haben sogar geholfen!«
»Geholfen?« staunte Maria leicht besorgt. »Wobei denn?«
»Wir haben ein Beet umgegraben,« fiel Nikolai erläuternd ein.
Mutter und Vater blickten skeptisch drein, während der Pastor sich ein wenig verlegen wand bei der näheren Erklärung dieser Begebenheit.
Jenny kam ihm zuvor. Sie hatte es immer eilig, mit Worten wie mit Taten. Wahrscheinlich die vom Vater mitbekommene Ungeduld, wie Maria manchmal kommentierte.
»Wir haben ein ganzes Beet umgegraben. Leider war da Kresse drin, und die kam ja nun wieder mit raus,« berichtete sie.
Der Pastor zuckte bedauernd die Schultern.
»Ich hatte da gestern gesät,« sagte er kleinlaut, als habe er sich zu entschuldigen.
»Aber sie haben es so gut gemeint, die lieben Kleinen,« fügte er begeistert hinzu und tätschelte ihnen tröstend die Köpfe.
Für ihn zählten eben die Taten und der gute Wille, nicht was dabei herauskam – wie es sich für einen rechtschaffenen Pastor geziemte!
Während Martin sich wortgewandt für sein Kind entschuldigte, konnte er sich das Lachen nur mühsam verkneifen. Nur Maria sah das Zucken in seinen Mundwinkeln.
Schnell wandten sie sich ab und gingen Arm in Arm mit ihren sauren Rhabarberstangen auf ihr Haus zu.
Zwei Stunden später saß die gesamte Familie beim Abendessen im Wintergarten.
Inzwischen gab es - trotz Marias anfänglicher Proteste – neben dem Wohnbereich auch ein Esszimmer. Es wurde jedoch nur benutzt, wenn Gäste kamen, und auch dann nur, wenn es sehr viele Gäste waren.
Die Familie hatte sich so an das Essen in dem schönen alten Wintergarten gewöhnt, dass niemand diese Gewohnheit aufgeben wollte.
Nun saß man also bei Tisch, und zum Nachtisch gab es Rhabarberkompott von Pastor Leos – wie Jenny ihn nannte – so großzügig gespendetem Rhabarber.
Jenny verzog angewidert ihre Rosenlippen, als sie ihn gewahrte, schob ihr Dessertschälchen weit fort, bis zu Jona hinüber.
»Du kannst dann meines mitessen,« verkündete sie großmütig. Aber Jona hörte gar nicht hin. Er hatte Anderes im Kopf. Am Nachmittag war er bei seinem neuen Freund Jeremy Sanders gewesen, dem Sohn des Zahnarztes, der kürzlich mit seiner Familie in Nummer 16 eingezogen war. Jeremy hatte ihm sein neues Labor im Keller gezeigt, und Jona war über alle Maßen beeindruckt gewesen.
Während er das Gemüse, von dem er ohnehin nicht viel hielt, auf seinem Teller hin und her schob, grübelte er darüber nach, wie er zu so einem fantastischen Labor kommen könnte. Sein Geburtstag war erst nächstes Jahr im März und bis Weihnachten war ebenfalls viel zu lange hin. Gespartes hatte er kaum, das schrumpfte bei ihm immer sehr schnell und auf geheimnisvolle Weise zu einem Nichts zusammen.
Was war da zu tun? Er zerbrach sich den Kopf und erwog sogar allerlei Möglichkeiten des Geldverdienens, aber ihm erschien diese Lösung als die schlechteste. Geldverdienen war sehr unbequem, nahm einem viel freie Zeit und brachte nicht viel ein, jedenfalls nach seinen Erfahrungen. In seinen Augen standen die Dinge in keinem angemessenen Verhältnis zueinander – diese meist langwierigen, strapaziösen Anstrengungen und dann die paar Euros, die dabei herauskamen.
Wenn es etwas wäre, das ihm Spaß machte, ja, das wäre etwas Anderes! Aber damit war selten Geld zu machen. Im Fußball war er ein Ass. Und wenn es um Schwimmwettbewerbe oder Fahrradrennen ginge, da könnte er was leisten. Aber dafür gab es höchstens Pokale, die herumstanden und aus denen er sich nur in den ersten 14 Tage etwas machte. Danach hätte er sie gern verkauft, aber dafür fand sich meist kein Käufer, höchstens Jenny, und die wollte nicht viel ausgeben!
Jona litt unter chronischem Geldmangel, und so war er ständig am Grübeln, wie er das große Geschäft machen könnte. Geschäftemachen, ja, das lag ihm! Eigentlich war er der geborene Geschäftsmann. Er fühlte es! Er hatte den Bogen nur noch nicht so ganz heraus. Aber eines Tages sollten sie alle staunen!
Die Stimme der Mutter drang in seine Gedanken:
»Was geht dir im Kopf herum, Jona? Und was machst du da mit deinem Gemüse?«
Jona fuhr über seinem Teller zusammen, auf dem sich Gemüse mit Kartoffeln und Fleisch auf wundersame Weise zu einem bunten Brei vermengt hatten.
Maria musterte ihren jüngsten Sohn prüfend. Er war selten so ruhig und in sich gekehrt. Meistens lieferte er sich mit Jenny bei Tisch eine lebhafte Debatte. Heute war das anders. Mit gerunzelter Stirn und zusammengezogenen Augenbrauen blickte er seine Mutter an, in Gedanken seine Pläne wälzend.
Und wieder einmal staunte Maria insgeheim über die Ähnlichkeit mit Martin. Unwillkürlich lächelte sie ihn an.
»Magst du nicht essen?« Jona schüttelte stumm den Kopf und beäugte wie erwachend den unappetitlichen Brei auf seinem Teller. Nun war auch der Vater aufmerksam geworden, der sich bis jetzt mit seinem älteren Sohn über eine neue Gitarre unterhalten hatte.
»Was ist los, Jona? Bist du krank? Oder hast du eine 6 in Mathe geschrieben?«
Jona lächelte schwach, denn das war noch nie vorgekommen. Dann kam ihm die zündende Idee! Er konnte schnell, logisch und planmäßig denken; da war er unschlagbar.
»Wo denkst du hin, Papa,« meinte er herablassend. »Im Gegenteil. Gerade heute hat Herr Brennecke mich in der Chemiestunde gelobt wegen meiner besonders guten Leistungen in Chemie – die man unbedingt fördern sollte!«
Er verstummte und blickte seine Eltern aufmunternd an, als müssten sie auf der Stelle mit unglaublichen Vorschlägen für die Einrichtung eines erstklassigen Labors im Keller für ihren Sohn herausrücken. Die aber schienen nicht recht zu begreifen, was da von ihnen erwartet wurde.
Martin runzelte die Stirn und musterte Jona mit scharfem Blick. Nicht umsonst waren sie Vater und Sohn, und Martin kannte die seinigen.
Maria beobachtete die beiden mit Vergnügen. Was führte Jona im Schilde?
»Du hast also heute deinen neuen Freund Jeremy Sanders besucht?« forschte Martin jetzt mit ausdrucksloser Miene.
»Ja, und stell dir vor, Papa, was der im Keller hat!«
»Ich hab gar nicht so große Lust, mir das vorzustellen,« meinte Martin und verzog erschrocken das Gesicht. Er hatte gerade das Rhabarberkompott gekostet, wobei Jenny ihn gespannt beobachtete.
»Mein Gott, hat Beate denn keinen Zucker daran getan?« fuhr er auf.
Jenny nickte teilnehmend. »Nun weißt du, was ich gemeint habe.« Unverhohlener Triumph klang in ihrer Stimme.
Jona war etwas unwillig über diese Unterbrechung seines geplanten Feldzuges.
»Ein Labor, Papa, stell dir vor!«
»Ich ahne Schlimmes,« murmelte Martin und schob seinen Teller zurück.
Unbeirrt fuhr Jona fort: »Und da ja Herr Brennecke mich gerade so gelobt hat, weil ...«
»weil du so ein Ass in Chemie bist, das der unbedingten Förderung bedarf, brauchst du nun dringend auch so ein Labor,« ergänzte Yannis.
Jona staunte seinen Bruder bewundernd an.
»Richtig,« stimmte er zu, völlig perplex ob des Scharfsinns und der treffenden Formulierung des älteren Bruders. Besser hätte selbst er nicht für sich sprechen können!
Martin blickte mit ungerührter Miene von einem zum anderen.
Maria hatte inzwischen begonnen, das Geschirr zusammen zu stellen.
»Kommt, Kinder! Fasst ein bisschen mit an. Beate hat heute frei,« ermunterte sie ihre Sprösslinge. Beflissen ergriff Jona die Salatschüssel, während die beiden Großen hilfsbereit mit dem Abräumen begannen.
»Jeremy hat einen Teil seiner Laborausrüstung zum Geburtstag bekommen,« meldete Yannis sich wieder, »und den Rest hat er selbst gespart,« fügte er beiläufig hinzu, was ihm einen vernichtenden Blick seines Bruders eintrug.
Ritterlich beladen mit dem vollen Tablett verschwand Yannis hinter Maria in der Küche, Jenny im Schlepptau, die ihr unberührtes Kompottschälchen vorsichtig in beiden Händen trug, als wollte sie es großmütig einer armen, bedürftigen Familie zur Verfügung stellen.
Martin war mit Jona zurückgeblieben, der immer noch die Salatschüssel in der Hand hielt.
»Jona, ich habe ja gar nicht grundsätzlich etwas gegen dein Labor einzuwenden, und ich weiß auch, dass du tüchtig in Chemie und Physik bist. Aber so von heute auf morgen ein komplettes Labor einzurichten, ist nicht drin. Wir werden uns gemeinsam überlegen, wie wir das sinnvoll beginnen können. Einverstanden?«
Jona nickte, seufzte aus tiefstem Herzen und trottete mit der Salatschüssel in die Küche.
Maria und Martin hatten ihren Rundgang durch die Kinderzimmer im Obergeschoss des Doktorhauses gemacht, wie sie es meistens zum Gutenachtsagen taten. Das erforderte mitunter einiges an Zeit und Geduld, denn jedes Kind hatte meistens etwas auf dem Herzen, das es noch schnell loswerden musste, bevor die Nacht und der Schlaf kamen.
Meistens begann dieser Rundgang bei der Kleinsten, die am frühestens schlafen musste. Als nun heute Abend die Eltern gemeinsam ihr Zimmer betraten, flüsterte sie ihnen lautstark entgegen: »Mama, Papa, ich habe ein Geheimnis! Ich habe mich heute verlobt.«
Aus der offenen Tür des Nebenzimmers erscholl lautes Gelächter. »Hört! Hört!« rief Jona prustend. »Verlobt hat das Baby sich! Das wird nicht lange ein Geheimnis sein, wenn du so schreist!«
Ob solcher Rohheit seitens des Lieblingsbruders traten der Kleinen die Tränen in die Augen.
»Ich hab doch geflüstert,« jammerte sie und sprang mit einem Satz aus dem Bett. Auf flinken nackten Füßen rannte sie zur offenen Tür von Jonas Zimmer.
»Wehe, wenn du es verrätst, du ... du Rohling!« schrie sie und drohte ihm mit der Faust.
»Dann wird dich Nicki ... er wird dich …«
»Oho,« ertönte Jonas Stimme aus dem Nebenraum. »Nicki ist also der glückliche Bräutigam! Ich hätte es auch nicht anders erwartet! Und was wird er mich?«
»Duellieren! Duellieren wird er dich,« schrie die Kleine triumphierend und warf die Tür mit lauten Knall hinter sich zu.
Martin griff sich das empörte Persönchen, um es wieder ins Bett zu befördern. Mit todernster Miene wischte er ihr zwei Tränen von den Wangen.
Seine Mundwinkel zuckten verräterisch, als er sagte: »Lass ihn nur. Er hat ja von der Liebe keine Ahnung. Eine Verlobung ist etwas sehr Schönes. Aber mit der Heirat lasst ihr euch doch noch ein Weilchen Zeit, hoffe ich.« Mühsam verbiss er sich das Lachen und vermied es Maria anzusehen.
»Aber Papa,« entrüstete sich Jenny. »Man kann doch als Kind noch nicht heiraten.«
Endlich lag sie zugedeckt und bereit für die Nacht unter ihrer Daunendecke. Da fuhr sie voller Schrecken wieder in die Höhe.
»Ich habe meinen Blumenstrauß im Garten vergessen!«
Maria entsann sich des halb verblühten Maiglöckchenstraußes, den sie vor Stunden in Nikolais Hand wahrgenommen hatte. Davon würde nicht mehr viel übrig sein, schätzte sie.
»Ich muss ihn holen,« jammerte die kleine Braut kummervoll und schickte sich an, wieder aus dem Bett zu steigen.
»Ich werde gehen,« erbot Martin sich schnell. »Wo ist er denn?«
»Er ist ja versteckt. Du weißt doch nicht, wo er ist.«
Schließlich gingen sie beide, Jenny mit zerzaustem braunem Lockengewirr über hellgrünem Frottee mit braunen Teddys darauf, in dunkelbraunen Teddy-Hausschuhen. Maria seufzte hinter den beiden her und ging, um Yannis Gute Nacht zu sagen.
Der hatte das lautstarke Intermezzo durch die offene Tür seines Zimmers bis ins Kleinste mitbekommen und grinste der Mutter entgegen.
»Von diesem Sträußchen wird nicht mehr viel übrig sein,« sagte er. »Das wird ein Geschrei geben!«
Maria lachte. »Arme Jenny! Und was glaubst du, werden die beiden tun?«
Ohne zu überlegen, sagte Yannis: »Papa wird im Dunkeln mit der kleinen Kröte in Pastors Garten herumkriechen und einen neuen Strauß pflücken.«
»Es ist aber nicht der Verlobungsstrauß,« gab Maria zu bedenken. Dann brachen sie in Gelächter aus. Sie lachten, bis ihnen die Tränen kamen.
Als Martin nach einer Weile die Treppe heraufgestapft kam, Jenny auf den Schultern, hielt diese einen hübschen, erstaunlich frischen Maiglöckchenstrauß in der Hand.
Der Rest der Familie empfing sie geschlossen am Geländer der Galerie und blickte ihnen gespannt und höchst belustigt entgegen.
»Er war leider nicht mehr zu gebrauchen,« erklärte Jenny bekümmert.
»Darum mussten wir ihn ein bisschen umtauschen. Aber Papa sagt, Maiglöckchen sind Maiglöckchen!«
In den Kinderzimmern war endlich Ruhe eingekehrt.
Maria und Martin wanderten Arm in Arm durch ihren Garten.
Der Rasen dämpfte ihre Schritte, Mondlicht lag auf den blütenüberschäumten Apfelbäumen, weißlicher Dunst über dem See.
Sie schlugen den Weg zum Häuschen von Vincent ein.
Er saß auf seiner hölzernen Veranda auf einem seiner harten Gartenstühle und schmauchte sein Pfeifchen. Eine Laterne an der Balkonbrüstung verbreitete mildes, gelbes Licht.
»Wie schön, dass ihr kommt,« empfing er sie und erhob sich ein wenig schwerfällig. Zwar war er mit seinen 74 Jahren noch rüstig und arbeitete nach wie vor mit Eifer im Garten, doch ging es ihm nicht mehr so von der Hand wie einst, und wenn er einmal saß, fiel es ihm schwer, sich wieder aufzurichten. Maria ermahnte ihn oft besorgt, nur noch die leichte Gartenarbeit zu tun; Vincent ließ sie reden und machte was er wollte.
Sie wollte jemanden anstellen, der zweimal in der Woche käme, um ihm zu helfen, aber Vincent hatte bisher immer abgelehnt. Er werde sich schon melden, wenn es ihm zu viel sei.
Beim Rasenmähen half Yannis ihm meistens. In den letzten Monaten besuchte sein 45-jähriger Neffe Johannes ihn oft, der tüchtig mit anpackte. Er war seit kurzem verwitwet, und sein Leben war etwas aus dem Geleise geraten. Er hatte ein kleines Häuschen am anderen Ende der Stadt, das er seit dem Tode seiner Frau allein mit dem 12-jährigen Sohn Kevin bewohnte.
Nun schob Vincent Maria einen der bequemeren Korbsessel zu und stapfte ins Haus. Gleich darauf kam er mit einer Flasche Rotwein und Gläsern zurück.
»Ein besonderer Tropfen für einen besonderen Abend,« sagte er und ließ sich ächzend auf dem Stuhl nieder.
»Was ist denn heute für ein besonderer Abend?« wunderte Martin sich, während er seinen Stuhl dicht neben den Marias schob und sich darauf niederließ.
»Heute vor 30 Jahren bin ich in dieses Haus eingezogen,« sagte der Alte bedächtig. »Es war das Jahr, nachdem Bernhard und ich aus den USA zurück kehrten.«
Und während sie an ihrem Wein nippten und in die Sterne hinaufschauten, begann Vincent von der Vergangenheit zu erzählen. Von den Jahren, die er mit seinem Freund Bernhard, Marias Vater, in Amerika verbracht hatte, und von der Zeit danach, als er sich hier auf dem Grundstück dieses Häuschen selbst errichtet und darin gewohnt hatte.
»Bernhard wollte immer, dass ich mit ins große Haus einziehe,« sinnierte der Alte. »Aber das wollte ich nicht. So ist es mir lieber. Ich muss für mich sein. Außerdem hatte er damals eine Frau kennen gelernt, Margot, die mit ihm hier lebte. Für ein paar Jahre leider nur, dann starb sie.«
Er schwieg. Nach einer Weile begann er aufs Neue.
»Dann kam Anna. Das heißt, sie wollte kommen und mit mir hier leben. Aber wie gesagt -. Sie ist eine nette Frau, und wenn man sich hin und wieder sieht, ist das in Ordnung. Aber leben will ich allein. Bin nun mal ein Eigenbrötler.«
Er verstummte erneut. Was mochten da für Erinnerungen vor seinem inneren Auge erstehen! Erinnerungen an das Leben mit seinem Freund Bernhard Sarnow, Marias Vater. Maria hatte erst im August 1996 an seinem Sterbebett erfahren, dass Bernhard Sarnow ihr Vater war. Danach war sie fast sofort in das Haus am Kastanienweg, das er ihr vererbt hatte, eingezogen. Das war nun inzwischen knapp 14 Jahre her.
Vincent hatte kaum je von seiner Vergangenheit gesprochen. Er war niemals verheiratet gewesen und hatte keine Kinder. Maria vermutete, dass er in der Jugend irgendeine schlimme Enttäuschung mit einer Frau erlebt hatte, aber sie hatten nie darüber geredet.
»Nun hat ja unser Püppchen, die Jenny, bald Geburtstag,« hub Vincent erneut an. Er schmunzelte. »Meine Güte, sie wird auch schon 5. Sie hat mir heute einen Geburtstagswunsch bekanntgegeben und mich zu ihrer Party eingeladen.«
»Was für ein Wunsch?« Maria staunte.
Der Alte lachte leise.
»Sie wünscht sich einen Katzenkorb.«
»Einen Katzenkorb?« wunderte sich Martin. »Sie besitzt doch gar keine …«
Er verstummte, ihm war wohl ein Licht aufgegangen.
»Und wo wird die Katze herkommen?« fragte er.
»Sie hat gesagt, darum würde sie sich schon selbst kümmern. Außerdem sei der Katzenkorb nur für Transporte gedacht. Ansonsten schliefe das Kätzchen natürlich in ihrem Bett.«
»Um die Katze will sie sich also selbst kümmern,« sinnierte Martin. »Soso …«
♦♦♦
Wenn die Vormittagssprechstunde beendet war, ging Martin in der Regel durch die breite Doppeltür, die den Anbau vom Wohnhaus trennte, zum Mittagessen in sein Haus hinüber.
Als er heute die Diele betrat, war es ungewöhnlich ruhig darin. Auf der Suche nach seiner Frau betrat er die Küche. Da saß ganz allein Jenny an dem großen Tisch, vor sich ein riesiges Blatt Papier, auf dem gerade eine von ihr verfertigte Zeichnung entstand.
»Hallo, meine Süße,« sagte er und betrachtete seine Tochter, wie sie da am Tisch saß, mit konzentrierter Miene, die rosa Zungenspitze zwischen den Zähnen. Er beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie zur Begrüßung auf die Pfirsichwange. Jenny blickte nur kurz auf.
»Guten Tag,« sagte sie höflich und fuhr fort in ihrer Malerei.
Martin musterte begutachtend das Werk.
Ein spitzohriges, braun-gelbes Etwas mit dichtem Schwanz war da im Entstehen, das Martin flüchtig und mit ein wenig Fantasie an eine Katze erinnerte.
»Meine kleine Maus malt eine Katze,« eröffnete er gutgelaunt das Gespräch und ließ sich neben ihr auf einem Küchenstuhl nieder.
Es versetzte ihn stets in eine gehobene Stimmung, mit seiner Jüngsten zu plaudern. Jenny fuhr fort, eifrig den Bauch der Katze mit dem gelben Stift auszumalen.
»Das ist wohl eine Katze, aber ich bin keine Maus,« sagte sie unwillig. Sie blickte den Vater strafend an.
»Du weißt, dass ich keine Mäuse mag. Sie schütteln mich.«
»Du meinst, es schaudert mich,« berichtigte der Vater.
»Dich nicht, aber mich,« stellte Jenny richtig. Martin schmunzelte. Dann fragte er:
»Du bist ja ganz allein hier. Wo ist denn …?«
»Meine Maria ist mit einem fremden Herrn in der Werkstatt,« war die Antwort.
Martin stutze, dann musste er grinsen. Er erkannte seine eigene gewohnte Formulierung, wenn er das Haus betrat und nach seiner Frau auf die Suche ging.
»Wo ist meine Maria?« pflegte er Beate zu fragen, die ihm meistens als Erste über den Weg lief.
»Was ist das für ein Herr?« wollte er nun wissen.
»Ach, nur einer, der eine Pumpenfigur will,« war die erschöpfende Auskunft.
»Eine was?«
»Eine Figur, die an einer Pumpe stehen muss.«
Dann zählte sie auf:
»Cristi und Yanni sind noch in der Schule, und Jona ist oben in seinem Zimmer und muss denken. Beate ist noch bei Pastor Leo drüben.«
Dieser Gedanke schien ihr für einen Moment Sorgen zu machen.
Sie blickte auf und meinte: »Ich hoffe nur, sie bringt nicht wieder den grässlichen Rhabarber mit.«
»Warst du heute gar nicht im Kindergarten?« wollte Martin wissen.
»Nein,« war die knappe Antwort.
»Und warum nicht?«
»Meine Sinne standen nicht danach.«
Martin grinste erheitert.
»Du meinst: dir stand der Sinn nicht danach.«
Sie schüttelte entschieden den Kopf.
»Nein, so war es nicht,« klärte sie ihn auf. »Du hast mir selbst gesagt, dass jeder Mensch mehrere Sinne hat. Und kein einziger davon wollte heute in den Kindergarten.«
Martin brach in Gelächter aus.
»So gesehen hast du Recht,« gab er zu.
»Fertig!« Jenny legte aufatmend den Stift auf den Tisch, musterte zufrieden ihr Werk und sah ihren Vater mit etwas mehr Aufmerksamkeit und Interesse an.
»Heute gibt es später Essen,« verkündete sie dann.
»Und auch nur Suppe. Beate ist nämlich gerade erst nach Hause gekommen. Sie war in der Kirche und auf dem Friedhof,« berichtete sie weiter.
Martin wunderte sich. »Beate war heute Morgen auf dem Friedhof? Was wollte sie denn da?«
»Nicht heute Morgen! Vorhin gerade, und es hat etwas mit dem Kalabreser zu tun.«
Martin sah verständnislos drein.
»Was ist denn ein Kalabreser?« wollte er wissen.
»Da kann man Särge hineintun,« war die Auskunft.
»Ein Kalabreser, in den man Särge hineintut?«
»Man tut nicht, aber man kann,« sagte Jenny.
Martin war ein wenig verwirrt.
»Erzähl mir das genau, von Anfang an! Also: Beate war heute Morgen, ach nein: vorhin in der Kirche. Und was wollte sie da?«
»Na, beten und dem Pastor zuhören,« erwiderte sie.
Was schließlich tat man sonst in einer Kirche?
»Jenny, Schätzchen, erzähl mir nun die ganze Geschichte,« bat Martin und lehnte sich zurück.
Das Kind rutschte vom Stuhl, um auf Martins Schoß zu klettern. Sie legte ihre Arme um seinen Hals, und mit ihrem Gesicht nah vor dem seinen begann sie:
»Also, es war so: Eine alte Frau ist gestorben. Als sie noch lebte, hat Beate sie gekannt. Aber nun ist sie tot und musste begraben werden. Da ging also Beate und kaufte einen Blumenstrauß. Er war sehr schön, und eigentlich ist es schade, dass die tote Frau ihn nicht mehr sehen kann. Mit diesem Blumenstrauß ging sie dann zur Beerdigung. Vorher hatte sie noch ihren schwarzen Mantel angezogen, weil …. Eigentlich weiß ich nicht recht warum, aber vielleicht …«
Sie runzelte die Stirn und grübelte darüber nach.
Martin verbiss sich mühsam das Lachen.
»Es ist ein alter Brauch, dunkle Kleidung auf einer Beerdigung zu tragen,« klärte er sie auf. »Und wie ging es dann weiter?«
Jenny fuhr fort: »Beate hat mir ganz genau erzählt, wie alles war, weil ich es hören wollte. Ich war ja noch nie auf einer Beerdigung. Also da standen nun alle schwarz angezogene Menschen am Grab. Und am dichtesten beim Pastor und dem Grab standen zwei alte Frauen. Das waren die Schwestern von der Toten. Es ist immer so, dass die Verwandten am dichtesten beim Grab stehen, weißt du?
Und nun kommt’s, Papa. Hör nur, was Beate sagte. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also sie sagte: Mein Gott, ist das ein riesiger Kalabreser, was die Anna da hat. Da passt ja fast der ganze Sarg rein. Und dann hat sie auch noch das Eigene genommen, und damit meinte sie die Handtasche.«
Jenny schwieg verwirrt und blickte dem Vater ins Gesicht.
»Weißt du, was das bedeuten soll, Papa?«
In diesem Moment war Beate in die Küche gekommen.
»Ach Gott, Sie sind ja schon da, Doktorchen. Es tut mir leid, dass ich so spät komme, aber die Suppe ist gleich soweit.«
Manchmal duzten sie einander, dann wieder wurde das »Sie« benutzt, wobei Beate sich fast immer des Sie’s befleißigte, während Martin sie meistens duzte.
Beate fand, es gezieme sich kaum, die »Herrschaft« zu duzen, wenn man eine Angestellte war. Dabei war sie weitaus mehr als eine Angestellte, das wusste sie sehr gut und verhielt sich auch so. Bis auf bestimmte Grenzen, die sie zog, ganz einfach »weil es sich so gehört.«
»Ich weiß, du warst zu einer Beerdigung,« unterbrach Martin sie und lachte über das ganze Gesicht.
»Meine Tochter hat mir schon einiges davon berichtet. Nur bin ich leider nicht so ganz schlau aus alledem geworden. Vielleicht klärst du mich mal auf. Ich bin schon sehr gespannt, warum Särge in einem Kalabreser untergebracht werden, und was die trauernden Schwestern für Eigenes genommen haben.«
Beate riss die Augen auf und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
Dann begann sie auch zu lachen.
»Ach, dieses Kind! Also es war so, Herr Doktor: Wir standen alle am Grab, und die beiden Schwestern der Toten hatten so riesige Hüte auf, besonders die Anna. Ein Mordsding war es, und wie mir schien, hatte er der Toten gehört. Und da sagte ich wohl so was wie: Was hat die da für einen Kalabreser auf, da passt ja fast der Sarg hinein.
Na ja, und das mit dem Eigenen hat Jenny wohl falsch verstanden. Es ging um die Handtasche, die Anna in der Hand hielt. Die hatte auch der Toten gehört, es war ein teures Ding von Aigner. Und ich fand es empörend, weil die Tote noch nicht einmal ganz kalt war …«
Als Maria einen Augenblick später die Küche betrat, empfing sie ein brüllendes Gelächter. Jenny stand mit empörter Miene und erhitztem Gesichtchen daneben, das braune Haar ein wenig feucht und sehr lockig um die Stirn.
Maria blieb verdutzt in der Türe stehen, diese ungehemmte Heiterkeit bestaunend. Dann blickte sie in Jennys grüne Augen und fragte: »Was ist los? Warum lachen sie so sehr?«
Das Kind hob verständnislos die Schultern.
»Beate war auf einer Beerdigung und es war recht traurig,« erläuterte sie.
Und weil die Mutter nun erst recht verblüfft dreinblickte, fügte sie hinzu: »Es hat was mit dem Kalabreser zu tun, in den ein ganzer Sarg hineinpasst.«
Jenny wunderte sich sehr, dass Papa und Beate aufs Neue in ein gewaltiges Gelächter ausbrachen. Und die Mama stand ganz und gar verständnislos daneben und beäugte die beiden anderen, als hätten diese den Verstand verloren.
Endlich wandte Martin sich an seine Frau:
»Und nun wüsste ich von dir noch gern, was eine Pumpenfigur ist?«
Maria sah ihren Mann nur verständnislos an.
♦♦♦
Maria klopfte und steckte ihren Kopf durch die nur angelehnte Tür zum Zimmer ihrer älteren Tochter.
»Darf ich herein kommen?«
»Ja, komm nur und sag mir, was du davon hältst. Ich weiß nicht recht…«
Cristina drehte sich mit zweifelnder Miene in einem wadenlangen, auberginefarbenen Rock vor ihrem hohen Spiegel hin und her.
»Oh,« staunte Maria, »da ist er ja schon, der neue Rock für die Party bei Astrid.«
Cristina sah der Mutter ein wenig erschrocken ins Gesicht.
»Von meinem Geburtstagsgeld! Das durfte ich doch?«
»Natürlich, mein Kind,« Maria lächelte ihre Tochter beruhigend an.
»Hast du ihn in »Monikas Boutique« gekauft?«
»Ja, heute Mittag. Wir hatten nach der Schule eine Freistunde und da beschlossen wir, Petra und ich, in die neue Eisdiele Am Marktbrunnen zu gehen. Na ja, und da schauten wir auch in Monikas Schaufenster. Sie sah uns von drinnen, kam heraus und ermunterte mich, ihn anzuprobieren. Und da ist er nun!«
»Und was gefällt dir daran jetzt nicht?« fragte Maria, der der zweifelnde, unzufriedene Blick der Tochter angesichts des eigenen Spiegelbildes nicht entgangen war.
Cristina zupfte am Taillenbündchen herum.
»Eigentlich gefällt er mir gar nicht mehr,« sagte sie niedergeschlagen und ließ sich auf ihren Schreibtischstuhl fallen.
»Sag mir doch, was du davon hältst.?« Vertrauensvoll sah sie zur Mutter auf.
Maria trat einen Schritt auf die Tochter zu und begann nun ihrerseits, an dem Rock herumzuzupfen.
»Er sitzt nicht, und diese Farbe passt nicht zu dir,« sagte sie dann.
»Hat Monika dich nicht beraten?«
Cristina schüttelte den Kopf. »Sie meinte, wenn er mir gefiele, dann sollte ich ihn nehmen. Also habe ich ihn angepasst und Petra meinte, er wäre o.k.«
»Und was meintest du?« fragte Maria und sah ihrer Tochter forschend ins Gesicht.
»Ich fand ihn eigentlich nicht mehr so toll, als ich ihn anhatte,« gab diese kleinlaut zu. »Aber ich konnte gar nicht recht sagen warum. Ich war so unsicher,« schloss sie ganz verzagt.
Maria wandte sich zur Tür. »Warte mal einen Moment,« sagte sie und lächelte ihre Tochter aufmunternd an. Dann lief sie in ihr Schlafzimmer hinüber. Ein paar Minuten später kam sie zurück, ein dunkelblaues Etwas über dem Arm.
»Probiere den mal,« sagte sie und hielt der Tochter einen Jeansrock mit aufgesteppten Taschen und langem Schlitz im Vorderteil hin.
»Wo hast du den her?«
Cristina nahm den Rock und schlüpfte hinein.
»Oh, sieh nur!« rief sie begeistert aus. »Er passt wie angegossen! Und wie schön er ist! Wie für mich gemacht!«
Sie drehte sich einmal herum und lächelte ihr Spielbild an.
Maria lachte.
»Er ist für dich! Heute Morgen habe ich ihn in der Jeansboutique in der Ulmenallee entdeckt.«
»Oh, Mama! Wirklich für mich! Das ist lieb. Und er ist tausendmal schöner als dieses andere Ding.«
»Mir erging es ähnlich wie dir,« erzählte Maria. »Ich ging zufällig durch die Ulmenallee und warf einen Blick ins Fenster. Und da sah ich ihn. Und ich wusste sofort, das ist ein Rock für dich!«
Cristina fiel der Mutter um den Hals.
Maria hielt ihr Kind einen Moment lang fest an sich gedrückt.
»Ich habe auch gleich gedacht: wie für Cristina gemacht,« sagte sie. »Und ich hatte recht, wenn ich dich so anschaue.«
Sie nahm das verschmähte Stück und legte es zusammen.
»Den bringen wir morgen zurück,« sagte sie.
Dann setzte sie sich in einen von Cristinas kleinen Sesselchen und musterte die schlanke Gestalt der Tochter prüfend.
»Ich fürchte, dieses Geschenk ist als kleine Bestechung gedacht. Ich habe nämlich eine Bitte an dich,« fuhr Maria fort.
Cristina drehte sich immer noch vor dem Spiegel.
Nun blieb sie stehen und sah der Mutter ins Gesicht.
»Eine Bestechung? Was meinst du?«
»Ich wollte dich bitten, mir Modell zu stehen,« sagte Maria und ließ ihren Blick über die sehr schlanke Gestalt der Tochter gleiten.
Cristina ließ sich überrascht aufs Bett fallen.
»Modell stehen? Oh Mama, da fühle ich mich ja geschmeichelt. Und wann?«





























