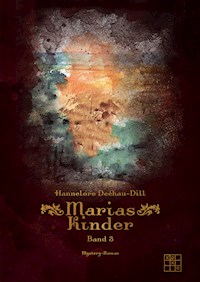Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Leute vom Kastanienweg
- Sprache: Deutsch
Mit sieben Jahren verliert Isabel ihre Eltern bei einem Autounfall. Sie kommt zu ihrer Tante in das Haus am Fluss. Aus dem Kind wird eine erwachsene Frau. Wie jedem Menschen begegnen ihr Freude und Schmerz, Enttäuschungen und schließlich auch die erste Liebe. Zunächst hat sie es schwer, sich in das neue Leben hinein zu finden und den Tod der Eltern zu verarbeiten. Die Geheimnisse des alten Hauses am Fluss nehmen sie gefangen. Ein Stück trauriger Vergangenheit kommt dabei ans Licht, das bis in die Gegenwart hinein wirkt. Ein großer Schmerz wirft sie fast ein zweites Mal aus der Bahn, aber Isabel hat gelernt, damit fertig zu werden, denn »die Zeit ist eine weise Heilerin. Die schlimmste Zeit dauert niemals länger, als ein Mensch sie ertragen kann.« Ein Roman aus dem Kastanienweg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Neptuns Nachtgesang
Die Leute vom Kastanienweg
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-067-5
E-Book-ISBN: 978-3-96752-567-0
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 1552763996
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Ende und Anfang
Der graue Nebel vermischt sich mit der herannahenden Dunkelheit. Beides zusammen scheint alles aufzusaugen und zu verschlingen, die fernen Hügel, die grauen Wiesen und den dunklen Waldstreifen am Horizont.
Ganz plötzlich taucht das Haus aus dem Nebel auf, ein hoher schwarzer Kasten, an zwei Seiten von mächtigen Baumriesen flankiert. Es wirkt wie eine wuchtige Festung, beinahe quadratisch, mit altertümlichen Türmchen und Schornsteinen bewehrt. Zwei hohe Fenster im ersten Stock sind matt erleuchtet, das übrige Haus liegt im Dunkel.
Isabel erscheint das Haus wie ein gewaltiges, schwankendes Schiff auf bewegter See, wie es da düster und riesig in den wabernden Nebelschwaden zu schlingern scheint. Sicher liegt das auch an ihrer unglaublichen Müdigkeit, die sie kaum noch fühlen und denken lässt. Sie ist wie betäubt, und die Stimme des grauhaarigen Fahrers vor ihr dringt nur wie von weither an ihr Ohr. Die Stimme ist tief und freundlich, und man hört das Mitleid darin.
»Nun sind wir da,« sagt die Stimme. »Dann wirst du endlich in dein Bettchen und zur Ruhe kommen.«
Kies knirscht unter den Rädern, als das Auto auf die breite Einfahrt fährt.
Eine der hohen Laternen zu beiden Seiten des Vorplatzes gibt einen dünnen, flackernden Lichtschein von sich, die anderen haben längst irgendwann ihren Geist und somit ihren Dienst aufgegeben.
Isabel stolpert an der Seite der Tante über den Kies. Die Tante hält ihre kalte Kinderhand mit mageren, langen Fingern umklammert und zieht sie die breiten Eingangsstufen zur Haustür hinauf.
»Du bist müde, ich weiß,« murmelt sie dabei. »Armes Kind, was du auch alles mitmachen musst.«
Eine Weile hantiert sie umständlich mit einem enormen Schlüsselbund an dem altmodischen Türschloss herum, dass es nur so klappert und klirrt. Endlich schwingt die breite Tür mit heiserem Knarren auf und eine nahezu dunkle Eingangshalle liegt vor ihnen. Kälte, Nebel und Dunkelheit scheinen ihnen ins Haus zu folgen. Mit einem dumpfen, unwirklichen Geräusch schlägt die Tür zu, und dann ist Stille.
Der flackernde Schein eines einzelnen Nachtlichts fällt von irgendwoher auf dunkelrote Steinfliesen. Wuchtige Schränke und Kommoden reihen sich an den Wänden in einer unbeweglich verharrenden, stummen Prozession. Schwere Truhen, Tischchen und hochlehnige Stühle füllen die Halle bis in den letzten Winkel.
Inmitten der Schatten schwingt sich eine gewaltige Treppe in düstere Höhen empor, die sich nur erahnen lassen.
Diese Treppe hinauf müssen sie, das ahnt die kleine Isabel dunkel, wenngleich es ihr ganz unmöglich erscheint, das jetzt auch noch zu bewältigen.
»Gleich haben wir es geschafft,« murmelt die Tante, selbst müde und mit den Nerven am Ende von all den ungewohnten Ereignissen dieses endlosen, langen Tages. Gutmütig streicht sie dem Kind mit ihren dünnen Fingern über die Wange, die kalt und feucht ist, während ihre andere Hand immer noch die kleine Kinderhand umklammert hält.
Nebeneinander steigen sie die Stufen hinauf, langsam und schwerfällig, beide so erschöpft wie zwei müde Wanderer nach einer langen Tagestour.
»Du wirst sehen,« murmelt die Tante beruhigend vor sich hin. »Dein neues Zimmer wird dir gefallen. Und wenn du dich erst eingelebt hast, findest du auch Kinder in der Nachbarschaft zum Spielen. Wir werden uns schon verstehen, wir beide.«
Die Tante meint es gut, Isabel spürt es wohl durch diesen Nebel von Müdigkeit und Gefühllosigkeit hindurch. Aber instinktiv und undeutlich spürt sie auch, dass die Tante nichts von Kindern weiß und vielleicht auch gar nicht wissen will. Sicher ist sie nicht bös und will das Richtige tun, aber dieses Kind, das ihr da unversehens ins Haus geschneit kommt, ist ihr fremd und unverständlich. Sie hat nie eigene Kinder gehabt, hat den Kopf voll mit eigenen Dingen und lebt ihr Leben auf ihre Weise. Wie soll da ein kleines 7-jähriges Mädchen hineinpassen?
Die Tante hat vergessen, wie es ist, 7 Jahre alt zu sein.
Immer noch steigen die zwei nebeneinander die Stufen hinauf. Sie scheinen kein Ende zu nehmen. An den Wänden hängen Bilder und Fotografien längst verblichener Vorfahren in altmodischen Rahmen. Dazwischen schwanken ihre vom flackernden Nachtlicht verzerrten Schatten wie überdimensionale Gespenster über die Wand.
Isabel nimmt das alles nur wie durch einen Nebelschleier wahr. Immer noch kann sie weder denken noch fühlen. Da ist nur ein kalter schwerer Stein in ihrer Brust, vor ihren müden Augen verschwimmen alle Konturen, und die Füße sind ihr wie Blei, so dass es ein Wunder ist, dass sie der Tante überhaupt folgen kann. Hätte diese sie nicht mit eiserner Hand nachgezogen, wäre sie sicher längst auf einer der Treppenstufen sitzen geblieben und eingeschlafen.
Endlich, endlich sind sie oben angekommen. Sie schlurfen den langen düsteren Korridor entlang, der viele Nischen und Winkel zu haben scheint. An seinem anderen Ende öffnet die Tante eine Tür und nun sind sie da.
Die Tante macht Licht, ein kleines Wandlämpchen neben der Tür erhellt den Raum nur spärlich.
Einen Augenblick lang stehen Tante und Nichte nebeneinander im Raum.
»Nun geh gleich ins Bett,« sagt die Tante ein wenig hilflos und sieht sich um.
»Du musst ja furchtbar müde sein. Ich bin es auch. Morgen ist ein neuer Tag. Da sieht alles schon ganz anders aus, du wirst sehen.«
Sie blickt sekundenlang unschlüssig auf das Kind, das regungslos neben ihr steht, dann zieht sie ihm das Wollmäntelchen und die Mütze aus und legt es auf einen Stuhl.
Plötzlich scheint ihr etwas einzufallen.
»Du hast doch keinen Hunger mehr, oder?« fragt sie leicht erschrocken und abwehrend, als würde das Gegenteil unüberwindliche Hindernisse herauf beschwören.
Das Kind schüttelt den Kopf.
»Gut, dann zieh dich gleich aus und geh ins Bett. Morgen sehen wir weiter. Gute Nacht, mein Kind.«
Sie streicht der Kleinen über das Haar und sekundenlang erscheint so etwas wie Mitleid und Schmerz in ihren Augen. Dann dreht sie sich um und verlässt fast fluchtartig den Raum.
Die Tür schlägt dumpf hinter ihr ins Schloss.
Isabel ist allein. Sie steht immer noch mitten im Zimmer. Es ist ganz still ringsumher. Nein, doch nicht so ganz still. Da ist immer noch dieses Geräusch, das sie schon bei der Ankunft wahrgenommen hat. Als sie das Haus betreten und auf die Geräusche des Hauses gelauscht hatte, war es für Augenblicke fort gewesen. Und auch, als die Tante sprach – mit ihrer leisen, monotonen Stimme, die irgendwie so fern und abwesend klang, als sei sie mit den Gedanken ganz woanders –, hatte Isabel es nicht bemerkt. Nicht bewusst jedenfalls, denn jetzt weiß sie, dass es auch da gewesen ist, dieses seltsame Geräusch. Nur ferner, leiser und verhaltener. Wie ein steter Wind, der um dicke Mauern eines Hauses streicht und niemals damit aufhört. Oder wie die Geräusche einer fernen Autobahn, an die man sich irgendwann gewöhnt und sie dann nur noch im Unterbewusstsein wahrnimmt – so wie daheim …
Ein Geräusch, das immer da ist, das einen Tag und Nacht begleitet.
Aber was ist es nur, dieses Geräusch? Woher kommt es? Gibt es hier auch eine ferne Autobahn?
Isabel steht regungslos im Raum, der im Halbdunkel vor ihr liegt, dunkle Schatten fremder Möbel, da vorn die hohen Rechtecke der drei Fenster, die nahezu bis zum Boden reichen und deren Vorhänge nur teilweise zugezogen sind.
Isabel achtet im Augenblick kaum auf ihr neues Zimmer, das von jetzt an ihr Zuhause sein soll. Zu sehr ist sie damit beschäftigt, dahinter zu kommen, was das für ein Geräusch ist, das ihr seit ihrer Ankunft überallhin zu folgen scheint. Aber sicher folgt es ihr doch nicht, es ist ganz einfach da und vielleicht Bestandteil ihres neuen Lebens.
Das Kind geht die paar Schritte zum Fenster, hinter dem die Nacht lauert. Da ist nicht viel zu sehen, es ist sehr dunkel. Kein Mond und keine Sterne lassen sich blicken, nur Wolken und Nebel. Vom Vorplatz herauf schimmert das klägliche Licht der Laterne durch den grauen Dunst wie ein einsamer Stern. Isabel öffnet das Fenster einen Spalt, es ist mühsam, das Fenster klemmt, es ist so alt wie das Haus und schon sehr lange nicht geöffnet worden, aber es geht. Sie lehnt sich ein Stückchen hinaus und lauscht in die Dunkelheit. Und nun kann sie es ganz deutlich hören. Es ist der Fluss! Sein Rauschen dringt durch den Nebel an ihr Ohr wie eine gleichbleibende, sanfte Musik.
Da fällt ihr wieder ein, was die Tante gesagt hat.
»Mein Haus steht an einem Fluss, und er rauscht Tag und Nacht, mal mehr, mal weniger. Es ist schön dort und wird dir gefallen.«
Es ist also der Fluss. Isabel schließt die Augen und lauscht seiner Stimme, die sanft und beruhigend bis zu ihr herauf dringt. Ja, es gefällt ihr. Fast hat sie das Gefühl, er würde zu ihr sprechen, als wollte er sich mit ihr unterhalten.
Langsam zieht sie sich aus, legt ihre Kleider ordentlich auf einen Stuhl und kriecht nur mit ihrem Hemdchen bekleidet ins Bett. Es ist kalt und klamm, aber die Daunendecke ist dick und puffig. Sicher wird sie bald warm werden. Die Tante hat vergessen, ihr Nachtzeug mit nach oben zu nehmen. Sie hat auch vergessen, ihr Badezimmer und Toilette zu zeigen.
Im Augenblick aber vermisst Isabel beides nicht. Sie ist nur müde. So unglaublich müde, und das ist gut so. Denn wenn diese ungeheure Müdigkeit nachlässt, kommt das Schreckliche, das Unglaubliche auf sie zu. Dann kann sie wieder fühlen und denken und die grässlichen Erlebnisse des Tages stehen erneut vor ihr auf, bedrängen sie unerbittlich und machen ihr klar, was geschehen ist.
Und dann muss sie begreifen, dass alles, alles kein Traum, sondern Wirklichkeit ist! Dann wird die furchtbare Wahrheit auf sie einstürzen. Grausame Wirklichkeit für ein kleines Mädchen, das vor ganz kurzer Zeit das Schrecklichste erlebt hat, was einem Kind geschehen kann.
Ein grauer Nebel, feucht und schwammig wie getränkte Watte, senkt sich über das Land. Er scheint nahezu alles einzuhüllen und nach und nach den Blicken zu entziehen. Die struppigen Büsche am Wegesrand kauern am Boden wie zum Sprung bereite Kobolde.
Der Weg über den Friedhof ist vom Regen aufgeweicht, und die schwarzgekleideten Gestalten, die in langsamer Prozession dahinschreiten, sinken mit ihren schwarzen, blankgeputzten Schuhen tief in den dunklen Schlamm ein.
Isabel geht mitten unter diesen Gestalten, aber ihr Mäntelchen ist nicht schwarz, es ist rot. Niemandem ist in den Sinn gekommen, dem Kind schwarze Kleidung anzuziehen, es besitzt ja auch gar keine. Und wer hätte in diesen Tagen des Tumults und des Grauens mit dem kleinen Mädchen in ein Geschäft gehen sollen, um ihm Trauerkleidung zu besorgen.
Wozu auch?
Isabel starrt die düsteren Gestalten an, die wie Phantome durch den Nebel gleiten, dann schaut sie an ihrem eigenen Mäntelchen hinab. Ihr Blick bleibt auf den roten Winterstiefelchen haften, die bis zu den Knöcheln mit Schlamm bedeckt sind. Dann wandert ihr Blick weiter, hinauf zu dem Gesicht der fremden Frau, deren Hand die ihre umfasst hält. Dieses Gesicht ist zur Hälfte hinter einem schwarzen Schleier verborgen, der von der Hutkrempe herab hängt. Es ist ein verschlossenes, kühles Gesicht, sie hat es nie zuvor gesehen.
So ist es mit fast allen diesen Menschen, in deren Mitte sie hier geht. Sie alle sind ihr fremd, bis auf den Doktor und drei oder vier Onkel und Tanten, die sie wenige Male im elterlichen Haus getroffen hat.
Isabel weiß, wem diese feierliche Inszenierung gilt und wohin man geht. Sie weiß, dass Mama und Papa jetzt, in diesem Augenblick, zu Grabe getragen werden, weil sie tot sind. Bei einem Autounfall ums Leben gekommen auf tragische Weise, beide starben noch am Unfallort. All das hat man ihr gesagt, so behutsam und freundlich es eben möglich war. Isabel hat alles gehört und die Worte verstanden, schließlich ist sie sieben Jahre alt und kein Baby mehr. Sie hört, was man ihr sagt, sie tut, was man ihr aufträgt, und sie antwortet, wenn man mit ihr spricht.
Oh ja, Isabel hat gehört, was man ihr sagte, aber noch ist nichts davon wirklich in ihr Bewusstsein gedrungen. Sie hat sich in einen Kokon zurückgezogen, der sie schützend umhüllt.
Nun steht sie inmitten all der schwarzgekleideten Menschen an dem breiten Doppelgrab. Sie beugt den Kopf und sieht zur Erde nieder, als der Pastor zu reden beginnt. Sie lauscht seinen Worten und fragt sich dabei, warum diese Worte keinen Sinn für sie haben. Sie steht ganz still, ganz allein. Sie hebt den Blick und sieht gebeugte Menschen, hört Schluchzen und verhaltenes Weinen, die tragende Stimme des Pastors.
All das kann nur ein böser Traum sein, aus dem sie jeden Augenblick erwachen wird. Die Eltern sind daheim und schauen längst nach ihr aus. Das Mädchen Milena hat bestimmt schon den Kamin angeheizt, die Mutter sitzt davor und wartet auf sie, fröstelnd mit zusammen gezogenen Schultern, wie sie es immer tut bei so einem Wetter.
Während der Pastor die letzten Worte spricht, die Trauergemeinde langsam den Rückzug antritt und durch den Nebel wandert, ist es vor Isabels Augen hell geworden. Sie blickt durch ein erleuchtetes Fenster in ein warmes, freundliches Zimmer, ein flackerndes Kaminfeuer darin, und dort in dem tiefen, geblümten Sessel die Mutter. Ihr blondes Haar hängt über die Lehne herab und schimmert im Feuerschein ganz golden, ihre blauen Augen lachen das Kind Isabel an, und liebevoll zieht die Mutter es auf ihren Schoß.
Und während draußen die Bäume schwarz und kahl im grauen Nebel stehen, ist drinnen alles hell und warm. Und Isabel ist daheim bei der Mutter, eng an sie geschmiegt auf ihrem Schoß, und die Mutter wiegt sie in ihrem Arm wie ein ganz kleines Kind, und alles ist gut.
Die Nacht
Isabel erwacht in der Dunkelheit. Sie ist allein in einem fremden Raum, das spürt sie, noch bevor sie die Augen aufschlägt.
Die Mutter ist fort, und auch das warme Kaminfeuer in dem hellen, freundlichen Zimmer ihrer Kinderzeit. Auf einmal kommt es ihr so vor, als sei diese Kinderzeit unendlich lange her und so lange schon vorbei. Mit jähem Schrecken wird ihr bewusst, wo sie sich befindet.
Ihr Herz beginnt wie wild zu hämmern. Eine plötzliche Furcht jagt ihr einen Schauer durch den Körper, und die schreckliche Wahrheit ist da!
Mutter und Vater sind fort – für immer. Sie sind tot, und das heißt: Niemals mehr wird Isabel sie wiedersehen! Niemals mehr wird sie zur Mutter laufen, wenn sie gefallen ist; nie mehr dem Vater entgegen stürmen, wenn er abends heimkommt. Nie mehr ihre Stimmen hören und ihre Hände fühlen, in ihre Gesichter blicken, wenn sie sich beim Gutenachtsagen über ihr Bett beugen. Nie mehr die Arme des Vaters spüren, wenn er sie auf die Schaukel hebt. Und nie mehr nachts zu ihnen ins Bett hüpfen, wenn sie nicht schlafen kann.
Nie mehr … nie mehr … nie mehr!
Es ist so grässlich, so entsetzlich und grausam, dieses »nie mehr«, dass Isabel es schleunigst loswerden muss. Sie kann es nicht aushalten. Es ist zu schlimm, zu traurig, zu furchtbar.
Was soll sie in diesem riesigen, unheimlichen Haus? Bei dieser kalten, fremden Frau?
Für immer und immer und immer! Wie um alles in der Welt soll sie das aushalten? Es ist doch ganz und gar unmöglich. Es kann doch alles gar nicht wahr und wirklich sein.
Isabel weiß aber, dass es wahr und wirklich ist. Das ist das Schlimme am Tod: er ist für immer und unwiderruflich.
Ein Gefühl der Leere, der Verlassenheit und der Furcht schleicht sich heran und legt sich wie eine kalte Hand um ihr Herz. Plötzlich packen Kummer und Leid sie wir ein überwältigender Schmerz, eine würgende Sehnsucht nach den beiden Menschen, die für sie das Wichtigste im Leben waren, und die sie niemals wieder sehen wird.
Isabel weint. Sie weint so sehr und so lange, bis sie kaum noch atmen kann. Lange Zeit liegt sie da, die Augen brennen wie Feuer und sind ganz verschwollen, das Gesicht ist heiß, und jeder Atemzug schneidet ihr in die Kehle. Sie hat das Gefühl, nun hätte sie alle Tränen, die jemals in ihr waren, aus sich heraus geweint. Sie fühlt sich matt und leer und ganz schwindlig. Sie liegt still und ganz gerade ausgestreckt in ihrem Bett und horcht in sich hinein. Sie versucht zu fühlen, was noch in ihr ist, tastet und spürt tief in sich hinein, als tauche sie in unergründliche Tiefen, um hervorzuholen, was noch da ist an Gefühl, an Schmerz und Kummer.
Und während sie noch in sich hinein spürt, nimmt sie auf einmal das Geräusch wieder wahr, das Rauschen des Flusses. Mit seiner murmelnden, beruhigenden Stimme spricht er zu ihr. Isabel liegt mit geschlossenen Augen da und lauscht. Sie konzentriert sich ganz und gar auf das Rauschen, und all ihr Kummer tritt so nach und nach in den Hintergrund.
Sie lauscht der murmelnden Stimme und sieht das Wasser vor sich in seinen ständig wechselnden Schattierungen, in seiner immerwährenden Bewegung. Hinter ihren geschlossenen Lidern ist ein goldener Sommertag. Der Himmel über ihr ist blau mit nur ganz wenigen ziehenden Schäfchenwolken. Sie sitzt im hohen Gras am mit Weiden bewachsenen Ufer des Flusses und blickt auf das Spiel von Licht und Schatten über dem Wasser.
Plötzlich ziehen dunkle Wolken herauf und ein kühler Wind streicht über ihr Gesicht. Ringsumher wird es kalt und grau. Eine ferne Erinnerung flackert auf.
Da ist auf einmal die Stimme der Mutter, die sagt: »Geh nicht so nah ans Ufer, das ist gefährlich.«
Isabel blickt auf das Wasser, es ist braun und schwer wie Sirup. Man kann nicht auf den Grund sehen, aber das kann man ja nie bei einem Teich. Denn es ist ein Teich, an dessen Ufer Isabel sitzt, und vor dem die Mutter sie warnt.
»Er ist tief, und du weißt, wer dort unten wohnt, auf seinem Grund. Geh nicht zu nah heran, er könnte dich packen und zu sich herab ziehen.«
»Ist er denn böse?«
»Nur zu ungehorsamen Kindern, die ihm zu nahe kommen.«
»Ich bin aber doch nicht ungehorsam.«
»Wenn du zu nah ans Wasser trittst, dann schon.«
Die kleine Isabel starrt angestrengt auf das dunkle Wasser. Dort ganz tief unten wohnt er also, inmitten all der Unterwassergeschöpfe, die in dem morastigen Schlamm über den Boden kriechen. Vielleicht auch Kinder wie sie, die ungehorsam gewesen sind. Die ihm zu nah gekommen waren, so dass er sie zu sich herunter holen musste. Und dort hausen sie nun, in seiner düsteren, sonnenlosen, nächtlichen Welt, Neptuns Welt.
Ob sie dort atmen können?
Isabel weiß, dass man im Wasser ertrinken kann, aber wie ist es, wenn man dort wohnt? Bei ihm, Neptun mit den feurigen Augen und dem Schuppenschwanz. Er atmet ja auch in seiner Unterwasserwelt, und wenn er kleine Kinder zu sich holt, so werden sie ja vielleicht genau wie er. Ihnen wächst ein silbriger Fischschwanz, sie bekommen Kiemen, sie werden zu einer Nixe. Denn Neptun kann alles, er ist ein Gott, ein Wassergott. Und Götter können nun mal alles.
Was sollte er auch mit ertrunkenen, toten Kindern dort unten in seinem Reich? Mit kleinen lebendigen Nixen jedoch ist das ganz etwas anderes. Und wer weiß, vielleicht ist es ja ganz lustig da auf dem Grund, eine geheimnisvolle, aufregende Welt für sich. Vielleicht kommt manchmal die Sonne hin und zaubert grüne und goldene Lichter in die dunkle Tiefe, und inmitten der sich wiegenden Schlingpflanzen und Unterwasserblumen huschen niedliche kleine Fische und Wasserschlangen durch das grün goldene Blitzen und Leuchten.
»Werde ich dann zu einer Nixe, wenn Neptun mich holt?« fragt Isabel die Mutter.
»Was fällt dir ein?« fährt diese sie an. »Du ertrinkst jämmerlich und dann bist du tot.«
»Aber Neptun ist ein Wassergott, und Götter können alles.«
»Die Götter der Mythologie sind launische Götter. Menschen, die an sie glaubten, sahen zu, sich gut mit ihnen zu stellen. Sonst konnte es ihnen schlecht ergehen.«
Das alles ist doch sehr verwirrend und scheint der kleinen Isabel nicht recht zu dem zu passen, was sie sonst schon von Gott gehört hat.
Um etwas Klarheit in diese Sache zu bringen, forscht sie weiter: »Es gab also viele Götter, nicht nur den einen, wie heute?«
»In der Mythologie wurden viele Götter verehrt. Sie beherrschten jeweils verschiedene Bereiche der Welt oder des Lebens. Es gab Kriegs-, Wetter-, Meeres- und Liebesgötter. Und noch andere. So war zum Beispiel Poseidon der Gott des Meeres und Fortuna die Göttin des Glücks.«
Du liebe Zeit, wie verwirrend. Aber irgendwie doch auch einleuchtend und interessant. Einleuchtend darum, weil doch schließlich ein einzelner Gott nie und nimmer für alles allein zuständig sein kann.
»Das war früher? Und heute gibt es nur noch einen Gott? Und alle Menschen wissen das?«
Die Mutter seufzt.
»Es gibt viele Religionen, und die Menschen glauben längst nicht alle das Gleiche. Jedenfalls – in der römischen und griechischen Mythologie gab es eine Vielzahl von Göttern. Die alten Griechen verehrten Zeus als obersten Gott. Ihm untergeordnet auf dem Olymp waren seine Gemahlin Hera, Poseidon, Demeter, Apoll, Artemis, Hermes, Ares, Aphrodite, Athene und andere. Die Menschen verehrten die Götter in Tempeln. Den Willen der Götter suchte man durch Orakel zu erkunden. Hinter den Göttern standen als letzte Instanz des Schicksals die Moiren und …«
Isabel kann den Worten der Mutter nicht mehr folgen.
Das ist ja auch zu verwirrend. Diese Menge von Göttern – wer soll sich da noch auskennen. Und nun gab es auch noch den Göttern übergeordnete Wesen!
Aber das muss wohl alles in früherer Zeit gewesen sein. Heutzutage hat man so eine Götteransammlung nicht mehr. Da gibt es nur noch einen Gott, nämlich den, der dort oben im Himmel wohnt, und zu dem Isabel jeden Abend betet. Gott hat natürlich noch einen Sohn, das weiß Isabel. Und die Mutter Maria lebt auch noch bei ihnen. Und all die Jünger Jesu und …
Nun ja, auch eine Menge Leute da oben im Himmel, aber schließlich doch nur ein einziger Gott.
Und Neptun?
Was ist mit dem? Scheinbar lebt der doch auch noch da unten in seinem Reich. Oder ist er inzwischen gestorben, so wie all die anderen griechischen und römischen Götter? Können Götter denn überhaupt sterben?
Wenn ja, so waren es möglicherweise gar keine richtigen Götter. Lügner und Betrüger vielleicht, die sich einen Vorteil davon versprachen, sich als solche auszugeben.
Oder hat gar die Mutter all diese Geschichten erfunden? Oder gelesen, sie liest ja die ganze Nacht und den halben Tag noch dazu. Und was in den Büchern steht, kann man nicht alles glauben, das weiß Isabel. Man denke doch nur mal an die Märchen! Das sind ausgedachte Geschichten – jeder weiß es.
Und was die Mutter und ihre Geschichten betrifft: Isabel hat schon manches Mal gedacht, dass da nicht alles der Wahrheit entspricht. Die Mutter denkt sich mitunter selber Geschichten aus, oder sie dreht sich die Wahrheit ein wenig zurecht, so dass sie ihr besser gefällt, als sie ist.
Ob man das so machen darf, ist Isabel nicht so ganz klar. Die Mutter jedenfalls macht es, und Isabel weiß das. Nur ist es manchmal schwierig, die Dinge auseinander zu halten, das Wirkliche und das Hinzugedachte.
»Und was ist nun mit Neptun? Gibt es den wirklich?« will Isabel fragen, aber dann lässt sie es. Vielleicht erfindet die Mutter wieder nur eine neue Geschichte, und die kann sie sich auch selber ausdenken.
Neptun ist groß und schön und mächtig, mit silbernem Schuppenschwanz, glühenden Augen und seinem blinkenden Dreizack in der Hand. Er hat feuerrotes, ganz langes Haar, das beim Schwimmen hinter ihm durch das Wasser gleitet wie ein gewaltiger, schimmernder Fächer. Er ist launisch, also manchmal gut und manchmal weniger gut oder sogar böse. Je nachdem, wie man ihm begegnet. Zu ihr, Isabel, würde er sicher nicht böse sein.
Isabel denkt an das sanfte Murmeln des Flusses, es ist schön und beruhigend. Es macht, dass sie ihren Kummer vergisst und es in ihr ganz friedlich wird. Das ist sicher seine, Neptuns, Stimme. Auf diese Weise spricht er mit ihr, und sie wird ihm aufmerksam zuhören, um ihn mit der Zeit immer besser zu verstehen.
Und bald wird sie ihn besuchen, vielleicht gleich morgen. Natürlich wird sie nicht in den Fluss steigen, so dumm ist sie schließlich nicht.
Und allzu nah will sie auch nicht ans Wasser gehen, denn im Augenblick hat sie keine Lust auf ein Nixendasein in der Unterwasserwelt. Sie wird nur gerade eben so dicht heran gehen, dass sie in das braune Wasser schauen kann.
Und wer weiß, vielleicht erblickt sie eine blinkende Speerspitze seines silbernen Dreizacks.
Isabel schläft, und das Murmeln des Flusses begleitet sie in ihrem Traum.
Der Morgen
Der Morgen ist da, grau und sonnenlos, ein dunkler Tag im März. Der Nebel jedoch ist fort.
Isabel erwacht und hört den Fluss. Sein Rauschen scheint ihr ein wenig anders zu klingen als in der Nacht. Sie öffnet die Augen und blickt auf die Wand, an der ihr Bett steht. Sie sieht eine verblichene Blumentapete, dichte Sträuße von Mohn und Margeriten, dazwischen ehemals grüne Efeuranken, die jetzt ebenso verblichen sind wie der Mohn und die Margeriten. Alles in allem aber findet Isabel die Tapete schön. Es gefällt ihr, am Morgen als erstes auf Blumen und Ranken zu schauen. Daheim waren alle Wände schlicht weiß oder elfenbeinfarben, allenfalls lindgrün oder taubenblau. Daheim war alles anders …
Schnell verscheucht Isabel die schwarzen Gedanken, die da kommen wollen, und auch die Tränen, die sich schon wieder in die Augen drängen. Ihr Blick wandert über die Blumen an der Wand.
Da hängt ein Bild. Es zeigt eine hölzerne Brücke, die über einen Fluss führt und im Hintergrund Hügel, Wiesen und einen Wald. Ein Mädchen steht auf der Brücke und blickt ins Wasser, die Wiesen und Hügel sind sehr grün und der Waldstreifen am Horizont blauschwarz. Über alledem spannt sich ein blauer Himmel und die Sonne spiegelt sich im blaugrauen Wasser des Flusses.
Es scheint ein sehr altes Bild zu sein, von jemandem gemalt, der Pjeterow oder so ähnlich geheißen hat. Der Rahmen ist breit und golden, er war es jedenfalls mal. Jetzt ist sein Gold ein wenig abgestoßen und stumpf, aber das stört weiter nicht.
Isabel ist davon überzeugt, dass es ein Bild des Flusses da draußen ist. Sicher wird sie irgendwann diese Brücke finden.
Was muss sie nun tun? Sicher aufstehen und ins Badezimmer gehen. Aber sie weiß noch nicht einmal, wo das Bad ist.
Im Haus ist noch alles still. Sie schlüpft aus dem Bett und geht ans Fenster. Wird sie den Fluss von hier aus sehen?
Zunächst sieht sie nur das knorrige Geäst eines Baumes, der direkt vor ihrem Fenster seine kahlen Äste in den Himmel reckt. Isabel kniet sich auf einen Stuhl und blickt hinaus. Dort unten ist die breite Kieseinfahrt, da sind sie gestern Abend angekommen. Die Einfahrt wird von einer hohen Hecke begrenzt, dahinter liegt die Straße und hinter der Straße kann Isabel viele Bäume und hin und wieder das graugrüne Rechteck einer Wiese erkennen, dahinter sind Hügel.
Das Haus ist an drei Seiten von hohen alten Bäumen umgeben, fast wie ein Park kommt es ihr vor.
Und wo ist der Fluss? Vielleicht weit vorn hinter der Straße, dort wo die Wiesen beginnen.
Isabel fröstelt. Sie hat nur ihr dünnes Hemdchen an, und im Zimmer ist es nicht sehr warm. Sie schlüpft wieder ins Bett und betrachtet zum ersten Mal bewusst das Zimmer, in dem sie nun leben soll.
Es ist ein großes Zimmer. Vor den drei hohen Fenstern stehen gepolsterte Stühle und ein kleiner Tisch. Eine ganze Wand wird fast von einem riesigen Schrank eingenommen. Er ist aus dunklem Holz und hat zum Teil in der oberen Hälfte Glasscheiben. Isabel sieht eine Unmenge Bücher dahinter. Das Bett steht ihm gegenüber. Es ist breit und mit hoher, geschnitzter Lehne aus dem gleichen dunklen Holz wie der Schrank. Daneben steht ein Nachttisch, ein Lämpchen mit rosa Schirm darauf. Dann gibt es noch zwei tiefe, altmodische Sessel mit bunten Bezügen, eine lange Kommode, ein gewaltiger Schreibtisch in einer Ecke und zwei weitere Tischchen mit geschwungenen Beinen und Fransendeckchen darauf.
Unzählige Nippsachen stehen herum, Porzellanfiguren, Schalen mit künstlichen Früchten, Vasen mit getrockneten oder künstlichen Blumen, Fotos in altmodischen Rahmen und verschnörkelte Kerzenhalter.
Ein merkwürdiges Zimmer ist das, denkt Isabel. Jedenfalls kein Kinderzimmer. Eher ein Raum für eine alte Dame, die inmitten von Erinnerungsstücken ihrem baldigen Tode entgegen wartet.
Und doch ist es auch gemütlich. Auf dem Boden liegt ein dicker Teppich mit üppigem Blumenmuster, vor dem Bett ein flauschiger Läufer.
Isabel hockt im Bett, die Decke bis zum Kinn hoch gezogen, und ihr Blick wandert durch den Raum. Sie hört das Rauschen des Flusses und plötzlich noch etwas anderes, ein fernes Klopfen und Scharren, als würden Möbel geschoben.
Ist das die Tante? Gerade als Isabel aufstehen und sich auf die Suche nach dem Badezimmer machen will, klopft es an die Tür. Im nächsten Augenblick steht die Tante im Türrahmen, sehr groß und aufrecht, in einem dunklen Kleid, dessen hochgestellter Kragen vorn mit einer blinkenden Brosche zusammen gehalten wird.
Das Gesicht der Tante ist ernst und blass und hager, kaum Farbe darin, die Lippen schmal und die Augenbrauen ebenfalls. Das Haar ist von unbestimmter Farbe, leicht bräunlich, von aschblonden Strähnen durchzogen. Sie trägt es aufgesteckt, in der Stirn ist es ein wenig gelockt, was ihrem Gesicht einen weichen Zug verleiht. Ihre Augen sind von einem dunklen Grau und das Schönste an ihr.
»Guten Morgen, mein Kind,« sagt sie und die Stimme klingt freundlich.
»Hast du gut geschlafen? Hier bringe ich deine Reisetasche. Die haben wir gestern Abend ganz vergessen. Den großen Koffer wird Olaf später herauf bringen. Und nun komm, damit ich dir das Badezimmer zeige. Das haben wir gestern auch völlig vergessen.«
Isabel tappt auf bloßen Füßen hinter der Tante her über den schummrigen Korridor.
Sie gehen an vielen geschlossenen Türen vorbei, dann um eine Ecke und noch ein Stückchen weiter. Dort gabelt sich der Korridor, ein schmaler Gang führt zu einer Treppe ins Obergeschoss, ein anderer zu einer weiteren Reihe von Türen. Alles liegt in schummrigem Halbdunkel, Isabel ist nicht ganz klar, woher dieses Dämmerlicht kommt.
Endlich haben sie das Badezimmer erreicht. Isabel schaudert es bei dem Gedanken, in der Nacht einmal hierher gehen zu müssen.
»Es ist ja so weit weg,« stammelt sie leise.
»Du gewöhnst dich bald daran,« sagt die Tante. »Wenn du fertig bist, komm hinunter. Dann frühstücken wir zusammen in der Küche.«
Isabel steht allein in dem riesengroßen, blau gekachelten Bad, es ist nur mäßig warm darin. Eine mächtige Wanne auf Klauenfüßen steht an einer Wand, eine Dusche mit Vorhang befindet sich in einer Ecke, Waschbecken und Toilette an der anderen Wand. An den Wänden stehen weiße Schränke, auf einem hohen Bord liegen Stöße von dicken weißen und blauen Handtüchern. Das Fenster ist so hoch, dass Isabel auf den Hocker steigen müsste, um hinaussehen zu können.
Ach, wie ist das alles doch so fremd und anders als alles, was sie gewohnt ist. Und niemand da, der ihr zeigt, wie diese merkwürdigen Wasserhähne an der Dusche oder über der Wanne funktionieren.
Eine Zahnbürste hat sie auch nicht, von einem Bademantel ganz zu schweigen. Isabel wäscht sich so gut es geht, Seife und Handtücher sind ja da. Dann nimmt sie eines der großen blauen Badetücher um die Schultern und läuft auf bloßen Füßen über den Korridor zurück.
Gott sei Dank, sie hat sich nicht verlaufen, wie sie anfangs befürchtet hatte.
Vor ihrer Zimmertür verharrt sie einen Augenblick. War da eben nicht wieder das Scharren und Klopfen? Und jetzt wieder. Ganz deutlich hat Isabel es gehört. Es kommt vom anderen Ende des Korridors. Sicher ist es die Tante, die dort in einem der Zimmer rumort. Isabel steht und horcht.
Ein dumpfes Dröhnen dringt von unten herauf. Es ist der Türklopfer, den jemand kräftig von außen an die Eingangstür schlägt. Sie fährt erschrocken zusammen. Im nächsten Augenblick klappt im Erdgeschoss eine Tür, dann schnelle Schritte auf den Fliesen, und die schwere Außentür wird unter Knarren und Scharren aufgezogen.
Stimmen im Flur, eine männliche, eine weibliche.
»Bring ihn gleich nach oben,« hört Isabel die Tante sagen. Schnell schlüpft sie in ihr Zimmer. Sicher ist das der Olaf mit ihrem Koffer, den er nun gleich heraufbringen wird. Sie wickelt sich fest in ihr Handtuch und wartet. Sie hört schwere Schritte gemächlich herauf stapfen, dann dieselben schweren Schritte heran traben, dann klopft es.
»Ja, bitte,« sagt Isabel zaghaft und im gleichen Moment wird die Tür aufgerissen. Ein großer Mann in einer Cordjacke steht vor ihr, mit grauem Haar und mächtigem, grauem Bart. Seine Augen unter den buschigen Brauen blicken sie gutmütig an.
»So, Kleinchen, da ist der Koffer,« sagt er und seine Stimme ist tief und warm.
»Nun hast du hoffentlich erst mal, was du brauchst.«
Er macht zwei Schritte auf Isabel zu und streckt ihr eine braune Männerfaust entgegen.
»Ich bin der Olaf und oft da unten anzutreffen.« Er zeigt mit der Hand in den Garten. »Da beim Gartenhäuschen, wo der alte Brunnen ist. Wenn was ist – kannst immer zu mir kommen.«
Seine raue Pranke streicht ihr kurz übers Haar, dann ist er zur Tür hinaus.
Isabel macht sich daran, aus Reisetasche und Koffer ein paar Sachen zum Anziehen heraus zu suchen. Endlich ist sie angezogen und blickt auf all die Dinge, die nun in ihre neuen Schränke eingeräumt werden müssen. Soll sie das ganz allein machen? Nie zuvor hat sie so etwas getan. Hoffentlich ist überhaupt Platz in dem schwarzen riesigen Schrank.
Ach Gott, es ist alles so schrecklich. Sie kann sich gar nicht zurecht finden. Mit ihrer Haarbürste in der Hand sitzt sie auf dem Stuhl und versucht, dem langen, zottigen Gelock auf ihrem Kopf Herr zu werden.
Dabei hat ihr sonst immer das Mädchen Milena geholfen. Dann saß sie in ihrem Bademäntelchen auf dem weißen Höckerchen im warmen Badezimmer, durch das breite Fenster schien die Sonne herein, und vom Erdgeschoss tönte die lustige Stimme des Vaters herauf: »Wo bleibt mein Mädchen? Soll ich etwa allein frühstücken?«
Und Milena lachte und zückte die Haarbürste und sagte: »Meine Güte, Isa, was hast du für Locken! So wie die Mama, nur sind deine braun und die der Mama hellblond.«
Und dann war sie fertig, die braunen Locken waren zu einem wippenden Pferdeschwanz gebunden, und Isabel lief die Treppe hinunter, geradeswegs dem Vater in die Arme. Isabel lässt die Haarbürste sinken und fängt an zu weinen. Die Bürste fällt zu Boden und Isabel rutscht hinter ihr her. Da kauert sie auf dem geblümten, ausgeblichenen Teppich, Kopf und Arme auf dem Stuhl, und weint bitterlich.
Ich bin so allein, denkt sie über alle Maßen verzweifelt. Ich bin so allein wie noch nie im Leben, und ich bin doch erst sieben. Allein und verlassen, und so wird es nun bleiben.
Sie weint und schluchzt so laut, dass sie das Rauschen des Flusses nicht mehr hören kann. Aber da ist auf einmal etwas anderes, das sie hören kann: die Stimme des Vaters. Ach, die Stimme des Vaters, sie kann es kaum glauben. Ganz deutlich hört Isabel sie in ihrem Kopf: »Du bist niemals ganz allein, meine Kleine. Es gibt jemanden, der immer in deiner Nähe ist und auf dich acht gibt. Das ist dein Schutzengel. Er ist immer da, du kannst dich auf ihn verlassen. Er ist da, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Und wenn du einmal nicht weiter weißt, dann sei ganz still und hör ihm zu. Er wird dir immer sagen, was du zu tun hast, denn er weiß immer das Richtige für dich.«
Isabel hebt lauschend den Kopf. Die Stimme des Vaters ist fort, und nun hofft sie, die Stimme ihres Schutzengels zu hören, aber da ist nichts. Gar nichts, nur das Rauschen des Flusses, sanft und stetig.
Was hat der Vater gesagt? »Du musst Geduld haben. Manchmal hört man ihn nicht gleich. Versuch es immer wieder, bis es klappt. Er spricht sehr leise, und du hörst ihn nur in deinem Kopf.«
Isabel setzt sich auf einen Stuhl, schließt die Augen und lauscht. Ihre Gedanken machen sich selbständig, huschen davon. Wie mag er aussehen, der Schutzengel? Isabel hat schon einige Engel gesehen, in Bilderbüchern und die künstlichen Weihnachtsengel auf dem Christbaum. Engel sind hell und leuchtend, schimmernde Gestalten, um die Schultern schwingendes langes Haar, und sie haben weiße, gespreizte Flügel, die sich heben und senken können. Und die Gesichter – wie sind ihre Gesichter? Und wie ist das Gesicht ihres Schutzengels? Vielleicht wie das Gesicht der Mutter, hell und freundlich und auch voller Ernst und Frieden … aber nein, das Gesicht der Mutter ist nicht immer voller Frieden … durchaus nicht …später, später ist es zerquält und manchmal auch … nein, nicht daran denken …an den Schutzengel denken … eine Vision aus Licht …seine Stimme … sie hört seine Stimme nicht …Wie kann sie auch, denn sie ist eingeschlafen.
Isabel fährt von ihrem Stuhl hoch. Eine Tür hat geklappt. Hat jemand nach ihr gerufen? Sie rappelt sich mühsam auf, bückt sich nach der Haarbürste und macht sich daran, das Lockengewirr zu ordnen. Ich will nicht wieder weinen, denkt sie. Ich muss lernen, die Stimme des Schutzengels zu hören. Wie hat der Vater gesagt? »Du musst geduldig sein und es immer wieder versuchen.«
Ob es auch möglich ist, den Engel zu sehen? Am Abend, wenn sie in ihrem Bett liegt und ins dunkle Zimmer starrt? Vielleicht wenn sie ganz, ganz fest daran glaubt? Hat die Mutter nicht gesagt, wenn man ganz stark an etwas glaubt, dann geschieht es auch?
Aber die Mutter hat so viele Dinge gesagt und so viele Geschichten erzählt …
Isabel ist verwirrt und verstört. Noch einen Augenblick sitzt sie auf ihrem Stuhl, unschlüssig, was jetzt zu tun ist. Dann weiß sie es. Unten wartet die Tante auf sie. Und hinten beim Brunnen Olaf. Sie ist nicht ganz allein!
Lorenzo
Die Küche ist warm und groß, mit schwarz-weiß gemusterten Fliesen am Boden und schweren, verräucherten Eichenbalken an der hohen Decke. An den Wänden reihen sich mächtige, altmodische Schränke dicht aneinander. Auf Borden stapelt sich blau-weißes Küchenporzellan neben blinkendem Kupfergeschirr. An einer Wand residiert ein gewaltiger, schwarzer Herd, daneben ein moderner, blitzender, elektrischer. Auf den Fensterbänken blühen rosa Geranien und weiße Begonien in roten Keramiktöpfen um die Wette. Eine Ecke wird ganz ausgefüllt von einem enormen Spülbecken aus Steingut. Daneben thront auf einem Tischchen ein riesiger buschiger Farn. Seine fedrigen Wedel sind so makellos geschwungen und saftig grün, dass Isabel anfangs glaubt, er könne nur künstlich sein.
Vor einem der hohen Fenster, die in den verwilderten Park hinausgehen, steht ein Schaukelstuhl mit bunten Kissen darauf, ein hölzernes Fußbänkchen daneben.
In der Mitte des Raumes prangt ein gewaltiger Eichentisch, aber nur vier Stühle umringen ihn.
Isabel sitzt der Tante gegenüber und würgt an ihrem Brötchen, das gar nicht herunter will. Die Tante scheint auch keinen großen Appetit zu haben. In Gedanken versunken sitzt sie da und knabbert an einem Käsebrot herum, als ob eine Granate in seiner Mitte stecken könnte. Nun scheint sie sich des Kindes an ihrer Seite bewusst zu werden. Besorgt und ratlos blickt sie auf den braunen Kopf hinunter.
Mühsam sucht sie nach Worten. Es scheint so schwierig, mit Kindern umzugehen. Irgendwie hat sie es sich einfacher vorgestellt. Oder vielmehr, sie hat sich gar nichts so recht vorgestellt. Kinder schlafen, essen und trinken, gehen in die Schule und spielen. Wenn sie etwas möchten, sagen sie Bescheid, und wenn ihnen etwas wehtut, tun sie dasselbe und dann kommt der Doktor. Man verabreicht ihnen nach Vorschrift Medikamente, macht Wadenwickel und liest ihnen vor, bis sie wieder gesund sind. Man sorgt für ausreichend Kleidung, kauft hin und wieder ein paar Spielsachen und geht mit ihnen in den Zoo. Damit hat es sich, und eines Tages sind sie groß.
Über all das hat die Tante sich natürlich nicht so ausführlich Gedanken gemacht, aber so ähnlich hätte sie es spontan formuliert, wenn man sie gefragt hätte.
Und vielleicht kommt es ja auch noch so, eines Tages. Im Augenblick jedoch ist sie einigermaßen ratlos. Was tut man mit einem kleinen siebenjährigen Mädchen, das einem so plötzlich ins Haus geschneit kommt und das einem fast fremd ist? Und das so stumm und abweisend dasitzt. Hätte sie sich doch lieber nicht darauf eingelassen!
Nun ja, jetzt ist die Kleine einmal hier und sie will doch nichts unversucht lassen, dem Kind ein neues Zuhause zu geben. Das ist sie schließlich ihrem verstorbenen Bruder und seiner Frau schuldig.
Sie gibt sich einen Ruck.
»Ich weiß ja, dass es im Augenblick schwer für dich ist,« sagt sie und legt ihre lange, dünne Hand auf die kleine, runde des Kindes, die neben ihr auf dem Tisch liegt.
»Es ist schlimm, was da passiert ist. Aber warte nur ein wenig, mit jedem Tag wird es ein bisschen besser. Mit der Zeit wirst du dich hier ganz zu Hause fühlen und wenn du erst wieder mit der Schule anfängst …«
»Muss ich in eine fremde Schule gehen?«
Die Stimme des Kindes klingt furchtsam und ein wenig zittrig.
Die Tante nickt und macht eine bedauernde Miene.
»Leider ja. Aber mach dir keine Sorgen, ganz bald wirst du dich einleben und nette Schulkameraden kennen lernen. Die neue Schule ist im Städtchen, etwa zwei bis drei Kilometer von hier. Wir wohnen nun mal etwas abgelegen hier am Fluss. Es kommt aber morgens und mittags ein Bus, mit dem wirst du fahren. Wenn du älter bist - vielleicht schon in einem Jahr oder so - kannst du im Sommer mit dem Rad ins Städtchen fahren und später … «
Da ist es wieder, das »Später« und »in einem Jahr«, die ganze unendliche Zeit der Zukunft, die sich vor ihr ausdehnt und in der sie hier zu Hause sein soll!
Denn in ihr früheres Zuhause wird sie nie mehr zurück kehren, nie mehr …nie mehr …
Die weiteren Worte der Tante hört Isabel nicht, sie rauschen wie von fern an ihr vorbei.
»Isabel, hörst du mir auch zu? Ist dir nicht gut? Du bist so blass geworden.«
Isabel schreckt auf und blickt die Tante starr an.
»Ich hab Angst,« will sie sagen, aber sie bringt kein Wort hervor. Stumm blickt sie zur Tante auf. Diese scheint plötzlich etwas in den Augen des Kindes zu sehen, das ihr eine Ahnung vermittelt von dem, was in dem kleinen Mädchen vorgehen mag.
»Ach, meine arme Kleine,« sagt sie leise und ihre Stimme ist voller Mitleid. »Ich kann mir ja denken, wie dir zumute ist. Aber sieh mal, ich bin ja auch noch da. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht gut, aber das kommt schon noch. Glaubst du nicht auch, dass wir uns ganz gut verstehen werden?«
»Ja, Tante,« flüstert Isabel, weil die Tante sie gar so eindringlich anblickt.
»Du kannst Tante Elisa zu mir sagen, Tante allein klingt so dumm, nicht wahr? Ich bin ja die Schwester deines verstorbenen Papas, wir sind doch verwandt.«
Sie mustert das ungegessene Brötchen auf Isabels Teller. »Nun iss doch ein bisschen. Oder trink wenigstens deine Milch.«
Gehorsam hebt Isabel das Glas an den Mund und nippt daran, das Brötchen aber bleibt unberührt liegen.
Die Tante trinkt ihren Kaffee und betrachtet das runde Kindergesicht.
»Was für ein strenger Name: Isabel,« sagt sie auf einmal. »Wer hat dir diesen Namen gegeben, dein Vater? Oder war es damals im Krankenhaus, als …«
Sie unterbricht sich noch rechtzeitig und schluckt die restlichen Worte hinunter. Isabel weiß ja nicht, dass sie ein Adoptivkind ist. Niemand außer ihr und den Eltern wusste es, und niemand sollte es wissen.
Ihre Gedanken wandern in die Vergangenheit zurück, bis zu Isabels Geburt vor sieben Jahren. Ihr Bruder und seine Frau konnten keine eigenen Kinder bekommen. Sie waren reich, und es fehlte an nichts, nur an einem Kind. Alle Bemühungen, einen Säugling zu adoptieren, schlugen fehl, was immer auch die Schwägerin an Anstrengungen unternahm, um an einen solchen zu kommen.
Aber dann, eines Tages, klappte es doch. Plötzlich und wie aus heiterem Himmel war das Baby da, niemand wusste so recht, woher es gekommen war. Das blieb auch weiterhin ein Geheimnis, und Elisa Bongart wurde in all den Jahren den Verdacht nicht los, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen war.
Mit Geld ist schließlich alles zu machen, hatte sie damals gedacht. Und das denkt sie auch heute noch.
Wer hätte jemals geglaubt, dass dieses Kind eines Tages in ihrem Hause landen würde!
Aufmerksam mustert sie die Kleine. Hübsch ist sie, ein energisches Kinn in dem kleinen Gesicht, dessen Blässe nicht teigig, sondern blumenhaft wirkt. Die Augen sind trotz der müden dunklen Schatten darunter von einem tiefen, samtenen Blau, und das kastanienbraune Haar hebt sich leuchtend von der hellen Stuhllehne ab.
Elisa Bongart denkt an ihre Schwägerin Inge, die so gern Mutter sein wollte und es sich in den Kopf gesetzt hatte, ein kleines Mädchen im Säuglingsalter zu adoptieren. Kein anderes Kind kam in Frage!
Eine eigenartige Frau war das - und wurde in den letzten Jahren immer noch eigenartiger. Sieben Jahre lang war sie Mutter, dann war alles vorbei. Und nun sitzt da dieses arme Wurm und ist Vollwaise. Hat zum zweiten Mal seine Mutter verloren.
Was mochte aus der ersten geworden sein?
Zum ersten Mal denkt Elisa über Isabels leibliche Mutter nach. Wo mag sie stecken? Ob es ihr jemals leid getan hat, ihr Kind fortgegeben zu haben? Für Geld! Nun ja, sicher war sie in Not und brauchte das Geld, nicht aber das Kind. Was für eine Mutter ist das, die das eigene Kind abgibt und Geld dafür nimmt!
»Meine Mama hat mir den Namen gegeben,« sagt Isabel jetzt laut und deutlich in die Stille hinein.
Die Tante fährt zusammen, sie hat ihre Frage ganz vergessen.
»Ja, sicher,« sagt sie schnell. »Das wird deine Mama gewesen sein. Das sieht ihr ähnlich – die Inge mit ihren verschrobenen Ideen.«
Isabel schaut die Tante fragend an. Wie seltsam die manchmal spricht.
»Was ist verschroben?« will sie wissen.
»Nun ja, verschroben ist – immer etwas Besonderes wollen,« windet sich die Tante heraus.
Isabel schweigt und denkt darüber nach.
Dann sagt sie, scheinbar ohne jeden Zusammenhang: »Wo ist der Fluss? Kann man dorthin gehen?«
Die Tante fährt im Stuhl hoch.
»Um Gottes willen, was willst du am Fluss? Da ist es viel zu gefährlich für dich. Du könntest hineinfallen.«
Isabel antwortet nicht.
»Aber du kannst in den Park gehen. Er ist groß, da findest du genug Platz zum Spielen. Du darfst auch im ganzen Haus herum gehen. So ein großes, altes Haus ist doch sicher aufregend für ein kleines Mädchen.«
Sie schiebt mit einem Ruck ihre Kaffeetasse fort und erhebt sich. Dann beginnt sie, mit energischen Griffen das Frühstücksgeschirr zusammen zu stellen.
»Später kommt Philomena und hilft beim Putzen und Kochen. Sie wohnt im Städtchen und radelt täglich hierher. Die gröberen Arbeiten, wie Fensterputzen und Gartenarbeit, verrichtet der Olaf. Den hast du ja schon kennen gelernt.«
Sie seufzt laut, während sie das Geschirr zum Spülbecken trägt.
»Nichts ist mehr wie früher,« klagt sie. »Da hatte man viele Bedienstete, weißt du. Heutzutage kann ich mir das nicht mehr leisten. Alles ist anders geworden. Der Olaf schafft mal gerade das Nötigste in diesem weitläufigen Park, und das Haus – na ja, du siehst ja, wie riesig es ist. Da braucht es mehrere Hilfskräfte, wenn man es ordentlich halten will. Und Geld ist nicht da! Weder um es zu pflegen, noch für Reparaturen. Nach und nach zerfällt alles.«
Sie seufzt wieder und blickt zum Fenster hinaus.
»Ein Jammer ist das. Wer hätte gedacht, dass es einmal so weit kommt. Übrigens – «
Mit einem Ruck wendet sie sich um und blickt auf das Kind, das immer noch ganz still am Tisch sitzt.
»Nun komm, damit ich dich deinem Onkel vorstelle.«
Isabel starrt die Tante an. Ein Onkel? Wo gibt es denn noch einen Onkel?
Langsam steht sie auf und folgt der Tante in die schummrige Halle hinaus.
Sie steigen nebeneinander die vielen Stufen in den ersten Stock hinauf, fast wie am Abend zuvor. Die Tante erklärt:
»Es ist dein Onkel Lorenzo, mein Halbbruder. Du hast wohl noch nie von ihm gehört. Seit seinem schrecklichen Unfall vor vielen Jahren lebt er hier in meinem Haus, oben im ersten Stock am Ende des Korridors. Er ist krank und behindert, teilweise gelähmt.«
Sie blickt sich nach Isabel um, die hinter ihr zurück geblieben ist.
»Ich mochte ihn damals nicht in ein Heim geben, weißt du. Er – er tat mir so leid und so – nun ja, ich hab ihn aufgenommen, und nun wohnt er also hier. Ich pflege ihn, so gut ich kann. Hin und wieder kommt der Doktor, um nach ihm zu sehen. Alles andere mache ich allein.«
Während sie den halbdunklen Korridor entlang gehen, fallen Isabel die seltsamen Geräusche wieder ein, die sie am Morgen vernommen hat.
Der Onkel war es also. Er hat wohl dieses Scharren und Schieben gemacht.
Dieser endlos lange, dunkle Gang. Was mag nur alles hinter diesen vielen Türen sein? Sicher lauter mit alten Möbeln vollgestopfte Räume. Zimmer, in denen früher Menschen lebten. Vielleicht die Eltern der Tante, der Bruder – Isabels Papa - , dieser Halbbruder da oben und vielleicht noch mehr Geschwister. Möglicherweise auch noch Großeltern und andere Verwandte, es ist ja so ein riesiges Haus.
Isabel stellt sich vor, wie es ist, wenn viele Kinder durch die Gänge toben, treppauf und treppab rennen, lachen und kreischen. Lustig muss das sein, mit vielen Menschen in einem so großen Haus zu leben. Menschen, die sich vertraut sind, die immer füreinander da sind, die sich lieb haben. So etwas hat sie nie kennen gelernt. Sie war immer mit Mutter und Vater allein, von den vielen Bediensteten mal abgesehen. Die hielten sich allerdings stets in den ihnen zugedachten Räumen auf. Und mal abgesehen von der Pflegerin Mamas, die irgendwann kam …
Wie schön muss es inmitten einer großen Familie sein. Brüder und Schwestern, Vater und Mutter, ein lustiger Opa, der einen Drachen bauen kann, und eine ganz liebe Oma, die irgendwo in einem Turmzimmerchen sitzt und strickt. Zu der man jederzeit kommen kann und die viele Geschichten zu erzählen weiß. Die zwar sehr alt ist, aber doch nie verwirrt und krank so wie Mütter manchmal sind … jedenfalls ihre, Isabels, Mutter …… Geschichten hat sie auch sehr schöne erzählt …in ihrem sonnigen Zimmer mit dem efeuberankten Balkon, wenn Isabel sie besuchen durfte … später, als sie manchmal so durcheinander und krank war und …
»Isabel, träumst du?«
Die Tante packt Isabels Hand und zieht sie weiter.
Noch einmal biegen sie um eine Ecke, dann sind sie da. Tante Elisa klopft kurz und energisch an die Tür, und noch bevor das »herein« ertönt, stehen sie im Zimmer.
Es ist ein sehr großes Zimmer, größer noch als das von Isabel, und es ist trotz der vielen Fenster dunkel darin. Sämtliche Vorhänge sind zugezogen, zwei oder drei Lämpchen verbreiten ein mattes Dämmerlicht.
Das Zimmer ist vollgestellt mit alten, schweren Möbeln. Ein gewaltiges, hohes Bett mit vier Pfosten und einem Vorhang thront in seiner Mitte.
Darin liegt aber der Onkel nicht. Er sitzt nah bei einem der zugezogenen Fenster in einem Sessel, neben ihm steht ein Rollstuhl.
Die Tante schiebt Isabel auf den Onkel zu, der ihr neugierig entgegen blickt.
»Da ist sie also, unsere neue kleine Mitbewohnerin,« empfängt er sie und streckt eine klauenartige Hand nach ihr aus. Isabel tritt nah an ihn heran und reicht ihm zögernd ihre eigene Hand.
»Du bist also Isabel,« sagt der Onkel. »Setz dich da hin, damit ich dich ansehen kann. Und du –« er wendet sich an seine Schwester - »und du geh und lass uns allein.«
Isabel erschrickt. Soll sie etwa mit diesem merkwürdigen Mann allein bleiben? Aber da ist die Tante schon zur Tür hinaus. Isabel setzt sich gehorsam auf den Stuhl und mustert beklommen den neuen Onkel. Interessant genug sieht er aus. Das Auffallendste an ihm ist seine Nase, die scharf und groß aus seinem Gesicht heraus sticht, mit einem ansehnlichen Höcker darauf. Ein Paar dunkle Augen unter schwarzen Brauen lodern in seinem blassen Gesicht, deren Ausdruck Isabel in dem Dämmerlicht nicht erkennen kann. Seine Stirn ist hoch und sehr weiß, fast leuchtet sie im Halbdämmer. Das Haar ist schwarz und sehr glatt und sorgfältig über den Kopf gebürstet; es wirkt ein wenig ölig. Oder verschwitzt, was kein Wunder wäre, denn es ist stickig heiß im Raum. Auch Isabel beginnt zu schwitzen in ihrem warmen Pullover. Verstohlen wischt sie sich mit dem Ärmel über die Stirn.
Der Onkel hat nun seine Musterung beendet. Isabel fährt erschrocken zusammen, als er ein merkwürdiges, gackerndes Hüsteln hören lässt. Damit eröffnet er das Gespräch.
»Bist ein niedliches Ding, du,« sagt er.
»Hier sollst du also deine Kindheit verbringen, armes Kind. Keine Umgebung für ein kleines Mädchen. Deine Tante Elisa – na ja, die Übelste ist sie nicht. Und doch …eine verschrobene, alte Jungfer, wenn du mich fragst. Hat so ihre Skurrilitäten.«