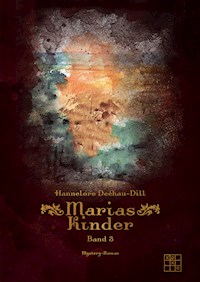Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem alten Haus am Rande des Moors wachsen die ungleichen Schwestern Lona und Charlotte auf. Die Hass-Liebe der beiden begleitet und beeinflusst ihre Kindheit und Jugend, bis die lebenslustige Lona ihr Glück in der Welt sucht. Charlotte bleibt zurück, um das Imperium des Vaters zu übernehmen und die kranke Mutter zu versorgen. Erst nach vielen Jahren treffen die Schwestern wieder aufeinander und die alte Rivalität entbrennt schlimmer denn je.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Schattenland
Die verlorene Welt der Gefühle
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-057-6
E-Book-ISBN: 978-3-96752-557-1
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 509403625
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Nichts ist wichtig, nichts ist unwichtig,
das Leben ist ein Schattenspiel,
aber die Spiegelbilder der Dinge
in unseren Seelen
haben eine tiefe, unheimliche Realität.
(H. Hesse)
Gegenwart
Immer noch sehe ich sie da stehen, eine weißgoldene Lichtgestalt vor dem Hintergrund der wuchtigen Mahagonitür, meine Schwester Lona.
Meine schöne Schwester Lona!
Dabei ist sie längst fort. Wie lange schon? Minuten? Stunden?
Ich merke, dass ich jedes Zeitgefühl verloren habe. Das Gefühl für die Zeit und das Gefühl für das, was in diesen letzten Stunden geschehen ist.
Beides wird wiederkommen – und allzu schnell.
Nur jenes eine Gefühl nicht, das mich zu meiner Tat getrieben hat: der Zorn!
Wahnwitziger, glühender Zorn gepaart mit Hass und noch ein paar anderen Dingen!
Diese ohnmächtige Wut, die mich zum Zittern brachte und mir fast den Verstand raubte – sie ist fort.
Ausgelöscht, als wäre sie nie da gewesen. Da ist nur noch ein dumpfes, dunkles Nichts. Oder vielmehr ein Gefühl der Leere, als wäre in mir alles betäubt. Als hätte mir jemand eine gehörige Dosis Thorazin verpasst, die mich und mein Fühlen vorübergehend matt gesetzt hat.
Aber ich habe ja auch etwas dagegen getan, gegen diese unermessliche Wut, gegen diesen mörderischen Zorn. Mörderisch – wie passend!
Ich kann mich deutlich erinnern, wie es war.
Noch so genau weiß ich, wie es anfing. Wie der Zorn in mir aufstieg. Wie er sich ausbreitete in mir, bis in alle Nerven und Fasern meines Seins. Wie er heiß und hämmernd in meinen Kopf strömte, in meinen verkrampften Bauchmuskeln brannte, bis in alle Eingeweide und Gelenke ausstrahlte, ein glutrotes, zorniges Beben.
Ich erinnere mich, wie dieser irrsinnige Zorn meinen ganzen Körper durchwanderte, um sich schließlich in meinem Inneren zu verdichten und zusammenzuballen – tief in mir, genau dort, wo das Herz sitzt.
Und dann hatte er sein Ziel erreicht: Er packte es und machte aus meinem Herzen einen harten, schmerzhaften Klumpen, der sich anfühlte, als müsse er jede Sekunde in tausend Stücke zerspringen. In tausend winzige Splitter; ja, genauso hat es sich angefühlt.
Aber nichts ist zersprungen, ich lebe noch..
Es war, als würde ich von einer jähen Wucht geschüttelt, die alles Denken und jegliche Vernunft in mir auslöschte. Ach, und wie stolz war ich doch stets auf meine Vernunft und meine ruhige Überlegenheit!
Dabei hatte ich es doch längst gewusst. Alles hatte ich gewusst, lange schon, bevor diese unmenschliche Wut in mir hochkroch und mich zu dem getrieben hat, was heute Abend geschehen ist.
Zu meiner bösen Tat.
Ich erinnere mich an alles, an die vorangegangenen Depressionen, an das Gefühl des Verlustes und den Betrug…
Und nun warte ich.
Warte darauf, dass jeden Augenblick mein Gefühl zurückkommt, in mich zurück fließt wie die Flut nach der Ebbe. Und ich warte, dass etwas anderes an die Stelle meines Zorns tritt. Gleich, gleich wird es soweit sein. Schließlich lebe ich und mein Herz ist nicht zersprungen. Es ist völlig intakt. Man kann sich nur wundern, was dieses viel besungene Organ alles aushalten kann. Aber im Grunde ist es ja nicht dieses Organ; man sagt zwar das Herz, aber man meint etwas ganz anderes. Man meint etwas, das viel tiefer sitzt, verborgen und unsichtbar, aber dennoch nicht weniger spürbar: mein innerstes, unsichtbares ICH - ist es die Seele?
Um mich herum ist mattes Dämmerlicht, ein Wandleuchter wirft ein trübes Licht auf die vertrauten Schattenformen der alten Möbel. Alles um mich herum ist alt: die Möbel, das riesige Haus mit allem, was darin ist. Und auch ich komme mir alt vor. Uralt und erschöpft und verbraucht. Dabei bin ich es noch gar nicht, nicht einmal vierzig Jahre, fünfunddreißig, um genau zu sein. Ein paar Jahre älter als meine schöne Schwester.
Und wieder sehe ich sie in der Tür stehen. Meine Schwester Lona mit ihren unglaublich blauen Augen und dem goldenen Haar, das wie ein Heiligenschein ihr Gesicht umrahmt. Starke, dichte Locken von der Farbe frisch geschlagenen Holzes, die ihr immer wieder ins Gesicht fallen, als seien sie etwas Lebendiges.
Diese strahlenden, schräg geschnittenen blauen Augen, von dichten dunklen Wimpern umrahmt, eine sinnliche, volle Unterlippe, hübsche lange Beine, schön geschwungene Hüften …
Ich höre ihre Stimme, ein wenig heiser und rauchig – geradeso wie es Männer lieben …
»Ich lasse dich nicht im Stich, Charly. Niemals, das weißt du! Haben wir nicht immer zusammengehalten? Unser Leben lang…«
Das waren ihre Worte, als sie da in der Tür stand, und dann ist sie gegangen.
Meine schöne Schwester.
Zurückgeblieben bin ich. Charlotte, die Hässliche.
»Finden Sie nicht, dass Charly mehr und mehr ihrem Vater ähnelt? Das arme Ding…in meiner Familie zum Beispiel … und da haben Sie das Gegenteil: unsere Lona … sie kommt ganz nach den Frauen meiner Familie … so sah ich aus, als ich jung war … ach ja, als ich jung war …«
Die Stimme der Mutter – ich höre sie in meinem Kopf, als ob sie neben mir stünde. Dabei ist sie schon lange tot. Ebenso der Vater. Nun bin ich ganz allein in diesem riesigen Haus. Ich und meine schöne Schwester Lona.
Schatten um mich herum, düsteres Dämmerlicht. Auch in dem wuchtigen, goldverzierten Spiegel über dem Kamin; sein Widerschein ist trübe und wellig wie ein glanzloser See. Er gibt mir ein verschwommenes Bild des Raumes wieder, in dem ich mich nun selber sehe. Es ist, als blickte mir mein Vater entgegen.
Auch er war dunkel, hatte dicke Augenbrauen und schwarze Haare über einer blassen hohen Stirn.
Ich habe mein Gesicht nie gern betrachtet, obwohl ich es früher manchmal voller Enttäuschung stundenlang studiert habe. Dieses blasse Gesicht mit seinen schweren, stumpfen Zügen ist mir stets wie ein schlechter Scherz erschienen. Und was für ein Kontrast zu dem lieblichen Engelsgesicht jener strahlenden Lichtgestalt Lona!
»Wenn du ein Pferd wärest, würde man dich für schön halten« – Lona hat es einmal gesagt und gelacht dabei. Lona, die Reiterin. Wie anmutig und graziös sie auf einem Pferd aussah. Wahrscheinlich ist sie nur darum geritten, denn von Pferden hielt sie nicht viel. Eigentlich wundert es mich, dass sie keine Angst vor ihnen hatte – ängstlich wie sie war. Heute reitet sie nicht mehr.
Auch ich bin gern geritten, und ich liebe Pferde. Heute noch. Pferde und Hunde – sie sind so viel treuer und zuverlässiger als Menschen.
Ich kneife die Augen zusammen und mustere mein Gesicht im Spiegel. So im Schummerlicht wirkt es weicher und fraulicher als es tatsächlich ist. Die Augen sind gar nicht mal so übel, dunkle Augen, so wie die des Vaters. Alles Übrige – nun ja, knochig und kantig, zu hohe Backenknochen, die Nase zu groß, der Mund ebenfalls.
Mechanisch streiche ich mein Haar zurück. Dichtes, starres, eigenwilliges Haar, schwarz wie das des Vaters. Alles, was an Lona strahlend, weich und leuchtend ist, ist an mir düster, hart und kantig.
Schwarz, denke ich, ein schwarzer Schatten. Lonas Schatten. Ich lebe in ihrem Schatten. Immer schon. Ich spielte, lernte und lachte in Lonas Schatten. Ich ging und stand und wartete in ihrem Schatten. Wartete, dass ein paar Sonnenstrahlen auch für mich abfielen.
Charlotte im Schatten. Sonnenland und Schattenland. Wir hatten sogar ein Spiel erfunden, Lona und ich.
»Schattenland« hieß das Spiel. Man musste bestimmte Aufgaben und erdachte Voraussetzungen erfüllen, um ins Sonnenland zu gelangen.
Darin war ich gut, besser als Lona. Was mir an Schönheit und Raffinesse abging, machte ich mit Überlegenheit und Scharfsinn wett.
»Du hast einen hellen Kopf, sagte mein Vater, und damit hatte er Recht. Was er nicht sagte: Also benutze deinen Verstand, da dir nun mal die Schönheit fehlt!«
Das tat ich, und ich wusste genau, dass ich darin Lona weit überlegen war. Ich war so viel klüger, tüchtiger, ehrgeiziger, fleißiger als sie.
Und doch – wie gern hätte ich mit ihr getauscht.
Mit meiner schönen Schwester Lona.
Aber ich lebte nun mal im Schattenland.
Ich stand auf und ging schlafen im Schatten, ich lernte zu leben, zu lachen und zu spielen im Schatten.
Alles Fassade, eine Maske für die Anderen, für die Menschen um mich herum.
»Es genügt nicht, die Zweitbeste zu sein, du musst die Erste sein … Wenn du verletzt bist, so zeige es nicht. Lass niemanden merken, dass es dir wehtut … Du bist klug, du wirst es allen zeigen … sei stolz…«
Stolz und eine glatte Maske - oh ja, mein kluger Vater.
Ich hielt mich an die Analyse, schließlich bin ich eine Frau des 20. Jahrhunderts und somit dem Irrglauben unterworfen, dass, was der Kopf begriffen hat, dem Herzen nicht mehr wehtun kann, und dass ich es fest in der Hand habe, was ich der Außenwelt zeige …
Das Haus ist still. Die alten Dielenbretter knarren unter meinen Füßen, während ich durch den Raum und ans Fenster gehe. Die Nacht ist schwarz. Und so lang. Aber ich weiß, dass sie vorübergehen wird. So wie alles vorübergeht: andere dunkle Nächte ohne Schlaf, und wieder andere Nächte mit bösen Träumen; Kummer und Verletzungen, die Jahreszeiten wie die Jahre meines Lebens – die vergangenen und die zukünftigen.
Und plötzlich ist es da! Es bricht über mich herein wie eine Sturzflut – das Begreifen und die Angst!
Das Begreifen dessen, was geschehen ist. Heute am frühen Abend da draußen auf der Brücke …
Nun hat die Angst mich in ihren Fängen.
Und diese Stille, die schwarzen Schatten und die Einsamkeit.
Einsam bin ich eigentlich immer gewesen.
Lona? Auf meine schöne Schwester konnte ich mich nie verlassen. Immer hat sie mehr Angst gehabt als ich. Ich war es, die sie beschützt hat, die für sie in die Bresche sprang, die alles ausbügelte, was sie verbockt hat. Immer ich. Niemals sie.
»Hilf mir, Charly, ich weiß nicht weiter. Charly, mach, dass alles gut wird … Charly, Charly, vertreib den bösen Hund und das Gespenst unterm Bett …«
Nicht vor dem »Ding« im Schrank hatte sie Angst in der Nacht, oh nein. Der Schrank selber flößte ihr schon Furcht ein.
Charly, die Starke, die Tüchtige. Charly mit den breiten Schultern, die immer einen Weg, einen Ausweg wusste. Charly machte, dass alles wieder gut wurde.
Diese Stille … ich spüre plötzlich eine Gänsehaut auf dem Rücken … dieses alte Haus mit seinen düsteren Räumen, riesig und voller Schatten … Schattenland … passend für Charly, die im Schatten lebt …
Auf einmal kann ich es nicht mehr ertragen.
Stille, Melancholie und Verlassenheit steigen aus den alten Wänden auf, kriechen auf mich zu, dringen aus allen Spalten und Ritzen auf mich ein.
Endlich begreife ich das Ausmaß dessen, was geschehen ist. Wie grauenvoll, sündhaft und schrecklich ist das! Ich habe das Gefühl, auf abschüssigem Boden zu wandern. Eine eisige, böse Vorahnung packt mich, und der Weg, den ich vor mir sehe, scheint geradeswegs ins Entsetzen zu führen.
Ich fürchte mich vor dem Haus, vor meiner Schwester, am meisten aber vor mir selber, vor den Gefahren, die in der Tiefe meiner eigenen Natur auf mich lauern.
Ich habe doch gedacht, ich kenne mich, aber so war es gar nicht …
Ich kauere da voller Angst, wage mich nicht zu bewegen, fühle mich belauert von den schweigenden, sehenden Wänden! Und von den Toten!
Die Geister der Toten – vielleicht kommen sie wieder.
Ich, die ich noch nie in meinem ganzen Leben abergläubisch war, sitze da und zittere. Es ist die Schuld … ich bin schuldig … oh meine böse Tat!
Die Geister der Toten!
Vor allem der eine, der bis vor wenigen Stunden noch lebendig war…
Aber wenn sein Geist wieder kommt, so steigt er aus meiner Seele auf, nicht aus seinem Grab!
Gegenwart
Nacht
Ein Reiher zieht niedrig und schwer den Strom entlang, und sein heiserer Ruf hallt über das dunkle Wasser. Der Nebel schiebt sich langsam zwischen mich und die Welt.
Ich laufe durch die Nacht, stundenlang, denn im Hause finde ich keine Ruhe. Es ist eine flache, waldreiche, von Gewässern durchschnittene Gegend. Ich kenne sie gut, schließlich habe ich hier mein ganzes Leben verbracht. Der Wald macht mir keine Angst, mit weit ausholenden Schritten schreite ich schnell durch seine nächtlichen Geheimnisse. Ich verlasse ihn und habe die weiten Sümpfe vor mir. Ein Schaudern befällt mich. Weißliche Nebelschwaden hängen über den Wasserflächen, über den mit Schilf und Strauchwerk bestandenen Mooren.
Es ist eine endlose Landschaft aus Erde, Wasser und Nebel. Der Mond scheint über dieser endlosen Ebene, aus der hier und da phantastische Baumriesen ragen. In seinem blassen Schein zeigt sich weißliches Wasser. Es ist der alte Fluss, der hier träge und langsam seine Strömung durch die Ebene schiebt, mit weiten Ausuferungen.
Man hätte die weite Wasserfläche für einen See halten können, wären nicht an den unerwartetsten Stellen Röhricht, Gesträuch und Weiden daraus emporgewachsen.
Es sieht mehr nach einer Überschwemmung aus als nach einem See oder nach einen größeren Anzahl einzelner Teiche. Hier und da sind Land und Wasser so miteinander verwoben, dass es schwer fällt zu bestimmen, welches Element vorherrscht.
Ich empfinde die Melancholie dieser düsteren Gegend. Ich lausche auf alle Geräusche der Nacht, auf den Wald, die Vergangenheit und auf die eigene bebende Unruhe in mir.
Eine Überraschung in der hoffnungslos ebenen Landschaft ist der Hügel, der das Wasser überragt und sich über die Ebene erhebt. Geradezu beeindruckend ist das Riesenbauwerk auf diesem Hügel, das Haus: eine große steinerne Masse, aus der ein hoher Turm emporragt; einsam und würdevoll beherrscht er die Gegend.
Ich spüre den Tod ringsumher. Ich wusste nie, dass auch ich Angst vor dem Tode habe, aber so ist es. Das düstere, gewaltige Haus da drüben zwischen Wasser und Sumpf bedeutet für mich Tod.
Wie es da auf seinem Hügel steht, wirkt es auf mich wie ein zu Ende gehendes, zur Vernichtung bestimmtes, unter der Last der Jahrzehnte zusammenbrechendes Monstrum. Die Nebel reichen bis fast an den Fuß der erhabenen Mauern. Aus der Ferne klingt Hundegebell, unheimlich und wie aus einer anderen Welt.
Ein einsamer Lichtschein dringt aus dem Fenster des Ecktürmchens. Ein einzelnes, kümmerliches, einsames Licht in dem Riesengebäude, es vertieft noch den Eindruck der Leere und Verlassenheit. Ein Schauder überläuft mich bei dem Gedanken, dass in den vielen Räumen nur zwei Menschen leben, meine schöne Schwester Lona und ich. Nur an den Tagen, wenn die alte Babette kommt, sind wir zu Dritt. Sie bleibt dann manchmal über Nacht.
Aber das wird ja bald anders sein. Ich werde nicht bleiben. Man wird kommen und mich holen. Morgen schon? Übermorgen?
Und was kommt dann? Reue nach all der Angst und meiner Schuld?
Meine Füße finden allein den Weg über den Damm. Die Feuchtigkeit des Nebels hüllt mich ein. Die Luft über den überschwemmten Flächen wird jetzt immer dichter, schwerer, gesättigt vom Nebel, der sich jeden Augenblick zu weißen Schwaden ballen kann.
Ich kenne das alles so gut, die schreckliche Leere der Gegend, die Traurigkeit und Verlassenheit der mit Röhricht bewachsenen, gelegentlich von einem Damm durchschnittenen Sümpfe. Hier bin ich aufgewachsen, alles ist mir vertraut. Ich habe diese Landschaft geliebt. Geliebt und gehasst. Diese tragische und mystisch-geheimnisvolle Stimmung über der Ebene, die weißen Nebelschwaden, die Vermischung der Elemente Erde, Wasser und Nebel.
Wenn man sich nicht auskennt, kann man leicht vom Weg abkommen und auf dem verräterischen, sumpfigen, stellenweise unmerklich in Moor übergehenden Boden den Tod finden.
Nun habe ich den Fuß des Hügels erreicht, auf dem das Haus steht. Es ist wirklich nur ein Hügel, knapp fünfzig Meter hoch. Das Haus ist von Bäumen umgeben.
So wie die Landschaft ringsum habe ich auch das Haus im Laufe meines 35jährigen Lebens geliebt und gehasst. Immer abwechselnd. Geliebt und gehasst, so wie es auch ist mit den Menschen, die uns nahe stehen, der Vater … die Mutter … meine schöne Schwester Lona … und er … oh ja, gerade er. Geliebt und gehasst, diese ambivalenten Gefühle, denen mit dem Verstand nicht beizukommen ist
Je mehr der Weg ansteigt, desto dünner wird der Nebel, das Mondlicht spiegelt sich in den schwarzen Fensterscheiben. In der Ferne bellt immer noch der Hund, und dort oben ist der Nachthimmel, schwarz wie Teer, und das harte, ungebrochene Licht der Sterne. Mir ist, als müsse ich das Gewicht des Himmels stützen, damit er nicht auf mich herab stürzt.
Die rächende Faust Gottes?
Wohl kaum, eher die der Menschen. Aber noch nicht heute Nacht, erst morgen oder übermorgen. Also habe ich diese Galgenfrist von einer Nacht.
Die schwere Eichentür schließt sich dumpf hinter mir. Dunkelheit und Kälte schlagen mir entgegen. Wie in einer Gruft, denke ich, und wie eine Gruft erscheint mir heute Nacht das ganze Haus. Ich bin sehr müde, die endlosen Treppen nach oben nehmen kein Ende. Die Treppenstufen knarren, der Wind lässt die Fenster klappern. Ist denn auf einmal Wind aufgekommen?
In meinem Zimmer angekommen, mache ich Licht. Ich ziehe mich aus und dusche. Immerhin habe ich ein eigenes Badezimmer, für dieses alte Gemäuer ziemlich modern und fortschrittlich.
Ich lasse das Wasser erst heiß, dann kalt auf mich herunter prasseln, reibe mich kräftig mit dem rauen Badelaken ab. Die Müdigkeit ist verflogen, aber die Erschöpfung bleibt. Die Erschöpfung und die nagende Angst ganz tief in meinem Inneren. Eine seltsame, beklemmende Unruhe, die mein Herz hämmern lässt.
Im Zimmer ist es noch warm von dem Kaminfeuer am Nachmittag. Babette hat es angezündet, bevor sie ging. Meine liebe, alte Babette, die sich stets so um mich sorgt.
»Charly, du musst mehr essen, mein Gott, man kann ja deine Rippen zählen … Charly, nun gönne dir mal eine Pause … mach mal Urlaub, liebes Kind, du schuftest zu viel …«.
Ich schlüpfe in meinen Bademantel. Dann stehe ich regungslos im Raum. An Schlaf ist nicht zu denken. Oder vielleicht sollte ich … aber nein, das hab ich mir doch abgeschworen.
Mein Blick wandert zu der hohen Kommode in der Ecke. Ich weiß, dass noch Valium da ist, eine ganze Menge sogar. Hinten unter meiner Wäsche in einem netten, runden, vielversprechenden Gläschen .
Nein, nicht wieder. Nie wieder!
Warum hab ich das Zeug nicht längst weggeworfen!
Aber ist jetzt nicht alles gleichgültig?
Mit einem Ruck wende ich mich ab. Ich will mir doch noch ein Restchen Würde bewahren. Würde! Wie oft habe ich mich daran geklammert. Mein Stolz und meine Würde. Bis es dann doch nicht mehr ging. Immer diese Anspannung, diese Unfähigkeit zur Entspannung. Dieses grausame Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben, vor allem mich selbst.
Nur nicht zeigen, dass du verletzbar bist …
Meine Hand tastet nach dem kleinen Kreuz aus Gold, mein Amulett, mein Glücksbringer. Vor vielen Jahren hat Leni es mir gegeben. Leni, meine alte Kinderfrau. Damals, als ich noch ein Kind war, als ich noch ängstlich und schüchtern war, als ich noch weinen durfte …
»Dieses Amulett ist etwas ganz Besonderes,« hatte Leni gesagt. »Es besitzt ungeahnte Fähigkeiten und kann Wunder bewirken.«
Welche? habe ich gefragt. Was für Wunder sind das?
»Das hängt einzig und allein von dir ab«, war die Antwort. »Auch von den Wundern, die du benötigst. So etwas kann man nicht verallgemeinern.«
Auf das Wunder der Schönheit habe ich jahrelang umsonst gewartet. Was für ein Wunder würde ich mir jetzt, in diesem Augenblick, erhoffen?
Tief auf dem verborgenen Grund meiner Seele, dort wo ich meine Träume, meine Gefühle und all meine Kümmernisse verschlossen halte, hätte vielleicht der Glaube an ein Wunder Raum gehabt, früher einmal. Was wäre das für ein Wunder: die Uhr um ein paar Stunden zurückstellen zu können, alles ungeschehen zu machen, was geschehen ist … ihn zur Tür herein kommen sehen wie an allen anderen Abenden zuvor, sein Lächeln, so jungenhaft und unschuldig, als könne ihn kein Wässerchen trüben ..
Oder dass alles nur ein Traum gewesen ist.
Hätte ich mir so ein Wunder gewünscht?
Nein, denke ich, nein, ich bin froh, dass er tot ist. Es tut mir nicht leid um ihn. Meine Liebe ist dahin, ein für alle Mal. Ich hasse ihn … hasse ihn … ich würde es wieder tun … Oder?
Denn nun die Folgen. Die Folgen meiner bösen Tat. Um Gottes willen, was habe ich mir damit eingebrockt!
Außerdem – es gibt keine Wunder. Das immerhin hat das Leben mir beigebracht. Es sei denn, man vollbringt sie selbst. Aber das sind dann keine Wunder mehr, es ist das Ergebnis jahrelanger, harter Arbeit, und irgendwo gibt es Grenzen für diese Art Wunder.
Der Mensch hat nun mal seine Grenzen.
Kein Wunder wird mich vor dem bewahren, was mir bevorsteht.
Ich liege auf dem Bett und stelle mir meine Zukunft vor. Hier von meinem Bett aus kann ich den Mond deutlich sehen. Vielleicht wird mir das in naher Zukunft auch möglich sein: den Mond auf seinem Stückchen Himmel durch das Fenster zu sehen. Durch blitzende Gitterstäbe!
Im Geist sehe ich bereits, wie sich sein Licht auf den Gitterstäben vor dem Fenster fängt und sie dunkler und dicker und noch stabiler erscheinen lässt. Gitterstäbe, hinter denen ich gefangen bin, festsitze bis …
Ja, bis wann? Wie lange? Jahre, Jahrzehnte? Bis ich alt und grau bin? Was gibt es für – Mord?
Es war doch Mord, oder?
Und wie ist es mit Unzurechnungsfähigkeit? Ich war doch nie im Leben bei Sinnen, als ich das tat. Was habe ich überhaupt getan?
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so kommt es mir vor, als ob das Schreckliche vor wenigen Stunden gar nicht mir passiert ist. Ich war das gar nicht. Ich bin doch zu so einer Tat gar nicht fähig. Was ist da mit mir geschehen? Halluzinationen? Thorazin?
Mir ist, als hätte ich danebengestanden und zugesehen. Aber was habe ich gesehen? Selbst das ist mir nur eine verschwommene Erinnerung.
Ich war da, ja, auf der Brücke ich erinnere mich. Sehe ihn da stehen, weit vorn, sehe ihn winken. Höre noch meinen Wagen, sein Rufen, und dann … sein Gesicht, so hübsch wie immer, sein Lächeln, das mir in der Erinnerung wissend und spöttisch erscheint. So seltsam wissend und spöttisch. Worüber spottet er? Über mich?
Irgendwann bin ich aus dem Wagen gestiegen, ja, haben wir nicht noch miteinander gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. In meinem Kopf geht alles durcheinander. Alles ist nebelhaft und verschwommen, so wie die düstere, öde Landschaft da draußen. Nebelhaft und verschwommen, als wäre es einem anderen Menschen oder in einer anderen Zeit geschehen.
Es muss doch eine vernünftige Erklärung für das alles geben! Nur bin ich im Augenblick nicht in der Lage, diese Erklärung zu finden, die Wahrheit zu erkennen. Ich bin so verwirrt und über alle Maßen verstört.
Aber Tatsache ist: Henrik ist tot. Und wenn er tot ist, dann bin ich dran. Dann wird man zu mir kommen, mich zur Rechenschaft ziehen. Nur mich, denn nur ich komme in Frage.
Wenn er wirklich tot ist – diese Worte rasten in meinem Hirn ein und schockieren mich. Vorübergehend.
Denn ich weiß, er ist tot. Muss tot sein …
Man wird also kommen und mich holen. Ich werde hier sitzen und warten. In diesem alten düsteren Kasten werde ich dasitzen und warten, bis sie kommen, um mich zu holen.
Ich werde nicht davonlaufen, oh nein. Das habe ich nie getan. Es ist nicht meine Art. Charly ist nicht feige, sie steht immer zu dem, was sie getan hat. Auch heute noch.
Also warte ich..
Und danach?
Sonne, Mond und Sterne und vielleicht ein kleines Stückchen Himmel nur noch durch Gitterstäbe? Wenn überhaupt noch für mich.
Wird dann nur Kälte und Trübsinn und Grau um mich sein? Wie ist das heutzutage im Gefängnis? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Und war’s das dann?
Ist das für mich Endstation?
Ich sitze am Fenster und blicke nach draußen. Der Mond kriecht über den Himmel und schwärzt die Schatten der Bäume. Irgendwann beginnt das Dunkel des Raumes sich mit flüchtigen Gesichtern zu füllen, denen der Vergangenheit und denen der Zukunft; undeutlich und verschwommen. Dann treten klar und scharf drei aus ihnen hervor: das Gesicht meines Vaters, das Gesicht Lonas und seines, Henriks Gesicht. Henriks helles schönes Männergesicht mit der blonden Haartolle in der Stirn. Henrik, wie gern wäre auch ich für dich schön gewesen!
Wie sagte Mutter immer?
»Mädchen sind so programmiert, dass sie um die Aufmerksamkeit der Männer konkurrieren, unsere Gesichter und Körper sind die Tauschgegenstände gegen Aufmerksamkeit und Beachtung.«
Früh wusste ich, dass Persönlichkeit und Verstand das waren, was ich als Tausch anzubieten hatte. Das hatte mir Vater eingebläut. Von beiden Eltern habe ich gelernt, dass es im Leben immer um Konkurrenz geht – man gewinnt oder verliert.
Habe ich wirklich geglaubt, was ich zu bieten hatte, könnte genügen?
Ich weiß jetzt, woran ich wirklich glaubte: an Liebe. An meine und Henriks Liebe. Aber ich habe mich geirrt. Ich habe mich an Schatten geklammert und die Wahrheit geleugnet, die alle anderen sahen außer mir .
Als ich die Wahrheit erfuhr, stürzte die Welt für mich ein. Wie sollte ich das ertragen: eine Zukunft ohne ihn, eine alles umfassende Schwärze. Würde ich kämpfen, um über die Tage zu kommen, immer einen nach dem anderen – und alle ohne ihn und somit ohne Sinn?
In der große schwarzen Leere sah ich nur die Spiegelung meines eigenen Gesichts – allein. Und das Gesicht ist mit einem Horror erfüllt, der keinem anderen gleicht. Gestern Abend, als ich mich umzog, stolperte ich in einen dieser Leerräume. Ich saß im Sessel, starrte auf das Bett, das wir geteilt hatten, und sprach laut mit ihm …
Das war, bevor der Zorn kam. Zuerst kam der Schmerz, dann für einen kurzen Moment eine heftige Panik, die mich lähmte, als würde sich ein Gift in meinem Körper ausbreiten. Dann riss ich mich von mir selbst los, holte tief Atem und verließ das Haus.
Das war, als der Zorn kam.
Ich will nicht daran denken. Auch die Geräusche nicht hören, die mit dem grässlichen Erlebnis verbunden sind. Mit dieser gottlosen Tat, die ich mir nie – nie zugetraut hätte.
Angstgefühle und Verzweiflung überfallen mich. Ich möchte weinen, weinen. So wie als Kind, wenn Leni zu mir kam …
Leni. Ihr liebes, altes, faltiges Gesicht kommt in der Dunkelheit auf mich zu. Genauso wie es damals war. Und nun ist sie tot, so lange schon.
Leni …
Und dann weine ich, weine …
So wie damals, und Leni ist wieder bei mir … sitzt an meinem Bett, ganz nah … sie nimmt meine kalte Kinderhand in ihre trockene, warme und sie singt mit hoher, zittriger Stimme eines ihrer alten Lieder.
Ich schließe die Augen und höre den Wind um die Hausecken fegen. Aber ich fühle mich geborgen, denn Leni hockt auf meiner Bettkante …
Leni …
Vergangenheit
Ein Ausbund an Ungeschick
Als ich Kind war, hielt ich unser Haus für ein Schloss. Schon damals war es sehr alt, etwa zweihundert Jahre. Vaters Urgroßeltern haben es auf diesem Hügel erbaut. Unsere Vorfahren waren angesehene Leute in dieser Gegend.
Die umliegenden Gewässer wurden früher einmal für Fischfang und Jagd genutzt. Später begann der Abbau von Brenntorf. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden großflächig die Moorflächen trocken gelegt, um sie landwirtschaftlich zu nutzen.
Im Geschäftemachen waren Vaters Vorfahren schon immer groß. Sie passten sich den Gegebenheiten an und verstanden es, aus allem Geld zu machen. Großvater Rombach war in der Umgebung bekannt als Der Gemüsekönig. Als kleines Mädchen stellte ich mir Kapitäne vor, die ihre Schiffe flussauf navigierten, um hier Zwiebeln und Möhren zu laden, tonnenweise und in Säcke verpackt, die dann zu irgendwelchen ausländischen Häfen mit exotischen Namen wie Jamaika und Trinidad transportiert wurden.
In meiner Phantasie lebten viele Bilder der Vergangenheit: schlanke Kutschen mit schmalen Rädern, die leise knirschend über die kiesbestreute Auffahrt kommen; Damen mit prächtigen Hüten und Reifröcken, fürsorglich geleitet von Herren mit üppigen Perücken und Gamaschen; livrierte Diener am Eingangsportal, die mit undurchdringlichen Mienen Gäste zum abendlichen Ball in der Halle empfingen.
Ob das wirklich so war, weiß ich nicht.
Jedenfalls sah ich in meiner Phantasie ein Haus voller Farbe und Leben, geräumig, weitläufig, mit zwei Stockwerken, mit Tapisserien, Gobelins und Ahnenbildern an den Wänden, die steinernen Treppenaufgänge mit dicken roten Läufern ausgelegt und von Kerzenleuchtern erhellt, mit Ecktürmen, einer prächtigen Veranda und einem Säulengang am einen Ende, mit hohen Räumen, viel Stuck und Kaminen, Spitzengardinen und Samtportieren überall.
Ein Haus voller Licht und Leben, so sah ich es in meiner Phantasie.
Einiges davon war noch in meiner Kinderzeit da, und vieles gibt es auch heute noch: den Stuck und die vielen Kamine, die Ahnenbilder und die voluminösen Samtportieren. Und natürlich die Ecktürme, die vom Steildach des Hauptgebäudes überragt werden, der große viereckige Hauptturm, der seit langem zu bröckeln beginnt. Auch die schöne Veranda mit dem Säulengang gibt es noch, nur hält sich dort niemand mehr auf.
Wir haben immer noch eine ansehnliche Bibliothek und eine Reihe wertvoller Gemälde in der Hauptgalerie. Von den in Jahrzehnten angesammelten Kostbarkeiten ist in all den Jahren nichts veräußert worden. Das hatten die Rombachs niemals nötig, denn Geld war immer vorhanden. Zwar soll mein Urgroßvater ein Lebemann reinsten Wassers, ein Kartenspieler und Weiberheld gewesen sein, aber er hat immer das Geschäftliche vom Privaten zu trennen gewusst. Wenn es darauf ankam, konnte er einen kühlen Kopf bewahren.
Seit meiner Kinderzeit ist das Haus von Bäumen umgeben, meist Eschen und Kiefern. Großvater Rombach hatte unter anderem eine Baumschule betrieben, dort hinter dem Moor. Er liebte Bäume und pflanzte so viele Eschen, Kiefern und Eichen, dass der hintere Teil des Anwesens zu einem dichten Wald geworden ist.
Das Haus selbst ist aus roten Backziegeln gebaut, deren Farbe man als warm bezeichnen kann. Im Hochsommer allerdings ist das Mauerwerk fast völlig unter dem dichten Blätterkleid des wilden Weins verschwunden, dessen grüne, glänzende Blätter in der sanften Brise, die vom Fluss heraufkommt, zittern. Die gesamte Außenfläche des Hauses scheint dann zu beben und zu rascheln, sie wirkt wie ein senkrechter grüner See, den der Wind zu kleinen Wellen kräuselt. Eine Mauer voll Laub, eine Mauer als glänzende Kaskade in zahlreichen Grüntönen, in der viele kleine Tierchen leben.
Im Herbst färbt sich das Laub allmählich zu Gold und dann zu Braun, Rot und Hellgelb, um schließlich abzufallen und als dicker, raschelnder Teppich die gesamte Terrasse zu bedecken. Der Wind kommt und bläst dazwischen, dass es in dichten rotgoldenen Schwaden empor wirbelt, und die vierjährige Charly stapft mitten hindurch und versucht die Blätter in der Luft zu fangen.
»Was für ein Geraschel, hör nur, wie es knistert und rauscht? Als wären tausend kleine Käfer darin, die sich flüsternd unterhalten, hörst du?«
Der alte Gärtner Mattes blinzelt mir verschmitzt zu, während er die Laubberge zusammen rafft und in Säcke stopft. Und ich weiß: nun ist der Sommer zu Ende. Die Mauern werden nun für eine Weile kahl sein, bis im Frühling wieder neue hellgrüne Schösslinge sprießen und der natürliche Kreislauf von neuem beginnt.
Noch aber ist Sommer, und ich bin klein. Vier Jahre alt.
Es ist noch früh, als ich erwache, aber die Sonne scheint schon warm, und ein breites Lichtband zieht sich vom Fenster her über mein Kopfkissen. Ich springe aus dem Bett und laufe ans Fenster. Mein Zimmer liegt im ersten Stock und hat drei Fenster in einer sehr dicken Mauer, so dass ich tiefe Fensternischen habe. Bis zur halben Wandhöhe ist da eine Eichenholztäfelung, die sich im Laufe der Jahre zu einem dunklen Goldton verfärbt hat.
Ich blicke in den Garten hinunter. Auf dem Gras liegen schwerer Tau und lange, tiefblaue Schatten. Überall sind Blumen, von Mama mit Mattes Hilfe gepflanzt. Vor allem Rosen, rote und weiße, rosa und gelbe, Mamas Lieblingsblumen. Aus Blumenkästen und Kübeln quellen pinkfarben und weiß Trompetenblumen und blaue Gänseblümchen und lange Zweige mit silbernen Blättern.
Ich weiß, Mama liebt Blumen, und ich weiß auch warum. Blumen sind schön, und sie machen keinen Ärger, was man beides von mir leider nicht sagen kann. Oft genug hab ich es gehört, aber ich vergesse es immer wieder.
Dass ich nicht mit Mamas Blumen konkurrieren kann, was Schönheit anbetrifft, ist mir klar. Nicht klar ist mir allerdings, was ich daran ändern soll, obwohl Mama zu erwarten scheint, dass ich es tue.
Was nun den Ärger betrifft, den ich mache, da gebe ich mir die größte Mühe, aber es passiert wieder und wieder.
Allein gestern, diese Sache mit dem wunderhübschen Porzellanservice für meine Puppen.
Großmutter ist zu Besuch gekommen, und das ist herrlich. Und was das Schönste ist: sie bringt mir ein Geschenk. Ein Geschenk in einem prächtigen weißen Karton.
»Du musst recht vorsichtig sein, sagt sie, »diese Sachen sind sehr empfindlich. Sie könnten zerbrechen.«
Ich hocke mich an den kleinen Tisch in der Küche und öffne den weißen Karton, mit allergrößter Vorsicht und voller Vorfreude. Ach, wie wunderhübsch ist das, was da zum Vorschein kommt: ein Puppenservice. Ein komplettes, zierliches Kaffeeservice für meine Puppen: ein winziges Kännchen mit verziertem Deckel, passend dazu Milchkännchen, Zuckerdose und sechs Tässchen samt Untertassen und Kuchenteller. Alles in feinstem weißem Porzellan mit winzigen blauen Vergissmeinnicht darauf.
»Damit habe ich als Kind schon gespielt, sagt Großmutter. Also pass gut auf und halte es in Ehren. Bald wirst du fünf, und ich denke, du bist ein gewissenhaftes kleines Mädchen und kannst gut darauf aufpassen.«
Oh ja, ich werde vorsichtig und gewissenhaft sein und stets aufpassen. Das nehme ich mir fest vor.
Großmutter setzt sich neben mich an den Tisch, und nun haben wir gemeinsam unseren Spaß.
Jedes einzelne Teilchen nehme ich in die Hand, ganz behutsam und vorsichtig, damit nichts zerbrechen kann. Stück für Stück bewundere ich, stelle es auf dem weißen Leinendeckchen zurecht, ordne es hin und her, und alles ist in bester Ordnung.
Und dann geschieht das Unglück.
Mama erscheint auf der Bildfläche, ich höre schon ihren Schritt, das Klappern der hohen Hacken auf dem Fliesenboden in der Halle. Ein Schreck durchfährt mich. Meine Hände beginnen zu zittern. Eilig will ich das Geschirr in den Karton zurück räumen, da – peng! rutscht mir das Kännchen aus der Hand und zerspringt in tausend Scherben. Ausgerechnet auf den harten Fliesenboden muss es fallen. Da liegt es nun, ein einziger trauriger Scherbenhaufen.
In alle Glieder ist mir der eisige Schrecken gefahren. Und nun die Angst. Oh Gott, warum musste Mama jetzt kommen! Meine Hände zittern, mein Kinn zittert, und ich kann nichts mehr sehen, denn nun fließen die Tränen. Ich kann sie nicht zurückhalten, obwohl ich weiß, dass ich nicht weinen soll. Aber ich weine, schluchze herzzerreißend. Ein Bild des Jammers gebe ich ab, zusammen gekauert da auf meinem Stuhl.
Und dann kriege ich Mamas feste Hand zu spüren. Irgendwie sollte mir doch mein Ungeschick auszuprügeln sein …
Großmutters Beschwichtigungen nützen nichts, ich werde in mein Zimmer gebracht, und da sitze ich nun, auf meiner Fußbank in der Ecke und kann nicht aufhören zu schlucken und zu schluchzen.
Es tut nämlich weh, immer noch spüre ich Mamas energische Handschrift auf meinem Po. Aber das Andere tut vielmehr weh: Dass ich Großmutter so enttäuscht habe. Was muss sie von mir denken? Ich mache nur Ärger, bin ein ungeschicktes Kind wie es kein anderes gibt. Und eine Heulsuse noch dazu.
Ich weiß ja, Mama hat Recht. Ich bin ein tollpatschiger Nichtsnutz!
Am späten Nachmittag darf ich wieder nach unten kommen. Mama hat es erlaubt. Sie steht in der Halle und blickt mir entgegen. Ihr Blick erscheint mit kalt, ja fast verächtlich. Als wüsste sie bereits um sämtliche neuen Missgeschicke, die mir demnächst passieren werden.
»Geh doch vernünftig, hüpfst ja die Stufen hinunter, als hättest du Sprungfedern statt Beine. Gleich wirst du fallen, ich sehe es bereits kommen …«
Und siehe da, ich falle.
Tatsächlich, unter Mutters forschender, stirnrunzeliger Miene verhaken sich meine Füße irgendwie, als würden sich ihre Blicke förmlich in meine Beine bohren, ich verliere das Gleichgewicht und falle …
Mit aufgeschlagenen Knien liege ich dann auf dem alten Küchensofa, Leni hockt neben mir auf dem hölzernen Schemel und verarztet meine Wunden – die körperlichen und die seelischen.
Vergangenheit
Das neue Bett
Mit vier Jahren habe ich ein schreckliches Erlebnis.
Papa ist auf einer Geschäftsreise. Ich bin mit Mama und Leni allein. Mama hat mir eine Überraschung versprochen. Sie ist besonders lieb zu mir. Das hätte mich eigentlich stutzig machen müssen, aber – mein Gott, ich bin erst vier. Und ich denke: dieses Mal bin ich ein braves Kind gewesen, habe Mama keinen Ärger gemacht. Nun kommt die Belohnung.
Die Belohnung ist ein Ausflug samt einer großartigen Überraschung, die damit verbunden ist: Ich soll ein neues großes Bett bekommen, denn das Kinderbettchen wird ausrangiert, weil ich ja nun ein großes Mädchen bin.
Da macht es gar nichts, dass der Morgen trüb und ohne Sonne ist. Wir werden ja in ein schönes, großes Möbelgeschäft fahren, und dort kann ich mir ein eigenes Bett aussuchen – ganz nach meinem Wunsch.
Was für ein Erlebnis.
Wir sitzen in Mamas feinem Wagen, sie fährt selbst. Aus dem wolkenbedeckten Himmel hat es zu regnen begonnen. Zuerst kommen einzelne Tropfen, wie große blanke Münzen, und dann wird ein Platzregen daraus, das Wasser stürzt nur so herab. Ich sitze im Auto und staune. Noch nie bin ich bei so einem Wetter mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich drücke mein Gesicht an die Scheibe und starre in das viele Wasser hinaus. Es reißt sich vom Himmel los und prasselt als eine geborstene Wasserwand herab, eine stählerne Jalousie aus Wasser fällt mit metallischem Krachen herab. Und wir schlängeln uns mittendurch.
Während des Wolkenbruchs hellt sich der Himmel nicht auf, sondern scheint noch dunkler zu werden. In den Häusern geht das Licht an, die Autos fahren mit eingeschalteten Scheinwerfern. Die Strahlen unserer eigenen bahnen sich dunstige Pfade durch den sintflutartigen Regen.
Ich bin beeindruckt und kein bisschen ängstlich, Mama jedoch da vorn am Steuer ist nervös geworden und hat zu schimpfen angefangen. Sie murmelt vor sich hin, dass wir nicht rechtzeitig ankommen, und was weiß ich alles. Für mich jedoch ist das ein phantastisches Abenteuer, ein Erlebnis, an dessen Ende der Kauf eines neuen Bettes steht. Noch nie im Leben war ich in einem großen Möbelgeschäft! Ich bin ganz aufgeregt.
Und dann sind wir am Ziel.
Und – oh, wie grausam, was dann passiert. Mein einzigartiges, großartiges Erlebnis stellt sich als glatter Betrug heraus. Schon das Möbelgeschäft kommt mir sehr sonderbar vor, als wir davor stehen. Schließlich entpuppt es sich als ein Krankenhaus.
In einem Zustand höchstens Entsetzens werde ich in einen Operationssaal geschoben, wo man mir – wie ich später erfahre – die Mandeln heraus nimmt.
Aus diesem Erlebnis lerne ich, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Ich bin jedoch nicht sicher, dass ich diese Lektion gut gelernt habe.
Noch Monate später habe ich immer wieder Alpträume, in denen ich durch eine Sintflut von Regen fahre. Der Himmel in meinem Traum wird dunkler bis hin zu einer tintenartigen Schwärze, und dann taucht in der Ferne ein Haus auf.
Plötzlich liege ich in einem weißen Bett, es ist kalt und feucht um mich, aber ich bin bis zum Hals zugedeckt – und das hat seinen Grund.
Durch das Fenster sehe ich den immer noch schwarzen Himmel, Wolken jagen hindurch, und wie gequält schreien die Bäume im Sturm, ihre Äste werden bald nach der einen, bald nach der anderen Seite gerissen. Es ist ein einziges Getöse, es hört sich an, als brüllte die See.
Ich liege still und starr und spüre mein Herz rasen vor Angst, denn ich weiß: Nicht nur da draußen ist das Unheimliche, es ist auch hier drin. Hier unter dem Bett lauert es, das grauenvolle Ungewisse.
Ich habe das Gefühl, jeden Augenblick kann es hervor kriechen, ich weiß nur nicht, was es ist. Darum bin ich bis zum Hals mit dieser feuchten, kalten Decke zugedeckt. Sobald ich meine Hand heraus strecke oder mein Bein aus dem Bett halte, kann es nach mir greifen, das schreckliche Etwas. Vielleicht mit einer hässlichen Tatze mit Klauen daran – und mich dann in die unheimliche Dunkelheit zerren, die da unter dem Bett auf mich wartet …
Wenn ich dann schreiend aufwache, ist manchmal mein Bett nass. Ich habe mich nassgemacht und liege nun zitternd da, wage nicht, mich zu rühren vor Angst. Aber dann höre ich Lenis Schritte die knarrenden Stufen herauf kommen, die mir vertrauter sind als das eilige Trippeln meiner Mutter.
Und dann ist sie da, Leni. Mit ihrem Trost und ihren weichen Armen. Das Treppensteigen fällt ihr schon schwer, sie ist nicht mehr die Jüngste. Sie schnauft heftig und kriegt kaum Luft, wenn sie bei mir angekommen ist. Aber sie weiß immer, wann ich sie brauche.
Sie macht helles Licht und setzt sich auf die Bettkante. Mit erhobenen Armen versucht sie, ein paar graue Haarsträhnen in den sich auflösenden Haarknoten zurück zu zwängen, dabei murmelt sie halblaut tröstende Worte.
Später liege ich warm und trocken im Bett, Leni hockt neben mir, streicht mir übers Gesicht und summt eines ihrer alten Lieder, deren Melodie mir noch heute manchmal in den Kopf kommt.
Ach, Leni mit ihren Märchen und Liedern, mit den Küssen, dem Streicheln und mit der bei Strafe verbotenen Schokolade, Leni mit dem heißen Holundertee, dem Hustensaft und den liebevollen, tröstenden Worten.
Ach, Leni, was hätte ich ohne dich gemacht?
Vergangenheit
Kindheitsängste
Kleine, ängstliche Charly.
Bis zu meinem sechsten Lebensjahr habe ich vor vielen Dingen Angst. Das Erlebnis mit dem Möbelgeschäft, das sich als »Schreckensort Krankenhaus« entpuppt, sitzt mir jahrelang in den Gliedern. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit, vor Gewitter, vor großem Sturm, vor allem Neuen.
Mein Urvertrauen ist gründlich erschüttert.
Sogar vor dem Schwimmen im See habe ich Angst. Ich muss den Grund unter mir sehen können, wie in einem Pool. Sobald das Wasser undurchsichtig wird, trübe oder von Kraut durchwachsen, schaudert es mich. Ich bade noch heute nicht gern im offenen Meer.
Ich liege in meinem Bett – ein neues habe ich übrigens nie bekommen. Schließlich ist das alte Haus samt Speicher voll mit alten Möbeln und jeder Menge Betten. Immerhin durfte ich mir eines aussuchen.
Nun prunkt ein gewaltiges Geschütz mit einem eindrucksvollen Baldachin mitten in meinem Zimmer. Ich finde es schön, vor allem den geschnitzten Engel an der Decke, der wie beschützend auf mich herabsieht. Und dann die bauschigen, geblümten Vorhänge, ich kann sie zuziehen und fühle mich wie in einer Höhle, geborgen und sicher.
Ich liege also in meinem Bett, es ist später Abend. Ich betrachte den Engel über mir; sein rosiges, freundliches Gesicht schaut gütig zu mir durch das Dämmerlicht. Ich schlafe jetzt immer mit einem Nachtlicht, nur darf Mama das nicht wissen. Leni hat es erlaubt. Sie ist ohnehin die Einzige, die zum Gutenachtsagen zu mir kommt. Papa ist ein vielbeschäftigter Mann, der mit kleinen Kindern nicht viel anfangen kann. Sein Interesse für mich ist praktisch erst mit Beginn meiner Schulzeit erwacht.
Das Lämpchen am Bett flackert leicht, ein Zeichen dafür, dass Sturm aufgekommen ist. Ich kenne die Vorzeichen.
Ich liege lang ausgestreckt da und nehme aus den Augenwinkeln das Aufleuchten vor den Fenstern wahr. Es hält mich nicht länger unter meiner Decke. Ich bin voller Unruhe und Angst. Ich schlüpfe aus dem Bett und öffne vorsichtig die Tür. Stille im Korridor, dunstiges Schummerlicht im ganzen Treppenhaus. Ich beuge mich über das Geländer und spähe hinunter. Wo bleibt Leni nur? Sie weiß doch, dass ich Angst vor Sturm habe. Aber nichts da unten. Nicht einmal leises Stimmengemurmel aus den Räumen.
Ich beuge mich weit über das Geländer und blicke zur unteren Halle, wo ein schwaches Licht schimmert. Draußen rumort der Wind um das Haus, in dem auf einmal überall Geräusche aufspringen: das Flattern von Gardinen wie wild bewegte Geisterhände; das Klirren von Kristall; das Vibrieren der Fensterscheiben; das Knistern und Knacken im Gebälk. Eine Schranktür klappert, als versuche jemand, einem engen Verlies zu entkommen, und ticktack, ticktack macht die alte Großvateruhr in der Diele.
Ich zittere vor Angst und Kälte. Wo bleibt Leni?
Nach unten darf ich nicht gehen, das weiß ich. Mama hat es verboten. Nach acht gehören kleine Kinder ins Bett und haben dort zu bleiben, egal ob es stürmt, schneit oder gewittert.
Ich schlüpfe in mein Zimmer zurück, knalle die Tür hinter mir zu, als sei eines der Nachtgespenster mir auf den Fersen.
Leni, warum kommst du nicht?
Ich stehe am Fenster. Die Einfahrt liegt im Dunkeln, aber da - ein tagheller Blitz schießt über den schwarzen Himmel, der sekundenlang wie geschmolzenes Silber aussieht. Dann ein Donnerschlag, und gleich darauf das Splittern eines Dachziegels, ein dumpfes Rollen und gedämpftes Aufschlagen.
Jetzt spült gleißende Helle über die schwarzen Umrisse da draußen, und alles scheint aufzuglühen. Und wieder ein langer, gezackter Blitz, der alles taghell werden lässt. Dann erneut der Donner. Noch bevor das Grollen verklingt, strömt Regen herab, prasselt auf das Dach, auf die Einfahrt, gegen die Mauer.
Ich stehe zitternd am Fenster und spüre, wie am ganzen Körper winzig kleine Härchen sich sträuben. Wo bleibt Leni?
Ein erneuter Blitz zuckt wie ein zerfaserter Draht durch die schwarzen Wolken. Ich schließe die Augen und warte auf den hallenden Schlag.