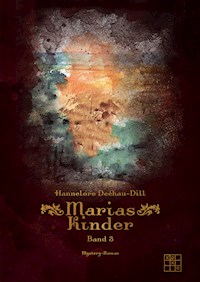Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Leute vom Kastanienweg
- Sprache: Deutsch
Vom »kleinen Häwelmann« aus dem Märchen lernt das Kind Undine, wie man der Wirklichkeit entflieht. Der Wirklichkeit und dem schattenhaften ziegenköpfigen Ungeheuer, das in den dunklen Nächten und der Stille lauert. Sie reist auf den Mondstrahlen in eine bessere Welt oder in eine schönere Zeit, doch niemals für lange. Dann muss sie zurück in das graue Haus inmitten vieler anderer grauer Häuser in den grauen Straßen. Es ist nicht leicht für sie, sich und den Bruder zu beschützen, nur bei der Großmutter sind sie sicher, denn dahin kommt es nicht. Irgendwann begreift Undine, was es mit diesem unheimlichen Schatten an der Wand auf sich hat. Dem Ungeheuer, das ihre gesamte Kindheit überschattet und dessen langer Schemen noch weit darüber hinaus reicht. Ein Roman aus dem Kastanienweg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Die Unerträglichkeit der Stille
Die Leute vom Kastanienweg
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-070-5
E-Book-ISBN: 978-3-96752-570-0
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 1291043602
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Erfüllung aber, Erwähltwerden,
der Sieg also über die elende Angst, spurlos ersetzbar zu sein – das alles gelingt nur, wenn die Liebe gelingt.
Eine romantische Überforderung der Herzensbeziehungen?
Ja, man weiß
Eine Strategie der Verklärung?
Ja, man hört es im Kopf
Das Glücksverlangen aber ist rebellisch.
Es bleibt anarchistisch, wilder als der Kopf.
(Bahr, 1978)
Teil I
Undine und der kleine Häwelmann
Vergangenheit
»Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Häwelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war. Wenn er aber nicht müde war, so musste seine Mutter ihn darin in der Stube umherfahren, und davon konnte er nicht genug bekommen.
Nun lag der kleine Häwelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen, die Mutter aber schlief schon lange in ihrem großen Himmelbett.
»Mutter,« rief der kleine Häwelmann, »ich will fahren!«
Und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her, und wenn ihr Arm müde werden wollte, so rief der kleine Häwelmann: »Mehr, mehr!«
Und dann ging das Rollen wieder von vorne an.
Endlich aber schlief die Mutter gänzlich ein, und so viel der kleine Häwelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht; es war rein vorbei.
Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben, der gute alte Mond, und was er da sah, war so possierlich, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen; so etwas hatte der alte Mond all sein Lebtag nicht gesehen. Da lag der kleine Häwelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf; dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise, fing es an zu rollen, über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann kopfüber die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter.
»Mehr! Mehr!« schrie Häwelmann, als er wieder auf dem Boden war; und dann blies er wieder seine Backen auf, und dann ging es wieder kopfüber und kopfunter. Es war ein großes Glück für den kleinen Häwelmann, dass es gerade Nacht war und die Erde auf dem Kopf stand; sonst hätte er doch gar zu leicht den Hals brechen können.
Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm plötzlich ins Gesicht.
»Junge,« sagte er, »hast du noch nicht genug?«
»Nein,« schrie Häwelmann, »mehr, mehr! Mach mir die Tür auf! Ich will durch die Stadt fahren, alle Menschen sollen mich fahren sehen!«
»Das kann ich nicht,« sagte der gute Mond, aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen, und darauf fuhr der kleine Häwelmann zum Hause hinaus.
Auf der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht, als der kleine Häwelmann in seinem Rollenbett über das Straßenpflaster fuhr, und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen…«
Die vertraute Stimme der Großmutter plätschert nur noch von fern an ihr Ohr. Undine hat die Augen geschlossen, ganz fest zugekniffen, um den Schatten an der Wand nicht zu sehen. Seinen mächtigen Schatten, verzerrt und in die Länge gezogen, diese ziegenköpfige, hängeschultrige Silhouette, die über die Wand gleitet wie eine Figur in einem Schattenspiel, der Schatten des Ungeheuers…
Es ist aber gar nichts da, Undine weiß es genau. Es ist nicht hier. Bei der Großmutter ist sie sicher.
Die Stimme der Großmutter ist verstummt. Sicher glaubt sie, Undine sei eingeschlafen. Sie fährt einmal sacht mit ihrer rauen Hand über Undines Haar, das sich wüst und zerzaust über das ganze Kissen ausbreitet, dann steht sie leise auf, löscht das Nachtlicht und geht hinaus.
Undine aber schläft noch nicht. Sie liegt auf dem Rücken und denkt an den kleinen Häwelmann. Aber vor allem denkt sie an den Mond und sein Licht. In der Nacht beleuchtet er die nach Süden gewendete Seite aller Dinge. Er steht mit seinem Gesicht direkt über ihrem Fenster, wendet den Kopf ein wenig ab, mit schrägen Augenbrauen und leicht geöffnetem Mund, die Augen halb geschlossen, so als ob er über irgend etwas dringend nachdenken müsse…
Auf einmal öffnet er weit die Augen, lacht sie freundlich an und schickt ein paar lange silberne Strahlen zu ihr herunter. Und nun geschieht das Wunderbare: Die kleine vierjährige Undine mit dem wirren rotblonden Lockenkopf und den tausend Sommersprossen fährt mit ihrem Bettchen auf diesen Strahlen hinaus in die Nacht. Weit fort in ein anderes Land. Vielleicht ein Land ohne Tränen, ohne Angst…ohne das Ungeheuer .
Gegenwart
Taumelnd und wie von Sinnen hastet sie auf die Straße. Das dumpfe Zuschlagen der Tür dröhnt in ihren Ohren, fast noch übertönt vom hämmernden Schlag ihres Herzens. Wirre, unzusammenhängende Bilder jagen durch ihren Kopf. Mit steifen Beinen setzt sie sich in Bewegung und es ist, als wollten die Füße ihr kaum gehorchen. Mit einer klammen Hand wischt sie sich übers Gesicht, das nass von Tränen ist, mit der anderen presst sie die braune Tasche fest an die Brust.
Mit gekrümmten Schultern, den Blick zu Boden gewandt, eilt sie voran. Sie fühlt sich seltsam und schwindlig, am Rande einer geistigen und emotionalen Erschöpfung. Das Straße scheint sich ihr entgegen zu neigen, das graue Pflaster ist schon ganz nah. Sie weiß, dass ihr nur noch Sekunden bleiben, bis sie in das wartende Nichts fallen wird.
Um Gottes willen, nur das jetzt nicht. Sie muss weg von hier, und das möglichst schnell. Panik erfasst sie bei dem Gedanken, was passieren könnte, wenn man sie hier ohnmächtig auf der Straße fände. Ein stechender Schmerz schießt ihr den Rücken hinauf, ein Schmerz, der ihr wohl vertraut ist. Zum ersten Mal heißt sie ihn willkommen, denn er macht sie mit einem Schlage munter.
Undine läuft, läuft mit langen, hastigen Schritten durch die stillen Straßen. Eher ist es ein Vorwärtshasten, als würde sie getrieben von unsichtbaren Gespenstern. Grau verschleiert im Zwielicht stehen die Häuser zu beiden Seiten der Straßen, schmale, winklige Gassen, in denen sich die Häuser vorlehnen, als steckten sie tuschelnd die Köpfe zusammen.
Bald wird es Nacht sein. Ohne einen Gedanken im Kopf hastet sie voran, läuft immer weiter, durch schmutzige, schlecht beleuchtete Gegenden. Längst hat sie ihr Wohnviertel verlassen. Ringsumher ist ihr alles fremd.
Gibt es Hoffnung? Hoffnung zu entkommen? Hoffnung auf ein neues Leben jenseits der Verzweiflung, auf eine andere unbekannte Welt jenseits ihrer Erfahrung?
Wohin soll sie rennen? Gibt es ein Ziel?
Urplötzlich wird ihr klar, dass sie nicht darüber nachgedacht hat, über dieses Ziel. Sie ist gelaufen, hat sich nicht einmal umgesehen - ohne einen einzigen Blick zurück. Wenn sie doch ihr altes Leben abstreifen könnte wie eine überflüssige Haut, um einem neuen, besseren Leben Platz zu machen. Und mit ihm die Vergangenheit und Erinnerung! Aber nein, das kann man nicht. Das kann niemand. Man kann sich und seine Vergangenheit nicht loswerden, mochte man auch noch so rennen und flüchten.
Da ist wieder der pochende Schmerz in den Nieren. Undine versucht ihn zu ignorieren. Sie hört ein Auto hinter sich, das erste Auto in diesen stillen Straßen.
Und plötzlich weiß sie: man ist ihr bereits auf den Fersen! ER ist es! Oder irgend jemand anders. Die Vergangenheit!
Das Auto fährt langsam an ihr vorüber. Sie holt tief Atem und denkt: natürlich, kein Mensch verfolgt mich, es kann ja gar nicht sein. Niemand ist hinter mir her. Niemand weiß, was ich getan habe – noch nicht.
Auf einmal überkommt sie eine ungeheure Müdigkeit. Der Kopf erscheint ihr dumpf und leer, hinter den Schläfen hämmert es. Sie stolpert, die Tasche fällt zu Boden. Mühsam bückt sie sich, der stechende Schmerz fährt ihr durchs Kreuz. Schweiß tritt ihr auf die Stirn, sie rappelt sich auf und geht mit gesenktem Kopf weiter. Stundenlang geht sie, durch ein unbekanntes Viertel nach dem anderen, durch belebte Straßen und stille Gässchen.
Inzwischen ist es ganz dunkel geworden. Wie lange irrt sie wohl schon durch diese Stadt? Sicher viele, viele Stunden lang.
Die Nacht ist von einem weichen, fast schwarzen Blau, der Himmel übersät mit Sternen. Zwischen Häusern und Wolkenfetzen wirft der Mond sein kaltes, weißes Licht über die schlafende Stadt.
Nicht überall schläft die Stadt.
Undine hat vor einer schmutzigen kleinen Bar in einer Nebenstraße Halt gemacht. Das gelbe Licht einer hohen Bogenlampe fließt über die Straße.
Sie spürt wieder ihre unglaubliche Erschöpfung, Füße und Rücken schmerzen, es hämmert hinter der Stirn.
Ich muss schlafen, denkt sie. Ich bin am Ende. Ganz einfach am Ende mit meiner Kraft.
Ihr Blick wandert an der düsteren Hauswand empor, ein schmales, verräuchertes Backsteingebäude, eine Leuchtreklame für Bier wirft flackernde Schatten auf das Pflaster. Aus der halb geöffneten Tür dringen graue Rauchschwaden und aus den verstaubten Fenstern fällt trübes Licht nach draußen.
Undine ist meilenweit gelaufen und diese Gegend ist ihr ganz und gar fremd. Sicher kennt sie hier niemand.
Kurzentschlossen stößt sie die Tür auf und steht im rauchigen Inneren. Nur wenige Menschen sind in der Bar. Zwei unrasierte Männer mit Schirmmützen auf dem Kopf hocken auf Barhockern am Tresen, in einer schummrigen Ecke kauert ein Liebespärchen in verschlungener Umarmung auf einem alten Sofa.
Der bärtige Mann hinter dem Tresen blickt ihr verblüfft entgegen.
Undine bleibt in der Tür stehen. Plötzlich wird ihr ihr zerzaustes Äußeres bewusst. Als sie so eilig davon lief, hat sie gar nicht darauf geachtet, was sie anhat. Es ist ihr auch jetzt ziemlich egal. Mit einer Hand streicht sie flüchtig über ihr herabhängendes, rotblondes Wuschelhaar, mit der anderen umklammert sie fest ihre braune Handtasche, ihr einziges Hab und Gut in dieser verrückten Nacht.
Auf ihre Frage, ob man hier Zimmer vermiete, nickt der Wirt freundlich. Ja, ein Zimmer könne sie haben. Zwar ohne großen Komfort, aber mit fließendem Wasser und einem anständigen Frühstück am Morgen. Und ruhig sei es hier auch in der Gegend. Leider gehen die Geschäfte nicht mehr so wie einst. Diskos sind wohl mehr gefragt, und dann diese Gegend, na ja.
Und wenn sie noch etwas zu Essen wünsche, auch das sei möglich. Kein großes Essen, aber immerhin eine Bockwurst mit Salat.
Undine schüttelt den Kopf. Nach Essen ist ihr absolut nicht zumute. Aber eine Tasse Tee wäre wunderbar.
Aber sicher, wenn’s weiter nichts ist! Tee könne sie haben. Vielleicht mit Rum? Warum nicht, kann doch nicht schaden.
Schließlich hockt Undine in der dunkelsten Ecke der Kneipe auf einem der zerschlissenen Sofas vor einem großen Becher dampfenden Tees und lehnt sich aufatmend zurück. Ihre braune Tasche hat sie neben sich gelegt. Verstohlen kramt sie darin herum. Sie weiß, dass sie Geld mitgenommen hat. Diese Tasche hat schon seit Wochen in einem Schubfach der Flurgarderobe gelegen, ausgestattet mit dem Notwendigsten: ein paar Geldscheine, Ausweis und Führerschein, ein warmer Poncho, ein Trainingsanzug, ein wenig Unterwäsche, Strümpfe und ein paar Kleinigkeiten wie Kamm und Zahnbürste. Viel ist es nicht, aber für mehr war kein Platz, außerdem hätte Undine auch gar nicht gewusst, was man noch hätte einpacken sollen, wenn man sich möglichst unauffällig davonstehlen will.
Eigentlich hatte sie sich nie ernsthaft über ihr Fortgehen Gedanken gemacht. Irgendwann geh ich fort! Das war alles, was ihr manchmal durch den Kopf gegangen ist. Das Packen dieser Tasche war ganz von selbst geschehen, sozusagen aus dem Unterbewusstsein heraus. Sicher war ihr oft durch den Kopf gegangen, ihr Leben zu verändern, aber niemals wäre ihr in den Sinn gekommen, dass es so geschehen könnte. Dass es auf diese Weise nötig sein würde. Hals über Kopf in die Nacht hinaus!
Auf einmal kommt ihr der Gedanke, dass sie diesem Alptraum vielleicht niemals entkommen, dass ihr ganzes restliches Leben eine Flucht sein könnte. Die Ereignisse der letzten Stunden überfallen sie in einem Gemisch aus grässlichen, beängstigenden Bildern. Mit einem Schrei fährt sie zusammen, als der Wirt plötzlich neben ihr steht.
»Noch ein Teechen mit Rum? Als kleiner Schlaftrunk sozusagen? Sie sehen aus, als ob Sie’s brauchen könnten.«
Undine nickt stumm.
Nur ruhig, sagt sie sich energisch. Es ist alles in Ordnung. Ich darf nicht jedes Mal losschreien, wenn man mich anspricht. Und auf keinen Fall will ich mich selbst verrückt machen. Jetzt heißt es, wohlüberlegt einen Schritt nach dem anderen zu tun. Den ersten hab ich bereits getan: ich bin aus meinem Leben ausgebrochen. Wie das geschehen ist – daran will ich jetzt nicht denken. Es ging nun mal nicht anders. Sicher hätte jede andere das Gleiche getan. Jetzt heißt es nach vorne schauen!
Wie sagte die fromme Großmutter Friederike stets?
Es kommt darauf an, wie man sich innen einstellt, ob man das Schwere schwer und steif nimmt oder elastisch. Oft kann man die Schwere nicht loswerden, aber man darf nicht das Vertrauen in seine Flügel verlieren, auch wenn sie grad müd und reparaturbedürftig sind.
Aus den Tiefen ihrer Erinnerungen taucht das verschwommene Bild der Großmutter auf, wie sie steif und gerade auf ihrem Stuhl sitzt und in der Bibel liest, vollkommen in sich gekehrt. Dichtes graues Haar zu einem festen Knoten im Nacken verschlungen, die randlose Brille auf der knochigen Nase, das Kinn ragt dünn über den hohen Stehkragen. Stets hat sie es fertig gebracht, gleichzeitig energisch und demütig zu wirken.
So jedenfalls lebt sie in Undines Erinnerung….
Die Stille der Nacht
Vergangenheit
Es ist Nacht. Das Kind fährt erschrocken aus dem Schlaf. Irgendetwas stimmt nicht im Haus. Es ist sehr still, eine bedrückende Stille, die Undine ängstigt. Eine Stille, in der etwas Unheimliches steckt. Sie liegt ruhig da und lauscht in die Dunkelheit, wie sie es in all den Jahren gelernt hat. Es gilt abzuwarten, ob sich das Geräusch, das bis in ihren Schlaf gedrungen ist und sie geweckt hat, sich wiederholen wird.
Nicht das Ächzen des alten Hauses ist es, nicht das Klappern eines Fensters in seinem Rahmen oder das Raunen des Windes an den Hausecken. All das ist es nicht. Das sind gute Geräusche. Dieses Geräusch, das aus der Stille kommt, ist keineswegs gut. Es ist böse und beängstigend.
Starr auf dem Rücken liegt Undine da und lauscht und wartet. Ihr Puls beginnt schneller zu schlagen, während sie sich mit weit aufgerissenen Augen zwingt, die vertrauten Schattenformen der Möbel zu erkennen. Und immer noch ist es still. Ist es die Stille davor oder danach? Die Stille danach, die befreit ist von Angst und Schrecken, in der nur noch die Alpträume lauern.
Undine kann nicht mehr warten, sie muss dringend zur Toilette. Der Bauch tut ihr schon weh, und wenn sie nicht gleich geht, dann macht sie ins Bett, wie schon früher…
Sie krabbelt aus dem Bett und tappt aus dem Zimmer. Im Dunkeln geht sie durch den Flur und tastet sich bis zum Badezimmer. Hier scheint der Mond hell herein, und während Undine auf der Kloschüssel hockt, betrachtet sie im Mondlicht ihre Füße, die sehr weiß aussehen. Sie versucht nicht daran zu denken, was für eine Stille es ist im Haus. Nur schnell fertig werden und ins Bett zurück.
Schon steht sie wieder im dunklen Flur, da dringt ein Geräusch an ihr Ohr. Angespannt lauschend steht sie da, mit klopfendem Herzen und schwitzenden Händen. Was ist das für ein Geräusch?
Noch bevor sie ihr Zimmer erreichen kann, ist es wieder da. Sie ist doch nicht schnell genug gewesen! Nun heißt es nur, mucksmäuschenstill zu sein, sich nicht zu rühren, ja, am besten gar nicht zu atmen. Sie drückt sich hinter die geöffnete Küchentür und hält für einen Augenblick die Luft an. Die Wand im Rücken ist rau und kalt und der Steinboden unter den Füßen noch kälter. Vor Angst läuft ihr der Schweiß von der Stirn, während Füße und Rücken wie aus Eis sind. Und auch innen drin ist es wie Eis, obwohl die Angst sie in ihren Klauen hält. Und dann ist es da!
Riesig, gewaltig wie ein Dämon erscheint der Schatten an der Wand, huscht darüber hin mit seinem Ziegenkopf und den grotesken Hörnern, lange Arme mit Klauen in der Luft schwenkend.
Undine ist nicht mehr da, ganz klein ist sie innen drin geworden, so wie Däumelinchen, das winzige Mädchen in dem Märchen, das die Großmutter ihr erzählt hat. Däumelinchen ist so klein, dass sie in einer Nussschale Platz hat – so klein ist Undine jetzt auch. Und niemand kann sie sehen.
Auch das Ungeheuer nicht…
Unsinn, sagt die Großmutter resolut. Ungeheuer gibt es nicht. Nur im Märchen.
Du erzählst dem Kind sowieso zu viele Märchen, sagt der Vater oft. Aber die Großmutter hört nicht auf ihn, zwinkert Undine mit einem Auge zu – und erzählt weiter ihre Märchen. Denn Undine liebt die Märchen. Alle. Die schönen von den lieblichen, sanften Prinzessinnen, und die vom Teufel und seiner Großmutter. Auch die von Drachen und Gespenstern, die manchmal wirklich Angst machen können. Trotzdem liebt Undine sie. Und all die Geschöpfe und Zauberwesen sind längst nicht so unheimlich und beängstigend wie das Ungeheuer. Und das Ungeheuer ist keine Gestalt aus einem Märchen, oh nein. Es ist wirklich!
Das Reich der Phantasie ist groß und kostbar, sagt die Großmutter. So wie die Träume, die wir haben, am Tage und in der Nacht. Besonders die Tagträume sind etwas Gutes, sie lösen uns vom Alltag und führen uns in das Reich der Phantasie.
Ganz ernst ist die Großmutter geworden, als sie dann weiter spricht.
Nun hast du einen kleinen Bruder bekommen, Undine. Er ist hilflos und braucht den Schutz seiner großen Schwester, verstehst du? Du darfst ihm niemals wehtun, er kann sich ja noch nicht wehren. Sei immer behutsam und liebevoll mit ihm, nicht wahr? Versprich mir, dass du gut auf deinen kleinen Bruder acht gibst.
Natürlich verspricht Undine das. Sie ist ja groß, bald fünf Jahre alt. Ach, wie wird sie den kleinen Bruder lieb haben. Und auf ihn aufpassen. Ihn vor dem Ungeheuer beschützen…
Die Großmutter hat weitergesprochen. Undine hat einen Augenblick nicht zugehört, all ihre Gedanken sind bei dem kleinen Bruder, der so winzig ist und so süß, mit dem blonden Haarbüschel auf dem Kopf.
Das Gesicht der Großmutter ist unter den grauen Falten seltsam glatt und undurchdringlich geworden, während ihr Blick aus dem Fenster wandert.
Und wie ist es nachts? fragt sie und schaut Undine auf einmal forschend an, mit immer noch glatter Miene, nur die Augen blicken mitleidig auf das Kind. Undine lehnt sich an den Schoß der Großmutter, deren lange schwarze Röcke bis zum Boden reichen. Sie sitzt auf ihrem hochlehnigen Stuhl am Fenster, vor sich auf der Fensterbank ihre Bibel und ein über alle Maßen zerfleddertes Gesangbuch. Undine kennt beides gut, Bibel und auch das Buch mit den frommen Liedern.
Eigentlich braucht die Großmutter gar kein Liederbuch, denn sie kennt sämtliche Lieder darin auswendig, alle Strophen. Es ist erstaunlich. Undines Gedanken schweifen wieder ab, es fällt ihr schwer, bei der Sache zu bleiben, wenn Großmutter sie so ausfragt. Da ist etwas in ihr, das dann am liebsten flüchten will. Und das tut Undine auch, das Flüchten und Davonlaufen hat sie gut gelernt…
Ihre Gedanken wandern zum letzten Sonntag in der Kirche. Es ist ein Kirchgang wie so viele andere. Die Großmutter nimmt Undine oft mit, wenn sie geht. Sonst geht niemand, Mutter und Vater nicht, und der Großvater ist schon lange tot.
Sie sitzt ganz eng an die Großmutter geschmiegt in einer der vorderen Reihen. Der Pastor ist fertig mit seiner Predigt, nun wird gesungen. Die kleine Tafel an der roten Steinwand über den Köpfen der Kirchgänger zeigt die Nummern der Lieder an, die heute dran sind; das letzte Lied ist an der Reihe, zwei Strophen davon sind bereits überstanden.
Die Orgel orgelt immer weiter, mit leicht blechernem Klang, denn sie ist alt. Es gilt noch drei Strophen zu singen, aber der Pastor weiß nicht weiter, er hat kein Gesangbuch vor der Nase wie die Gemeinde. Die aber bringt nichts Richtiges zustande, nur ein schleppendes, klägliches Leiern. Vielleicht hat die Predigt des Pastors sie müde gemacht und nun sind alle kurz vor dem Einschlafen. Das kann Undine gut verstehen.
Jedoch die Stimme der Großmutter schmettert laut und klar durchs ganze Kirchenschiff, als wollte sie nicht nur die dösende Gemeinde, sondern auch noch alle Heiligenfiguren an den Wänden unverzüglich zum Leben erwecken. Und alles ohne Gesangbuch!
Der Pastor lächelt beifällig und wirft ihr einen verschwörerischen Blick zu. Dann stimmt er auch wieder ein. Der laute Gesang der Großmutter hat ihm scheinbar auf die Sprünge geholfen, so dass ihm der Text wieder eingefallen ist. Und nun hat alles wieder seine rechte Ordnung.
So ist das mit Großmutter. Sie kennt alle Lieder, und viele, viele Märchen und Geschichten. Im hohen Schrank mit den Glastüren bewahrt sie noch eine andere Bibel auf, eine ganz besondere Bibel. Sie ist nicht so klein und abgegriffen wie die auf der Fensterbank. Die Blätter darin sind nicht hauchdünn und mit winziger, merkwürdiger Schrift bedeckt – Wörter, nichts als Wörter.
Nein, diese Bibel im Schrank ist viel größer und prächtiger, sie hat einen bunt bedruckten Einband, die Schrift darin ist deutlicher und auf dickeren Blättern. Und dann die Bilder! Sie sind blank und farbig und unglaublich eindrucksvoll. Sie zeigen die Geschichte von Gott und den Menschen, wie alles damals vor vielen hundert Jahren anfing - das gesamte Alte Testament, und hinten dran dann noch das Neue. Es beginnt mit der Entstehung der Welt, und das erste Bild zeigt, wie Gott sie erschaffen hat.
Sicher ist nicht alles darin abgebildet, vieles ist nur in Wörtern beschrieben. Aber die wichtigen Dinge – so wie die Geschichte von Adam und Eva – sind auf diesen Bildern zu sehen. Spannendere – und gruseligere! – Geschichten hat Undine nie gehört als in diesem Buch.
Undine liebt die Bilderbibel, obwohl sie vieles nicht versteht – oder erst so nach und nach verstehen lernt. Eines ist ihr jedoch von Anfang an klar: Gott ist nicht nur der gütige Herr mit dem Bart und den wallenden Gewändern, oh nein! Er kann sehr böse werden, nämlich wenn die Menschen nicht parieren! Dann gibt es Strafe, und das nicht zu knapp, das kann man auf den blanken Bildern sehen. Grausige Dinge passieren da, und alles unter Gottes Regie! Geradezu beängstigend ist das. Undine kann nur staunen…
Aber Gott ist gerecht, sagt die Großmutter dazu. Und wenn er den Menschen Strafe schickt, so haben sie die auch verdient. Alles, was Gott schickt, haben wir hinzunehmen, es ist unser Schicksal und seit langem vorbestimmt. Seien es nun Strafen, Prüfungen oder Belohnungen, nämlich das Brot auf dem Tisch oder die Sonne am Himmel. Für jede kleine Gabe hat man dankbar zu sein und jede Strafe oder Prüfung hat man demütig willkommen zu heißen – so will es Gott. Und wehe, wenn man da aufmuckt…
Vielleicht schickt Gott als Strafe ja manchmal ein Ungeheuer. Das wäre einleuchtend, wenn man an das Alte Testament denkt. Nur weiß Undine absolut nicht, was sie denn so Böses getan haben soll. Immerhin – Gott scheint es zu wissen. Er weiß ja alles.
Hörst du, was ich sage, Undine? dringt die Stimme der Großmutter in ihre Gedanken.
Schläfst du nicht gut in der Nacht? Du siehst so blass aus in letzter Zeit. Ein guter Nachtschlaf ist wichtig für ein kleines Mädchen wie du eines bist. Siehst du denn dein Ungeheuer auch in der Nacht?
Undines Geist kehrt in die Gegenwart zurück. Sie nickt.
Ja, ich höre es manchmal und ich hab’s auch schon gesehen, wenn ich nachts aus dem Zimmer gehe.
Das sind deine Träume, mein Kind. Und warum wanderst du nachts im Hause herum? Kannst du nicht schlafen?
Manchmal muss ich zum Klo, dann – dann kommt es…
Es gibt keine Ungeheuer, Kind. Sicher hast du nur geträumt. Und dann bildest du dir ein, dass es aus deinen Träumen geradeswegs in die Wirklichkeit hinein spaziert. So ist das nicht, glaub mir…
Undine glaubt ihr aber nicht. Sie weiß es besser, da mag die Großmutter reden, was sie will.
Die spricht auch schon weiter.
Vergiss nicht, an jedem Abend deine Gebete zu sprechen, liebes Kind. Das ist wichtig! Gott sieht alles und kann alle bösen Geister vertreiben, auch die in deinem Kopf. Und du musst abends an schöne Dinge denken, weißt du? An kleine Mädchen, die zu Prinzessinnen werden und auf einem Schloss wohnen. Dann stellst du dir vor, dass du selber so eine Prinzessin wärst, du reitest mit dem Prinzen zu seinem prächtigen Schloss…
Undine will gar keine Prinzessin sein, auf den Prinzen und das Schloss kann sie gut verzichten. Und vom Beten hält sie auch nicht viel. Es hilft nicht gegen Ungeheuer, das hat sie längst heraus gefunden.
Erzähl mir die Geschichte vom kleinen Häwelmann, sagt sie auf einmal und lehnt den roten Schopf an das braune Wolltuch, das die Großmutter immer über den Schultern trägt.
Die Großmutter seufzt leise, blickt mit sorgenvoll gerunzelter Stirn auf den wirren Lockenkopf ihrer Enkelin. Dann erzählt sie.
»…sie fuhren Straßen aus, Straßen ein, aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie an der Kirche vorbei kamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturm. Sie hielten still.
»Was machst du da?« rief der kleine Häwelmann hinauf.
»Ich krähe zum ersten Mal!« rief der goldene Hahn herunter.
»Wo sind denn die Menschen?« rief der kleine Häwelmann hinauf.
»Die schlafen,« rief der goldene Hahn herunter, »wenn ich zum dritten Mal krähe, dann wacht der erste Mensch auf.«
»Das dauert mir zu lange,« sagte Häwelmann, »ich will in den Wald fahren, alle Tiere sollen mich fahren sehen!«
»Junge,« sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?«
»Nein,« schrie Häwelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!«
Und damit blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete, und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein. Der gute Mond hatte große Mühe, zwischen den vielen Bäumen durchzukommen; mitunter war er ein ganzes Stück zurück, aber er holte den kleinen Häwelmann doch immer wieder ein.
Im Walde war es still und einsam; die Tiere waren nicht zu sehen; weder die Hirsche noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter, durch Tannen und Buchenwälder, bergauf und bergab. Der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche, aber die Tiere waren nicht zu sehen; nur eine kleine Katze saß oben in einem Eichbaum und funkelte mit den Augen. Da hielten sie still.
»Das ist der kleine Hinze!« sagte Häwelmann, »ich kenne ihn wohl; er will die Sterne nachmachen.« Und als sie weiter fuhren, sprang die kleine Katze mit von Baum zu Baum.
»Was machst du da?« rief der kleine Häwelmann hinauf.
»Ich illuminiere!« rief die kleine Katze herunter.
»Wo sind denn die andren Tiere?« rief der kleine Häwelmann hinauf.
»Die schlafen!« rief die kleine Katze herunter und sprang wieder einen Baum weiter, »horch nur, wie sie schnarchen!«
»Junge,« sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?«
»Nein,« schrie Häwelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!«
Und dann blies er die Backen auf, und der gute alte Mond leuchtete, und so fuhren sie zum Walde hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt, und dann gerade in den Himmel hinein…«
Undine hockt da mit geschlossenen Augen und ist weit fort. Sie träumt von einer hohen Leiter, mit einem Engel auf jeder Sprosse, und die Leiter berührt mit der Spitze den Himmel. Sie ist von Mondlicht angestrahlt und glänzt ganz silbrig. Auf dieser Leiter kann Undine hinauf steigen, höher und höher, bis in den Himmel hinein – wie der kleine Häwelmann. Und dort oben sitzt Gott in seinem Strahlenglanz. Nun wird sie ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen, er soll ihr sagen, warum er ihr das Ungeheuer geschickt hat
Gegenwart
Undine erwacht mitten im Traum, einem beunruhigenden Traum, der gerade in einen Alptraum übergehen wollte. Sie schlägt die Augen auf und erwartet die vertraute Umgebung ihres Heims zu sehen. Mit einem Ruck setzt sie sich auf. Einen Augenblick lang weiß sie nicht, wo sie ist. Ein fremdes Zimmer, fremde Möbel, die sogar in dieser halben Dunkelheit schäbig aussehen. Aber nichts Beunruhigendes ist im Raum. Da ist nur das Mondlicht, das sich durch die Vorhänge stiehlt und eine verschwommene Erinnerung an ihren Traum herbei holt.
Ich bin als Kind auf den Mondstrahlen gereist, denkt sie vage, und Großmutters altes Märchen vom Häwelmann kommt ihr in den Sinn.
Auf den Mondstrahlen konnte ich überall hin flüchten: in ferne Länder, ins Weltall und in schönere Zeiten.
Und dieser Traum – was war es nur?
Sie starrt in die Dunkelheit, und dann kommt die Erinnerung. Die Erinnerung an den gestrigen Tag.
An ihre überstürzte Flucht Hals über Kopf in die Nacht!
Eine Kette von Bildern flackert durch ihren Kopf, der Zustand ihrer Welt, die sie durchlebt und an dem niemand teilhaben kann, nur sie allein. Stille und Einsamkeit hier nur für sie. Aber das macht ihr keine Angst! Im Gegenteil, beides heißt sie willkommen.
Undine sitzt in dem klapprigen, alten Bett, die klumpige Daunendecke bis zum Hals hochgezogen, und schwört sich: Niemals wieder ein Leben wie das, aus dem sie ausgebrochen ist. Niemals wieder!
Das alte Leben ist fort. Sie hat es hinter sich gelassen, mit all seinen früheren Bezüglichkeiten und seinen erduldeten und gewohnten Gepflogenheiten. Und nun das neue, in das sie langsam hinein gleitet, nichtsahnend, was es für sie bereit halten wird. Aber eines weiß sie gewiss: schlechter als das alte Leben wird es nicht sein! Ist sie nicht gesund und stark und mutig? Komme, was da wolle, sie wird es schon packen!
Sie muss nur – ja, was? Vernünftig und besonnen handeln! Und sich nicht von ihren Ängsten unterkriegen lassen. Nicht von den Ängsten, den Gespenstern der Vergangenheit und der Erinnerung!
Plötzlich wird ihr klar, dass sie hier nicht in Sicherheit ist. Wer weiß, vielleicht ist man ihr längst auf der Spur. Möglicherweise noch nicht jetzt, in der Nacht. Aber am Morgen, bestimmt jedoch im Laufe des Tages. Man wird sie vermissen, in der Bibliothek, in der sie halbe Tage arbeitet, die Nachbarin, die täglich über den Zaun ruft und deren Töchterchen oft nachmittags zu ihr herüber kommt, der Bäckerjunge, der am Morgen die Brötchen durchs Küchenfenster reicht – der wohl noch zuerst.
Und dann Aldo –
Energisch schiebt Undine diese beunruhigenden Gedanken beiseite. Sie muss an das Nächstliegende denken: sie muss hier fort, sobald es Tag ist. Wenn es nur schon so weit wäre.
Aber noch ist Nacht. Vielleicht sollte sie noch ein wenig schlafen. Der morgige Tag wird anstrengend sein. Undine liegt mit geschlossenen Augen unter ihrer klumpigen Federdecke und lauscht in die Stille. Sie denkt an Patrick, den kleinen Bruder Patrick, der vier Jahre jünger ist als sie. Wo mag er jetzt stecken? Seit Jahren hat sie nichts von ihm gehört. Vielleicht ist er längst tot. Tot so wie alle anderen.
Sie sieht ihn wieder vor sich, wie er als ganz kleiner Junge war, stets so ein liebes Kind, und so zart und hübsch – ganz anders als sie; sein zierlicher Nacken, die runden, glatten Kugeln der Schultern, sein helles, weiches Lockenhaar, die großen blauen Augen. Und wie empfindsam er war, und so oft fiel er hin.
Du bist ja gar kein richtiger Junge, sagte der Vater dann. Womit habe ich so einen Sohn verdient?
Da hebt Undine ihn schnell vom Boden auf.
Er ist doch so süß - und diese blonden Locken, sagt sie schmeichelnd, um dem Vater die Schönheit des kleinen Bruders vor Augen zu führen.
Süß! Seit wann muss ein Junge süß sein! Mädchen steht es zu, süß zu sein! Tapfer und mutig muss er sein, kräftig und robust.
Undine wendet schüchtern ein: Aber er ist doch noch so klein…und er ist doch auch tapfer und mutig.
Der Vater hat gelacht, gelacht, dann ist er vom Stuhl aufgestanden und nach draußen gegangen. Undine hat ihn noch draußen leise lachen gehört.
Undine hört das Lachen noch heute in ihrem Kopf. Es klingt verächtlich. Sie denkt: Er hat seinen Sohn gar nicht richtig geliebt. Und mich? Hat er mich auch nicht geliebt? Denn »süß« war ich nie! Muss man seine Kinder nicht so lieben, wie sie sind?
Ihre Gedanken wandern weiter.
Patrick und Undine - sie hatten sich aneinander geschmiegt und sich gegenseitig Wärme gegeben…es war so tröstlich gewesen, im Dunkeln unter der Decke zu liegen und gemeinsam auf die Stille zu horchen, Geborgenheit zu spüren, einen anderen Menschen atmen zu hören…
Es ist so lange her. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen, in Jahren gemessen? Zehn Jahre? Fünfzehn Jahre?
Wie seltsam ist das doch mit der Zeit. Hat sie nicht einen scheinbar relativen Charakter? Für ein Kind kann ein Tag so unendlich lang sein. Und wenn man es sich richtig überlegt, dann ist ja Zeit für ein Kind wirklich länger als für einen Erwachsenen. Im Leben eines Kindes ist ein Tag doch ein wesentlich höherer prozentualer Anteil des Ganzen als im Leben eines Erwachsenen. Wir haben ein Gefühl von Zeit nur in Beziehung zu der Zeitmenge, die wir bereits erlebt haben, also ist es immer relativ.
Wie lang war damals mitunter eine einzige Nacht!
Schier endlos, endlos… Hat sie nicht tatsächlich manchmal gedacht, dass es unterschiedliche Zeit gibt? Zeit bei der Großmutter und die Zeit fürs Spielen – sie war kurz, zu kurz. Zeit in der Schule – sie war länger. Und Zeit in der Stille und der Dunkelheit – sie war endlos, endlos, wie ein Stück von der Ewigkeit abgetrennt.
Erst viel später hat Undine begriffen, dass es nur eine einzige Zeit gibt. Die Zeit, die wir mit der Uhr messen. Und sie ist messbar an der Veränderung all dessen, was ist. Das andere aber, das hat mit uns selber zu tun, mit unserem Zeitbewusstsein.
Manchmal hat die Großmutter gesagt: Die Gegenwart - das Jetzt - hat keine Dauer, die Vergangenheit wird als Erinnerung, die Zukunft als Vorwegnahme erlebt. So ist das mit der Zeit, mein Kind. Und eines steht fest: die Zeit heilt keine Wunden. Sie trübt nur die Vergangenheit und mildert den Schmerz.
Schließlich vergehen auch die Stunden dieser ewigen Nacht. Noch ist es dunkel, aber Undines Armbanduhr zeigt sechs, als sie sich mühsam aus dem Bett rappelt. Sie fühlt sich wie zerschlagen, aber von einer inneren Unruhe getrieben.
Als sie die schmale Treppe ins Untergeschoss hinab steigt, kommt ihr ein Geruch von kaltem Rauch und so etwas wie der noch verweilende Dunst von unsauberen Menschen und Dingen entgegen. Aus der Küche dringt das Klappern von Geschirr zu ihr her. Eine Tür wird aufgestoßen. Ein dralles Mädchen mit Schürze und buntem Kopftuch steht vor ihr.
»Ach du liebe Zeit. Sind Sie aus dem Bett gefallen?«
Das Mädchen stützt sich träge auf ihren Besenstiel und stemmt die andere Hand in die Hüfte.
»Ich muss aufbrechen. Ich muss einen Bus erreichen,« sagt Undine fest und entschlossener, als ihr zumute ist.
»Wann kann ich denn mein Frühstück haben?«
Sie spürt nun großen Hunger und hat nicht vor, sich ohne Frühstück auf den Weg zu machen.
Das Mädchen mustert Undine von oben bis unten.
»Ich bin noch beim Putzen,« sagt sie und überlegt einen Augenblick. »Na gut,« murrt sie schließlich. Gehen Sie mal schon rein. Ich setz den Kaffee auf.«
Eine halbe Stunde später ist Undine wieder auf der Straße.
Sie fühlt sich gestärkt und sehr viel wohler als noch vor einer Stunde. Das Mädchen hat ihr gesagt, wie sie den nächsten Busbahnhof erreicht. Entschlossen macht sie sich auf den Weg.
Ihre Füße schmerzen von dem ungewohnten Fußmarsch der letzten Nacht, auch der Rücken tut ihr weh. Aber ihr Kopf ist klar und in ihrem Inneren spürt sie eine neu erwachte Zuversicht. Ein frischer, sonniger Oktobertag bricht an. Niedrige Wolken jagen über den Himmel, und während Undine ihren Schritt beschleunigt, erwacht das Leben in den Straßen ringsumher.
Undine spürt eine ungeheure Erleichterung, als der Bus den Bahnhof verlässt. Sie hat einen Platz im hinteren Drittel des Busses gefunden und kauert sich in die Fensterecke. Die braune Tasche klemmt sie neben sich an die Wand. Sie schließt die Augen und lehnt das Gesicht an die Scheibe. Der Platz neben ihr ist frei geblieben, Undine ist froh darüber. So muss sie nicht mit fremden Leuten reden.
Seefeld heißt das Städtchen, für das Undine sich entschieden hat. Eine kleine Stadt an einem See. Das klingt schön und friedlich. Sie ist viele Kilometer entfernt, eine Fahrt von nahezu fünf Stunden wartet auf sie. Das ist ihr aber gerade recht, nur möglichst weit fort will sie. Und hier im Bus ist sie sicher. So glaubt sie jedenfalls. Und dann – in Seefeld – wird sie versuchen, irgendwo unterzukommen. Sie wird ihr Äußeres verändern, vielleicht mit einer Perücke oder einer neuen Frisur, vielleicht eine andere Haarfarbe. Noch hat sie Geld. Davon muss sie in der ersten Zeit leben, in irgend einem Zimmer am Rande der kleinen Stadt. Vielleicht kann sie Arbeit bekommen, als Kellnerin in einem Lokal. Als ihr die düstere Kaschemme einfällt, in der sie übernachtet hat, schaudert es sie. Aber sicher gibt es doch andere Möglichkeiten. Siedend heiß schießt es ihr durch den Kopf: Vielleicht gibt es gar keine Möglichkeiten für mich! Wer nimmt schon eine Arbeitskraft ohne Ausweis?
Und ihren Ausweis kann sie doch kaum benutzen; wer weiß, vielleicht sucht man sie schon!
Schweiß bricht ihr aus, während ihr allmählich klar wird, dass sie gar nichts tun kann ohne Papiere. Man kann nicht einfach von heute auf morgen verschwinden, sich in Luft auflösen, seine Identität wechseln und ein neues Leben beginnen. Habe ich das nicht gewusst?
Ich muss es versuchen, was bleibt mir schon anderes übrig.
Vor allem muss ich mein Aussehen verändern. Und ich werde putzen gehen, von einer Putzfrau lässt man sich doch keinen Ausweis zeigen, oder? Auf jeden Fall werde ich mir darüber Gedanken machen, wenn es soweit ist. Immer ein Schritt nach dem anderen, und jetzt bin ich auf dem Weg nach Seefeld.
Der Bus hat die Stadt verlassen. Nun fahren sie durch kleine Dörfer. Das schwarze Band der Straße windet sich zwischen Feldern und Wiesen hindurch, verwandelt sich manchmal in eine Allee, deren rot goldenes Blätterdach sich schon unter den ersten Herbststürmen gelichtet hat. Hier und da leuchtet ein Stück Himmel hindurch. Die einzigen Geräusche sind das Brummen des Motors, die Reifen auf dem Asphalt und das leise Gemurmel von Stimmen, hin und wieder eine helle Kinderstimme dazwischen. Undine lehnt sich tiefer in den Sitz, und endlich, endlich entspannt sich ihr Körper.
Gemächlich gleiten sie dahin. Undine versinkt in ein Zwischenreich zwischen Schlafen und Wachen. Sie ist nicht mehr im Bus. Da ist das Zimmer der Großmutter. Es hat sich in all den Jahren nicht verändert und bietet Zuflucht vor allem, vor Kälte und vor Hitze, vor Streit und den schwarzen Schatten. Die matt dunklen Bodendielen mit den bunten Webteppichen darauf, die goldfarbenen Vorhänge an den Fenstern, die zierlichen dunklen Möbel. Und dort hinter der Schranktür aus Glas die flache Keksdose aus Keramik mit den Kätzchen darauf und auf der Nussbaumkommode all die Fotos.
Ja, diese Fotos, die das Kind Undine immer wieder in ihren Bann ziehen. Sie entführen Undine in eine andere Welt, fern und von geheimnisvollem Zauber vergangener Zeiten. Da sind die Großeltern in würdiger Pose, Großvater Eduard mit gestutztem Oberlippenbart und Großmutter Friederike mit hoch aufgetürmter Lockenfrisur. Beide lächeln freundlich in die Kamera. Da sind Gruppenbilder von Hochzeiten der Vergangenheit, mit strahlenden Bräuten unter duftigen Schleierwolken und stolzen Bräutigams mit schwarzen Zylindern.
Und endlich ein Hochzeitsfoto der Eltern.
Es ist das schönste von allen, und Undine kann stundenlang davor hocken und es betrachten. Wie schön die Mutter darauf ist. Und so glücklich schaut sie aus. Ihren Kopf ziert ein Myrtenkranz samt Schleier, in der Hand hält sie einen prachtvollen Rosenstrauß. Der Vater als Bräutigam an ihrer Seit sieht fast genauso prächtig aus mit seinem lockigen Haar und der starren Fliege unter dem Kinn. Direkt majestätisch kommt er dem Kind vor. Und was das Erstaunlichste ist: Beide sehen glücklich aus. Aber was hält schon lebenslänglich, das Glück jedenfalls nicht.
Auf einmal kann Undine den Herbst riechen, über allem liegt der Geruch von Herbstlaub und Erde. Aber da ist noch ein anderer Geruch, der sich dazwischen schiebt, Rauch! Es ist Rauch. Er mischt sich mit dem Herbstgeruch und scheint Wärme mit sich zu bringen. Wärme durch das, was den Rauch verursacht hat. Was ist das nur?
Undine steht mit bloßen Füßen im Gras und als sie aufschaut, sieht sie das helle Knochengesicht des Mondes hoch über sich. Es scheint hämisch auf sie herunter zu grinsen, sein weißes Leuchten breitet sich aus und verwandelt den Nebel, der von dem feuchten Gras unter ihren Füßen aufsteigt, in Rauch…Rauch…und dahinten das Feuer! Es brennt, es brennt lichterloh. Der ganze Nachthimmel ist voller Feuer…
Undine erwacht stöhnend und mit schweißnasser Stirn. Die Fensterscheibe ist beschlagen und feucht von ihrem Atem. Sie ringt nach Luft, hält sich die Hand vor den Mund, während sie mit der anderen verstohlen über die feuchte Stirn wischt. Das Herz schlägt ihr wie ein Hammer in der Brust, und ihr Mund ist trocken.
Nur nicht auffallen, denkt sie verwirrt. Nur das nicht. Sie holt tief Atem, hält ihn sekundenlang an, atmet langsam und zitternd aus. Alles ist gut, nur ruhig, ruhig. Was war das nur für ein Traum? Der ist neu. Sie kann sich nicht erinnern, ihn schon einmal geträumt zu haben. Da gibt es andere, viel schlimmere, die immer wieder kommen, Jahr für Jahr. Aber dieser…
Der Schatten einer Erinnerung flackert in ihrem Bewusstsein auf, wie ein Blitz in dunkler Nacht. Eine Erinnerung an ein Feuer in frühester Vergangenheit? Warum nicht? Jeder Mensch hat doch irgendwann einmal ein Feuer gesehen, warum nicht auch sie. Sie hat es nur vergessen.
Patrick, denkt sie. Mein Bruder Patrick. Wo magst du wohl stecken? Wie merkwürdig, dass sie in den letzten Stunden so oft an ihn denken muss.
Ich muss mich zusammen reißen, sagt sie sich. Mit einem Ruck richtet sie sich gerade auf, schiebt ihre Tasche zurecht und wischt die beschlagene Fensterscheibe frei.
Die Landschaft hat sich verändert. Sie fahren jetzt durch hügeliges Land, Heide und braune Felder, blaugrüne Waldstreifen am Horizont, hin und wieder ein Bach, der sich durch eine Wiese schlängelt. Wie schön ist das, diese Gegend gefällt ihr.
Hat sie lange geschlafen? Durch ihr Dösen und Träumen hat sie jegliches Zeitgefühl verloren. Hat nicht einmal gemerkt, wenn der Bus an den wenigen Stationen angehalten hat.
Es muss längst Nachmittag sein. Sie blickt auf ihre Armbanduhr, tatsächlich, bald sind sie am Ziel.
Da ist es schon: Seefeld.
Ziellos ist Undine durch das Städtchen gewandert. Seefeld liegt an einem See, das hat sie längst herausgefunden. Eine Weile hat sie im Café »Am Marktbrunnen« gesessen, ungestört und entspannt vor Kaffee und belegten Brötchen. Sie hat von der freundlichen Wirtin erfahren, wo sie günstig ein Zimmer mieten kann und sich den Weg beschreiben lassen.
Nun steht sie auf dem alten Marktplatz, dessen Mitte ein uralter Brunnen ziert. Eine steinerne Nymphe mit einem Wasserkrug auf einer Schulter blickt verträumt in unbekannte Fernen, während ein silberner Wasserschwall unaufhörlich aus ihrem Krug ins Becken plätschert.
Etliche Wege und Gässchen, flankiert von alten Fachwerkhäusern, führen von diesem Platz in die verschiedenen Richtungen. Halbwegs gepflegte Blumenrabatten mit leuchtend bunten Herbstblumen säumen die von Klee und Moos durchsetzten Rasenflächen, die den angrenzenden kleinen Stadtpark mit seinen uralten Kastanien und Linden vom Marktplatz trennen.
Über alldem liegt bereits der rauchige Glanz des Herbstes mit seiner rot und goldenen Farbenpracht. Welkes Laub sprenkelt gelb, rot und braun das Gras.
Hier gibt es ihn wirklich, den Goldenen Oktober, denkt Undine staunend, während sie zwischen den leicht zerzausten Blumenkübeln dahin spaziert, in denen rot goldene Zinnien und violette Chrysanthemen glühen. Tische und Stühle vor den Cafés sind zusammen gestellt, Regen ist im Anzug. Wie herrlich muss es sich hier im Sonnenschein sitzen, den Strom vorbei flanierender Passanten vor Augen, das Rauschen des Brunnens im Hintergrund.
Niemand scheint es eilig zu haben. Alle Menschen, denen Undine begegnet, schlendern gemütlich dahin oder spazieren gelassen ihres Weges. Hier müsste ich bleiben können, denkt sie. Und warum denn nicht? Es muss doch möglich sein, in diesem Städtchen fernab von ihrem alten Daseinskreis ein neues Leben anzufangen!
Die Dämmerung kommt plötzlich. Schiefergraue Wolken haben sie angekündigt. Dann setzt Regen ein. Er überrascht Undine unten am See. Sie hat den Weg zum Strand hinunter genommen. Kastanienweg nennt er sich, und er ist wunderschön. Die alten Kastanien mit dem bunt gefärbten Laub recken sich majestätisch gen Himmel, und überall liegen glänzende, goldbraune Kastanien am Boden. Das Gras am Fuß der gewaltigen Stämme zittert leicht, als ob ein Gewitter in der Luft liegt. Durch das Laub der Bäume geht ein sanftes Raunen wie am Meer, und hier und da taumeln ein paar der gelb-braunen Blätter durch die Luft. An einer Seite wird der Weg vom Stadtpark begrenzt, weit vorn erkennt Undine eine Kapelle auf einer Anhöhe.
Jetzt gießt es in Strömen. Wie ein Schleier hängt es über dem See. Undine steht im Regen. Hier ist nirgendwo ein Dach zum Unterstellen. Sie drückt sich an ein von Efeu überwuchertes Mäuerchen und späht in die Runde. Vor ihr liegt ein weitläufiger, parkähnlicher Garten, hohe alte Bäume, dichte Rhododendren, weite Rasenflächen und Rabatten. Inmitten von Grün ein hölzerner, weiß gestrichener Pavillon. Ob sie es wagen kann, sich dort für einen Augenblick unterzustellen? Sie zieht ihre Windjacke weit über den Kopf und läuft los.
Während sie auf der schmalen Holzbank in dem runden Pavillon hockt, rauscht draußen der Regen in dichten, grau silbernen Schleiern herunter. Von hier aus kann sie den See sehen, es ist nicht weit. Ein heller Streifen Sand begrenzt sein Ufer. Wie schön muss es sein, hier zu wohnen.
Der Regen hält an. Schon in den letzten Tagen scheint es hier viel geregnet zu haben. Der Rasen ist durchtränkt von Wasser wie ein dicker Schwamm. Undine späht unschlüssig hinaus. Was soll sie tun? Der Regen scheint so bald nicht aufzuhören, und hier kann sie nicht sitzen bleiben. Warum musste sie so dumm sein und erst zum See hinunter laufen, anstatt gleich das Haus ihrer zukünftigen Vermieterin aufzusuchen. Gleich wird es völlig dunkel sein.