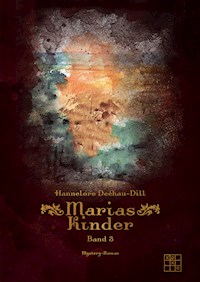Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Laura erzählt die Geschichte ihrer Mutter Kathleen, sie ist eine faszinierende Frau mit Aeinem geheimnisvollen Leben voller Liebe, Eifersucht und Hass. Nach langer Zeit kehrt Laura ins Ginsterhaus zurück, in dem sie ihre Kindheit und Jugend verlebt hat. Seither ist sie nirgendwo zur Ruhe gekommen, immer war sie unglücklich, rastlos, oft verwirrt und voller Schmerz. Ihre Ehe ging in die Brüche, sie konnte nirgendwo Fuß fassen, hetzte von einem Job zum nächsten. So will sie ihr Leben nicht weiterführen. Sie kehrt zurück in das Haus ihrer Kindheit, um alles noch einmal aufleben zu lassen. In einer Geschichte über ihre Mutter Kathleen und sich selbst. Über Magie, Zauberei und Hexenwahn. Und über Menschen, die auf falschen Wegen herumirren, weil sie sich selbst nicht kennen. Du sagst, es gibt keine Magie? Aber gibt es nicht mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich erträumen lässt? Und was hältst du von der Theorie: Wie du glaubst, so dir geschieht? Am Ende dieser Geschichte weißt du, was du von alledem zu halten hast. Oder auch nicht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Der MirabellenBaum
Lauras Mutter
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-088-0
E-Book-ISBN: 978-3-96752-588-5
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 1755373697
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Der Mensch ist nicht gut, noch ist er böse,
sondern er hat alle Möglichkeiten zu Beidem in sich,
und es ist schon viel,
wenn sein Bewusstsein und sein Wille
sich auf die Seiten des Guten neigen.
Auch dann noch
leben unter der Oberfläche
alle Urtriebe in ihm weiter
und können ihn zu Ungeahntem führen.
(H. Hesse)
Gegenwart
Laura
Heimkehr
Die Straßen sind still. Gespenstisch verödet. Nur hin und wieder begegnet mir auf meinem Weg ein Auto. Es ist ja auch eine einsame Landstraße, die ich fahre. Und es ist spät, fast schon Mitternacht. Ein warmer Septemberabend, und ich bin auf dem Weg nach Hause.
Ich bin seit vielen Stunden unterwegs. Am Tag hatte es Regenschauer gegeben, gegen Abend aber kam die Sonne durch. Und während ich unter dem gold-grünen Blätterdach der lindengesäumten Landstraße dahin fahre, steht mir bereits Mutters Garten vor Augen – so wie er jetzt, in dieser Stunde sein würde. Und wie ich ihn in Erinnerung hatte in all den Jahren meines Fortseins: wie ein warmes Treibhaus nach einem sanften Septemberregen. Die Erde würde dampfen und die Blumen duften.
Meine Mutter hatte stets viele Blumen in ihrem Garten. Sie lösten einander ab: wenn die eine zu blühen aufhörte, begann bereits eine andere.
Die Hummeln kamen schwer durch die Luft daher gesegelt und landeten auf den dichten Dolden des roten und weißen Phlox. Es gab eine Fülle von Rosen, die bis in den Herbst hinein blühten, und noch darüber hinaus. Erst der Frost machte ihnen gnadenlos den Garaus. Vom Blumengarten bis zu den Gemüsebeeten zog sich ein bunter Chrysanthementeppich, und eine niedrige rosa Nelkenborte säumte den Weg zur Geißblattlaube.
Der lange Gartenweg hinter dem Haus war eingefasst von Sonnenblumen, die ihre schweren, goldenen Köpfe tief hinab senkten. Als Kind habe ich mir oft eingebildet, ich sei eine Dame königlichen Geblüts, die zwischen der aufgereihten Dienerschaft hindurch schritt und demutsvoll begrüßt wurde. Die großen Sonnenblumenköpfe nickten mir zu und ich nickte hoheitsvoll zurück.
Das ist lange her, viele Jahre. Und lange bin ich fort gewesen.
Inzwischen steht das Haus leer. Niemand wartet auf mich. Nicht die alte Tante Adele, die meine Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt hat, und auch nicht meine Mutter.
Ich hätte damals bleiben können, allein in dem großen leeren Haus, denn es gehört mir. Aber ich hielt es nicht mehr aus. Es ist ein schönes Haus, aber es war mir unheimlich geworden. Allzu viele seltsame Erlebnisse waren damit verbunden, die erst nach Jahren ihren Schrecken verloren.
Heute aber komme ich zurück. Ich denke, ich kann es mit den alten Erinnerungen aufnehmen. Schließlich bin ich erwachsen geworden und viel ist geschehen.
Ich bin wieder allein, meine Ehe ist in die Brüche gegangen und ich komme nach Hause, um meine Wunden zu lecken.
Aber nein, das ist ja Unsinn. Ich komme nach Hause, weil ich mich dazu entschlossen habe. Weil ich hier mit meinem neuen Leben beginnen will und nicht zuletzt, weil ich Heimweh hatte.
Und weil ich die Geschichte meiner Mutter aufschreiben möchte. Was ja zum Teil auch meine eigene ist.
Meine Mutter Kathleen, wie ich sie geliebt, gekannt und erlebt habe. Vieles weiß ich aus Erzählungen meiner Großmutter und meiner Tanten, einiges von ihr selber, und manches habe ich mir allein zusammen gereimt. Alles zusammen soll die Geschichte meiner Mutter werden, wie ich sie heute sehe.
Es ist nach Mitternacht, als ich durch die stillen Straßen des Ortes fahre. Der Himmel ist voller Sterne, in einem der Häuser brennt noch Licht. Im Schneckentempo zuckle ich die Bahnhofstraße hinunter auf den Dorfanger zu. Ein grüner Hang mit hohen alten Bäumen, ein kleiner Teich in der Mitte. Dahinter das Kirchlein mit dem spitzen Turm, und eine Pforte, die auf den kleinen Friedhof führt.
Das Haus ist hinter einer gewaltigen Hecke verborgen, nur ein Teil des Daches ist sichtbar. Das breite Eisentor ist rostig und quietscht in den Angeln. Eine Garage gibt es nicht; ich lasse den Wagen in der gepflasterten Einfahrt stehen und blicke zum Haus hinüber. Still und verlassen steht es da unter dem nächtlichen Sternenhimmel, eingerahmt von Büschen und Bäumen.
Der gepflasterte Weg liegt vor mir, weiß schimmernd im Mondlicht. Auch das Haus leuchtet hell aus dem Dunkel der Büsche, das schräge Reetdach liegt wie eine dunkle Kappe darüber. Langsam gehe ich den Weg entlang, und ich bilde mir ein, das Haus heißt mich willkommen. Es riecht nach feuchter Erde und Phlox – genau so wie in meiner Erinnerung.
Im Innern des Hauses ist es kühl und die Luft abgestanden. Das Wandlämpchen neben dem hohen, bunten Glasfenster wirft ein gedämpftes Licht auf den schwarz-weiß gefliesten Boden und lange Schatten an die Wände.
Einen Augenblick lang stehe ich regungslos und nehme die Atmosphäre des Hauses in mich auf. Die Tapete an den Wänden ist noch die gleiche wie damals, Ranken auf dunklem Grund. Die Türen sind alle geschlossen, der rote Läufer auf der breiten Holztreppe ist ausgeblichen, auch er noch derselbe. Ein Gefühl des Heimkommens erfüllt mich. Habe ich also das Richtige getan?
Plötzlich spüre ich die Müdigkeit. Seit vielen Stunden bin ich auf den Beinen. Aber nun bin ich zu Hause, und vor allem anderen will ich schlafen. Wie oft habe ich mir ausgemalt, wie es sein wird, wieder dieses Haus zu betreten. Von Raum zu Raum wollte ich gehen, langsam und bedächtig, alles auf mich wirken lassen, schauen, was sich verändert hat und was nicht. All das wollte ich wahrnehmen und auf mich wirken lassen.
Und heraus finden, ob die alten Erinnerungen noch Macht über mich haben.
Nun aber, da es soweit ist, kann ich nichts mehr denken und spüren als meine grenzenlose Erschöpfung. Und ein friedliches Gefühl des Zuhauseseins.
Ich gehe langsam die Treppe hinauf, meine Finger tasten über das polierte Holzgeländer, mein Rucksack schleppt neben mir her. Den Koffer lasse ich im Flur stehen. Ein Koffer und ein Rucksack – mein einziges Gepäck und mein einziges Hab und Gut, das ich aus meinem alten Leben mit in mein neues nehme.
Trotz meiner Müdigkeit erkenne ich alles wieder: die schmale Kerbe im glatten Holz des Geländers – verursacht von der scharfen Kante eines herab geworfenen Kerzenleuchters -, das Knarren der fünften Stufe, wenn man in der Mitte auftritt, das dunkel gerahmte Ölbild am Treppenpodest, das eine sehr alte Ansicht des Hauses zeigt. Ich fühle mich wie in einem Traum, seltsam unwirklich und benommen.
Als ich oben ankomme und aufschaue, sehe ich meine Mutter. Sie steht halb abgewandt im Schatten, die Arme vor der Brust verschränkt, ihr Gesicht starrt mir entgegen, bleich und ernst. Sie trägt das dunkelgrüne Gartenkleid, in dem ich sie so oft sah, und den breitkrempigen Strohhut.
Mein Herzschlag setzt für den Bruchteil einer Sekunde aus. Dann schlägt es plötzlich so wild und heftig, dass ich kaum Luft kriege. Ich klammere mich an den Geländerpfosten, und im gleichen Moment ist der Spuk verschwunden. Dunkel und schattig liegt der Korridor vor mir. Ich schüttle mich wie ein nasser Hund, mein Kopf wird klarer. Meine Hände sind feucht, Schweißperlen stehen mir auf der Stirn, im Nacken kribbelt es.
Was Müdigkeit und erschöpfte Sinne einem doch für Streiche spielen können.
Mein altes Zimmer nimmt mich auf wie eine gute alte Bekannte. Alles ist wie damals, der breite altmodische Schrank, die behäbigen Sessel und der ovale Holztisch davor. Und dort mein Bücherregal und das Lämpchen daneben. Als hätte ich all das gestern erst verlassen.
Die dunkelroten Vorhänge an den Fenstern, die bunte Patchworkdecke auf dem Bett und der Flickenteppich auf den hölzernen Dielen, alles wie in meiner Erinnerung. Ich mache kein Licht, der Mond scheint hell ins Zimmer. Auch das wie in meiner Erinnerung.
Ich bin zu müde, mich zu waschen, lasse die Kleider liegen, wie sie fallen und schlüpfe unter die Decke. Im Mondlicht wirkt alles silbrig und die Schatten blau, ganz unwirklich, aber gerade so wie mir zumute ist. Als wäre das alles nicht Wirklichkeit, sondern einer meiner Träume, die ich in den Jahren meines Fortseins so oft geträumt habe.
Ich schließe die Augen und lausche. Ein Wind erhebt sich, die Efeuranken schlagen sanft an die Hauswand. Das Bettzeug riecht nach Lavendel, und die Decke ist klamm. Einige Minuten lang flattern Bilderfetzen durch mein Bewusstsein, versammeln sich dann zu einem Schwarm und fliegen davon.
Ich entspanne mich und vorbei ist aller Spuk.
Ich bin zu Hause.
Der Mirabellenbaum
Ich träume. Der alte Traum ist wieder da. Viele Jahre hat er mich in Ruhe gelassen, aber in dieser ersten Nacht kommt er zurück.
Es ist der Traum von dem alten Baum am Ende des Gartens, dem Mirabellenbaum. Nie hab ich einen schöneren gesehen, und auch keinen, der herrlichere Früchte hatte. Wenn er im Frühjahr in seiner Blüte stand, konnte man gar nicht weg schauen, so einen prächtigen Anblick bot er. Im Sommer trug er ein reiches Blätterdach, so dicht und grün wie kein zweites. Es war eine absolut prächtige Krone. Und erst die Früchte im September!
Goldgelb, ungewöhnlich groß und saftig. Kein einziges Mal habe ich Maden an ihnen gesehen, was bei den anderen beiden Pflaumenbäumen schon mal vorkam.
Oh ja, unser Mirabellenbaum suchte seinesgleichen.
Er war nicht immer so. Als wir in dieses Haus zogen, war er ein Baum wie jeder andere, aber das änderte sich später.
In dieser ersten Nacht zu Hause träume ich wieder von ihm.
Ich hocke unter dem Baum im Gras. Es ist Sommer, das Gras ist hoch und dicht und kühl hier im Schatten. Ein leichter Wind kommt auf, er weht über das Gras und es klingt, als würde es singen, wispern und raunen. In lebendigen, weichen Wellen scheint es über den Boden zu wabern.
Und dann spüre ich, wie es sich unter meinen Händen verändert. Es ist nicht länger glatt und kühl, sondern warm und feucht, geradezu schlüpfrig. Angst und Ekel packen mich, ich springe auf, falle aber gleich wieder zurück. Es geht nicht, ich komme nicht vom Boden hoch. Gras und Erde scheinen mich fest zu halten, als wären es Menschenhände.
Mit einem Schrei erwache ich. Zitternd setze ich mich im Bett auf. Mein Körper schmerzt, als hätte ich einen ganzen Garten umgegraben, der Kopf ist mir wirr und meine Lider sind geschwollen. Im ersten Augenblick weiß ich nicht, wo ich bin.
Ich spüre noch das warme schlüpfrige Gras zwischen den Fingern. Langsam beruhige ich mich.
Ich liege flach auf dem Rücken, ganz still. Unklar erinnere ich mich an die seltsame Vision oben im Korridor, an die Gestalt meiner Mutter, doch ohne Gefühl für die Zeit, ohne Schärfe, wie an etwas Verschwommenes, das nur in einem Traum vorkommt. Vielleicht war es ja auch nur ein Traum.
Ich blinzle in den dämmrigen Morgen und versuche mich zu erinnern. Das Denken fällt mir schwer, aber ich habe auch kein Verlangen zu denken. Ich bin zu Hause, und das genügt mir vorerst. Eine Fliege summt über die Fensterscheibe, ich schlafe wieder ein.
Als ich zum dritten Mal erwache, ist es heller Tag. Die Sonne malt ein weiches helles Quadrat auf das Muster des Teppichs neben der Tür. Vorbei sind der nächtliche Spuk und alle Träume.
Ich wandere durch das ganze Haus. Es kommt mir älter, beengter und verwohnter vor, als ich es in Erinnerung hatte. Jedoch das Gefühl von Vertrautheit und Zugehörigkeit überwiegt. Ich gehe von Raum zu Raum und ziehe alle Vorhänge auf. Fenster für Fenster lasse ich das dunstig-gelbe Licht eines warmen Septembermorgens herein.
Eine Flügeltür aus dunklem Holz führt in die »kleine Bibliothek«, wie wir sie immer genannt haben. Ein muffiger Geruch von altem Samt, Leder und Möbelpolitur hängt in der Luft. Irgendjemand hat hier geputzt; ich hatte den Verwalter beauftragt, ein wenig nach dem Rechten zu sehen. Auch das Wohnzimmer unverändert, ich erkenne den sperrigen Schreibtisch, die fransengeschmückte Stehlampe, die klobigen Polstermöbel. Alles noch aus Adeles Jugendzeit, vielleicht sogar älter.
Die Küche mit den breiten Blumenfenstern, den kompakten Holzmöbeln und den Tellerborden. Dort die Uhr über dem weißen Elektroherd und – tatsächlich steht auch der schwarze eiserne Herd noch da. Mutter hat ihn immer geliebt, dieses Stück aus alter Zeit, seine klauenartigen Füße und den mit einer bunten Emaillenhaube abgedeckten Wasserbehälter.
Nachgedunkelte Familienbildnisse an den Wänden, ein großer schwerer Tisch in der Halle, die geschnitzte Täfelung des Alkovens, in dem noch immer das schon damals ausgeblichene Sofa steht.
Vor der Zimmertür der alten Adele im ersten Stock mache ich Halt. Nach ihrem Tode bin ich nur noch wenige Male darin gewesen.
Dieser Raum und das sogenannte Himmelbett-Zimmer nebenan habe ich danach kaum betreten. Sie waren mir unheimlich.
In Adeles Schlafzimmer hatte ich stets vor Augen, wie sie da gelegen hatte, als ich sie fand. In der Nacht war sie gestorben. Still und friedlich war sie eingeschlafen – jedenfalls hat Muttermir das erzählt. Ich hatte immer meine Zweifel daran. Woher wollte sie das wissen?
Ich betrat also das Zimmer, und da lag sie. Ich sah sofort, dass etwas anders war als sonst. Ich habe von jeher ein feines Gespür für besondere Dinge gehabt, vor allem für die übernatürlichen. Da lag sie also, die alte Adele.
Sie hatte ihr Gebiss nicht eingesetzt. Klein und schmächtig wirkte sie in ihrem großen Bett, als hätte die Matratze sie zur Hälfte eingesaugt. Sie war nämlich immer eine große stramme Frau gewesen. Später dann allerdings mehr hager, dürr und gebeugt. Ich sehe mich noch in der Tür stehen, mit feuchten Händen und einem Kribbeln im Nacken, als könnte ich den Tod körperlich spüren. Und so war es wohl auch.
Die Wangen der alten Frau waren eingefallen, und die Höhlen unter den geschlossenen Augen schimmerten bläulich. Um das graue Haar hatte sie ein Tuch geschlungen, so dass es aussah, als trüge sie einen Turban. Er verlieh ihr sogar jetzt im Tode ein seltsam orientalisches Aussehen.
Die knochigen, weißen Hände lagen verkrümmt auf der Bettdecke. Nicht etwa fromm gefaltet, wie in Erwartung des kommenden Todes und des damit verbundenen Aufstiegs ins Himmelreich, sondern in die Bettdecke gekrallt, die ebenso weiß war wie ihre Hände.
Kein friedlicher Ausdruck lag auf ihrem faltigen Gesicht. Es war eher so, als habe sie kurz vor ihrem Ende etwas Entsetzliches erblickt und vor Panik und Schrecken darüber die Augen zugekniffen.
Das alles sah ich, als ich dort in der Tür verharrte. Ich stand wie fest geschmiedet, obwohl ich vorhatte, fluchtartig das Zimmer zu verlassen und nach Mama zu schreien.
Ich stand da und starrte auf die tote Frau in dem Bett, und tausend Dinge gingen mir durch den Kopf: Wie ist der Tod doch grässlich! Wo mag ihre Seele jetzt sein? Und was war vorher?
Und dann: Ist ihr Geist oder irgendetwas von ihr noch hier im Raum? Daran glaubte ich nämlich ganz fest. Dafür hatte meine Urgroßmutter gesorgt. Sie hatte mir einen unausrottbaren Glauben an allerlei verrückte Dinge eingepflanzt, den ich in meinem ganzen Leben nicht los wurde. Bis heute nicht.
Die Toten gehen um, hatte die Oma gesagt. Nur ihr Körper verlässt das Haus, nicht aber ihr Geist. Er verharrt unter den Lebenden; vor allem in dem Zimmer der Verstorbenen ist seine Anwesenheit zu spüren. Allerdings nicht für jeden. Nur besondere Menschen – zu denen sie sich selber und auch mich zählte – haben die Gabe, sie wahrzunehmen.
An besonderen Tagen und in bestimmten Nächten könne man sie atmen hören in dem Raum, in dem sie gestorben sind. Oder auch einen Luftzug spüren, vielleicht gar eine leichte Berührung, wie von einer kalten Hand.
All das nahm ich wahr und ich spürte es auch! Sowohl das Atmen, als auch den Luftzug und die kalte Hand! Dabei hatte ich auch später stets die weißen, knochenartigen Krallen auf der Bettdecke vor Augen, und es schauderte mich. Oh ja, die Oma hatte bei mir ganze Arbeit geleistet!
Und wie ich nun sehen kann, wirkt das immer noch.
An diesem schönen friedlichen Septembermorgen betrete ich jedenfalls nicht das Zimmer der armen verstorbenen Adele. Ich will mir den Tag nicht mit morbiden Dingen verderben.
Entschlossen kehre ich der Zimmertür den Rücken und steige die Treppe hinunter. In dem hohen, dunkelgerahmten Spiegel am Fuße der Treppe erblicke ich mich selber. Überrascht und hölzern starre ich mir entgegen. Komisch, dass man hier einen Spiegel aufgehängt hat. Der war früher nicht da. Oder habe ich es vergessen?
Ein paar Schritte vor mir sehe ich mein Gesicht, deutlich und klar. Meine überraschten braunen Augen, leicht umschattet, die dunklen Brauen, hohe Wangenknochen und eine weiße Stirn. Das Haar hängt mir unordentlich ins Gesicht, rötlich-braun und dicht.
Kein hübsches Gesicht, aber immerhin interessant, nicht alltäglich jedenfalls. Ich öffne den Mund, mein Spiegelbild tut das Gleiche. Ich wende den Kopf und sehe, dass auch der Kopf meines Gegenübers sich dreht – wie sollte es anders sein. Ich erblicke mich selber und habe doch das Gefühl, als beobachte ich eine mir nur vage bekannte Frau.
Mein Blick tastet über jene Gestalt in alten Jeans und ausgeleiertem Pullover und ich habe das dumpfe Gefühl, als sähe ich mich zum ersten Mal richtig. Ich wende mich hin und her, als könne ich erwarten, dass mein Gegenüber etwas anderes tut, etwa sich abwendet und davon geht. Als ich wieder voll hinsehe, ist die Gestalt verschwunden. Es ist, als sei genau das tatsächlich geschehen, in einer unbeobachteten Sekunde, vielleicht während eines Wimpernschlages. Ich starre geradeaus. Es hängt kein Spiegel an der Wand, und es war wohl nie einer da.
Es ist still im Haus. Durch das Fenster, das einen Spalt offen steht, dringt nur das leichte Rauschen eines Septembermorgens, Vogelgezwitscher …
Es ist warm wie im Sommer. Ein Dunstschleier liegt über dem Land. Die Spatzen schilpen in den Bäumen.
Ein wunderbarer Spätsommertag.
Und doch kann man schon den Herbst riechen. Das Laub der Bäume, die das Haus umstehen, beginnt sich langsam zu färben. Ich erinnere mich, wie sie in jedem Oktober in den prächtigsten Herbstfarben entflammten, bis sie das Haus mit einer Farbenpracht umloderten – ein phantastisches Purpur, Gold und Orange. Nach und nach verblassten die Farben zu trübem Ocker und die Blätter fielen ab. Dann war der Winter im Anmarsch.
Aber noch ist es nicht so weit.
Ich gehe langsam den Gartenweg hinauf. Er ist mit Ziegeln gepflastert und hat sich in den letzten Jahren in einen schlüpfrigen Pfad aus Moos und Algen verwandelt. Die Blumenbeete sind überwuchert von Unkraut und wilden Blumen. Die Rosen bilden ein einziges Dickicht aus Dornen und Blättern, ein wildes Gestrüpp, aus dem sich erstaunlicherweise die prächtigsten Blüten hervor drängen, rot und rosa, weiß und gelb.
Ja, der Garten ist wirklich zu einem Urwald geworden. Am üppigsten blüht und wuchert der Phlox. Sein Duft begleitet mich Schritt für Schritt. Teppiche aus Glockenblumen, Ackerwinden und rosafarbenem Mauerpfeffer bedecken den Boden. Ich entdecke Mutters Kräutergarten hinter der dichten Buchsbaumhecke. Die Herbstsonne, die nach dem gestrigen Regen warm auf grüne, silbrige und rotgoldene Blätter fällt, lässt eine Duftkaskade aufsteigen, die mich auf der Stelle in meine Kindheit zurück versetzt.
Ich habe mich einmal sehr gut ausgekannt mit allen Kräutern. Urgroßmutter verbrachte damals viel Zeit in ihrem Kräutergarten, sie hat mir alles beigebracht, was sie für nötig und nützlich hielt. Sie stellte ihre eigene Arznei her, Salben und Heiltränke.
Hinter der Buchsbaumhecke schließt sich der Gemüsegarten an. Das heißt, so war es einmal. Jetzt ist da nur noch hohes Gras, das Beete und Wege gleich gemacht hat.
Ich stapfe durch das nasse Gras bis hin zum Obstgarten, dessen Bäume zum Teil schon die goldene und rötliche Färbung des Herbstes annehmen.
Und dort steht er. Ganz am Ende des Gartens, nur wenige Meter von der Hecke entfernt, die den Garten vom Feld trennt: der Mirabellenbaum.
Eine Pracht in Gold und Grün. Auf den ersten Blick denke ich, auch hier hat der Herbst schon seine Spuren geprägt. Dann sehe ich, dass es Früchte sind, was ich für vom Herbst gefärbtes Laub hielt. Es sind Mirabellen, goldgelb und üppig, in einer Menge, dass man glauben könnte, die Äste müssten sich unter dieser Last biegen. Das ist aber nicht der Fall. Stolz und gerade steht der Baum da, in seiner ganzen herrlichen Pracht, ein Mirabellenbaum, wie ich nie einen zweiten gesehen habe.
Was für eine unglaubliche Ernte. Und das sicher Jahr für Jahr, auch in all den Jahren, als niemand hier geerntet hat.
Jemand hat eine einfache hölzerne Bank vor die Hecke gestellt, als hätte er sich oft vor den Baum gesetzt, um ihn zu betrachten. Und zu bewundern, was durchaus verständlich ist.
Dann fällt mir ein, dass ich den Verwalter Tobias gebeten habe, sich um die Obstbäume zu kümmern. Sicher hat er in jedem Jahr das Abernten besorgt. Ich sehe nun auch, dass die Obstbäume das Einzige sind, das einigermaßen beschnitten und gepflegt ist.
Ich stelle mir vor, wie der alte Tobias nach getaner Arbeit auf diesem Holzbänkchen sitzt, seine Pfeife raucht und den Mirabellenbaum anstaunt.
Es ist wirklich und wahrhaftig ein Wunder von einem Baum.
Ob seine Frau Marmelade aus den Mirabellen gekocht hat?
Später mache ich einen Gang durch den Ort. Ich überquere den Dorfanger, vorbei an dem kleinen Teich, an dessen Ufer ein paar aufgeplusterte Enten in der Sonne dösen. Bei Görners Zeitungsladen biege ich in die Dorfstraße ein. Die Blätter der alten Linden malen Schattenmuster auf das Kopfsteinpflaster. Haus an Haus reiht sich hier, aus roten Ziegeln oder gelbgrauem Stein gebaut, Blumengärten mit blühenden Hortensien oder Rosen davor. Ich wandere durch den ganzen Ort, vorbei an dem kleinen Lädchen und der Bäckerei, die schon seit langem geschlossen ist. Nichts scheint sich verändert zu haben, wohl ist hier und da ein neues Haus oder ein Bungalow hinzu gekommen, das ist alles. Als hätte die Zeit dieses versteckte Dörfchen zwischen den Hügeln übersehen.
Es ist merkwürdig, die altvertrauten Wege zu gehen, und mich überkommt das gleiche unwirkliche Gefühl wie am Abend zuvor.
Ich biege in einen Feldweg ein. Die Hügel wirken wie sanfte Wellen in der Landschaft. Die Wiesen sind mit Hecken und Stacheldraht voneinander getrennt. Große rotbraune Kühe grasen darauf, hin und wieder eine Schafherde. Dunst liegt in dünnen Schleiern über den Senken, und wo Felder brach liegen, steht das Gras hoch.
Ich erinnere mich. Diesen Feldweg sind wir oft mit dem Rad entlang gefahren, anfangs mit meiner Mutter, später dann mit Malthe, meinem Freund - als ich sechzehn war.
Merkwürdig, ich kann mich gar nicht an Malthes Gesicht erinnern. Da ist nur Mutter, ihr braunes, sommersprossiges Gesicht, ihr flammendes, stets unordentliches langes Haar, ihre kräftige Gestalt in dem ausgeblichenen grünen Gartenkleid. Ich sehe ihre Augen, dunkel und undurchdringlich, höre ihr heiseres Lachen, laut und spröde und ungehemmt – damals, als sie noch lachen konnte. Es wurde dann immer seltener, bis es irgendwann ganz aufhörte … .
Auf dem Heimweg mache ich vor dem Dorfladen Halt. Ich muss mich mit den nötigsten Lebensmitteln versorgen, zögere jedoch, hineinzugehen. Mir ist nicht nach dem ganzen Wiedersehenstheater. Wenn ich allerdings bleiben will, muss ich es doch irgend wann über mich ergehen lassen. Also warum nicht gleich? Vielleicht erkennt mich auch niemand oder die früheren Besitzer sind gar nicht mehr da.
Die Türglocke schrillt laut über meinen Kopf hinweg, so dass ich erschrocken zusammen fahre.
Und dann ist es wieder, als hätte ich einen Schritt in die Vergangenheit getan. Alles ist unverändert, die vollgepackten Regale an den Wänden, die aufgetürmten Waren in den zwei schmalen Gängen. Eine dicke Frau steht hinter dem Ladentisch. Sekundenlang starrt sie mich an, kommt dann um den Tresen herum nach vorn gewackelt. Es ist die Besitzern Frau Rottbusch, sie hat mich sofort erkannt.
Über ihr rundes rotes Gesicht zieht ein Strahlen. Mit beiden Händen klatscht sie sich in die Seiten, während der beeindruckende Busen sich hebt und senkt.
»Na, wen haben wir denn da!«
Ein langer steifer Kittel mit großen runden Knöpfen wölbt sich in einem Bogen über den stattlichen Leib, sein Saum endet über einem strammen Wadenpaar, die Füße stecken in ausgetretenen Schlappen undefinierbarer Farbe.
»Wenn das nicht die Laura ist!«
Die dicke Frau Rottbusch wie sie leibt und lebt. Kaum verändert in all den Jahren, vielleicht noch ein bisschen dicker als früher. Eine gekrauste graue Tolle erhebt sich über der hohen Stirn, als würde sich vor lauter Wohlwollen ihr Gefieder spreizen, während sie tief durch die Nasenlöcher einatmet, die gebläht und rot sind, wie die Nüstern eines Rennpferdes.
Ihre fleischige Hand packt die meine und schüttelt sie kräftig.
»Und wie unsere Laura sich verändert hat. Und hübsch ist sie geworden, wenn auch ein bisschen mager. Wie geht es denn, liebes Kind?«
Sie mustert mich von Kopf bis Fuß.
»Jaja, aus Kindern werden Leute. Wirst du bleiben? Ist ja auch Zeit, dass das alte Haus wieder bewohnt wird. Verkommt ja ganz. Der Tobias macht doch nicht viel. Kann wohl nicht mehr, wie er möchte, der arme Alte.«
»Vorerst werde ich wohl bleiben. Jedenfalls habe ich mir das vorgenommen, und …«
»Wie geht es der Mutter? Ist sie auch zurück?«
Ich habe nicht die geringste Lust, über meine Mutter zu reden.
»Nein, ich bin allein gekommen. Sie ist nicht hier.«
»Soso, sie ist also nicht mitgekommen. Wird es da nicht ein bisschen einsam für dich in dem alten Haus?«
»Das macht mir nichts aus.«
Frau Rottbusch runzelt die fleischige Stirn, ihre runden Augen blitzen vor Neugier.
»Du bist also wieder allein. Ich glaubte, du hättest geheiratet. Hatte mal so was läuten hören. Ist es schief gegangen mit der Ehe? Und keine Kinder?«
»Nein, keine Kinder. Ich lebe ganz gut allein.«
Ihre ausdrucksvolle Stirn umwölkt sich vor Mitgefühl. Tröstend klopft sie mir auf den Arm.
Dann wirft sie sich stolz in die Brust.
»Unsere Klara hat drei von der Sorte. Und was für Rangen. Nun ja, für dich kann das auch noch kommen. Ich sage immer, für eine Frau ist Ehe und Familie das einzig Wahre. Wirst schon sehen, der Richtige kommt irgendwann. Bist ja noch jung.«
Sie fließt geradezu über vor Anteilnahme und Wohlwollen. Eine gutmütige Seele ist sie, die Frau Rottbusch. War sie schon immer. Und so hilfsbereit und fürsorglich, dass es fast schon lästig ist.
»Wir haben noch ein paar nette Junggesellen im Ort,« zwinkert sie. »Wirst schon sehen. Was machst du so? Hast ja damals das Gymnasium in der Stadt besucht. Was war denn danach? Gleich von der Schulbank weg geheiratet?«
»Ich habe früh geheiratet, das ist wahr. Vermutlich zu früh. Darum hat es nicht geklappt. Seit einiger Zeit bin ich wieder allein. Ich habe als Journalistin für ein Lokalblatt gearbeitet. Und für Zeitschriften.«
Das muss ihr genügen. Ich habe keine Lust, über die letzten Jahre zu reden. Es gibt auch nicht viel Gutes zu sagen.
Wovon soll ich ihr erzählen? Von meinen Problemen in der Schule? Dass ich mit Ach und Krach letzten Endes doch noch das Gymnasium geschafft habe?
Von meinem abgebrochenen Journalisten-Studium oder den vielen Jobs, die ich alle wieder hinschmiss?
Von den Antiquitätenauktionen, dich ich besuchte und dabei ein bisschen gekauft und verkauft habe, von den Partys, die ich arrangierte oder von den Klavierstunden für Anfänger, die ich gab? Das einzig Vernünftige in all den Jahren, wenn man mich fragt. Spaß gemacht hat mir das alles nicht, und Geld kam auch nicht viel herein.
»In der letzten Zeit habe ich an einer Zeitung gearbeitet, als freie Mitarbeiterin.«
»Also bist du eine richtige Journalistin, na das ist doch was Feines, oder?«
Ihre runden blauen Augen mustern mich mit einem gewissen Respekt. Eine feine Journalistin bin ich! Fast hätte ich laut gelacht. Aber ich muss ihr ja nicht alle meine Niederlagen auf die Nase binden. Auch nicht die kleine Erbschaft, die gerade zur rechten Zeit kam, und mit der ich nie im Leben gerechnet hätte.
Das Geld von Tante Adele war längst aufgebraucht, auch kein neuer Job in Sicht. Es ging mir gar nicht gut zu der Zeit, ich war buchstäblich am Ende. Da stöberte mich der alte Rechtsanwalt der Familie auf, und ich erfuhr von diesem Geldsegen.
Was für eine erstaunliche Schicksalsfügung. Oder war es etwas Anderes?
Jedenfalls: Es lebe meine alte Tante Gundula! Ich habe sie zu Lebzeiten kaum gekannt, aber jetzt nach ihrem Tode verehre ich sie gründlich. Schließlich hat sie es mir ermöglicht, mich hierher zurück zu ziehen, um das zu tun, was ich schon immer gern wollte: ein Buch zu schreiben. Wenn ich sparsam lebe, müsste das Geld eine ganze Weile reichen.
All das erzähle ich der guten Frau Rottbusch aber nicht. In ihren Augen bin ich eine erfolgreiche Journalistin, und das ist gut so.
Am Nachmittag mache ich einen Besuch bei Tobias und seiner Frau Mette. Auch sie erkennen mich sofort. Und ich habe mir eingebildet, ich hätte mich Gott weiß wie verändert.
»Unsere Laura ist also heimgekommen,« sagt Mette und schiebt sich ächzend aus dem Lehnstuhl.
»Das ist aber schön. Da freuen wir uns sehr.«
Sie schüttelt mir beide Hände.
Dann kommen die üblichen Fragen. Ob ich allein sei, was ich so mache und ob die Mutter nicht mitgekommen sei.
Tobias ist ein bisschen verlegen.
»Ich hätte ja gern mehr gemacht,« sagt er. »Da in deinem Haus. Aber es will nicht mehr so recht, weißt du? Die alten Knochen machen nicht mehr mit. Gehe ja schon auf die siebzig.«
Ich beruhige ihn, es sei schon alles recht so. Mehr habe ich gar nicht erwartet.
Seine Frau Mette wirft ein, es sei Eingemachtes da. Von den Obstbäumen, Apfelkompott, Pflaumenmus und Quittengelee. Und vor allem Marmelade von den schönen Mirabellen! Jede Menge! Zwar habe sie für den Kirchenbasar davon gespendet und auch sonst, aber es sei noch viel da. Ob ich was davon haben möchte. Sie gebe es mir gern, und schließlich sei es ja meines.
Ich winke ab. Oh nein, ich esse gar keine Marmelade. Auch nicht die von den Mirabellen. Nur Honig.
Nun ja, dann ist es ja gut.
Und was die Mutter mache!
»Ihr beide habt so gar keine Ähnlichkeit,« sagt sie und mustert mich eingehend. »Kathleen war damals so eine schöne Frau. Ist sie das immer noch? Sicher doch, die Art Schönheit vergeht mit dem Alter nicht. Und ihre Haare! So dicht und rot, dass einem die Augen über gingen. Jaja.«
Nein, Kathleen und ich haben keinerlei Ähnlichkeit. Ich komme mehr nach meinem Vater. Er war dunkelhaarig, groß und dünn, während Mama mehr der bodenständige Typ ist. Kräftig und unverwüstlich. Keine Arbeit war ihr zu viel, sie war unempfindlich gegen Hitze und Kälte.
»Nein,« sage ich laut. »Kathleen und ich – wir haben kein bisschen Ähnlichkeit.«
Mettes Blick wandert zum Fenster hinaus.
»Sie war schon eine aparte Frau. Ganz was Besonderes. Ich hatte immer das Gefühl, niemand durchschaute sie so ganz.«
Wie recht sie hat!
Niemand durchschaute Kathleen so ganz. Auch ich nicht.
»Aber ihr habt euch gut verstanden, nicht wahr? Selten sieht man so ein herzliches Mutter-Tochter-Verhältnis. Das habe ich immer zu Tobias gesagt. Nicht wahr, Tobias?«
Tobias nickt eifrig. Seine dünnen, grauen Haarsträhnen fallen ihm in die Stirn. Er hat eine Nase wie ein Zapfhahn.
»Ja, das hast du. Ein Herz und eine Seele wart ihr. Eine schöne Frau, die Kathleen.«
»Eine Frau, die man so leicht nicht vergisst,« fügt Mette hinzu und blickt in den Garten hinaus, als könne sie da draußen die rothaarige Kathleen herum spazieren sehen.
»Da hat es so manchen Kerl gegeben, der sie vom Fleck weg genommen hätte. Aber sie wollte ja keinen. Keine Männer mehr in meinem Leben, hat sie immer gesagt. Sie hatte wohl kein Glück mit Männern. Ja, und Pech in ihrer Ehe, mit deinem Vater.«
»Du redest zu viel,« sagt Tobias. »Lass doch die alten Geschichten. Ich hoffe, es geht ihr gut, der Kathleen. Schade, dass sie nicht mitgekommen ist.«
Ich nicke. »Ja, schade. Ich werde wohl ein paar Renovierungen am Haus machen lassen. Nichts Großes, Streichen, Tapezieren und so. Ja, und Anschaffungen. Aber nur das Nötigste. Ich finde alles schön, so wie es ist. Ich mag die alten Sachen.«
»Das hat man selten, dass die jungen Leute die alten Dinge zu schätzen wissen. Meistens wollen sie alles neu haben.«
»Nun, ich nicht. Mir gefallen alte Dinge.«
Der alte Tobias blickt mir nach, wie ich mit leichten Schritten davon gehe. Eine schmale, leicht nach vorn geneigte Gestalt.
Er denkt: Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Kathleen hat sie wahrhaftig nicht. Nein, das nicht. Sie ist nicht so zäh und unverwüstlich.Es will mir scheinen, als hätte sie nicht nur gute Tage gesehen. Einsam kommt sie mir vor – diese nach vorn geneigten Schultern …
Seltsame Gedanken gehen ihm durch den Kopf
Wenn man älter wird, vergisst man leicht, dass jeder Mensch auf dieser Erde in sich selbst eingeschlossen ist; er schaut auf die Welt hinaus und weiß, dass das Vorhandensein der Welt – was ihn selbst betrifft – von dem Funken Licht abhängt, der auf seine Pupille fällt. Und dass alles vorüber und beendet ist, wenn seine Augen geschlossen sind. Und das ist für alle gleich.
Was immer ein Mensch aus seinem Leben macht, er ist trotzdem eingeschlossen. Tobias ist ein einfacher Mann, aber ein paar Lebensweisheiten hat er doch gesammelt. Weisheiten, die ihm sein Leben beigebracht hat: Niemand ist tapfer, und ein jeder ist voll von Hunger und Zweifeln. Und jeder hat irgend einen Schmerz.
Der Nachmittag vergeht wie im Fluge. Ich richte mich in meinem alten Zimmer ein, stelle ein paar Möbel um und putze die Fenster. Dann gehe ich in die Küche hinunter und mache mir etwas zu essen. Früher ist diese Küche mit dem Fliesenboden und den tiefen Fenstern mein Lieblingsraum gewesen. Ich liebte die gelb getünchten Wände und das herrliche Durcheinander. Überall gab es etwas Besonderes, das andere Leute in ihren Küchen nicht hatten. Die zum Trocknen aufgehängten Kräutersträußchen an der Decke, eine aus einer Baumwurzel geschnitzte Figur auf der Anrichte, ein paar bunte Vogeleier in einem Nest, selbst gebastelte Mobiles in allen Winkeln, getrocknete Hortensien und Strohblumen in wuchtigen Keramiktöpfen. Das alles ist nicht mehr da. Auch die Geranientöpfe sind von den Fensterbänken verschwunden. Statt dessen steht da eine Heiligenfigur aus Gips.
Über einem der Fenster hängt ein einziges verstaubtes Mobile aus Federn, Zweigen und Wurzeln. Mutter hat es selbst gemacht. Sie war schon immer sehr geschickt in solchen Sachen.
Der hohe Kühlschrank funktioniert noch. Ebenso wie der Backofen und der weiße Elektroherd. Wenn demnächst die kühlen Tage kommen, werde ich den alten Kohleherd heizen. Und den Kamin im Wohnzimmer neben der »kleinen Bibliothek«.
Die »kleine Bibliothek« ist absolut nichts Besonderes. Es gibt auch keineswegs eine »große Bibliothek« - wie man dem Namen nach annehmen könnte. Sie ist einfach ein Raum mit hohen Fenstern und drei mit Büchern bepackten Regalen, die in viel Staub und völligem Durcheinander dort ihr Dasein fristen, einem wuchtigen Schreibtisch, ein paar Stühlen und Plüschhockern und einem durchgesessenen roten Sofa.
Der kleine Raum neben der Küche war immer für Mutters Webstuhl reserviert. Dort hingen Stränge gefärbter Wolle an der Wand. Die sind jetzt verschwunden. Eine Zeitlang hat sie selbst die Wolle gefärbt, hat Flechten und Wurzeln gesammelt und sie sorgfältig ausgekocht und destilliert, bis sie – manchmal nach unzähligen Versuchen- die gewünschte Farbtönung hatte. Auf dem Webstuhl entdecke ich auf den Kettfäden ein angefangenes Stück – einstmals Grau und Purpurrot, jetzt völlig verstaubt und ausgeblichen.
Mutter konnte ausgezeichnet weben. Sie hat Wandbehänge und Decken gearbeitet, die sie gut verkaufte. Man riss sie ihr förmlich aus der Hand. Auch mir hat sie das Weben beigebracht, aber ich hatte nie allzu viel dafür übrig. Mir fehlt die Geduld.
Am Abend mache ich noch einen Spaziergang durch den Ort. Die Luft ist warm und dunstig, keine Sterne am Himmel. Die alten Straßenlaternen brennen, und die Beleuchtung mit ihren langen, sanften Schatten schmeichelt der Hauptstraße des kleinen Dörfchens weit mehr als die helle Mittagssonne. Die alten Häuser sehen direkt hübsch aus, weil ihre Schäbigkeit, die Risse im Putz, verwischt werden. Die schmalen Seitenstraßen wirken wie romantische Gässchen.
Ich ertappe mich dabei, wie ich das Heimkommen hinaus zögere. Ist es Angst vor der zweiten Nacht in dem leeren Haus? Gestern war ich zu müde, um mich zu fürchten. Wie aber ist es heute?
Unsinn, das habe ich längst hinter mir. Die alten Geschichten haben ihren Schrecken verloren. Ich bin erwachsen und mutig geworden, und ich weiß, dass mir nichts in diesem Hause etwas anhaben kann, weder die Geister der Toten noch die der Lebenden. Stehe ich nicht mit allen inzwischen auf gutem Fuße?
Und wie steht es mit den Erinnerungen?
Vor dem Zimmer der toten Adele mache ich Halt. Wenn ich denn so mutig und furchtlos bin, warum habe ich diesen Raum bisher nicht betreten? Kurz entschlossen drehe ich den Schlüssel herum und stoße mit einem Ruck die Tür auf. Muffige Luft schlägt mir entgegen. Ich taste nach dem Lichtschalter, Helligkeit durchflutet den Raum.
Alles ist wie vor vielen Jahren: vollgepfropft mit schweren Möbeln, dunkelblaue Vorhänge vor den Fenstern, das breite Bett mit dem hölzernen Kopfteil und der blaugemusterte Orientteppich vor dem Sofa. Ein vager Geruch von Räucherstäbchen hängt in der Luft.
Trotz der vielen Möbel – oder vielleicht gerade deshalb – ist es ein gemütliches Zimmer. Ich habe es immer sehr gemocht, so wie ich auch die alte Adele mochte – als sie noch lebte.
Ich trete ans Fenster, ziehe die Vorhänge ein Stück zurück und blicke in den Garten, der allmählich in der Dunkelheit verschwindet. Wie Rauch schwebt der Abendnebel über dem Gras. Weit hinten sehe ich den Obstgarten, der Mirabellenbaum leuchtet geradezu unwirklich daraus hervor.
Ich wende mich in den Raum zurück. Nichts Unheimliches ist hier; nichts, das mir Angst machen müsste. Selbst wenn Adeles Geist sich nach all den Jahren noch hier aufhalten oder hierher zurück kehren sollte – was kann er mir anhaben?
Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich mich in diesem Raum aufhielt. Damals lüftete Mutter den Raum regelmäßig, und manchmal zündete sie eine Kerze an. Sie hatte da so ihre merkwürdigen Anwandlungen. An diesem Abend wollte ich mir beweisen, dass der Geist der toten Adele mich nicht schrecken konnte, und so ging ich entschlossen ins Zimmer hinein, schloss sogar die Tür hinter mir.
Da stand ich also, reckte den Kopf tapfer in die Höhe, während es mir im Nacken kribbelte. Die Kerzenflamme flackerte hinter der Glaskugel, denn das Fenster stand ein wenig offen, und fremdartige Schatten zitterten über die Wand.
Und obwohl ich mir alle Mühe gab, besaßen diese unheimlich flatternden Schattengestalten noch immer die Macht, das Zimmer in eine seltsame Schreckenskammer zu verwandeln. Ich geriet in Schweiß bei dem Gedanken, dass diese Schatten von langen, greifenden Händen geworfen wurden. Händen von den Geistern der Toten. Von Adele und allen anderen Menschen, die in diesem Raum vor ihr gestorben waren.
Ich erinnere mich, dass ich die Zähne fest zusammen biss. Ich nahm all meinen Mut zusammen, drehte mich um und blickte in die Dunkelheit. Und da spürte ich es: den kalten Atem, die kalten tastenden Hände, die mich berühren wollten … mich jeden Augenblick fassen konnten – voller Panik und Schrecken raffte ich mich auf und stolperte aus dem Zimmer. Knallte die Tür hinter mir zu, dass sie nur so in den Angeln krachte und fiel mehr als dass ich rannte - schreiend und keuchend die Treppe hinunter.
Danach habe ich den Raum nie wieder betreten. Mama hat in der ersten Zeit noch dort gelüftet und geputzt. Sie dachte wohl, sie sei es der alten Adele schuldig, weil sie uns alles vermacht hatte, was sie besaß.
Das ist lange her. Ich durchquere den Raum und knipse das Licht aus. Dunkelheit umgibt mich. Ich schließe die Tür hinter mir und drehe den Schlüssel im Schloss. Im Flur ist es dämmrig, und als ich mich umwende, sehe ich sie in dem langen Spiegel neben der Tür. Eine gebeugte Gestalt, ein altes Gesicht späht unter zerzaustem Haar hervor – eine alte, schwerfällige Frau steht da, weiße, dünne Hände, die sich heben.
Ich stehe regungslos. Mein Herz klopft laut. Welch Spuk narrt mich wieder! Was ist das mit den Spiegeln in diesem Haus?
Ich schaue genauer hin und – sehe mich, wie ich nun mal bin: eine dünne Frau mit wirrem Haar über einem weißen Gesicht. Ein müdes Gesicht, eine leicht gebeugte Gestalt.
Eine keineswegs hübsche und wenig ansprechende Frau, deren Mädchentage für immer vorbei sind. Das bin ich und niemand sonst. Keine Gespenster, keine Geister von Verstorbenen. Die alte Adele ist endgültig tot.
Schon seit vielen Jahren.
Dann liege ich in meinem Bett, das Nachtlämpchen neben mir verbreitet einen weichen Schein. Ich habe keine Angst, sage ich mir. Es gibt keinen Grund dafür. Erinnerungsbilder und Wortfetzen flackern mir durch den Kopf. … es atmet … eine Erscheinung, die auf der anderen Seite des Bettes geschwebt hatte … Schritte und Flüstern … ein kalter Hauch und die Berührung von kalten Händen… und immer das Atmen …
Das alles waren die Phantasiegespinste meiner Kinder- und Jugendzeit. Großmutter Paulines Gespenstergeschichten, die sie in mich hinein gepflanzt hat. Die Fremde im Spiegel. Übermüdung oder ein Spiegel, in den ich gestarrt habe. Die Vision oben an der Treppe, ein Wesen, das Mutter ähnlich sah.
Es atmet, eine Erscheinung – meine eigene Erscheinung, die hier seit Jahren spukt? Vielleicht schon, bevor ich überhaupt geboren wurde. Wer weiß denn, wie das mit Geistern ist? Ich sehe mich wie in einem Spiegel, nur dass dort kein Spiegel ist.
Es war kein Geist, vielleicht bin ich irgendwie aus mir heraus getreten, habe ein Double von mir projiziert.
Der Mirabellenbaum mit seiner Zauberkraft – wer hat das gesagt? Großmutter nicht, die war schon lange tot. Mutter auch nicht, die hatte Anderes im Kopf. Vielleicht der alte Tobias? Ich weiß es nicht mehr. Es ist lange her. Alles ist so lange her. Ich habe das Gefühl, als sei mein ganzes Leben lange her. Als sei ich dabei, mich aufzulösen. Meine ganze Gegenwart. Um in die Vergangenheit zurück zu kehren.
Vielleicht ist alles nur ein Traum, und ich bin gar nicht hier.
Ich bin gar nicht wirklich. Nie war ich so wirklich wie Mutter es war. Meine schöne Mama. Wie sehr habe ich sie geliebt und bewundert! Und beneidet. Wie gern wäre ich wie sie gewesen. Jedenfalls als kleines Mädchen.
Sie hatte langes rotes Haar und besaß ein gewisses, nicht zu verleugnendes Etwas, das man weder in der Kosmetikabteilung kaufen noch sich in einem Fitness-Center antrainieren konnte. Eine Art Sinnlichkeit, die ihr noch nicht einmal bewusst zu sein schien.
Sie war eine merkwürdige Frau. Sie wirkte ernst, sogar wenn sie lachte. Und sie lachte viel. Ein heiseres, dunkles Lachen, das ich unter tausend anderen heraus gekannt hätte. Sie neigte zu dem Glauben, das Leben werde schon irgendwie funktionieren. Jedenfalls kam es mir immer so vor.
Ich sehe sie vor mir in ihrem grünen Gartenkleid, den Strohhut tief in die Stirn gezogen. Sie hatte eine prachtvolle Figur, nicht die zarte Gebrechlichkeit und eine überschlanke Taille, wie es gerade Mode war. Auch sie war schlank, dabei aber kräftig und stabil, und doch anmutig wie eine Katze. Im Sommer war sie so braun gebrannt von der Sonne, dass ihre Sommersprossen gar nicht zu sehen waren. Dann sah sie aus wie eine Indianerin.
Wenn sie ausging, machte sie sich fein. Ihr langer, geschlitzter Rock schleifte über den Boden, die grüne Seidenbluse bauschte sich über ihrem üppigen Busen, Armreifen klimperten an ihren Handgelenken, lange Ohrringe baumelten ihr fast auf die Schultern. Zwischen allen anderen Frauen wirkte sie wie eine exotische Blume.
Das war in ihrer Jugend, und auch noch zu der Zeit, als sie Vater kennen und lieben lernte. Irgend wann begann sie sich zu verändern. Oder änderten die Zeiten sich? Vermutlich beides. Die Menschen ändern sich mit den Zeiten und mit dem, was ihnen geschieht.
Mama ist in einer kleinen Stadt aufgewachsen. Dort hat sie meinen Papa geheiratet, und dort bin auch ich geboren. Weit weg von diesem Dörfchen, in dem wir beide schließlich gelandet sind. Es war alles so anders da als hier. Die Menschen um uns herum, und auch das Haus, in dem wir lebten.
Die Eltern meiner Mutter starben bei einem Unfall, als sie noch sehr klein war. Ihre Großmutter hat sie aufgezogen. Großmutter Pauline!
Ich schließe die Augen, und sehe alles vor mir. Es ist alles noch da, auch die Stunde, als wir fort gingen. Der morgendliche Dunst, der sich den Konturen des Bodens anschmiegt. Die kalte Luft, die mich schaudern lässt und meine Müdigkeit vertreibt.
»Wir gehen fort,« hat Mama gesagt. Und ich muss mit. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das will, und auch nicht, warum es keinen anderen Ausweg gibt. Aber es scheint nötig zu sein. Schon aus dem Grund, damit alles wieder besser wird.
Wenn ich die Augen schließe, taucht in meinem Kopf die heimatliche Landschaft auf: hügelig, im Patchworkmuster aneinander gereihte Felder und Wälder rings um das kleine Städtchen, an dessen Rand wir lebten.
In unserem Viertel kannte ich mich aus. Es war wie eine kleine Welt für sich. Die alte Bäckerei und die weitläufige Gärtnerei hinter dem großen Haus, die lindengesäumte Straße mit dem holperigen Kopfsteinpflaster, all die Ein- und Zweifamilienhäuser in den bunten Gärten, das kleine Kino und am Ende der Straße die alte Kapelle auf einem Hügelchen. Und gleich hinter den Häusern Wiesen und Felder, und der halb zugewachsene Weg, der zum kleinen See hinunter führte. Es war eher ein Teich mit grünem Ufer und ein paar Weiden, deren lange Wedel im Wasser schleppten.
Das Wasser war nicht klar, sondern dunkelgrün, ein paar Seerosen schwammen am Rand, und im Sommer gab es Frösche und Mücken in Mengen. Das alles machte uns nichts aus, wir badeten trotzdem darin. Das heißt, einige von uns. Ich zum Beispiel, und ein paar der Jungen. Die Mädchen schrien bei jedem Frosch huch und igitt, und wenn gar ein Blutegel auftauchte, stoben sie kreischend davon.
Es war schön dort, fast war es wie in einem Dorf. Ich sehe alles ganz genau vor mir. Jeder Baum, jeder Weg und jeder Zaun ruft Erinnerungen in mir wach. Erinnerungen an lange Sommertage am Teich und Schlittenfahrten im Winter, mit kahlen oder schneebedeckten Bäumen, mit Frühlingsblumen oder bunten Sommerwiesen, und alles verschmilzt ineinander, all die Jahre und Erlebnisse.
Ich sehe das Haus vor mir, in dem ich geboren bin. Und in dem auch Mama geboren ist.
Das Haus, in dem wir bis zu meinem 11. Lebensjahr gelebt haben, in dem ich wunderbare Zeiten hatte.
Aber es gab auch Schatten. Vor allem für Mama. Hier begann ihre schönste, später dann ihre schlimme Zeit. Für mich als Kind blieb alles recht verworren, denn ich kriegte längst nicht alles mit, was geschah.
Für mich lag über allem ein besonderer Zauber, und das war Großmutter Pauline zuzuschreiben. Ein Teil von mir schwebte stets in höheren Sphären.
Wenn meine Füße über die grüne Wiese hüpften, hing mein Kopf droben in den Wolken. Oder in irgendwelchen Zauberwelten, die Großmutter Pauline für mich erschaffen hatte.
Arme Mama, arme Kathleen. Langsam und schleichend muss es geschehen sein, dass ihre glücklichen Zeiten sich in das Gegenteil verwandelt hatten,
Vergangenheit
Kathleen
Ankunft
Es ist ein großes Haus, etwa hundert Jahre alt. Der graue Stein über der Eingangstür trägt die Inschrift: 1897 V. C. Svoboda. Das war der Name des Erbauers. Er hat hier seine Familie gegründet.
Das Haus ist aus gelbgrauem Stein gebaut. Auf den ersten Blick ein einfaches, zweistöckiges Gebäude mit schmuckloser Fassade, einem steilen Dach mit zwei Giebelfenstern und je einem Schornstein an jedem Ende.
Die Eingangstür ist breit, aus nachgedunkeltem Eichenholz, mit bunten Glasfenstern auf jeder Seite. Durch diese Tür kommt man in eine weitläufige Diele, an deren Ende eine breite Treppe in den ersten Stock hinauf führt. Über eine schmalere Treppe gelangt man dann in den zweiten mit den beiden kleinen Mansardenzimmerchen und einem weitläufigen Boden.
Zum Garten hin liegt eine breite, geflieste Terrasse, die an zwei Seiten von Fliederbüschen begrenzt wird. Flieder gibt es auf diesem Grundstück reichlich, in verschiedenen Farben und Sorten, und manche der Fliederstöcke sind so groß wie Bäume. Sie säumen überall die Mauern, und ihr Duft dringt bis ins Haus, wenn es Mai ist und die Fenster offen stehen.
Es ist gerade Mai und der Flieder steht in voller Blüte, als Kathleen in das Haus der Großmutter kommt, das von nun an ihr Zuhause sein soll. Kathleen ist mal gerade fünf Jahre alt, und alles hier ist ihr fremd. Vor kurzem hat sie ihre Eltern verloren, und seitdem ist sie noch gar nicht recht zu sich gekommen. Mit einem Schlage hat sich ihre alte Welt und ihr altes Leben in Nichts aufgelöst.
Ein Onkel, den Kathleen kaum kennt, begleitet sie zum Hause der Svobodas.
Die Dämmerung wird schon dichter, als sie ankommen. Aus den Fenstern dringt Lampenschein. Der kleinen Kathleen ist es recht beklommen zumute, als sie an dem grauen Haus hinauf blickt. Es kommt ihr vor, als lauere es sprungbereit dort hinter dem schmiedeeisernen Zaun. Die Fenster starren mit Argusaugen auf sie herunter, geradezu düster und bedrohlich.
Alles ist so fremd und neu. Und vor allen Dingen merkwürdig.
Das Haus ist riesig und seltsam. In der dämmrigen Halle ist es kühl. Unzählige Türen gehen von hier ab, hinter denen eine Menge Stimmen zu hören sind.
Und dann steht Kathleen einer stämmigen Frau mit kurzgeschnittenem grauem Haar gegenüber, die sich als Betsy vorstellt.
»Ich versorge deine Oma,« sagt sie und mustert Kathleen prüfend. »Und in Zukunft auch dich,« fügt sie hinzu und nimmt die Kleine resolut bei der Hand.
»Am besten bringe ich dich gleich nach oben zu deiner Oma. Deine Tanten und Kusinen kannst du morgen begrüßen. Ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal.«
Kathleen steht stumm und reglos und lässt alles über sich ergehen.
Dann stolpert sie an den vielen Türen und Stimmen vorbei an Betsys Hand über den Flur und die Treppe hinauf.
»Arme Kleine, wie alt bist du denn?«
»Fünf,« will Kathleen sagen, aber sie bringt keinen Ton heraus. Das Herz klopft ihr bis zum Halse, und sie kann kaum denken.
»Brauchst keine Angst zu haben, wird schon werden,« tröstet Betsy und drückt der Kleinen aufmunternd die Hand.
»Und da sind wir auch schon.«
Nebeneinander gehen sie einen langen Gang hinunter, der ausgefranste rote Läufer verschluckt ihre Schritte. Vor einer der Türen macht Betsy Halt und klopft.
Eine kräftige Stimme ertönt von drinnen, und dann steht Kathleen ihrer Großmutter gegenüber. Bisher hat sie sich kein Bild von ihr gemacht, dazu war sie viel zu durcheinander. Allerdings hat sie bis zu diesem Tag immer gedacht, Großmütter hätten weiße Haare, zu einem Knoten im Nacken geschlungen, weite graue Röcke und faltig-freundliche Mienen, vielleicht noch ein Häubchen auf dem Kopf. Diese hier sieht völlig anders aus. Kathleen kann kaum glauben, dass sie eine Großmutter sein soll.
Die hochgewachsene, imponierende Frau da am Fenster entspricht keineswegs dem Bild einer klassischen Oma. Ein Paar dunkle Augen unter dichten Brauen blicken Kathleen forschend entgegen. Das schwarze Haar ist zu zwei dicken Zöpfen geflochten und straff um den Kopf gelegt. Eine einzige weiße Strähne zieht sich über die Schläfe. Ein breites Umschlagtuch in leuchtenden Farben umhüllt straffe Schultern, ein weiter langer Rock bedeckt die Beine bis zu den Waden.
»Komm her zu mir, hier ans Fenster.«
Sie streckt Kathleen beide Arme entgegen. Zwei kräftige ringgeschmückte Hände packen sie bei den Schultern und ziehen sie zu sich heran.
»Ich bin deine Großmutter Pauline.« Ihre Stimme ist dunkel und forsch, gar nicht wie die einer alten Frau.
»Ich bin die Mutter deiner Mama. Ich werde jetzt für dich sorgen.«
Ganz nah ist ihr Gesicht, Kathleen kann die kleinen hellen Fünkchen in ihren dunklen Augen sehen. Merkwürdige Augen hat sie, und eine scharfe, gerade Nase. Ihr Gesicht ist braun und hat kaum Falten. Ein hoher Stehkragen geht ihr bis zum Kinn.
Auf einmal verschwimmt das dunkle Gesicht der Großmutter vor Kathleens Augen. Da ist ein merkwürdiges Schwindelgefühl, als hätte das Haus, ohne dass sie es gemerkt hätte, seinen Ankerplatz an der lindengesäumten Straße verlassen und treibe aufs offene Meer hinaus. Ihr ist übel, und der Boden unter ihren Füßen schwankt. Sie packt mit einer Hand die Lehne des Stuhls. Das hilft, aber nur wenig. Sie krümmt die Zehen, um den Boden deutlicher zu spüren.
»Hab keine Angst,« hört sie wie aus weiter Ferne die beruhigende Stimme der Großmutter. »Ich bin ja da. Wirst sehen, alles wird gut.«
Als sie schließlich im Bett liegt, zwischen kühlen Laken, ist wie durch ein Wunder wirklich alles gut. Das Bett ruht fest und sicher unter ihr, die Zimmerdecke hängt bewegungslos über ihr. Durch das offene Fenster ihres neuen Zimmerchens im Dachgeschoss dringt Fliederduft zu ihr herein. Der große Busch reicht beinahe bis zum Fenstersims herauf. Kathleen liegt mit geschlossenen Augen im Bett und atmet tief ein.
Im Zimmer unter ihr sitzt die alte Pauline am offenen Fenster und blickt in die Mainacht hinaus. Der Himmel ist tief dunkelblau, und irgendetwas scheint da draußen zu flüstern. Es sind die Fliederbüsche, deren Blätter in der warmen Luft wispern, als seien sie aus altem Pergament und könnten jeden Moment zerfallen.
Sie weiß, dass nur sie es hören kann, wie sie auch weiß, was das für die Zukunft zu bedeuten hat.
Ein violetter Schleier senkt sich über den ganzen Garten, als der Mond hinter einer Wolke hervor kommt.
Die alte Pauline denkt an das Kind, das zu ihr gekommen ist und an alles, was noch kommen wird.
Vorerst wird Regen kommen, das weiß sie auch. Der Regen wird nach Mitternacht einsetzen. Er wird herunter rauschen wie ein gläserner Fluss. Die ganze Welt wird aussehen wie in Silber getaucht. All das kann sie spüren. Jetzt ist da nur eine leichte Brise, die den Duft des Flieders herüber trägt.
Wenn sie ein wenig ihre Augen anstrengt, kann sie auch den Mann am Zaun sehen. Und kann seine Stimme hören, seine Worte werden vom Wind über den Rasen getragen, aber verstehen kann sie sie nicht. Hingegen hat sie den Geschmack von Mirabellen auf der Zunge, und der Duft des Flieders scheint sie direkt zu betäuben.
Es ist erstaunlich, denkt sie. Erstaunlich, was man alles wahrnimmt, wenn man seine Sinne offen hält.
Die alte Pauline kennt Nächte wie diese. Sie kennt sich mit vielen Dingen aus, was anderen nicht gegeben ist.
In manchen Nächten ist es am besten, wenn man aufhört, an die Vergangenheit und an alles zu denken, was man gewonnen und verloren hat. Was geschehen ist und was noch geschehen wird.
In Nächten wie diesen ist es gut, einfach ins Bett zu gehen, zwischen die kühlen Laken zu kriechen und die Augen zu schließen.
Schließlich ist es eine ganz normale Mainacht - bis auf den besonders starken Fliederduft, den Geschmack von Mirabellen auf der Zunge, das blaue Licht zwischen den Wolken und einen seltsam silbrigen Mond.
Kathleens neues Leben
Es ist eine große Familie, in die Kathleen hinein geraten ist. Genau genommen sind es drei Familien und dazu die alte Pauline, die im Obergeschoss des Svoboda-Hauses lebt.
Zunächst begreift Kathleen nicht recht, wer in welchen Räumen wohnt und wer zu wem gehört. All diese Menschen geraten ihr durcheinander. Erst mit der Zeit erkennt sie die Zusammenhänge, lernt ihre Namen und Eigenarten kennen.
Die Großmutter ist seit vielen Jahren allein. Sie hat vier Kinder geboren, von denen eine Tochter – Kathleens Mutter Kerstin – bereits gestorben ist. Die Töchter Ellen und Sophie wohnen mit Mann und Kindern im Hause, während der Sohn Gernot mit seiner Familie in der Gärtnerei lebt. Zur Familie gehören diese Gärtnerei und eine Bäckerei, und alle Familienmitglieder haben hier ihre Arbeit.
Jede Familie hat zwei Kinder, und es ist Kathleen nachgerade unmöglich, sich Namen und Zugehörigkeit zu merken.
Sie will es auch gar nicht. Soweit es möglich ist, geht sie dem ganzen Trubel aus dem Weg. Sie hat ja Großmutter Pauline, die von Stund an ihr Dreh- und Angelpunkt geworden ist. So bilden die Älteste und die Jüngste der Familie ein interessantes Gespann und es scheint, als seien sie wie für einander geschaffen. Kathleen fühlt sich am wohlsten bei der Großmutter, mit den Kindern der Familie, die ohnehin alle älter sind als sie, hat sie zunächst nicht viel im Sinn.
Zwar hat man sie sehr freundlich willkommen geheißen, aber danach hat es den Anschein, als sei sie auf geheimnisvolle Weise unsichtbar geworden. Alle haben genug mit sich selbst und ihren Angelegenheitenzu tun, und die kleine Fünfjährige ist in einem Alter, in dem die Leute sie übersehen.
Großmutter Pauline hat eine dicke gelbe Katze, der es dagegen anders ergeht. Molly hat sich sofort an Kathleens Fersen geheftet und folgt ihr auf Schritt und Tritt. Sie liebt es, ihr ins Mansardenstübchen zu folgen, wenn diese am Abend zum Schlafen hinauf geht. Dann springt sie mit elegantem Satz auf das Bett, wobei sie mehr als einmal die Steppdecke mit unbekümmerten schwarzen Abdrücken ihrer Pfoten besprenkelt.
Begeistert gräbt sie sich in die Kissen, und Kathleen wühlt sich neben ihr hinein. Zärtlich zieht sie das wollige, gelbe Knäuel an sich, und dessen dicker, pelziger Kopf bohrt sich unter ihr Kinn. So liegen die beiden zufrieden eingekuschelt beieinander, und das rollende Schnurren der Katze wiegt Kathleen in den Schlaf.
Kathleen liebt es, in Großmutters Zimmer zu sein.
In ihren Augen ist es der gemütlichste Raum im ganzen Haus. Hohe Schränke und Kommoden stehen darin, aus denen die Oma die erstaunlichsten Dinge zutage fördert. In schlanken Mahagonivitrinen stapelt sich wunderhübsches blaugoldenes Geschirr, auf kleinen Tischchen thronen Lampen mit prächtigen, befransten Schirmen und der Boden ist mit farbenfrohen Teppichen bedeckt, einer neben dem anderen.
Eine Seite wird von einem mächtigen Bücherschrank eingenommen, alle Bücher stehen hinter Glas, was kein Wunder ist, denn Kathleen hat nie zuvor solch goldene und blausilberne Buchrücken gesehen. Davor stehen tiefe Sessel, in denen mindestens zwei Personen Platz hätten. Karminrote Vorhänge an den Fenstern reichen bis zum Boden herab.
Um den Kamin zieht sich ein glänzend poliertes Messinggitter, und daneben steht ein großer blanker Kohlenkasten aus Messing mit Holzscheiten darin.
Über dem Kamin hängt ein Portrait vom Großvater in einem ovalen Rahmen, braun und golden verziert. Er war ein stattlicher, schnurrbärtiger Mann mit lustigen Augen, wie Kathleen sehen kann. Darunter auf dem Kaminsims steht ein ovaler Glassturz über einem getrockneten Rosensträußchen.
In einer der Kommoden verwahrt Großmutter einen Stapel Fotoalben, die sie manchmal hervor holt. Es sind viele Bilder darin von der gesamten Familie.
Alle ihre Kinder sind da auf vergilbten Fotos zu finden, in allen Altersstufen. Diese vielen lachenden Gesichter will Kathleen gar nicht sehen, sie kann sie ohnehin nicht auseinander halten. Für sie zählt nur die Mutter. Stundenlang kann sie über den Kinderbildern ihrer Mutter brüten. Da ist das Baby Kerstin auf einem weißen Fell, dort ein lachendes Kind auf einer Schaukel, und schließlich ein kleines bezopftes Mädel mit Schultüte. Und viele, viele Bilder beim Spielen, beim Baden, beim Schlittenfahren.
Auch an den Wänden hängen jede Menge Bilder, in allen Größen und Formen, in den unterschiedlichsten Rahmen. Sie zeigen die Vorfahren, Männer und Frauen. Es gibt blonde und dunkelhaarige Köpfe, auch rothaarige, und eine Reihe der Männer trägt wilde Bärte.