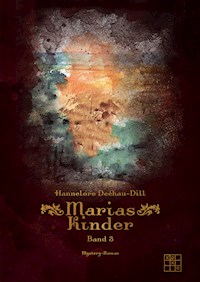Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maria-Reihe
- Sprache: Deutsch
Maria hat erreicht, wofür sie gekämpft und was sie ersehnt hat. Die entsetzlichen Erinnerungen an ihr früheres Leben verblassen allmählich. Wenn da diese eine Sache nicht wäre, mit der sie nicht leben zu können glaubt. Sie sieht nur einen Weg, dauerhaften Frieden und Glück für sich und ihre Familie zu finden. So nimmt sie heimlich die Spuren der Vergangenheit wieder auf. Sie taucht völlig in ihr altes Leben ein und findet den Weg in die Gegenwart nicht mehr. Zwar gelingt es ihr, jenen Fehler wieder gutzumachen, jedoch setzt sie damit eine Kette unglaublicher Ereignisse in Gang, mit denen sie nicht gerechnet hat. Sie beschwört neue Ängste und Gefahren herauf, die ihr von nun an auf den Fersen sind. Suchte sie wirklich nur ein friedliches Leben oder gab es da noch etwas anderes? »Maria lag noch lange Zeit mit offenen Augen in der Dunkelheit, ein heller, weiß-silbriger Mond schien ihr direkt ins Gesicht, der Himmel war voller Sterne. Das Universum, dachte sie ehrfürchtig, was für ein Mysterium! Eine leise Stimme flüsterte in ihrem Kopf: Diese Reisen in eine andere Zeit, in die Vergangenheit – ist das so etwas wie Unsterblichkeit? Bin ich unsterblich?«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Marias Spurensuche
Teil 2 der Maria Reihe
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-059-0
E-Book-ISBN: 978-3-96752-559-5
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung einer Illustration der Autorin
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Was sind Zeit und Realität?
Raffinierte Trugbilder
unseres Bewusstseins?
- E. Meckelburg
Vorwort
»Zeit – für die meisten von uns wird sie durch Uhren und Kalender verkörpert.
Und wir werden durch den unaufhaltsamen, regelmäßigen Stundenschlag an die Vergänglichkeit des Augenblicks gemahnt – an das Gestern, Heute und Morgen, an Geburt, Leben und Tod.
Weil wir unsere Zeit »eingeteilt« haben, ist es uns möglich, nach dem Alter der Menschheit zu fragen, nach dem der Erde, unseres Sonnensystems und dem des Universums. Ja, sogar die Frage nach dem Woher und Wohin ist an dieses Phänomen gebunden. Denn ohne Zeit gäbe es weder Bewegung, Schwingung noch Reaktion. Nichts würde existieren, keine Menschheit und kein Universum.
Es sieht so aus, als wäre der Ablauf der Zeit unbeeinflussbar, unabänderlich und unverrückbar. Doch hier trügt der Schein. Weisen doch in unserer Welt immer wieder unerklärliche Zwischenfälle darauf hin, dass unsere orthodoxe Auffassung von Raum und Zeit auf Treibsand gebaut ist. Denn hin und wieder führt ein »Zeitriss« zu fantastischen Begegnungen mit dem Unfassbaren, durch die die Grundfesten bestehender Dogmen erschüttert werden.
Gewohnt, in einfachen Kausalitätsketten zu denken, muss sich der Mensch nunmehr auf gedankliche Dimensionen einstellen, die bisher der Sciencefiction vorbehalten waren. Denn die bislang weitgehend mechanistischen Denkschemata verhaftete Naturwissenschaft ist an eine Grenze gestoßen, deren Überwindung die Menschheit auf eine neue, höhere Bewusstseinsstufe heben wird. Die Revolutionierung der Physik durch die Einsteinsche Relativitätstheorie und die Heisenbergsche Unschärferelation hat bewiesen, dass unverrückbar geglaubte Naturgesetze in Wahrheit nur in begrenztem Maß und unter bestimmten Bedingungen gültig sind.
Die Ansicht, das Universum bestehe aus Energie und Materie im dreidimensionalen Raum und werde durch eindimensionale Zeit Veränderungen ausgesetzt, widerspricht einer weit komplexeren Realität mit zusätzlichen Dimensionen, die unserem Wahrnehmungsvermögen normalerweise verborgen bleiben. Denn allem Anschein nach ist das physikalische Universum nur Teil eines größeren – eines Multiversums, das sich manchmal ganz unerwartet durch einen »Riss« in der Zeit andeutet.«
- J. v. Buttlar
Kapitel 1
»Leben – ist der lauernde Gedanke all dessen, was einst war.
Aufgefächert in Ideen, Stimmen, Augen, Gesichter, Gefühle und Träume spukt es – ungeachtet von Raum und Zeit – hinter den Türen und Fenstern unseres Seins, in der Hoffnung, aufs Neue, durch einen Zeitriss, aus dem Nichts des Vergessens, aus stummer, zeitloser Ewigkeit wieder zurück kehren zu können.«
- J. v. Buttlar
Es schien Maria, als habe es in ihrem ganzen Leben noch nie so einen heißen August gegeben.
Und nicht nur der August! Schon in den Monaten zuvor hatte während der meisten Zeit eine bleierne Hitze über dem Land gebrütet.
Bereits am Vormittag schien eine unbarmherzige, heiße Sonne vom wolkenlosen Himmel herunter, trocknete die ohnehin schon harte Erde mehr und mehr aus, ließ Blumen und Gras lange vor dem Herbst welken.
Maria hatte die Sonne früher immer geliebt. Wenn sie ihr beim Laufen über den Rasen warm in den Nacken schien, sie blendete beim Schwimmen im See, ihr weiches Licht auf den geschlossenen Lidern beim morgendlichen Erwachen.
Nun hatte sie sie fürchten gelernt. Ihr gleißendes, helles Licht, ihre sengende Hitze, die sie gnadenlos verbreitete. Heiße Luft schien über trockenem Gras und ausgedörrter Erde zu flimmern.
In den meisten Räumen des Hauses herrschte eine dumpfe, stickige Luft, in wenigen war es kühl und angenehm. Maria ging es in diesen Tagen nicht sehr gut. Ihre Schwangerschaft machte ihr zu schaffen. Diese Übelkeit, die doch eigentlich nur in den Morgenstunden auftreten sollte, hielt oft den ganzen Tag über an. Sie war kaum fähig, sich auf irgendeine Arbeit zu konzentrieren.
Gott sei Dank, dass ich nicht mehr im Berufsleben stehe, dachte sie. Ich wäre gar nicht fähig dazu.
Aber wie ist das nur möglich? Geht es anderen Frauen ebenso?
Ihr Arzt hatte sie getröstet: »Nach dem dritten Monat hört das auf. Dann wird es Ihnen prächtig gehen! Warten Sie nur ab!«
Nun, dann hätte sie es ja bald geschafft!
Maria saß im Schatten eines alten Apfelbaumes und blickte auf den See hinaus.
Sie war allein. Nur Vincent am anderen Ende des Gartens war bei seiner Arbeit. Mit seinem breitrandigen, uralten Strohhut auf dem Kopfe, der verblichenen blauen Latzhose und dem karierten Hemd mit den hochgekrempelten Ärmeln war er zu einer vertrauten Gestalt für sie geworden.
Maria schätzte ihn sehr. Immer für sie da, stets voller Verständnis, Güte und Hilfsbereitschaft; ohne viele Worte zu machen, war er ihr und Martin ein guter Freund geworden. Wie ein Vater, dachte Maria mitunter. Ein Vater, wie sie ihn nie gekannt hatte.
Jetzt wunderte sie sich. Ihn schien weder Sonne noch Hitze zu stören. Wenn er nicht mit dem Gartenschlauch oder seiner Gießkanne hantierte, war er mit den Rosen oder irgendwelchem imaginären Unkraut auf einem der Blumenbeete beschäftigt.
Nun ja, er ist ja auch nicht schwanger, dachte Maria mit müder Ironie. Wenn doch Martin da wäre! Aber vielleicht lieber doch nicht. Er würde viel zu viel Aufhebens um sie machen. Eigentlich war er rund um die Uhr besorgt um sie. Maria Cristina Scheffler, dachte sie. Das bin ich! Seit wenigen Wochen bin ich Martins Frau.
Sie hatten eine ganz ruhige Hochzeit gehabt. Niemand von Marias Verwandtschaft war dabei gewesen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie ihren Großvater verloren, an dem sie sehr hing. Die Großmutter war zurzeit nicht fähig zu verreisen. Der Mutter, die seit dem Anfang des Sommers in ihrer eigenen wirren Welt, bestehend aus Vergangenheit, Phantasie und Medikamenten, lebte, ging es ebenfalls nicht gut. Und Tante Henrike war bei ihnen, um sie zu pflegen. Die übrigen Verwandten in Mühltal hatte sie gar nicht eingeladen. Martins Vater war vor drei Jahren bei einem Unfall umgekommen, seine Mutter bereits seit vielen Jahren tot.
Trauzeugen waren Vincent und Martins Sohn Daniel gewesen. Daniel war 20 Jahre alt und befand sich noch im Medizinstudium. Er sah Martin unglaublich ähnlich, auch im Wesen glichen sie einander.
Fast wie eine jüngere Ausgabe Martins, hatte sie staunend gedacht, als sie einander kennen lernten. Daniel war nur 6 Jahre jünger als Maria.
»Mein Stiefsohn Daniel,« hatte sie gesagt, und sie hatten gelacht. Aber merkwürdig war es schon, als dieser »junge Martin« da vor ihr stand.
Maria war ein wunderlicher Gedanke gekommen, als sie die beiden Männer so nebeneinander sah. Sie wusste inzwischen, wie sehr es Martin zu schaffen machte, dass er 15 Jahre älter als Maria war. Diese heimliche Angst, die ihn immer wieder beschlich, Maria könnte sich irgendwann einem Jüngeren zuwenden! Und nun diese jüngere Ausgabe seiner selbst! Ob ihm da wohl der Gedanke gekommen war, Maria könnte in Daniel etwas anderes als Martins Sohn sehen?
Was geht mir da für ein Unsinn durch den Kopf, rief sie sich zur Ordnung.
Maria erhob sich von ihrem Liegestuhl, nahm die Sonnenbrille ab und wischte sich die schweißnasse Stirn. Langsam wanderte sie über den Rasen zum See hinunter, das schwarze lange Haar zu einem Knoten windend. In einer der Taschen ihres dünnen Sommerkleids suchte sie nach ihren Haarnadeln, mit denen sie den schweren Knoten im Nacken zusammensteckte.
Dieses lange Haar, voll und dicht, war ihr in dieser Hitze eine rechte Last. Wie gern hätte sie es geschnitten! Sie stellte sich eine duftige kurze Lockenpracht vor, die ihr nur bis auf die Schultern reichte, so dass sie herum schwang, wenn sie den Kopf schnell drehte. Ach, das müsste herrlich und praktisch sein! Aber Martin wollte nicht, dass sie ihr Haar veränderte. Es sollte weder lockig, noch kurz sein. Er liebte es so, wie es war.
Maria seufzte. Sie sehnte sich nach ihm. Aber er konnte erst am Wochenende wieder nach Seefeld kommen. Sie hatten nur eine Woche Hochzeitsurlaub gehabt. Eine schöne Woche, aber sie verging so schnell! Sie waren nicht fort gefahren. Ihr neues Heim in Seefeld gefiel ihnen so gut, und es war noch ganz neu für sie.
Da war der See, in dem sie schwimmen konnten, der wunderschöne große Garten. Andere Menschen brauchten sie im Augenblick nicht. Nur Vincent war da, mit dem sie mitunter in den Abendstunden auf der Terrasse oder auf seiner hölzernen Veranda gesessen hatten.
Und im Übrigen war es ihnen im Augenblick ganz gleich, wo sie waren, wichtig war nur, dass sie zusammen waren. Eine Woche ganz für sich – das hatten sie noch nie gehabt. Und es war ein einzigartiges Erlebnis für sie gewesen.
Maria brauchte nur Martin, und Martin wollte nur Maria! Niemand sonst zählte in dieser Woche für sie!
Noch gelang es Martin, die Schatten der Vergangenheit, die Maria zuweilen einzuholen drohten, rechtzeitig zu vertreiben. Mitunter sorgte er sich um sie, wie es wohl werden würde, wenn er fort musste. Wie überhaupt die Zukunft sich entwickeln würde!
Dann hatte er zurück ins Gesundheitsamt fahren müssen. Viel Arbeit wartete auf ihn.
Maria hatte ihre Stellung dort gekündigt. Sie wollte nicht zurück, weder zu ihrer Arbeit, noch in ihr altes Haus, in dem Tante Henrike nun allein lebte.
Sie wollte in Seefeld bleiben. Sehr zum Ärger Martins! Er wollte sie so gern bei sich haben, in seinem Haus in Heydholm.
Zum Ende des Jahres würde er ganz hierher ziehen. Er hatte seine Stellung gekündigt trotz der Bedenken und Einwände Marias. Wie konnte er so leichtherzig alles aufgeben, was er sich in den letzten Jahren aufgebaut hatte! Erst vor kurzem war er Obermedizinalrat und Amtsarzt geworden.
Es hatte eine heftige Diskussion gegeben, aber sein Entschluss stand fest.
Maria stand wieder jener Tag vor Augen, als sie über die gemeinsame Zukunft gesprochen hatten. Es war sehr hitzig dabei zugegangen.
Martin hatte vor ihr gestanden, beide Hände in den Hosentaschen, weil er sich einbildete, dann hätte er sich besser in der Gewalt. Was ein großer Irrtum war! Mit gerunzelter Stirn und wütenden Augen hatte er sie angefunkelt. Anfangs war seine Stimme noch recht gemäßigt gewesen, dann aber immer lauter und ärgerlicher geworden, bis sie schließlich nur noch als Gebrüll zu bezeichnen war.
»Was, zum Teufel, willst du eigentlich?« hatte er geschrien.
»Du willst nicht mit mir in meinem Haus in Heydholm wohnen! Du willst hier bleiben. Gut, das kann ich zur Not noch verstehen. Aber wie stellst du dir den Rest vor? Ich bin ja bereit, in Seefeld neu anzufangen und mit dir hier zu leben! Aber das passt dir scheinbar auch nicht. Verdammt, sag mir doch genau, was du eigentlich willst! Manchmal kommt es mir vor, als wolltest du hier in diesem Haus ganz allein leben. Sag mal, liebst du mich überhaupt? Mir scheint, du kannst ganz gut auf mich verzichten!«
Maria sah in an, wie er da so finster, nahezu drohend vor ihr stand. Und eine Nacht stieg in ihrer Erinnerung auf. Eine Nacht, in der sie sich geschworen hatte, sich nicht mehr aus der Ruhe bringen zu lassen durch seinen Jähzorn und seine Ungeduld.
In dieser Nacht hatte sie geglaubt, mit sich und ihrem Leben am Ende angelangt zu sein, so verzweifelt und hoffnungslos war sie gewesen. Martin hatte während langer, schrecklicher Stunden bei ihr gesessen, sie in den Armen gehalten, ihr mit unendlicher Geduld Hoffnung und neuen Lebensmut gegeben.
Damals hatte sie gedacht: Sollte er jemals wieder überkochen und herumbrüllen, so will ich mich an diese Nacht erinnern! An seine Geduld, seine Fürsorge, sein Verständnis, seine Liebe!
Aber ach, es war gar nicht so leicht mit ihm, wenn dieser unselige Jähzorn ihn einmal gepackt hatte!
Während er noch immer auf Maria ein schrie, war ihr ein Gedanke gekommen!
Sie trat auf ihn zu, ganz nah stand sie vor ihm, sah ihm in seine dunklen, wütenden Augen. Dann legte sie ihm beide Arme um den Hals.
»Verzeih mir meine Querköpfigkeit. Es tut mir leid. Es ist doch nur, weil es mir so zu schaffen macht, dass du so viel für mich tust. Ich habe das Gefühl, du gibst immer und ich nehme stets nur! Dabei liebe ich dich wirklich.«
Maria sah Überraschung und Ungläubigkeit in seinen Augen. So hatte sie bisher nie auf seinen Jähzorn reagiert, besänftigend und mit zärtlicher Umarmung. Es kam ohnehin nicht oft vor, dass sie auf ihn zuging oder zu ihm von Liebe sprach. Fast immer war er es, der sie in die Arme nahm. Das war ihm oft ein Dorn im Auge, aber er hatte sich vorgenommen, geduldig zu sein.
Und manchmal gelingt es mir sogar, hatte er zynisch gedacht.
Tatsache war, dass er Maria nicht zwingen wollte oder konnte. Sie hatte Schreckliches durchgemacht in der Vergangenheit. Es war noch gar nicht so lange her. Wenn er es recht bedachte, wunderte er sich überhaupt, dass sie sich psychisch schon wieder soweit gefangen hatte.
Nun aber stand sie vor ihm, sah ihn an mit ihren grünen Augen und sagte ihm das!
Auf der Stelle war all sein Zorn verraucht. Stattdessen wollte sich das schlechte Gewissen melden ob seines Ausbruchs, aber auch das verflüchtigte sich sofort, als er sie im Arm hielt und ihre Nähe spürte.
Danach hatte Maria sich vorgenommen, ihn gewähren zu lassen. Sollte er seine Zukunft so planen, wie er wollte. Sie würde ihm nicht mehr hineinreden!
Es war schon recht mutig, was er da im Sinn hatte. Ihr kam es wie ein großes Opfer vor, das er ihr zuliebe brachte.
So hatte er also seine Kündigung eingereicht, zum maßlosen Erstaunen des gesamten Teams im Gesundheitsamt. Niemand begriff es. Dann hatte er Kontakte geknüpft für seine neue Zukunft in Seefeld.
»Denkst du nicht mehr an unseren Traum von einer Praxis auf dem Lande? Nun ja, Seefeld ist ja so etwas wie auf dem Lande,« hatte er gesagt.
Es schien, als könnten seine Pläne Wirklichkeit werden. Durch Beziehungen hatte er einen Arzt kennengelernt, der eine Praxis in der Lindenallee in Seefeld hatte und bald in den Ruhestand treten wollte. Martin könnte sich einarbeiten, sobald es möglich war, um dann später sein Nachfolger zu werden.
Blieb noch Martins Haus, das er zu verkaufen gedachte. Einen Teil des Geldes wollte er für Daniel anlegen. Die restliche Summe, oder ein Teil davon, würde für eine neue Praxis verwandt werden. Martin hatte nicht vor, lange Zeit in den Räumen des alten Arztes zu praktizieren. Er wollte die neue Praxis an das Haus im Kastanienweg, Marias Haus, das sie in diesem Sommer von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatte, anbauen.
So schien also alles aufs Beste geplant und geregelt, und es sah aus, als sollte es so klappen, wie Martin es sich vorstellte.
Da war zunächst nur eine Sache noch, die ihn ärgerte. Bis zu seiner Amtsaufgabe konnte er nur zum Wochenende bei Maria in Seefeld sein. Es war zu weit, um täglich hin und her zu fahren, 200 km. Zwar kam es vor, dass er es trotzdem tat, wenn er es möglich machen konnte, aber es war eine zusätzliche Anstrengung, zumal er oft im Stau stecken blieb und erst spät abends bei Maria ankam. Dann hieß es am nächsten Morgen wieder sehr früh aufstehen, um rechtzeitig im Amt zu sein.
Martin hatte lange auf Maria eingeredet, doch während dieser Zeit bei ihm in seinem Haus in Heydholm zu leben, aber Maria hatte sich nicht dazu entschließen können. Auch bei einigen dieser immer wiederkehrenden Debatten war er sehr zornig geworden.
»Verdammt noch mal, erzähl mir doch nicht, dass du mich liebst, wenn es dir kaum etwas ausmacht, die ganze Woche von mir getrennt zu sein!« hatte er getobt.
Schließlich hatten sie einen Kompromiss geschlossen. Maria war bereit, einen Teil der Zeit bis zum Jahresende in Heydholm zu wohnen.
Und doch! Der Gedanke, dass er sie dazu erst mühsam hatte überreden müssen, beschäftigte und beunruhigte ihn! War es ihr nicht so wichtig, bei ihm zu sein?
Was für einen Grund gab es dafür, dass sie einen Teil der Woche lieber allein in Seefeld blieb? Was zum Teufel hatte das zu bedeuten?
♦♦♦
Es gab einen Grund dafür, dass Maria eine Weile allein sein wollte.
Es ging ihr zeitweise gar nicht gut. Das hatte nichts mit der Schwangerschaft zu tun.
Ach, dachte sie, wenn es das doch wäre!
Es war aber immer noch die Vergangenheit, die ihr keine Ruhe ließ! Es waren nicht mehr die alten Albträume, die sie heimsuchten. Es war etwas anderes: Sie litt unter Schuldgefühlen!
Clemens Cornelius Tod war es, ihre unselige Tat, ihr Mord!
Ich bin eine Mörderin, dachte sie dann.
Es nützte ihr nicht, dass Martin und Vincent zu ihr von Notwehr gesprochen hatten. Sagten sie das nicht nur, um sie zu beruhigen? Und selbst, wenn es ihre ehrliche Meinung war, für Maria war es anders!
Tatsache war doch, dass sie ihn kaltblütig und bei klarem Verstand erschlagen hatte! Noch dazu, als er wehrlos, halb betrunken, im Wasser kauerte.
Mochte sie sich noch so oft sagen: Er hatte es verdient, tausendfach! Er hätte mich nie, niemals in Ruhe gelassen! Vielleicht hätte sonst er mich eines Tages umgebracht, oder Schlimmeres! Mich auf irgendeine Weise zerstört. Denn so wäre es gekommen!
Wäre es das? meldete sich dann die andere Stimme. Hätte ich nicht andere Möglichkeiten gehabt, ihm zu entkommen, da ich doch nahezu erwachsen war?
Es half alles nichts, sie konnte diesen Gedanken, dieses Gefühl, nicht loswerden: Ich bin seine Mörderin!
Dann kamen andere Träume! Träume, in denen sie davon rannte, nicht jenen Stein packte und auf ihn einschlug!
In diesen Träumen rannte sie fort, versteckte sich, plante ein neues Leben. Ein Leben weit weg von ihm, wo er sie nicht finden konnte! Und wurde nicht seine Mörderin!
Und dann: Mein ungeborenes Kind wird eine Mörderin zur Mutter haben!
So ist er in unserem Krieg denn doch Sieger geblieben, Clemens Cornelius! dachte Maria voller Bitterkeit und Schmerz und Trauer. Schmerz und Trauer um Martins willen! Diese unversehrte Zukunft, die sie haben könnten, Glück, Freude, Zufriedenheit! All das war ihr genommen! Und sie würde es Martin nehmen, wenn sie es nicht vor ihm verbergen konnte! Vielleicht wird es anders, wenn das Kind da ist, sagte sie sich manchmal.
Dann bin ich sicher nicht mehr so anfällig für all diese Gedanken, die mich nicht loslassen. Ich werde abgelenkt sein, denn ich habe an mein Kind zu denken! Und vielleicht kann ich all das irgendwann vergessen!
Aber sie glaubte nicht daran. Hoffnungslosigkeit überfiel sie, wenn sie an diesem Punkt ihrer Überlegungen angelangt war.
Warum sollte es anders werden? Von allein wurde gar nichts anders! Man musste immer selbst etwas tun!
♦♦♦
Vincent musterte Maria besorgt. Wie sie da vor ihm saß, auf der hölzernen Bank im Licht des herannahenden Abends, wirkte sie abgespannt und erschöpft.
Insekten umschwirrten sie, der Duft nach Heu und hochsommerlicher warmer Erde lag in der Luft. Von hier aus konnte man auf den kleinen Teich blicken, den Vincent vor Jahren auf diesem Teil des Grundstücks angelegt hatte. Inzwischen war er umwuchert von allen möglichen Pflanzen. Weiden ließen ihre weichen, wedelartigen Zweige ins Wasser hängen, die Teichbinsen standen bewegungslos, untrennbar von ihrem Spiegelbild.
Kein Lüftchen regte sich. Die Wasserfläche des Teichs lag still und schimmernd, kräuselte sich nur hier und dort zu sanften Kreisen, wenn Fische auftauchten, um nach den abendlichen Mücken zu haschen.
Ein anderer Teich tauchte im Geist vor ihren Augen auf und es schauderte sie. Sollte sie denn nie, niemals Ruhe haben vor der Vergangenheit?
Vincent war ihren Blicken gefolgt und hatte ihre Gedanken erraten. Sie tat ihm von Herzen leid. Wenn er ihr doch helfen könnte! In der kurzen Zeit, da sie sich kannten, war sie ihm wie eine Tochter, die er nie gehabt hatte, ans Herz gewachsen.
Jetzt stand er auf und trat neben sie. Er legte seine derbe, raue Gärtnerhand auf ihre Schulter.
»Irgendwann wird es besser! Die Zeit heilt alle Wunden, glaub mir. Das sind nicht nur Worte, es ist wahr. Ich habe es selbst oft genug erlebt. Und andere auch,« tröstete er sie mit seiner warmen, ruhigen Stimme.
Verzagt blickte Maria zu ihm auf.
»Ja, vielleicht. Aber ich glaube, das gilt nicht für alles. Vielleicht wirklich nur für Wunden, nicht für Schuldgefühle.«
Vincent seufzte. Was sollte er ihr sagen, was nicht schon gesagt worden wäre?
»Du kannst das, was du getan hast, nicht für dich als Notwehr akzeptieren; das ist es, nicht wahr?«
Maria nickte stumm.
»Was soll ich dir sagen, mein Kind? Ich kann dir meine Meinung und die deines Mannes nicht einpflanzen. Denn für uns war es das, nämlich Notwehr. Wenn du es anders empfindest – du weißt, wir haben wieder und wieder darüber geredet. In vielen Stunden das grauenhafte Geschehen von allen Seiten beleuchtet. Es schien dir wohl alles einzuleuchten – vom Verstand her. Aber es scheint dir nicht geholfen zu haben.«
»Nein,« sagte sie müde. »Es hat mir nicht geholfen. Vom Kopf her könnte es vielleicht noch klappen. Da könnte ich mir diese Theorie der Notwehr einreden, aber mein Gefühl sagt mir was anderes.«
Maria setzte sich ruckartig in ihrem Stuhl auf. Kerzengerade und angespannt saß sie da und starrte auf den Teich.
»Es ist wie ein Karussell – in meinem Kopf.
Sie wiederholen sich – diese Bilder. Wieder und wieder. Ich stehe dort an jenem Teich, ich höre ihn hinter mir, seine Schritte, seine Stimme. Diese widerlich schmeichelnde Stimme!
Und dann packt er mich! Ich stoße ihn ins Wasser. Wie konnte ich das überhaupt schaffen – ihn ins Wasser stoßen. Ich muss wahnsinnig wütend gewesen sein. Oder ist er gestolpert? Ich weiß es nicht mehr. Sicher, er hatte etwas getrunken, aber doch nicht viel – und er ist – er war doch viel stärker als ich. Ein Mann eben. Und doch schaffte ich es, ihn in den Teich zu stoßen. Er muss sehr überrascht gewesen sein. Und dann – dann dieser Stein. Er lag im Schilf, und ich dachte nur: du musst etwas tun, bevor er aus dem Teich herauskommt! Ja, und dann packte ich den Stein und – und schlug ihm den auf den Kopf.«
Ihre Stimme war fast nur noch ein Flüstern, ihr Blick wie irre, als sähe sie all das noch einmal vor ihren Augen in diesem Moment.
»Er sah mich an, mit diesem ungläubigen, zweifelnden Blick. Und dann war da nur noch Angst und Grauen in seinen Augen. Und ich hörte immerzu diese Melodie.«
Sie schwieg und sah zu Vincent auf.
»Es ist alles so sonderbar. Weißt du, manchmal wenn ich allein bin, wenn Martin nicht bei mir ist wache ich in der Nacht auf von seiner Stimme. Ich höre das Flüstern! Immer wieder! Meine kleine Marie! Meine kleine Marie.
Früher, wenn ich mich an diese Stimme und die Worte erinnerte, habe ich immer geglaubt, er habe mich geliebt. Mich, sein kleines Mädchen! Und es war immer so schön, an ihn als liebevollen Vater denken zu können.«
Sie lachte bitter auf.
»Na ja, das hat er ja auch! Mich geliebt! Als kleines Mädchen! Und als großes Mädchen auch!«
Vincent hatte seinen Stuhl nahe an Maria heran gerückt und nahm beruhigend ihre Hände in die seinen. Er wusste keine Worte für sie, die ihr helfen könnten. So schwieg er. Sie aber fuhr fort, als müsste sie all diese Dinge, die Erinnerungen, ihre Schreckensbilder der Vergangenheit, wieder und wieder hervorzerren, sie in Worte fassen, sie immer wieder neu aufleben lassen, wie unter einem Zwang.
Fast war es, als wollte sie verhindern, dass die Erinnerung daran verblasste! Als wollte sie all das, was geschehen war, mit aller Macht in ihrem Geist am Leben erhalten, so lebendig wie es eben möglich war.
Wollte sie sich etwa selbst damit quälen, unbewusst vielleicht? Als Buße für ihre Tat, mit der sie nicht leben konnte?
Vincent seufzte, während er unbeholfen ihren Arm tätschelte.
Armes Kind! Sie hatte schon einen Packen zu tragen!
Da hallte es in ihm nach: Als Buße für ihre Tat, mit der sie nicht leben konnte?
Vincent fuhr ein Schreck in die Glieder. Er richtete sich kerzengerade auf und drückte ihre feuchten Hände.
»Maria,« sagte er drängend und angstvoll. »Du musst es vergessen! Quäle dich doch nicht so! Denk an dein Kind. Und auch an Martin!«
Plötzlich strömten ihr die Tränen übers Gesicht, als hätten sie hinter ihrer Stirn gelauert und nur auf diese Worte gewartet.
»Das tu ich ja! Tag und Nacht versuche ich es. Aber das gerade ist ja das Schlimmste! Wenn ich allein wäre – ach Gott, ich würde mir nicht halb so viele Gedanken machen. Ich würde schon irgendwie zurechtkommen. Ich hab mich früher immer irgendwie hindurch gewunden. Zwar hat mir das Leben nicht gerade viel Spaß gemacht, aber ich kannte es auch nicht anders.
Nun aber ist Martin da, das Kind. Und nun geht es eben nicht nur um mich. Selbst wenn ich Martin verlassen würde, so wäre da immer noch das Kind!«
»Martin verlassen? Aber Maria, was fällt dir ein! Wem soll das nützen – mal abgesehen von dem Kind. Glaubst du denn, er würde wollen, dass du ihn verlässt?«
Maria entzog ihm ihre Hände.
»Er wäre ohne mich besser dran,« sagte sie mit harter Stimme.
»In den Augenblicken, wenn Martin bei mir ist, kann ich all das Gewesene vergessen. Für eine Weile! Und ich habe Stunden erlebt, in denen ich glücklich war! Aber das sind immer nur Augenblicke, allenfalls Stunden. Wenn wir täglich zusammen sein werden, könnte ich ihm nicht verheimlichen, wie ich mich so oft fühle. All das, was in mir ist, was mir durch den Kopf geht – ich könnte es nicht vor ihm verbergen. Was soll das für ein Leben sein – für ihn neben mir!« Sie schwieg.
»Verdammt!« fuhr sie plötzlich auf.
»Mein Leben lang muss ich so einen Wahnsinn mit mir herumschleppen! Früher diese anderen Geschichten, als ich meine ganze Vergangenheit noch nicht kannte. Als ich diese verrückten »Zustände« hatte, Anfälle, Albträume, Gedächtnisausfälle! Und jetzt – dies! Neue Albträume – und Schlimmeres! Ich möchte Martin nicht mit mir und meinen Problemen belasten! Er gibt sich so viel Mühe mit mir. Aber ich weiß genau, dass er endlich ein normales Leben mit einer normalen Frau, mit einer intakten Familie, haben möchte. Und er hat es auch verdient. Nur – das wird mit mir nie möglich sein. Ich dachte einmal, ich könnte für ihn eine normale Frau sein, aber das kann ich nicht.«
Sie schluchzte auf und begann erneut zu weinen.
»Ach Vincent, all eure Tröstungsversuche, sie sind gut gemeint. Ich weiß es ja. Aber nichts kann etwas an dem ändern, was geschehen ist.«
»Nein, das kann es nicht,« sagte Vincent mit fester Stimme.
»Das wissen wir ja auch, Martin und ich. Wir können nichts an den Tatsachen ändern, aber wir haben doch gehofft, dass du versuchen könntest, an deiner Einstellung zu den Dingen etwas zu ändern. Darum geht es doch, Maria!«
Ruhiger fuhr er fort: »Maria, ich habe noch sehr gut jene Nacht in Erinnerung, als Martin mit all seiner Kraft versuchte, dir seine Sicht des Ganzen klarzumachen. Er hat sich so eindringlich darum bemüht, dir alles im ganzen Zusammenhang darzustellen. Deine Vergangenheit, dein ganzes Leben und den Tod deines Vaters, vielmehr Stiefvaters!
War dieses Ende nicht die logische Folge all dessen, was vorher war? Würde es um jemand anderen gehen und du hörtest diese Geschichte als Außenstehender, so würdest du es anders sehen, stimmt’s? Dann hättest du Verständnis, Mitgefühl und auch eine Entschuldigung.
Aber mit dir selbst hast du keine Nachsicht, kein Mitleid und erst recht kein Verzeihen! Warum bist du so hart und gnadenlos mit dir? So gnadenlos und unbarmherzig ist Gott nicht! Warum willst und kannst du dir selbst nicht vergeben, Maria! Du musst es versuchen, denn euer Leben fängt doch erst an!«
Maria wischte sich das Gesicht und zuckte mit den Schultern.
»Lass nur, Vincent! Siehst du, das ist ja gerade das Dilemma! Vom Kopf her weiß ich das alles. Alles!
Da ist auch immer wieder diese Stimme in mir, die sagt: Clemens Cornelius hat das bekommen, was er verdiente! Es war in gewissem Sinne Notwehr! Denn wenn ich ihn am Leben gelassen hätte, was wäre dann geschehen? Hätte er dann mich irgendwann erwischt und zerstört, getötet – was auch immer!
Aber dann, Vincent – dann ist wieder mein Gefühl da. Und das sagt: Es war Abrechnung und Rache! Es hätte eine andere Möglichkeit gegeben, denn ich war kein Kind mehr! Ich hätte einen anderen Weg finden müssen, ihm zu entkommen! Nicht durch Mord!«
Sie war aufgestanden und auf Vincent zu getreten. Herzlich drückte sie seinen Arm.
»Mir selbst verzeihen? Nein, das kann ich nicht. Noch nicht! Vielleicht eines Tages. Wer weiß? Und was Gott und seine Barmherzigkeit betrifft! Wo war er in all den Jahren, als ich ihn gebraucht hätte? Er hatte nicht einmal eine richtige Mutter für mich! Entweder gibt es keinen Gott oder er ist nicht gütig oder aber nicht allmächtig!«
Da war sie wieder, diese harte, zynische Stimme, die Vincent direkt einen Schauer über den Rücken jagte. Und was sie plötzlich für Reden führte! Er bekam Angst um sie. Maria blickte in seine erschrockenen, alten Augen.
»Sorg dich nicht um mich, Vincent! Ich bin hart im Nehmen.« Auf einmal veränderte sich ihre Stimme, wurde ängstlich und bittend.
»Sag Martin nichts von dem, was ich dir anvertraut habe! Bitte!«
Vincent antwortete nicht. Das konnte und wollte er ihr nicht versprechen.
Da wandte sie sich ab und ging langsam über den Rasen auf ihr Haus zu. Nach ein paar Schritten drehte sie sich noch einmal zu ihm herum.
Mit tieftraurigem Blick sah sie ihn an.
»Weißt du, was ich manchmal befürchte? Dass wir unsere schönste Zeit schon hinter uns haben, Martin und ich.«
♦♦♦
Fünfzig Jahre braucht das Licht der Sterne, um uns hier auf der Erde zu erreichen!
Das, was wir am nächtlichen Himmel erblicken, ist nichts weiter als eine schier endlose Anzahl aneinandergereihter Vergangenheiten.
Maria betrat ihr Haus, in dem es jetzt angenehm kühl war.
Martin würde bald anrufen, und sie wappnete sich, seiner Stimme am Telefon fröhlich und unbeschwert zu begegnen. Er hatte soviel um die Ohren und sollte sich nicht zusätzlich um sie sorgen!
Sie setzte sich an ihr Klavier. Das war es, was ihr aufgestörtes Gemüt ein wenig zu besänftigen vermochte: Die Musik!
Und die Arbeit in ihrer Werkstatt!
Ein dunkles, seltsames Verlangen, wie eine Art Hunger, war in ihr erwacht, aus irgendwelchen Tiefen ihres Wesens quoll es empor, die ihr bisher fremd gewesen waren. Das Verlangen, mit ihren Händen etwas zu formen, zu schaffen. Vielleicht nicht nur Schönheit, auch anderes, etwas aus dem Leben in Ton zu formen, dem Ton Leben zu geben.
Sie hatte mit Kursen in Bildhauerei begonnen. Erst einmal nur um herauszufinden, ob sie geeignet dafür war, ob sie Talent hatte. Dann wollte sie weiter sehen! Vielleicht eine Fachschule für Bildhauerei besuchen. Oder bei einem Bildhauer in die Lehre gehen. Vielleicht gab es da eine Möglichkeit. Aber das musste warten bis nach der Geburt des Kindes.
Manchmal war es Maria schwer gefallen, an den heißen Vormittagsstunden zu ihrem Kursus zu gehen und aufmerksam dem Unterricht beizuwohnen. Übelkeit, Hitze und ein lähmendes Gefühl der Erschöpfung hatten ihr sehr zugesetzt, aber sie hatte nicht aufgegeben. Sie brauchte Ablenkung.
Oft stand sie dann in ihrer Werkstatt und arbeitete. Dabei konnte es geschehen, dass sie alles um sich her vergaß. Nichts anderes schien mehr zu zählen, während ihre Hände, ihre Fingerspitzen, jenes Eigenleben entwickelten, das sie erst hier in diesem Hause kennengelernt hatte. In dem Haus ihres richtigen Vaters, Bernhard Sarnow, der Bildhauer gewesen war. Und Musiker.
Dann habe ich das von ihm mitbekommen, dachte Maria. Sie war sehr froh darüber – sie konnte dabei vergessen!
Maria lag in ihrem rauchblau und violetten Himmelbett, über das Vincent anfangs schmunzelnd geäußert hatte, darin würde er Albträume bekommen.
Was hatte Martin eigentlich zu diesem Bett gesagt, als er es zum ersten Male sah?
»Meine kleine Romantikerin« ganz ernst, aber seine Augen hatten gelacht.
»So gnadenlos und unbarmherzig ist Gott nicht!« Das waren Vincents Worte gewesen.
Maria wälzte diesen Satz in ihrem Geist hin und her.
Es nützt alles nichts, dachte sie, das alles sind für mich nur Worte. Worte, die an mein Ohr und in mein Gehirn dringen, nicht aber in meine Seele.
Was ist nun mit meiner Seele, grübelte sie weiter. Was will sie? Geht es um Schuld und Strafe, um Gerechtigkeit, Reue und Buße?
Das Wort Reue blieb in ihrem Geist haften.
Aber ich bereue eigentlich ja gar nichts, dachte sie erstaunt und erschrocken.
Es tut mir nicht leid um Clemens Cornelius. Nicht dass er tot ist, nicht, dass ich ihn erschlagen habe!
Was aber ist es dann?
Es ist Schuld! Schuldgefühle plagten sie, so war es doch, oder?
Aber wenn es mir nicht leid tut, wie kann ich dann Schuldgefühle haben?
Maria fasste sich an den Kopf. Ein plötzliches Hämmern in den Schläfen kündigte sich an.
Wie ist das mit dieser Schuld, wenn keine Reue da ist?
Sie zermarterte sich das Hirn, sagte die Worte vor sich her: Schuld, Reue, Buße, solange bis sie jeden Sinn für sie verloren.
Wie kann das alles sein? Da muss doch etwas anderes dahinterstecken?
Es kann doch nicht einfach dieser irgendwann in der Kinderzeit eingepflanzte Gedanke sein: Das tut man nicht oder das ist verboten oder das ist eine Sünde.
Will ich also eine Strafe, obwohl ich keine Reue empfinde? Einfach eine Bestrafung für eine Tat, die gesetzeswidrig war?
Und hätte ich dann diese Strafe verbüßt – vielleicht jahrelanges Gefängnis – und die Menschen würden mir sagen: Du hast deine Schuld verbüßt – wäre ich dann frei? Frei von Schuld, weil ich im Gefängnis saß, obwohl keine Reue da war?
Maria schwirrte der Kopf. Sie stand aus ihrem Bett auf und ging ins Badezimmer. Das Wasser war kühl und frisch, sie trank es in langsamen Schlucken, aber sie fühlte sich nicht besser. Sie griff nach ihrem Morgenrock und trat auf den Balkon hinaus. Es war ein breiter, schöner Balkon, von Wein und gelben Rosen umrankt. Maria blickte zum See hinunter. Von hier oben sah er immer ganz nah aus.
Als sie das erste Mal hier gestanden hatte, damals nach dem Tode des Vaters, hatte sie gedacht: Es ist, als könnte man von hier oben gleich hinein springen.
Es war so schön damals, dachte sie inbrünstig.
Damals war ich noch keine Mörderin, schoss es ihr durch den wirren den Kopf.
Weil ich es noch nicht wusste, sagte eine kalte Stimme.
Natürlich, weil ich es nicht wusste! Ich bin eine Mörderin seit meinem 17. Lebensjahr. Aber ich wusste es nicht! Ich habe all meine Erinnerungen zurückbekommen, und der Preis dafür ist das Wissen, eine Mörderin zu sein!
Ach Gott, könnte ich das doch wieder vergessen! Um jeden Preis?
Sie dachte an Martin.
Was hatte er am Telefon gesagt?
Maria rief sich jedes seiner Worte ins Gedächtnis, zwang seine warme, liebevolle Stimme in ihren Kopf, so dass es war, als hörte sie ihn hier und jetzt:
»Maria, mein Liebling, wie geht es dir? Du klingst so niedergeschlagen, was ist los? Geht es dir nicht gut? Soll ich kommen? Ich könnte gleich losfahren, dann bin ich um 11 Uhr bei dir!«
Aber Maria hatte nein gesagt. Ihr gehe es gut, es sei nur die Hitze, die ständige Übelkeit und Erschöpfung, die ihr zu schaffen machten. Und sie freue sich auf ihn, wenn er in drei Tagen zu ihr käme, am Wochenende.
Scheinbar hatte Maria ihn beruhigen können, denn er drang nicht weiter in sie. Er schien selbst sehr müde und abgespannt, in den letzten Tagen hatte er wieder Notdienst und Vertretungen machen müssen.
Wer weiß, sonst hätte Maria vielleicht doch gesagt: Ach ja, bitte komm! Komm, so schnell du kannst.
♦♦♦
Maria wanderte am See entlang. Es war nicht ganz so heiß heute, und sie hatte den Vorsatz gefasst, sich mehr Bewegung zu verschaffen. Sie musste unbedingt mehr für ihre Gesundheit und das Wohlergehen ihres Kindes tun.
Ich darf mich nicht so hängen lassen, dachte sie trübe. Wie schön wäre es, wenn Martin jetzt hier neben ihr ginge!
Nächste Woche fahre ich mit und wohne mit ihm in seinem Haus in Heydholm, beschloss sie.
Was aber werde ich dort anfangen den ganzen Tag ohne ihn?
Ich könnte Tante Henrike besuchen, vielleicht die Winkelmanns und die eine oder andere Freundin von früher. Das würde mich ablenken. Ich könnte für ihn kochen, und abends würden wir zusammen auf seiner Terrasse sitzen. Und in der Nacht wäre ich nicht so allein!
Dieser Gedanke beflügelte sie geradezu.
Ja, ich muss etwas tun, etwas außerhalb meines Hauses. Musik und Bildhauerei sind ja ganz schön, aber ich muss mal aus dem Haus! Ich muss etwas tun, um diesen endlosen Grübeleien zu entgehen.
Maria ließ ihren Blick über halb vertrocknete Wiesen und abgeerntete Felder schweifen.
Der Sommer ging zu Ende! Obwohl es noch so warm war, wirkte die Natur um sie herum schon müde und welk, als sei der Herbst dem Sommer bereits auf den Fersen.
Auf dem Rückweg zum Haus kam Maria an der kleinen Kapelle vorbei, die in der Nähe ihres Hauses auf ihrem Hügel stand.
Ohne zu überlegen, stieg sie die sandige Anhöhe hinauf, stand einen Moment vor der geschlossenen Tür. Dann schob sie kurzerhand die Tür auf und trat ein. Kühles Dämmerlicht umfing sie, und eine andächtige, besänftigende Stille. Niemand war darin.
Sie schloss die Tür hinter sich und ging die wenigen Schritte zu dem kleinen Altar nach vorn. Die Kapelle war wohl nur für den Gottesdienst bei Beerdigungen gedacht, denn nebenan lag der Friedhof von Seefeld.
Es roch nach Blumen, Erde und Holz.
Auf dem Altar stand ein Strauß aus weißen und roten Rosen, in einer Ecke in der Nähe des Altars ein hoher, brauner Krug mit grünen Zweigen.
Unwillkürlich wurde Maria an die kleine Kirche in Mühltal erinnert. An jenen heißen Tag, als sie den Großvater zu Grabe trugen.
Ich trug ihn nicht zu Grabe, dachte sie. Bis dahin habe ich es gar nicht geschafft!
Schon wollte der Kreislauf der schrecklichen Bilder in ihrem Kopf wieder einsetzen, da rief sie sich energisch zur Ordnung. All das verbannte sie aus ihrem Kopf.
Sie setzte sich vorn in die erste Bank und blickte sich um. Wie friedlich und still es war! Und wo war Gott? Ihr Blick fiel auf die geschnitzte hölzerne Christusfigur an der Wand. Wie traurig war sein Gesicht, wie demütig die Haltung seines Kopfes mit der dornigen Krone darauf!
Habe ich eigentlich jemals an Gott geglaubt? fragte sich Maria.
Aber ja, überlegte sie, ich habe doch als Kind gebetet. Was habe ich denn gebetet?
Lieber Herr Jesus, halte mir meinen Vater vom Leib? dachte sie grimmig.
Sie starrte immer noch auf den hölzernen Christus an der Wand, und ein Schluchzen stieg ihr in die Kehle.
Du wurdest auch von deinem Vater verlassen, dachte sie. Er ließ dich am Kreuz leiden und sterben für die Sünden der gesamten verkorksten Menschheit und sah dabei zu!
Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und wie blind schaute sie zu dem gequälten Christus auf.
Mit einem Schrei fuhr sie in die Höhe, als hinter ihr eine Stimme sprach:
»Kann ich Ihnen helfen, mein Kind? Wenn Sie Trost brauchen, so sind Sie am rechten Ort.«
Maria sah sich um, ein alter Pastor in seinem Talar stand neben der Bank, die Hände auf dem Rücken verschränkt, den weißhaarigen Kopf zu ihr niedergebeugt.
Maria wischte sich über die Augen, die Wangen, und stellte fest, dass ihr Gesicht nass von Tränen war.
»Sie haben jemanden verloren, der Ihnen nahe stand?« Die Stimme des alten Pastors klang sanft und teilnehmend. Als würde er für alles Leid der Welt Verständnis und Mitgefühl aufbringen, dachte Maria flüchtig.
Und dann ironisch: Vielleicht ist das auch nur seine Berufssprache!
Sie nickte.
»Ja, mein Großvater ist vor ein paar Wochen gestorben,« sagte sie. »Ich hing sehr an ihm.«
Der Alte setzte sich zu ihr in die Bank.
»Das tut mir leid. Aber ich denke doch, dann hat er sein Leben gehabt, nicht wahr? Und es war Zeit für ihn, zu gehen. Für ihn war es vielleicht der richtige Zeitpunkt, nur für die Zurückgebliebenen ist es immer zu früh.«
Er legte leicht seine blasse schmale Hand auf ihren Arm.
»So ist das nun einmal,« fuhr er fort. »Nichts ist für immer auf dieser Welt. Alles ist endlich! Wir alle sterben einmal. Abschied, Tod und Trauer gehören zum Leben dazu, so schwer wir das auch begreifen können. Und oft wollen wir es auch nicht, weil es uns wehtut. Aber es gibt ein Wiedersehen – eines Tages.«
Ein Wiedersehen! Oh Gott, das fehlte mir noch, dachte Maria grimmig.
Das wäre das Richtige, wenn sie Clemens eines Tages wiedersehen würde – wo auch immer! Vielleicht lauerte er dort schon auf sie, um zu beenden, was ihm hier im Leben nicht gelungen war! Um sie zu zerstören!
Aber das schafft er sogar noch hier auf Erden, dachte sie.
Er ist ja auf dem besten Wege dazu. Er wird mich schon noch klein kriegen! Denn diese Schuld, die mir so zu schaffen macht – das ist sein Vermächtnis!
So wird er also Sieger sein!
Plötzlich hörte sie sich selbst reden, fast erschrak sie über die eigene Stimme und deren Worte.
»Herr Pastor, Sie sagen, Christus ist für uns alle am Kreuz gestorben. Gilt das für jeden von uns? Auch für jene, die nicht an ihn glauben?«
»Ja, es gilt für uns alle,« war die ruhige Antwort.
»Und wie ist es mit den Sünden und der Schuld? Wenn er alle Sünden, alle Schuld der Menschheit auf sich genommen hat, sind wir dann frei? Frei von jeglicher Schuld? Auch wenn wir nicht glauben?«
»Ach, mein Kind, das mit dem Glauben – das ist so eine Sache. Ich denke mir, jeder Einzelne von uns kann einmal zweifeln, in bestimmten Lebenskrisen. Das ist nicht so eine schlimme Sache. Wir sind Menschen, wie hadern mit Gott, wir klagen ihn an, und wir zweifeln. Und irgendwann kommt ein Tag, da kehren wir zu ihm zurück.
Christus ist für jeden von uns am Kreuz gestorben. Er hat alle Sünden, die Schuld aller Menschen auf sich genommen. Es gibt eine Vergebung aller Sünden. Wenn wir den Willen zum Besseren haben und bereuen.«
Maria starrte ihn aus tränenblinden Augen an. Sie sah ihn kaum, es war so schummrig in der Kapelle, und ihr Kopf schmerzte. Aber seine Worte hatte sie gehört: Wenn wir bereuen!
Sie wollte fragen: Und wenn nicht? Aber sie brachte kein Wort heraus, die Stimme wollte ihr nicht gehorchen. Sie stand auf, langsam und schwerfällig, die Glieder waren ihr steif geworden. Sie sah den Pastor an, reichte ihm die Hand und drückte sie. Dann taumelte sie ohne ein Wort nach draußen.
»Gott segne Sie, mein Kind!« hörte sie den Alten sagen, und es klang in ihren Ohren, als wüsste er, dass es um sie nicht allzu gut bestellt war.
Helles Sonnenlicht blendete sie, als die schwere Holztür hinter ihr zuschlug.
Sofort stieg eine andere hölzerne Tür in ihrer Erinnerung auf: Jene Tür der Kirche in Mühltal, die ihr fast ins Kreuz schlug, als sie von der Beerdigung des Großvaters davon rannte.
Schweißüberströmt hetzte Maria den Hügel hinab. Sie lief, als hätte sie den Leibhaftigen auf den Fersen!
Erst vor ihrem Gartentor stoppte sie ihren Lauf. Ihr Herz schlug so stark wie jener Hammer hinter ihren Schläfen, als sie die Pforte aufschob. Sie presste beide Hände auf ihre Brust und versuchte ruhig zu atmen.
Ein Auto stand auf dem halbmondförmigen Kiesplatz in der Einfahrt. Maria starrte es an und begriff gar nicht, was sie sah. Plötzlich wurde die Haustür aufgerissen.
»Martin!«
Mit einem Satz war er bei ihr. Sie taumelte auf ihn zu und in seine Arme.
»Oh, Martin! Du bist da!« Wildes Schluchzen schüttelte sie, sie presste ihr Gesicht an seine Brust, sein weißes Hemd wurde durchnässt von ihrer Tränenflut.
Martin war ganz starr vor Schrecken. Er nahm Maria in die Arme und führte sie ins Haus. Im Wohnzimmer setzte er sich auf die Couch und hielt sie fest umschlungen.
»Mein Gott, Maria, was ist denn nur? Also hat mich mein Gefühl gestern Abend doch nicht getrogen. Irgendetwas ist passiert! Nun sag es mir, Maria. Jetzt bin ich ja da.«
Er redete beruhigend auf sie ein, drückte sie an sich, wischte ihr das Gesicht ab. Er zwang sich, ruhig und gelassen zu erscheinen, obwohl ihm ein dumpfes Angstgefühl im Nacken saß.
Was um Himmels willen war da wieder geschehen?
Nach einer Weile beruhigte sie sich. Müde saß sie da und seine Arme hielten sie immer noch. Maria wollte nicht, dass er sie los ließ.
»Halt mich ganz fest und bleib bei mir,« flüsterte sie.
Schließlich sagte sie mit sprödem Lachen: »Armer Martin, wie oft haben wir schon so gesessen! Ich ein Häufchen Unglück, am Boden zerstört! Und du als mein Tröster und Retter. Es muss dir doch nachgerade zum Halse heraus hängen.«
Martin runzelte die Stirn. Er schob sie von sich und stand auf. Maria sah die Zornesfalten auf seiner Stirn anschwellen. Finster blickte er auf sie herunter.
Ach, welch ein vertrauter und wohltuender Anblick!
»Verdammt! Maria, weich mir jetzt nicht aus und versuche auch nicht, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen! Deine seltsame Ironie oder was immer das sein mag, erscheint mir absolut nicht angebracht! Ich will jetzt wissen, was los ist. Und mach mir ja keinen Zirkus vor!«
Maria schaute zu ihm auf; sie sah seine düstere Miene, seine schwarzen, zusammengezogenen Brauen, seine geballten Fäuste in den Hosentaschen; und sie hörte seine Stimme und die große Sorge um sie darin. Und auf wundersame Weise war plötzlich alles gut!
Wie konnte ich nur so verzweifeln und in Panik geraten, fragte sie sich.
Sie wollte ihm nichts erklären müssen, sie wollte auch gar nichts mehr reden. Er sollte sie nur wieder in die Arme nehmen und ihr sagen, dass er sie liebte. Und dass sich daran nie, niemals etwas ändern würde, wie viel Schuld sie auch auf sich geladen hätte.
Martin musterte sie unsicher, wie sie da auf der Couch vor ihm kauerte. Was war nur mit ihr los? Sie sah so erschöpft und verweint aus, das Herz krampfte sich ihm zusammen.
»Maria, kannst du mir nicht sagen, was geschehen ist?«
»Gar nichts, Martin. Nichts ist geschehen. Ich habe in der letzten Nacht so schlecht geschlafen. Dabei kam ich ins Grübeln. Es ist einfach immer noch all das, was in der letzten Zeit passiert ist. All die grässlichen Bilder tauchten wieder auf. Dazu mein Zustand, der mir so zu schaffen macht. Diese Stimmungsschwankungen, die damit verbunden sind. Ich bin im Moment so labil und so leicht umzuwerfen!
Ach, eben alles zusammen. Und das Schlimmste war die Sehnsucht nach dir. Als wir miteinander sprachen, hätte ich am liebsten zu dir gesagt: Komm! Aber ich wusste ja, dass es dir zu viel würde, die Fahrt und…«
»Verdammt, Maria, hättest du es doch gesagt. Ach, ich bin so ein dämlicher Esel! Ich hätte es wissen müssen. Zum Kuckuck, ich ahnte es doch auch. Nein, ich wusste es! Und ich wollte, ich wollte tatsächlich kommen. Aber es wären uns nur vier Stunden geblieben. Dann hätte ich wieder wegfahren müssen. Trotzdem…«
Er fuhr sich mit den Händen durch die Haare.
»Lass doch, Martin. Es ist doch jetzt ganz egal. Du bist hier, und in der nächsten Woche komme ich mit und wohne bei dir in deinem Haus. Ich mag nicht mehr allein ohne dich sein.«
Maria schlang ihre Arme um ihn und hob ihr verweintes Gesicht zu ihm auf.
Er schob sie ein Stückchen von sich und sah sie an.
»Ist das dein Ernst? Mein Gott, wie schön, Maria! Endlich.«
Bevor er sie küsste, vergrub er sein Gesicht in ihrem Haar, das in einer wild verzottelten Mähne weit über ihre Schultern herab hing und an den Schläfen nass von Schweiß und Tränen war.
♦♦♦
Maria war beim Packen. Nicht viel, ein paar wenige Sachen zum Anziehen, Bücher, ihren Ton, Arbeitsmaterial, Zeichenblocks und dergleichen. Schließlich, das könnte sie auch in dem Haus in Heydholm tun! Und auch Klavier spielen, denn Martin besaß auch ein Klavier, vielmehr Daniel. Martin konnte nicht Klavier spielen.
In wenigen Stunden wären sie in Heydholm und morgen früh würde Maria Martin nach Bad Bernburg zur Arbeit fahren, wenn sie sich wohl genug fühlte. Dann hätte sie den Wagen den ganzen Tag für sich und könnte damit unterwegs sein. Abends würden sie zusammen heimfahren.
Sie waren gemeinsam bei Marias Gynäkologen gewesen. Es war alles in bester Ordnung. Zwar hatte der Arzt Maria besorgt gemustert, ihr Allgemeinzustand war nicht besonders gut, aber nicht allzu besorgniserregend. Martin hoffte, dass sich das ändern würde, wenn sie bei ihm wäre. Aber er machte sich Vorwürfe. Er hätte besser auf sie achten müssen! Aber wie? Was konnte er tun? So sanft Maria auch war, in gewissen Dingen konnte sie einen unglaublichen Eigensinn entwickeln. Nun ja, und diese ganze unselige Vergangenheit! Das alles hatte sie noch nicht verkraftet.
Eigentlich kommt dieses Kind zu früh, hatte er gedacht. Es ist zu viel für sie! Sie ist mit sich selbst noch nicht im Reinen. Andererseits – vielleicht ist es auch gut so! Wer konnte das wissen? Außerdem – was nützten die Spekulationen! Es war ohnehin nicht zu ändern.
Martin hatte den Arzt gefragt, ob eventuell eine Fehlgeburt zu befürchten sei, aber der Arzt hatte den Kopf geschüttelt.
»Kaum, wenn sie sich ein wenig schont und keine weiteren Komplikationen dazu kommen. Sie sollte sich einfach gesund ernähren, sich ausruhen, Dinge tun, die ihr Spaß machen! Und sich auf das Kind freuen! Keine großen Probleme mehr!« hatte er gesagt.
Martin nahm sich ernsthaft vor, all dieses im Auge zu behalten.
Sie hatten erfahren, dass sie ein Mädchen bekommen würden!
Martin freute sich sehr.
»Donnerwetter, das hatte ich gehofft,« sagte er. »Sie soll Cristina heißen.«
Cristina war Marias zweiter Vorname.
»So? Du hast nichts davon gesagt, dass du gern ein Mädchen hättest!«
»Na, das konnte ich doch nicht, bevor ich es wusste!«
»Und einen Namen hast du also auch schon parat!«
»Oh ja, das stand für mich von Anfang an fest. Wenn es denn ein Mädchen würde!«
»Und was habe ich noch dazu zu sagen?«
»Gar nichts, mein Schatz! Du bist dran, wenn der Junge kommt!«
Kapitel 2
Was sind Zeit und Realität? Raffinierte Trugbilder unseres Bewusstseins?
- E. Meckelburg
Maria wanderte durch Martins Haus. Ein hübsches, modernes Haus mit einem Garten rundherum, gut und teuer eingerichtet. 1980 hatte Martin es gebaut. Sieben Jahre lang hatte er mit seiner Frau Iris und dem Sohn Daniel darin gewohnt.
Mein Haus in Seefeld ist schöner, dachte sie bei sich. Und auch mein Garten! Und dann der See!
Sie ging von Raum zu Raum. Sie war schon früher hier gewesen – einige Male vor ihrer Ehe. Zweifellos war es ein Haus, in dem ein Mann alleine lebt. Das sah man, obwohl alles sauber und ordentlich war, denn Martin hatte eine Haushälterin, die ein paar Mal in der Woche kam.
Einige Jahre hatte Daniel hier mit ihm gelebt. Das Kind Daniel, das beim Vater geblieben war, als die Scheidung 1994 ausgesprochen wurde. Das war noch keine drei Jahre her. Die Eheleute hatten bereits seit 1987 getrennt gelebt, seitdem der Junge 11 Jahre alt war. Eine kurze Zeitlang hatte die Mutter ihn bei sich gehabt, aber Daniel war sehr unglücklich gewesen in dem neuen Heim der Mutter, ohne den Vater. Als die Mutter dann wieder heiraten wollte, wurde die Scheidung eingereicht, und Daniel, der ohnehin die meiste Zeit bei Martin lebte, dem Vater zugesprochen.
Martin hatte Maria einmal von seiner Heirat, seiner Ehe, erzählt.
Es war während eines Spaziergangs am See gewesen. Sie hatten von ihrer bevorstehenden Hochzeit gesprochen und Maria hatte ihn gefragt. Bis dahin hatte sie nur sehr wenig von ihm gewusst, nur dass er geschieden war und einen Sohn hatte.
Nun wollte sie mehr wissen und Martin hatte in wenigen Worten von seiner Ehe erzählt.
Seine Frau Iris war zwei Jahre jünger als Martin. Sie hatten sich auf einer Party kennen gelernt, da war Iris 19 gewesen, Martin 21. Iris arbeitete damals als Angestellte im Betrieb ihres Vaters. Es war eine angesehene, gut betuchte Familie, in die Martin da hineingeraten war. Nur hatte er eigentlich noch gar nicht heiraten wollen. Für Martin war es eine kurze Liebelei gewesen und eigentlich schon vorbei. Da stellte sich heraus, dass Iris schwanger war. Da half nun nichts! Iris wollte ihn, ihr Vater wollte keine schwangere Tochter ohne Mann! Und so heirateten sie. Martin hoffte, die Ehe würde klappen auch ohne Liebe seinerseits.
Leider war es nicht der Fall.
Iris wollte das Haus bei der Trennung nicht, in dem sie fast sieben Jahre miteinander gelebt hatten. So arrangierten sie sich finanziell und Martin blieb mit seinem Sohn darin wohnen.
»Warum hast du nicht wieder geheiratet?« wollte Maria wissen. Sie konnte sich Martins vergangenes Leben nach der Trennung von seiner Frau nicht recht vorstellen.
Martin hatte die Schultern gezuckt.
»Ich hatte keine Lust auf eine zweite Ehe,« war die knappe Antwort.
Sie waren in ihrem Garten angekommen.
»Komm, setzen wir uns einen Augenblick auf die Terrasse. Es ist noch so schön draußen.«
Martin zog sie zu sich auf die breite Bank.
Maria war nicht recht zufrieden mit seinen kurzen Antworten.
»Aber Daniel! Wäre es für ihn nicht besser gewesen?«
»Nicht unbedingt. Er hatte ja eine Mutter, die er oft besuchen konnte. Außerdem hatten wir Beate Bergström, die heute noch bei mir ist. Sie war unsere Haushälterin seit Beginn unserer Ehe. Iris hatte nicht viel mit Hausarbeit im Sinn, was ich verstehen konnte. So kam Beate zu uns, anfangs nur stundenweise. 1987 bei unserer Trennung dann häufiger. Da war sie 45 Jahre und verwitwet, hatte drei eigene, bereits erwachsene Kinder. Sie passte gut zu uns und Daniel hing an ihr. Nach der Trennung von Iris kümmerte sie sich sehr um meinen Sohn. Sie wurde so etwas wie eine Großmutter für ihn.«
»Und andere Frauen?« bohrte Maria. »Sicher gab es doch für dich andere Frauen in all den Jahren. Und keine von ihnen wolltest du heiraten?«
Martin sah sie an und lachte.
»Scheinbar nicht, oder?«
»Aber warum nicht? Es waren doch sicher sehr nette, hübsche Frauen darunter und…«
»Was willst du hören, Maria?« Martin zog sie an sich und hob ihr Gesicht zu sich empor.
»Willst du wissen, wie viele es waren? Und ob ich sie geliebt habe?«
Maria wurde verlegen.
»Nun ja, du hast so viele Jahre ohne mich gelebt. Du musst viele Frauen gekannt, vielleicht auch geliebt und eine Unmenge an Erfahrungen gesammelt haben. In all der Zeit, als ich noch ein Kind war! Was weiß ich denn schon von deinem Leben! Du hingegen weißt alles über mich.«
Martin blickte ihr forschend in die Augen.
»Ich würde mir liebend gern einbilden, dass du eifersüchtig bist auf meine vergangenen Liebschaften,« sagte er ernst, aber seine Mundwinkel zuckten.
»Aber es gibt absolut keinen Grund dafür. Es scheint mir so lange her zu sein. So viele wie du zu glauben scheinst, waren es gar nicht. Und von Liebe war schon gar nicht die Rede. Genügt dir das nicht?«
Maria sah ihn zweifelnd an.
»Du willst also mehr wissen,« stellte er fest und zog sie an sich.
»Weißt du, ich erinnere mich an keine einzige dieser Frauen. Sie haben keinerlei Eindruck bei mir hinterlassen.
Allerdings…«
Plötzlich schob er sie etwas von sich blickte sie forschend an.
»Was wolltest du sagen?« Alarmiert schob Maria ihn von sich. »Es gab also doch eine Besondere?«
»Mein Liebling, du wirst doch nicht eifersüchtig auf etwas Vergangenes sein?«
Seine Stimme sollte beschwichtigend klingen, aber es schwang ein sonderbarer Ton darin, der Maria aufhorchen ließ. Seine Miene war ernst und grüblerisch geworden.
Immer noch musterte er sie.
»Weißt du, Maria, du erinnerst mich an eine Frau, die ich vor vielen Jahren einmal gekannt habe.«
Maria sah ihn beunruhigt an.
»Du hast nie erwähnt, dass ich dich an eine andere Frau erinnere,« sagte sie voller Verwunderung. Seltsamerweise fühlte sie sich auf einmal verletzt und einsam.
Martin schüttelte langsam den Kopf, als sei er selbst erstaunt.
»Es ist merkwürdig, ich habe nie mehr daran gedacht. Nun ja, es muss an die zehn Jahre her sein – vielleicht auch länger. Ich weiß es nicht mehr.«
Er war etwas von ihr abgerückt, sein Blick schien in unbekannte Fernen zu schweifen. Es war, als sei er einem Stückchen Vergangenheit auf der Spur, das er vergessen hatte. Er wirkte geradezu benommen, wie er so neben ihr saß.
Maria wurde es ganz eigenartig zumute. Er war ihr plötzlich so fremd und fern, und dieses Gefühl schien ihr unerträglich.
»Martin!« Sie schüttelte seinen Arm.
»Was ist? Was war mit dieser anderen Frau? Bitte, sag es mir! Du machst mir Angst.«
Da riss er sich zusammen, wandte sich ihr wieder zu und nahm sie in die Arme.
»Ach, du Schäfchen! Was ist denn? Also doch eifersüchtig? Noch dazu auf eine Frau, die dir sehr ähnlich war?«
»Sehr ähnlich sogar? Eben sagtest du, ich erinnere dich an sie! Nun sprichst du von großer Ähnlichkeit. Martin, wer war diese Frau?«
Er hatte sich wieder völlig in der Gewalt.
»Komm,« sagte er ruhig und zog sie von der Bank.
»Gehen wir hinein.«
Er blickte in ihre verstörten, erschrockenen Augen.
»Aber Maria! Das ist alles lange her. Ich erinnere mich kaum noch daran. All die Jahre hatte ich es vergessen. Und nun auf einmal stieg dieses Gesicht in meiner Erinnerung auf. Ganz verschwommen nur. Es hat doch nichts mit uns zu tun.«
Maria fühlte sich elend und traurig. Am liebsten hätte sie geweint!
»Ich will dich nicht an eine Frau aus deiner Vergangenheit erinnern,« sagte sie kläglich und hörte selbst, wie kindisch sie klang. Das machte sie zusätzlich noch ärgerlich.
Was musste er ihr mit seinen vergangenen Liebschaften kommen! In ihrem plötzlichen hilflosen Zorn vergaß sie ganz, dass sie ihn danach gefragt hatte. Sie war verwirrt, nie zuvor hatte sie Eifersucht gekannt. Und nun das!
Sie riss sich von ihm los und schritt erhobenen Hauptes über die Terrasse ins Haus.
Martin sah ihr verdutzt nach. Plötzlich begriff er, was sie so gekränkt hatte. Er musste lachen, aber er bezwang sich. Langsam ging er hinter ihr her.
Diese Maria kannte er noch gar nicht! Er war gespannt, wie das hier weiterging!
Maria war in die Küche gegangen, um das Abendessen vorzubereiten. Er stand in der Tür und beobachtete sie. Wie sie mit raschen Schritten hin und her ging, vom Kühlschrank zum Tisch, dann zum Herd, mit flinken, gewandten Händen den Salat wusch, das Brot schnitt, die Käseplatte arrangierte. Fasziniert sah er zu, wie ihr alles, was sie tat, so mühelos und schnell gelang. In Kürze hatte sie ein Tablett vorbereitet.
Martin hatte ganz vergessen, warum er dort in der Tür stand. Noch nie hatte er ihr so bei der Hausarbeit zugesehen. Nun wandte sie sich zu ihm um und sah ihn kühl an. Da kam ihm ihre kleine eifersüchtige Reaktion wieder in den Sinn.
»Würdest du bitte das Tablett nach drüben tragen?« sagte sie mit kalter Stimme.
Einen Augenblick lang packte ihn die Lachlust, aber dann sah er ihre Augen und erschrak.
Zweifellos war sie nahe daran zu weinen.
Er trat rasch auf sie zu und zog sie in seine Arme.
»Aber Maria, mein Schatz. Was ist denn nur? Diese andere Frau – ich erinnere mich doch kaum noch an sie! Es ging um eine Ähnlichkeit, die mir plötzlich bewusst wurde! Sonst weiß ich gar nichts mehr von ihr. Da siehst du, dass es mir nichts bedeutet haben kann.«
Maria blinzelte ihre Tränen weg und schüttelte seine Arme ab.
»Ja, ist ja schon gut. Reden wir nicht mehr davon,« war die abweisende Antwort. Ein eisiger Blick traf ihn. Dann nahm sie das Tablett selbst auf, um es in den Wintergarten zu tragen.