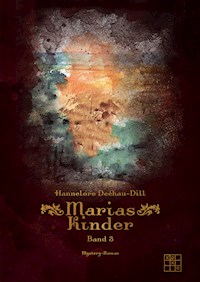Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Leute vom Kastanienweg
- Sprache: Deutsch
Ari wandert durch den blauen Wind. Es bedeutet, dass die Sonne scheint, der Himmel blau und die Luft klar ist. Nicht zu warm und nicht zu stark, ganz leicht und duftig. Eben blau! Blauer Wind ist der Inbegriff eines herrlichen Sommertages. David ist an einem Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Da findet er ein Päckchen sechs Jahre alter Briefe von einer jungen Frau an ihre Freundin. Er vertieft sich in die Dokumente und gewinnt Einblick in fremdes Leben, eine fremde Vergangenheit. Dabei geschieht etwas mit ihm. Auf seltsame Weise wird er mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Die Briefe werden für David zu einer Begegnung mit sich selbst. Seine Kindheit wird wieder lebendig. Alles kommt wieder, und manchmal ist es schmerzlich. Und dann ist da diese Fremde, die ihm bis in seine Träume folgt. Schließlich macht er sich auf den Weg und nimmt ihre Spur auf ... Ein Roman aus dem Kastanienweg
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Ari im blauen Wind
Die Leute vom Kastanienweg
Thriller
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-064-4
E-Book-ISBN: 978-3-96752-564-9
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 1873579087
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Es ist sonnig und still.
Der in der Sonne dösende Ort hat etwas trügerisch Schläfriges an sich, als wäre all das, was dort geschehen ist, längst in Vergessenheit geraten.
Es ist ein kleines Dörfchen inmitten einer grünen, hügeligen Landschaft im Südosten der Insel. Man gelangt dorthin wie durch einen grünen Tunnel, denn die »Sagraner Alleenstraße« führt den Besucher vorbei an Ulmen, Linden und Birken direkt nach Villmarsbach.
Das Dörfchen liegt eingebettet in die bewaldeten Höhenzüge der Sagran und ist dadurch gut geschützt gegen nördliche und östliche Winde.
Nicht weit davon im Städtchen Sagran hat einmal eine slawische Burg namens Charenzina gestanden, die es natürlich längst nicht mehr gibt. Der Sagraner Burgwall allerdings ist erhalten geblieben. Um ihn ranken sich Geschichten, die heute noch im Volk lebendig sind.
Ein Mann steht auf dem Dorfanger und blickt sich um.
Für diese Geschichten hat er keinen Sinn – heute noch nicht. Denn das wird kommen. Wenn er erst einmal in die versponnene Atmosphäre der Insel eingetaucht ist. Wenn auch er – wie andere vor ihm – der verzaubernden Wirkung von Ruganow erlegen ist. Dann wird er den alten Geschichten lauschen. Den Legenden über Spuk, über Irrlichter, Wassergeister und die Wunder der Götter, denen die wendischen Bewohner im ersten Jahrtausend anhingen.
All das wird der Mann eines Tages erfahren.
Jetzt aber ist er erst einmal auf der Suche und hat kaum Sinn für wunderliche Sagen und Legenden.
Seit vielen Tagen schon ist er auf der Suche, die ihn heute hierher geführt hat. Und er hofft, dass sie hier zu Ende sein wird.
Am frühen Morgen ist der Mann angekommen. Er hat seinen Wagen am Eingang des Dorfes geparkt, fast als wollte er die verträumte Stille des Örtchens nicht stören. Dann hat er sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Vorbei an einer Reihe von Häusern, niedrige Einfamilienhäuser aus roten Ziegeln, einige davon blassblau oder elfenbeinfarben gestrichen. Die Straße mit dem grauen Kopfsteinpflaster ist vermutlich die Hauptstraße des Dorfes, einen Namen hat sie nicht.
Sie führt ihn geradeswegs zum grünen Dorfanger mit hohem Gras und schönen alten Bäumen. Ein kleiner Teich mit Schilf und Weiden am Ufer, ein paar Enten, die in der Morgensonne dösen, das Köpfchen in den Federn versteckt und ein Bein unter den flauschigen Bauch gezogen. Auf einem Hügel inmitten von Bäumen die Kirche. Sie stammt in ihren Anfängen aus dem 13. Jahrhundert und erlangte ihre Bedeutung als Begräbnisstätte des fürstlichen Hauses von Pudlow, dem angrenzenden Städtchen.
Stille ringsumher, als sei das Dorf noch nicht vom Schlaf erwacht.
Der Mann lässt sich unter die Bäume ins Gras fallen, den Rücken gegen die schöne Rotbuche gelehnt. Das Gras ist noch feucht vom Regen der letzten Nacht. Direkt über ihm singt eine Amsel aus voller Kehle. Er atmet tief ein und aus. Die Bäume sind dicht belaubt, und die Sonnenstrahlen, die durch das Laub fallen, zaubern zarte Muster ins Gras.
Wenn er die Augen schließt, kann er die zitternden Schattenmuster spüren, die ihm die Sonne auf die Haut malt. Die Luft riecht nach Klee, Sonne und auch etwas nach Meer. Denn allzu weit kann das Meer nicht sein. Der Mann sitzt an die alte Rotbuche gelehnt und verliert jedes Gefühl für Raum und Zeit, als sei er der einzige Mensch auf einer Erde im Urzustand, Tausende von Jahren zurück.
Ein seltsames Rumpeln reißt ihn aus seinem Tagtraum. Er richtet sich auf und blickt die Straße hinunter. Weit vorn, wo sie eine kleine Biegung macht und ein wenig schräg abfällt, kommt ein sonderbares Gefährt heran gezuckelt. Der Mann blickt ihm staunend entgegen. Er sieht ein kleines Mädchen, das eine Art Wägelchen hinter sich herzieht. Das Kind kommt langsam auf ihn zu, hält einmal inne und wendet sich zum Wägelchen um, bückt sich, um etwas zu richten, spricht zu einem nicht sichtbaren Wesen darin und setzt dann seinen Weg fort.
Der Mann beobachtet die Kleine voller Spannung.
Sie wirkt so frisch und natürlich in dieser verträumten Idylle wie ein Frühlingswind. Als sie heran kommt, erkennt er, was das für ein Wägelchen ist. Jemand hat aus einem kleinen Bollerwagen eine Art Puppenwagen gemacht, mit einem blauen Stoffhimmel über dem Kopfteil, der auf komplizierte Weise mit Draht daran befestigt ist. Im Wägelchen hockt ein brauner, leicht verlebter Teddy, halb begraben unter einem mächtigen Strauß rosa und weißem Phlox, dem ein betörender Duft entsteigt.
Die Kleine kann nicht viel älter als vier Jahre sein. Sie ist barfuss, trägt eine kurze rote Latzhose und ein gestreiftes Blüschen darunter. Die braunen Haare sind zu zwei dicken Zöpfen geflochten, an deren lockigen Enden rote Spangen befestigt sind. Ein paar Strähnen haben sich hervor gestohlen und hängen in wirrem Gelock zu beiden Seiten des Gesichts herunter.
Sie ist braungebrannt wie eine Haselnuss, sowohl das kleine Gesichtchen mit den dunklen Augen darin, als auch die runden Arme und Beine, die allerlei Kratzer und Schrammen aufweisen.
Dann steht sie vor ihm und blickt staunend zu ihm herunter.
»Was machst du da unten im Gras?« forscht sie neugierig und runzelt die Stirn, als müsse sie dieses Phänomen erst einmal begreifen: ein Fremder, der dazu noch mitten im Dorf unterm Baum sitzt.
»Ich ruhe mich aus,« sagt der Mann und schmunzelt. Was ist das für eine merkwürdige Kleine. Das dreieckige Gesicht erinnert ihn an eine Katze, die Robby einmal hatte. Robby – ein schmerzhafter Stich fährt ihm durch die Brust. Diese Kleine da, sie ist jedoch so ganz anders als Robby, der zarte blasse Robby mit dem weichen blonden Haar …
»Wie heißt du?« forscht das Kind weiter und fährt schnell fort: »Ich bin Ari« – als hätte es sich soeben auf seine guten Manieren besonnen.
»Ari von Ariel, dem Luftgeist?«
Die Kleine antwortet nicht, mustert nur den Fremden aus großen Augen. Wie merkwürdig der gekleidet ist. Das weiße Hemd und dazu diese feine hellgraue Hose, mit der er sich einfach so ins Gras setzt! Die hat doch sicher Grasflecken abgekriegt.
»Ich bin David,« sagt der Mann und zeigt auf den duftenden Phlox in ihrem Wagen.
»Für wen ist das denn gedacht?«
»Für meinen Freund Lauri, der heut Geburtstag hat. Er ist schon alt und wohnt dahinten in dem weißen Haus, siehst du?«
Die kleine braune Hand zeigt auf ein imposantes Haus mit Reetdach, das ein wenig versteckt hinter alten Bäumen auf der anderen Seite des Teichs zu sehen ist.
»Da wohnt er, zusammen mit seinem Hund Hasso und Marthe. Marthe kocht für ihn, und sie ist genauso alt wie Lauri. Und Hasso ist auch schon sehr alt, aber sie sind trotzdem meine besten Freunde. Lauri hat ein großes Zimmer voller Bücher, bis zur Decke hoch - und er weiß alles. Er kennt alle Leute rings herum und er weiß alles über jeden. Und nun muss ich gehen, sonst welken die Blumen.«
Sie beugt sich zum Wägelchen hinunter und zieht den zerfransten Teddy, der nahezu im Blütenmeer versunken ist, energisch an einem Ohr in die Höhe.
»So kannst du besser gucken, nicht?«
Dann packt sie die Deichsel des Wagens und nickt dem Mann abschiednehmend zu.
»Dahinten geht’s zum Strand,« sagt sie und zeigt auf einen schmalen Sandweg. »Da ist es schön, nur darf ich nie allein hin. Aber du darfst ja.«
Sie seufzt einmal kurz, streicht das wirre Gelock aus der Stirn und macht sich auf den Weg.
Nach ein paar Schritten dreht sie sich noch einmal um.
»Auf Wiedersehen,« ruft sie. »Du bleibst doch noch ein Weilchen, oder?«
Einen Augenblick steht sie regungslos, als grübelte sie noch einmal über den Fremden nach. Die braunen wirren Zöpfe schimmern wie Kupfer in der Sonne. Der Mann sieht die kecke kleine Nase, das runde Kinn und den winzigen runden Mund, der einer Knospe gleicht. Er sieht ihre Augen in dem feingeschnittenen Gesicht, die ihn nachdenklich und ernsthaft anblicken, als wolle und könne sie alles verstehen.
Auf einmal glaubt er bereits die Frau in ihr zu erkennen, die sie einmal sein wird.
Und plötzlich weiß er es: Er ist am Ziel. Seine Suche ist zu Ende. Hier in diesem entlegenen Nest am Ende der Welt ist sie zu Ende gegangen.
Teil I
Die Fremde
Seefeld
Das alte Haus
Das Haus ist alt wie das Jahrhundert und genau so sieht es auch aus. Es steht auf dem Marktplatz von Seefeld, schmal und hoch, eingeklemmt zwischen zwei anderen Häusern, die ihm recht ähnlich sind mit ihren hohen Giebeln und dem hübschen alten Fachwerk. Von dieser Sorte gibt es noch mehrere in der Altstadt von Seefeld. Irgendwie scheint dieses jedoch das Älteste zu sein. Es sieht aus, als sei es recht froh, so eingeklemmt dazustehen, als wäre sonst zu befürchten, dass es nach einer Seite umsinken und als bloßer Haufen Steine am Boden landen könne.
Wie ein alter Mann, der – von seinen unzähligen gelebten Jahren einigermaßen hinfällig geworden – dankbar von zwei fürsorglichen Kumpels gehalten und gestützt wird.
Da stehen sie also: drei alte Kumpel, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, die aber keinesfalls bereit sind, klein beizugeben. Und wenn der Mittlere mit den trüben Augen auch schon ein wenig schwächelt, so muss man ihm halt Mut zusprechen, damit er noch ein Weilchen durchhält.
Mit den trüben Augen sind die Fenster des Hauses gemeint. Sie sind hoch und schmal und in viele kleine Scheiben eingeteilt. Trübe von Staub und Alter blicken sie auf den Marktplatz hinaus, als gäbe es dort schon längst nichts mehr zu sehen, was sie nicht irgendwann einmal im Laufe der Zeit bereits erblickt hätten.
Man muss dazu sagen, dass der Marktplatz von Seefeld durchaus einiges zu bieten hat. Da ist der schöne alte Marktbrunnen, von dem der Platz seinen Namen hat. Ihn ziert eine mollige Maid mit einem Steinkrug auf der Schulter, aus dem das Wasser stetig und unermüdlich ins Becken hinunter plätschert. An warmen Tagen wie diesem balancieren auf seinem Rand barfüßige Kinder, halten ihre Hände unter den kühlen Strahl und spritzen sich gegenseitig nass.
Rings um den Platz reihen sich schöne alte Fachwerkhäuser aneinander, ähnlich unseren drei alten Gesellen. Sie sind allerdings unterschiedlich breit und unterschiedlich schön, was Zweck, Schmuck und Pflege anbelangt. Da gibt es Cafes, ein Kino, Boutiquen, ein Reisebüro und Ähnliches.
Die mit bunten Tüchern bedeckten Tischchen der Straßencafes wirken einladend und gemütlich. Von Sommerblumen überquellende Blumenkübel prunken inmitten weißgestrichener Bänke, die im grünen Schatten alter Ulmen stehen.
Etliche Wege, Gässchen und Straßen münden auf diesen Platz. Zwei größere Straßen gibt es, die ebenfalls hierher führen: die Ulmenallee und die Lindenallee. Außerdem ein paar kleinere, wie die Rathausstraße, die Parkstraße, die Bahnhofstraße und die kleinste unter ihnen, die Waldstraße.
Halbwegs gepflegte Blumenrabatten mit buntgemischter Blumenpracht säumen die von Klee durchsetzten Rasenflächen, die den angrenzenden Stadtpark mit seinen uralten Kastanien, Ulmen und Linden vom Marktplatz trennen.
Um auf unser altes Haus zurückzukommen: Es ist also tatsächlich eines der ältesten im Städtchen. Sicher würde es zu diesem Zeitpunkt, da wir es uns näher betrachten, nicht ganz so müde und trübselig wirken, wenn es nicht schon sehr lange leer stünde.
Das tut es nämlich seit etlichen Monaten. Die Leute darin sind weggezogen oder weggestorben. Man hat den Erben ausfindig gemacht, der jedoch weit fort in Amerika lebt. Er hat nicht vor, herzukommen und seine Angelegenheiten persönlich in die Hand zu nehmen. Er hat es einem Makler anvertraut, der nun dafür zu sorgen hat, dass alles seinen rechten Gang geht.
Dieser Makler, Johannes Jacobsen mit Namen und um Etliches jünger als das verwaiste Haus, hat sich heute mit seinem langjährigen Freund David Walevskow hier verabredet. Es geht um das gesamte Mobiliar des Hauses, das von diesem gesichtet werden soll, bevor eine Firma mit der Haushaltsauflösung beauftragt wird.
David betreibt einen schwungvollen Antiquitätenhandel. Das heißt: schwungvoll war er einmal, bevor ihn das schreckliche Unglück ereilte. Vor achtzehn Monaten ist Davids Sohn an Leukämie gestorben, Robby, 4 Jahre alt. Ein halbes Jahr später wurde er von seiner Frau geschieden, und seitdem lebt er allein in seinem Haus in der Brunnenallee.
Seit dieser Zeit hat nichts mehr so recht sein Interesse gefunden, als sei er selber nur noch zur Hälfte am Leben. Nur noch halbherzig betreibt er seine Geschäfte. Lediglich das Restaurieren besonders schöner alter Einzelstücke kann ihn aus seiner Lethargie oder aus seinen düsteren Grübeleien reißen – vorübergehend. Immer wieder holen ihn die Erinnerungen, sein nagender Kummer und ein qualvolles Hadern mit dem Schicksal ein. Dann wirft er alles hin, steigt in seinen sich scheinbar nie leerenden Weinkeller hinunter, um sich mit einer Flasche Rotwein in einer Ecke des Hauses zu verkriechen und seinen Depressionen hinzugeben.
Mit Sorge haben seine Freunde diese Entwicklung beobachtet, die keiner von ihnen aufhalten konnte. Nach und nach haben sich die meisten von ihnen zurück gezogen. Johannes Jacobsen ist einer von denen, die noch übrig geblieben sind.
Johannes Jacobsen kommt mit Verspätung. Während er über den Marktplatz auf das alte Haus zueilt, sieht er David davor stehen, mit geistesabwesender Miene, beide Hände in den Hosentaschen seiner Jeans vergraben, die schon bessere Tage gesehen hat.
David ist hochgewachsen und schlank, die Schultern leicht nach vorn geneigt. Das dunkle Haar ist stellenweise von Grau durchzogen, es hängt ihm bis in den Kragen und hätte längst geschnitten werden müssen. Seine Augenbrauen sind sehr dunkel, dunkler als das Haar, und über der Nasenwurzel fast zusammen gewachsen. Um den Mund sind ein paar tiefe Falten eingegraben, die Lippen schmal und fest. Eine Narbe zieht sich wie ein Kreidezeichen vom Winkel seines linken Auges seitlich an der Wange abwärts, sichtbar besonders jetzt im Sommer bei gebräunter Haut.
Dann stehen die beiden voreinander.
Du siehst nicht gut aus, mein Alter, will Johannes sagen. Mir scheint, du isst und schläfst nicht so, wie du solltest. Und zum Tennis bist du letzte Woche auch nicht erschienen …
Er sagt es nicht. Es hätte auch keinen Sinn. Da gibt es nichts, was nicht schon irgendwann gesagt worden wäre, ohne dass es gefruchtet hätte. Längst hat er beschlossen, den Freund in Ruhe zu lassen in der Hoffnung, dass eines Tages irgend etwas geschieht, das ihn aus seiner Lethargie reißt und ins normale Leben zurück holt.
Die Holztür des alten Hauses knarrt laut, als Johannes sie aufschiebt. Düster und verschwommen liegt die schmale Eingangshalle vor ihnen. Trübes Dämmerlicht und abgestandene Luft hüllen sie ein. Es riecht nach Alter, Staub und Verlassenheit. Ein verwinkeltes altes Gebäude mit knackenden Treppen, schiefen Winkeln und Ecken, kleine Erker mit getrockneten und künstlichen Blumen, undichte Fenster und Möbel aus drei oder vier Generationen.
Johannes berichtet: »Das Haus hat einer Familie gehört, die nach und nach ausgestorben ist. Zum Schluss lebte die alte Dame ganz allein hier. Darum ist es wohl auch in diesem Zustand. Ihr Mann war seit Jahren tot, der einzige Sohn und jetzige Erbe ist nach Amerika gegangen, um dort reich zu werden – was ihm scheinbar auch gelungen ist. An diesem Haus hat er jedenfalls kaum Interesse. Merkwürdig eigentlich, wenn man bedenkt, dass er hier aufgewachsen ist. Nun ja, wie dem auch sei. Ein paar Jahre haben zwei junge Frauen im zweiten Stock oben gelebt. Eine von ihnen ist fortgezogen, hat wohl geheiratet, glaube ich. Die andere ist vor einiger Zeit tödlich verunglückt.«
Die beiden Männer durchwandern langsam das ganze Haus, im Erdgeschoss angefangen, dann die enge Treppe nach oben in den ersten Stock und schließlich in den zweiten Stock hinauf. Überall ein ähnliches Bild: eine Menge alter Möbel, vergilbte Tapeten, verstaubte Teppiche und Vorhänge, Nippes und Krimskrams auf Kommoden und Tischchen. Die Schränke zum Teil vollgestopft mit alten Kleidern, denen ein muffiger Geruch entsteigt. In den Vitrinen gutes und weniger gutes Porzellan und Kristall.
David öffnet eine schmale Tapetentür in eine Abseite und steckt den Kopf hinein. Aus einer schrägen Dachluke fallen ein paar Sonnenstrahlen auf Berge von Kisten, Büchern und gebündelten Zeitungen. Staubflusen tanzen in dem dunstigen Sonnenlicht. Ganz hinten in einem Winkel entdeckt er eine Kiste mit Kohlen neben einem hölzernen Schaukelpferd, dessen ehemals braune Mähne verstaubt und traurig herab hängt. Einen Augenblick betrachtet David das alte Ding mit zusammen gekniffenen Augen. Ein ähnliches hat auch Robby einmal besessen. Eine Erinnerung taucht in seinem Geist auf: Robby mit roten Wangen und lachenden Augen. Die kleinen Hände fest um die hölzernen Griffe zu beiden Seiten des Pferdekopfes geklammert, die blonden Haare vor Eifer ganz feucht in der Stirn.
Sieh nur, Papa, ich reite. Ich reite auf meinem Pferd über die Felder.
David hört das Rumpeln und Poltern auf dem Holzfußboden, dazwischen Neles lachende Stimme: Wenn du groß bist, bekommst du ein richtiges Pferd. Dann reitest du wirklich über die Felder…
Aber Robby ist nie wirklich geritten, nur damals auf dem kleinen hölzernen Pferd im Kinderzimmer des ersten Stocks.
Vielleicht ist dieses das Schaukelpferd des jetzigen Besitzers, der in Amerika lebt und kein Interesse mehr daran hat. Sicher hat auch er einmal begeistert darauf geschaukelt und gedacht, er reitet über Felder und Wiesen. Und nun hat er es vergessen.
David schreckt aus seinen Gedanken auf. Johannes hat nach ihm gerufen.
»Ist nichts für dich dabei?« erkundigt er sich und David schüttelt den Kopf.
»Kaum. Vielleicht der Mahagonitisch mit den vier Stühlen unten im Esszimmer …«
Vor einem Waschtisch, viktorianisch, Ebenholz, mit einer Marmorplatte ist er stehen geblieben. »Diesen hier werde ich nehmen. Und dann guck ich mir das Porzellan in der Vitrine unten noch einmal genauer an.«
Im letzten Zimmer im zweiten Stock steht ein alter Schreibsekretär, ein Möbel aus dem Biedermeier. David hat einen ähnlichen schon einmal restauriert. Er bleibt davor stehen.
»Den nehme ich auch. Er ist zwar etwas ramponiert, aber schön. Den kriege ich wieder hin.«
Er zieht ein paar Schubladen auf.
»Da ist ja noch jede Menge an Papierkram drin.«
Unschlüssig blickt er auf das ungeordnete Sammelsurium von Papieren.
Johannes zuckt die Schultern.
»Schätze wirst du da kaum finden. Schmeiß alles raus oder nimm ihn so, wie er ist.«
David kramt einen Augenblick zwischen den vergilbten Prospekten und Postkarten herum. Dann schiebt er die Schubladen zu. Er wird ihn nehmen, ihn aufarbeiten und für sich selber behalten.
Einen Augenblick stehen die beiden Männer unschlüssig vor dem Haus.
»Ich lass die Sachen heute Nachmittag noch abholen,« sagt David.
»Dann kann ich gleich morgen die Firma mit der Haushaltsauflösung beauftragen,« überlegt Johannes und blickt noch einmal prüfend an der Hausfront empor. »Ich denke, es wird sich bald ein Käufer für den alten Kasten finden lassen. Eigentlich ist das Haus ganz reizvoll. Und wenn es erst ein wenig aufgemöbelt ist - .Diese alten Gemäuer haben ja so ihre eigene Atmosphäre. Die Lage ist sehr gut, auch für eine Boutique oder ein weiteres Cafe. Früher einmal war ein Fotoatelier unten drin. Nun ja, wir werden sehen. Also dann.«
Er schiebt seine Aktentasche unter den Arm und streckt dem Freund die Hand zum Abschied hin.
Kommst du heute Abend zum Stammtisch? will er noch fragen, aber dann lässt er es. Er weiß ohnehin, wie ausweichend die Antwort ausfallen würde.
Statt dessen sagt er. »Ich komme dich in den nächsten Tagen einmal besuchen.«
»Tu das,« antwortet David und nickt geistesabwesend mit dem Kopf. Dann dreht er sich um und geht davon.
Johannes blickt ihm sorgenvoll und mit gerunzelter Stirn hinterher. In Gedanken versunken überquert er mit großen Schritten den Platz.
Das alte Haus bleibt still zurück.
Es steht da, zu beiden Seiten von den alten Kumpels flankiert, die ihm gut zuzureden scheinen. Hat nicht einer von beiden ihm gerade einen aufmunternden Knuff in die Seite verpasst? Und hat nicht auch diese trübselige Miene sich ein wenig verändert? Mir scheint, die Augen sind eine Spur heller geworden und sein ganzes Gesicht unter all den Altersfalten heiterer, ja geradezu erwartungsvoll und freudig erregt.
Was sagst du nun?
Bald kommt wieder Leben in die Bude!
…eigentlich ist der alte Kasten doch ganz reizvoll… diese alten Gemäuer haben so ihre eigene Atmosphäre … es wird sich ein Käufer finden lassen … und wenn es erst ein wenig aufgemöbelt ist…
Da siehst du es: Das Leben hat noch so einiges zu bieten! Man soll doch nie die Hoffnung aufgeben.
Denn: Wo Leben ist, ist auch Hoffnung!
Seefeld
Davids Erinnerungen
David verspürt nicht die geringste Lust nach Hause zu fahren. In sein stilles, seit langem verwaistes Haus, wo ein langer Abend und eine noch längere Nacht auf ihn warten. Eine lange Nacht mit unzähligen Stunden ohne Schlaf und voller quälender Erinnerungen.
Einen Augenblick lang trägt er sich mit dem Gedanken, zum Friedhof hinauf zu gehen. Es wäre ein schöner Spaziergang durch den Stadtpark und dann am See entlang. Vielleicht einen Augenblick in der Kirche sitzen in der Hoffnung, so etwas wie Frieden und ein Stückchen seelisches Gleichgewicht zu finden.
Dann aber fällt ihm ein, wie es ihm bei seinem letzten Kirchenbesuch ergangen ist.
Es war ein heißer Tag gewesen, er hatte eine Weile an Robbys Grab gestanden, dann hatte er die Kirche betreten, in der es angenehm kühl war. Er hatte in einer der Bänke gesessen und die alten Fresken betrachtet, die sich an den alten Gewölben hinauf ranken. Dabei hatte er versucht, sich die unzähligen Gebete vorzustellen, die im Laufe der Jahrzehnte daran entlang nach oben gesandt worden waren. Er hatte mit gefalteten Händen dagesessen und zu beten versucht.
Das schwache Licht um den Altarraum herum schuf tiefe Schatten zwischen den Bankreihen. Das Querschiff lag völlig im Dunkeln. Es war völlig still gewesen.
Er hatte die Augen geschlossen und in die Stille hinein gehorcht. Er wollte beten, aber es war ihm nicht gelungen. Ein Gefühl von Unwirklichkeit hatte ihn überkommen wie ein plötzlicher Albtraum. Da war kein Gefühl von Frieden und innerer Ruhe.
Im Gegenteil, er hatte das Empfinden, als wollte sich sein Inneres nach außen stülpen. Er spürte, wie sich ihm die Haare sträubten, als marschierten seine inneren Dämonen wie gespenstische Armeen an der vordersten Front seines Geistes auf. Seine ganze Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit holten ihn ein. All sein innerer Groll und Hass auf Gott und die Welt ballten sich wie ein Knäuel in seinem Inneren, als wollten sie ihm die Brust sprengen.
Mit aller Macht hatte er versucht, sich wieder in den Griff zu bekommen, um dann endlich fluchtartig die Kirche zu verlassen.
Als David nach endlosem Umherfahren seinen Wagen in die Garage fährt, schlägt die Kirchturmuhr der Seefelder Kirche St. Marien achtmal. Abendluft und ein dünner Regenschleier hängen in der Luft.
Es nieselt nur, die Tropfen fallen nicht zu Boden, sondern hängen einfach wie ein feuchter Schleier im leichten Wind. Über den niedrigen Hausdächern, den Gärten, den alten Brunnen an der Straße.
Um das Betreten seines Hauses hinauszuzögern, wandert er mit gebeugten Schultern, beide Hände in den Hosentaschen, im Garten umher. Es ist ein unglaublich zugewachsener, verwilderter Garten. Seit Monaten hat David ihn nicht mehr bewusst wahrgenommen.
Weder die verfilzte Eibenhecke, noch die ungepflegten Rosenbüsche und Blumenbeete, auf denen schon lange Zeit alles durcheinander wuchert nach dem Prinzip: der Stärkere siegt über den Schwachen.
Schwere, unter ihrer Last zusammen brechende Äste unbeschnittener Obstbäume lassen kaum Sonne hindurch und verdunkeln den Garten stellenweise zu einer grünen Höhle. Meterhohes Gras vereinigt sich mit allen möglichen Ranken und Blumen zu einem mehr oder weniger undurchdringlichen Dschungel. Diesem Chaos würde nur noch mit der Sense und einer Machete beizukommen sein.
Ein verkrauteter und halbwegs zugewucherter Steinplattenweg führt zur Haustür, ein weiterer um die Hausecke herum an alten Kiefern und Tannen vorbei zur Hintertür.
Die Büsche zu beiden Seiten der Haustür wachsen wie sie wollen. Sie haben jede Freiheit. Auf der einen Seite wuchern die langen Triebe eines Jasmins, auf der anderen die eines Ginsters bis zur Haustür, als suchten sie dort Halt.
In der Regel nimmt David den Weg von der Garage zur Hintertür, so dass er den grünen Dschungel des Gartens gar nicht zu Gesicht bekommt. Heute wird ihm dieses Chaos zum ersten Mal bewusst. Der leichte Schrecken weicht allerdings schnell einer müden Gleichgültigkeit. Er kneift die Augen zusammen, zuckt mit den Schultern und geht ins Haus.
Es ist ein schönes altes Haus mit einem Stockwerk, aus ockerfarbenen Ziegeln gemauert, mit weißen Einfassungen um Fenster und Türen, deren Farbe an vielen Stellen abblättert.
Das Innere ist großzügig und mit ausgesuchten Möbeln ausgestattet. Allerdings ist jedem Raum der Mangel an Pflege anzusehen. Die meisten Räume benutzt David gar nicht. Eine geschwungene Treppe im hinteren Teil der Eingangshalle führt in das obere Stockwerk, das David seit langem nicht betreten hat. Er kann sich kaum daran erinnern, wann er zum letzten Mal da oben war. Zu viele Erinnerungen hängen daran.
Zum Wohnen und Schlafen hat er sich einen der unteren Räume neben der Küche ausgesucht.
Ein schöner, eigentlich sehr gemütlicher Raum; für David jedoch vor allem zweckmäßig und bequem. Er hat einen schönen Marmorkamin, den er an kalten Tagen sogar anheizt, wenn die Heizung wieder mal bockt. Er hat es immer noch nicht geschafft, sie in Ordnung bringen zu lassen. Zwei Ledersessel stehen zu beiden Seiten des Kamins, ein breiter Schreibtisch mit zerkratzter Lederschreibfläche vor einem der hohen Fenster. Eine breite Couch hat er sich zum Schlafen eingerichtet. Das zerwühlte Bettzeug wird nur von Frau Meinhard, die hin und wieder zum Putzen kommt, gerichtet und gewaschen.
An den Wänden ziehen sich Mahagoniregale entlang, die mit ledergebundenen Bänden verschiedener Größe beladen sind. Ein Parkettboden, mit den Jahren abgenutzt, ist zum Teil von einem verblassten Orientteppich verdeckt. An der Tür steht ein Glasschrank mit einem Paar zusammen passender Schrotflinten darin, die noch von seinem Vater stammen. David selbst hat mit Jagen und Schießen nichts im Sinn. (Du bist zu weich, mein Sohn, viel zu weich! Nicht gut für einen Mann!)
Hohe Fenstertüren führen in einen Teil des Gartens, der einmal wie ein kleiner Park angelegt wurde, nun aber ebenso verwuchert und verwildert ist wie der Rest.
David wirft einen kurzen Blick in die Küche, die sauber und wie unberührt daliegt. Frau Meinhard war heute da. Oft macht sie ihm eine Mahlzeit zurecht oder sie bringt einen Eintopf von zu Hause mit. Sie ist eine mitfühlende Seele und sorgt sich um den vereinsamten Mann, dem das Schicksal so übel mitgespielt hat. Sie würde sich weitaus mehr um ihn kümmern, wenn er es denn zuließe. Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel.
»Essen ist im Backofen« steht da in ungelenker Schrift.
David verspürt keinen Hunger, wie so oft. Ihm ist eher nach etwas zu Trinken. Eine kleine Betäubung in Form eines Glases Wein wird ihm zur Entspannung verhelfen.
Einen Augenblick später hockt er in einem der Ledersessel am kalten Kamin. Der Regen ist stärker geworden. Sein sanftes Rauschen dringt von draußen herein. Der mühelose, unermüdliche Rhythmus des strömenden Regens wirkt besänftigend auf sein ruheloses Gemüt. Der Rotwein tut ein Übriges.
David sucht Ruhe und Vergessen. Was er findet, ist sein Kind. Robby.
Da ist ein langer sonniger Strand, sie halten ihn an den Händen in ihrer Mitte, laufen am Wasser entlang, schwingen ihn in die Höhe. Sie alle drei und sie sind glücklich: David, Robby und Nele.
Robbys helles langes Haar flattert im Wind, seine blauen Augen sind weit aufgerissen, genauso wie sein Mund, lachend, strahlend vor Begeisterung und Atemlosigkeit. Noch einmal! Noch einmal.
Und sie schwenken ihn an den Armen durch die Luft. Er kreischt und jubelt und Nele lacht ihn an …
Sie laufen am Wasser entlang, blau und unendlich breitet sich der Himmel über ihnen aus.
Eine Imbissstube an der Küste, und sie essen Fisch und Pommes frites und Eis. Sie laufen über die Dünen, ihre Füße sinken in den weißen Sand, Nele nimmt ihr Kopftuch ab und lässt den Wind durch das blonde Haar wehen. Blondes Haar und blaue Augen so wie Robby. Robby und Nele … Robby und Nele …und sie sind glücklich.
Ein anderer Tag: Robby im Garten auf der Schaukel. Derselbe Garten wie jetzt, auch die Schaukel ist noch da. Irgendwo im struppigen Dschungel verborgen da draußen …und Nele versetzt der Schaukel einen Schubs. David ruft: Nicht so hoch, er fällt doch herunter.
Robby lacht und Nele lacht, sie lachen ihn aus.
Ich falle nicht. Sieh nur, ich halte mich ganz fest.
David ist mit einem Satz bei der Schaukel und packt seinen Jungen und hält ihn fest in seinen Armen. Vielleicht wäre er ja doch gefallen, um Gottes willen. Er hätte sich den Hals brechen können, denn er ist ja noch so klein!
Nele faucht ihn bitterböse an: du verweichlichst ihn noch. Er soll doch einmal ein richtiger Mann sein, nicht so ein Hasenfuß… Hasenfuß wie wer? Wie David? Hält sie ihn für einen Feigling und Hasenfuß? Das wohl nicht. Eher für weich und zu ängstlich. Jungens müssen abhärten. Das haben deine Eltern bei dir versäumt. Hatten sie das?
Aber gegen diese Krankheit, die ihn dann heimsuchte, half kein Abhärten. Die lauerte damals schon in ihm und eines Tages war sie da …
David schreckt aus seinen Träumen auf.
Waren das Träume oder Erinnerungen? Es ist ja ganz gleich, denn im Grunde ist es dasselbe. Er zieht sein Rotweinglas zu sich heran, die Flasche, gießt nach.
Die Luft im Raum ist stickig. Er möchte aufstehen und das Fenster aufreißen, die frische Regenluft herein lassen, aber er rührt sich nicht.
Wie oft hat er so hier gesessen in den letzten Monaten? In der ersten Zeit nach Robbys Tod hatte er oft das Gefühl, er müsse nur die Treppe hinauf steigen, die Tür zum Kinderzimmer öffnen und da wäre er. Inmitten seiner Spielsachen auf dem Fußboden. Oder schon schlafend im Bett. Dann traf ihn das Bewusstsein, dass sein kleiner Sohn tot ist, wie ein Schlag.
Manchmal ging es ihm auch so, wenn er heimkam. Er riss die Haustüre auf und erwartete, dass wie früher Robbys flinke kleine Schritte durch die Halle gelaufen kamen, seine helle Stimme und sein Lachen ihm voraus eilten, und dann seine zarte kleine Gestalt, die in seine Arme flog.
Aber das Haus war still, sehr still. Nur Nele war da. Wie ein dünner, blasser Schatten kam sie ihm langsam entgegen. Wie war dein Tag? Ein stumpfer Blick aus trüben Augen und gar kein Interesse wirklich für ihn.
Das war wohl schon lange erloschen. Nur das Kind hatte sie überhaupt so lang zusammen gehalten.
Danach war es vorbei.
Hätte sich nicht alles lösen lassen, wenn sie miteinander geredet hätten? Wann hatten sie damit aufgehört? Oder hatten sie es nie gekonnt?
Nur Reden hilft, denkt David heute. Es ist das Einzige, was uns vielleicht hätte helfen können. Schweigen erzeugt Schweigen und schließlich ist nur noch Sprachlosigkeit da.
Irgendwann war alles vorbei, unsere Chance war vertan. Wenn wir je eine hatten.
Was haben wir denn wirklich füreinander empfunden? Woran misst man die Bedeutung, die man für das Leben eines anderen Menschen hat?
David rappelt sich stöhnend aus einem Sessel und geht ans Fenster. Es ist spät geworden. Er starrt sein Spiegelbild in der Fensterscheibe an. Der gespenstisch undeutliche Garten verschwimmt hinter seinen Gesichtszügen und verwischt einige der Falten, die sich im Laufe der letzten Monate eingegraben haben.
Wenn man doch vergessen könnte, denkt David. Oder noch einmal von vorn anfangen. Aber was würde ich anders machen? Ich könnte doch niemals verhindern, dass Krankheit und Tod kommen.
Diese Angst, die immer wieder auftaucht. Die Angst vor dem Unausweichlichen, eine Angst, die sich oft nicht abschütteln lässt, qualvoll, stark und unmittelbar. Die Angst, das zu verlieren, was man hat. Oder ist es eine Angst vor dem Morgen, vor dem Leben überhaupt?
Liegt es an mir?, denkt David.
Komme ich mit dem Leben nicht zurecht? Fange ich es falsch an? Bin ich zu weich – das, was Nele mir immer vorgeworfen hat? Und Vater auch. Nur Mutter nicht. Für die war ich richtig. Aber vielleicht hat sie mich ja so weich gemacht. Oder werden lassen.
Wer zum Teufel soll das wissen!
Außerdem – was soll es nützen! Ich bin bald vierzig Jahre alt, zu spät, um etwas zu verändern. Um mich zu ändern.
Aber die Dinge verändern sich – und einige verschwinden ganz. So geht es nun mal zu auf der Welt. Einige Dinge verschwinden und andere tauchen auf, Ereignisse und Menschen. Nur im Kopf ist alles noch da. Obwohl es oft den Anschein hat, als sei auch dort etwas verschwunden. So ist es aber nicht. Es ist alles noch da und taucht mitunter in den ungünstigsten Momenten wieder auf. Wenn man es gar nicht haben will. In Erinnerungen und Gedanken und Träumen. Ungebeten und grässlich.
Wenn man das Leben doch so nehmen könnte, wie es kommt! Ruhig und gelassen, zuversichtlich und mutig.
Mein Leben ist so ziemlich vorbei.
Auf das, was jetzt noch kommt, kann ich eigentlich ganz gut verzichten. Ein Wort seines Vaters fällt ihm ein: Wer nicht an die Zukunft denkt, wird keine haben.
Dazu muss man aber erst mal mit der Vergangenheit abschließen.
Und Abschiednehmen ist schmerzhaft und qualvoll. Wie eine Amputation. David will nicht Abschied nehmen und loslassen. Er will und kann das nicht.
Auf der Insel
Aris Welt
Hinter dem Dorf ist eine Wiese, von einem schiefen Holzzaun umgeben. Ein Bach schlängelt sich durch das hohe Gras und gräbt sich wie ein kleiner Hohlweg ins Land. Hinter der Wiese wird der Boden hart, hin und wieder leuchten weiße Felsbrocken in der Sonne, hier und da braune Sandstreifen mit spärlichem Graswuchs, dicke scharfkantige Halme, die in kleine Kinderfüße schneiden, wenn sie barfuss darüber laufen. Dahinter kommt der weiße Dünenstreifen, dann das Meer.
Eine Seite der Wiese wird von einem Waldstreifen begrenzt. Dort, wo der Abhang beginnt, macht der Bach einen scharfen Knick. Da wachsen Sumpfdotterblumen und Iris. Das Wasser des Bachs ist klar und durchsichtig wie Glas. Auf seinem Grund gibt es weiße, gelbe und braune Kiesel. Wenn man sich auf den Bauch legt, kann man von dem Wasser trinken, es ist eisig kalt und schmeckt wunderbar.
Ein wolkenloser blauer Himmel, nur vom Weiß eines Kondensstreifens durchbrochen, spannt sich über das Land.
Dies alles ist Aris Welt.
Ari ist vier Jahre alt. Sie ist heiter, quirlig, redet gern und mitunter singt sie. Worte und Sätze, die sie ebenso gut sprechen könnte, werden zu einem Lied. Manchmal ist sie nachdenklich und ernsthaft.
Sie liebt ihre Mutter, ihre Freunde, ihre wenigen Spielsachen. Viel braucht sie da nicht; ist die Welt nicht voll von Dingen, mit denen man spielen oder sich beschäftigen kann?
Die wichtigste Person in Aris Leben ist die Mutter. Ari liebt und bewundert sie sehr. Sie hat dunkelblaue Augen und braunes Haar, das sie zu zwei langen Zöpfen geflochten um den Kopf gewunden trägt. Es ist eine altmodische Frisur, aber praktisch bei der Arbeit in der Gärtnerei.
Am Sonntag, wenn Mama sie beide fein gemacht hat, zieht Ari sie vor den hohen Spiegel in Mamas Schlafkammer und sagt: »Sieh nur, nun sehen wir fast gleich aus.« So ganz unrecht hat Ari nicht. Beide haben die gleichen braunen Haare und die gleiche Frisur. Beide sind braungebrannt von dem Aufenthalt im Freien und die Kleider sind auch sehr ähnlich, grün-weiße Trachtenkleider, wie man sie hier am Sonntag zum Kirchgang trägt, von der Mutter selbst geschneidert.
So macht man das auf der Insel, und da Ari und Mama sich hier ganz zu Hause fühlen und auch niemals von hier fort wollen, machen sie alles so wie die Einheimischen. Das ist einer der Gründe, warum beide im Ort als vollwertige Gemeindemitglieder anerkannt sind, was sonst keinem Fremden bisher gelungen ist. Nicht etwa, dass es im Laufe der Jahrzehnte viele Fremde hierher verschlagen hätte.
Ihr ganzes Leben hat Ari in diesem Dorf verbracht, aus dem sie bisher kaum herausgekommen ist. Dann sind da natürlich der Strand und die Wiesen und Felder ringsherum. Ein paar Mal ist sie mit der Mutter zu Fuß nach Villmarshaff gewandert, ein anderes Mal war sie in Pudlow, und zweimal hat Lauri sie in seinem feinen Auto nach Sassinow zum Hafen mitgenommen. Das ist alles.
In ihrer Welt kennt Ari jeden Graben und jede Hecke und jeden Baum am Straßenrand. Sie weiß, wo wessen Grundstück zu Ende ist, auch wenn da keine Zäune und Hecken sind, und natürlich weiß sie, wer in welchem Haus wohnt. Allzu viele Häuser gibt es ja auch nicht in Villmarsbach. Sie kennt alle Hunde und fast alle Katzen, von den Kindern ganz zu schweigen, denn auch davon gibt es nicht sehr viele.
Nur sie weiß immer, wo Pit, ihr kleiner Freund, sich verkrochen hat, wenn er wieder mal davon gelaufen ist. Meistens steckt er in dem alten Baumhaus, das es seit undenklichen Zeiten auf dem uralten Apfelbaum hinten im Obstgarten gibt. Eine dicke Strickleiter führt hinauf. Ari und Pit, der ein paar Wochen jünger als Ari, aber viel kleiner und schüchterner ist, hocken oft da oben inmitten des dichten grünen Laubs. Sie ziehen den Strick hinauf und fühlen sich unsichtbar und sicher in ihrer grünen Höhle. Niemand, der es nicht kennt, würde ihr Versteck dort vermuten, wenn nicht Struppi, der weißbraune Terrier der Gärtnerei, ständig am Baum hochspringen und wie verrückt bellen würde. Er will nämlich auch hinauf, oder aber mit den Kindern auf dem Rasen herum tollen.
Aris größter Wunsch ist ein Fahrrad, und zum fünften Geburtstag hat Lauri ihr eines versprochen.
Auf jeden Fall möchte sie es bis zum Schulanfang haben, denn eine Schule gibt es in Villmarsbach nicht. Sie muss dann wie die wenigen anderen Kinder zur Hauptschule nach Villmarshaff fahren. Zum Gymnasium später sogar bis ins Städtchen Pudlow, aber bis dahin sind es ja noch Ewigkeiten.
Aris Welt ist bunt und voller Leben, vor allem im Sommer. Dann grünt und blüht alles ringsumher und sie hat den ganzen Tag über schrecklich viel zu tun. Jede Stunde ist bis zur letzten Minute ausgefüllt. Bis die Mutter sie energisch ins Haus ruft oder manchmal auch einfangen muss, wenn sie nicht gleich kommen will. Denn Ari ist eigensinnig und sehr selbständig. Sie mag sich nicht befehlen lassen, man muss sie überzeugen. Und damit hat die Mutter manchmal ihre liebe Not.
Gleich nach dem Frühstück beginnt sie mit ihrem Tagesprogramm. Zunächst hilft sie der Mutter beim Aufräumen und Bettenmachen. Danach wird ein wenig geputzt. Das ist schnell getan, denn das Häuschen ist klein. Eigentlich ist es nur ein etwas größeres Gartenhaus am Ende der weitläufigen Gärtnerei, in der die Mutter den Tag über zu arbeiten hat. Diese Art von Arbeit ist Ari gerade recht. Sie liebt nun mal alle Blumen und Pflanzen, fast so wie die Hunde und Katzen und Hühner im Dorf. Überhaupt alles, was kreucht und fleucht und sich von Ari streicheln oder auf den Arm nehmen lässt.
Das Häuschen mutet an wie ein Sommerhaus am Meer. Im Erdgeschoss hat es nur einen einzigen großen Raum mit Fenstern zu drei Seiten, eine winzige Toilette mit Dusche und eine Veranda mit vielen Fenstern. Eine hölzerne Wendeltreppe führt in den Dachboden hinauf, wo es zwei kleine Schlafräume gibt.
Ari liebt ihr winziges Kämmerchen mit dem schrägen Dachfenster, durch das am Morgen die Sonne hereinscheint und in der Nacht der Mond. Ihr Bett steht direkt darunter, und vor dem Einschlafen kann sie die Sterne sehen. Sie sind ihr so nah, dass sie fast nur die Hand auszustrecken braucht, um sie vom Himmel zu pflücken.
Außer dem Bett gibt es in ihrem Zimmer nur noch eine Kommode mit ihren Kleidern darin, einen Stuhl, ein winziges Nachtschränkchen mit einer kleinen Lampe darauf und ein Bücherregal, auf dem ihre Bilderbücher aufgereiht sind. Auf dem Holzboden liegt ein bunter Flickenteppich, den Marthe ihr geschenkt hat.
Auf ihrem Kopfkissen hockt ein zerfranster Tiger, der zu altersschwach ist, um das Bett zu verlassen. Er verbringt seinen Lebensabend in Aris Kämmerchen und wird nur zu besonderen Anlässen nach unten geholt, wie etwa Weihnachten oder Aris Geburtstag.
Wenn also das Haus blitzblank ist, die Betten gemacht und die Hühner gefüttert, so sind da die kleinen Botengänge, die sie für die Mutter erledigt. Sie zieht ihr Wägelchen unter dem Dachüberstand hervor, setzt den Teddy, der geduldig auf einem Küchenstuhl gewartet hat, hinein und rüstet sich für den Ausgang. Sie holt die Milch vom Kaufmann, bringt der Marthe ein Bund Mohrrüben oder den bestellten Blumenstrauß zum Gastwirt von der »Blauen Ente«.
Manchmal hat sie ein Buch von Mama zu Lauri oder umgekehrt zu transportieren. Das wird dann in eine saubere Tüte gesteckt, damit es unbeschädigt und sauber ankommt.
Danach hat sie etliche Besuche zu machen, Hassos Hund Lauri auszuführen und sich um ein paar bedürftige Tiere zu kümmern.
Gestern gegen Abend hat Jan, der Sohn des Gärtners, die alte Schaukel an der Birke beim Treibhaus wieder instand gesetzt. Die muss heute noch ausprobiert werden. Außerdem muss sie nach den Vogelnestern sehen. Vor ein paar Tagen, als es Zeit für die zweite Vogelbrut wurde, flügge zu werden, hat sie ein ganzes Nest mit drei jungen Rotkehlchen darin im Gras entdeckt. Der Nachtwind muss es aus dem Geäst gerissen haben. Über ihnen im Baum schrieen die Vogeleltern, denn Katze Toni näherte sich mit glühenden und mordlüsternen Augen. Ari schrie auch, lauter als die erschreckten Eltern, einmal, um die Katze zu vertreiben, und zum anderen, um Jan herbei zu rufen. Der kam dann auch gleich. Er nahm sich sofort der armen Vogelkinder an, wobei er leise vor sich hinmurmelte und fluchte, wovon Ari nur die Hälfte verstand. »So eine ungeschützte Stelle … diese dummen Vögel … werden die denn nicht klug … ein Wunder, dass die Katze sie nicht längst aus dem Nest geholt hat…«
Dabei versuchte er geduldig, die ineinander verwobenen Zweiglein und Halme, das weiche Polster aus Flaum, Tierhaaren und Moos, wieder an der alten Stelle zu befestigen. Es war wohl nicht so ganz das Richtige, denn am nächsten Morgen waren Vögel und Nest fort. Ari schimpfte und weinte ein Weilchen herzzerreißend. Am Nachmittag hatte sie sich dann beruhigt, aber seitdem sieht sie ständig und überall nach Nestern, um abgestürzte Vogelkinder zu retten.
Auch das gehört zu Aris Welt.
Es ist ein glasklarer Tag voller Schmetterlinge und Vogelstimmen. Ari liegt auf dem Bauch am Fuß der alten Eiche. Ein Heer von Ameisen marschiert über deren dicke Wurzeln dahin. Sie sind unglaublich emsig und fleißig, ständig haben sie zu tun. Marschieren mit ihrer Last, die doppelt so groß ist wie sie selbst, zielstrebig ihres Wegs.
Ari reckt sich behaglich im grünen Schatten und beobachtet eine Weile das emsige Treiben. Eine einzelne Ameise ist ein wenig vom Weg abgekommen, zwischen den dichten Grasspitzen irrt sie eilig dahin, ihr kleines Bündel tapfer mit sich schleppend über drei oder vier Wurzeln hinweg auf ihrem Weg nach Hause.
Ari rollt sich auf den Rücken und blickt in die dichtbelaubten Zweige eines wilden Kirschbaums hinauf. Ein Rotkehlchen sitzt dort oben und singt aus voller Kehle. Sie staunt. Wie kann so ein kleiner Vogel so einen großartigen Gesang von sich geben. Die ganze Luft ist voll davon und es klingt, als wollten die Töne bis in den Himmel hinauf klettern.
Ari verschränkt beide Arme unter dem Kopf und blickt in den Himmel hinauf. Von Süden her segelt eine große weiße Wolke heran.
Wenn die Wolke genau über mir ist, stehe ich auf und gehe heim, denkt sie.
Die Wolke lässt sich Zeit, aber auch, als sie dann genau über ihr steht, kann Ari sich nicht aufraffen. Es ist so schön hier im Gras. Sie hat sich wieder auf den Bauch gedreht und atmet den feuchten, süßen Geruch der Erde. Die Sonnenstrahlen liegen warm auf ihrem Rücken und direkt neben ihr recken ein paar Gänseblümchen ihre weißen Köpfe in die Sonne.
Immer noch singt der Vogel, in der Ferne hört sie einen Hund bellen. Ob das Hasso ist, der schon auf sie wartet? Aber nein, dann müsste es ja längst Nachmittag sein. Wie spät es wohl ist? Ari kennt die Uhr noch nicht richtig, sie hat ja auch gar keine. Aber sie weiß, wann es mittags um zwölf ist, und wann es Zeit wird, nach Hause zu gehen. Und jetzt muss es Mittagszeit sein.
Richtig, da schlägt auch die Kirchturmuhr, zwölfmal. Soweit kann Ari zählen, und noch viel weiter. Sie wird ja bald fünf.
Fort ist alle Müdigkeit. Mit einem Satz springt sie vom Boden auf, streicht sich kurz übers Haar, das schon wieder wie ein zerzaustes Vogelnest aussieht, und macht sich auf dem Heimweg. Sie läuft quer über die Wiese, klettert über einen herab hängenden Drahtzaun und trottet dann den Weg entlang, der neben der staubigen, gewundenen Straße herführt. Sie kann weit über das Land schauen und weit hinten erblickt sie den hohen Wachturm mitten auf dem Feld vor einer graubewachsenen Böschung. Einsam und majestätisch steht er da, als könne nichts ihn erschüttern, schon gar nicht Wind und Wetter.
Ein Rudel Rehe schreitet gemessen über den Weg und ein Kaninchen huscht vor ihr ins Gebüsch, dicke Grasbüschel sprießen tapfer aus dem grauen Sand, in der Ferne ertönt das Brummen eines Traktors.
Endlich hat sie das Dorf erreicht. Sie hüpft die baumbeschattete Straße entlang und ihre Sandalen klappern auf dem grauen Kopfsteinpflaster. Einen Augenblick fallen gelbe Sonnenstrahlen durch die Blätter auf sie herab, im nächsten kühler blauer Schatten.
Da geht die Straße ein wenig bergab, und hinten am Gartentor steht schon Mama und wartet. Ari fängt an zu laufen, ruft »juchhu, da bin ich schon«, und rennt laut kreischend der Mutter in die ausgebreiteten Arme.
Über ihnen steigt eine Lerche jubilierend in den blauen Himmel hinauf, Struppi springt laut bellend an ihr hoch, es riecht nach Geranien und Phlox und Sommer, die Augen der Mutter lachen und ihre Hand ist warm und fest.
Das ist Aris Welt.
Seefeld
Ängste und Träume
Die Nächte sind am schlimmsten. Schon die Tage sind übel, aber die Nächte …