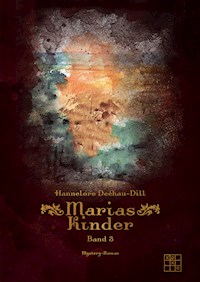Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jasmin wächst in der kalten Atmosphäre eines konventionellen Elternhauses auf. Ihr Bruder, die einzige Bezugsperson, verlässt die Familie früh. Seitdem ist sie allein und kämpft zunehmend mit den Hürden des Älterwerdens. Ein grauroter Morgen folgt dem nächsten. Ihr einziger Wunsch ist es, ihrem Bruder zu folgen – irgendwann. Eines Tages landet Jasmin ohne Erinnerungen in der Psychiatrie. Erst nach langer Zeit wird sie wieder entlassen. Doch die nächste Falle wartet bereits.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Grauroter Morgen
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-056-9
E-Book-ISBN: 978-3-96752-556-4
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 160949075
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle
Im Himmel ist Gnade
Im HIER und JETZT
Es ist Sommer. Ein heller, leuchtender Sommertag. Ich spüre einen warmen Windhauch an meinen nackten Beinen und schaue nach unten. Ja, ich trage Söckchen, zum ersten Mal in diesem Jahr. Sie sind rotweiß-gestreift und neu. Auch die Sandalen sind nagelneu, aus weißem, durchbrochenem Leder.
Ich erinnere mich, wie gut sie gerochen haben, als ich sie aus dem Schuhkarton nahm.
Karlchen hatte sie mit mir zusammen ausgesucht. Karlchen ist unser Dienstmädchen, und eigentlich heißt sie Karla. Sie jung und hübsch und lustig.
Nun hüpfe ich an ihrer Hand die Straße entlang und bin glücklich über meine prächtigen neuen Sandalen.
Ich blicke zu Karlchen auf, und da ist es plötzlich gar nicht mehr das fröhliche Gesicht Karlas, das auf mich herunter lacht. Auf unerklärliche Weise hat es sich in das Gesicht der Mutter verwandelt, und das schaut keineswegs fröhlich drein. Auf einmal wird der Tag dunkel, die Sonne ist hinter Wolken verschwunden, Mutters Hand zerrt mich ungeduldig hinter sich her.
Ich will das nicht, ich will Mutter nicht hier neben mir haben. Sie passt gar nicht hierher. Ich reiße mich von ihrer Umklammerung los und laufe davon.
Ich renne die Straße entlang. Meine neuen Sandalen klappern auf den Pflastersteinen, Mutters energisches Rufen hallt wütend hinter mir her. Endlich verstummt es, ich bleibe schnaufend stehen und blicke mich um. Da ist niemand mehr, keine Mutter hinter mir und auch sonst keine Menschenseele auf der Straße. Dunkle Wolken sind heran gezogen, hoch über mir schreien ein paar Vögel, und ich höre ein Rascheln in der Hecke, als sei ein Tier durch das Gebüsch gehuscht. Dann ist alles wieder still.
Der Himmel wird immer dunkler, ich habe Angst. Ich laufe weiter, von einer Straße in die andere, alle sind mir fremd. Meine Angst wächst. Ich biege in eine kleine Nebenstraße ein, endlich, dort am Ende muss unser Haus stehen. Ich renne und renne, dann bin ich da. Atemlos bleibe ich stehen. Da ist aber kein Haus, weder unseres noch ein fremdes. Nur ein hohes, dunkles Tor ragt vor mir auf, an dessen beiden Seiten eine graue Steinmauer anschließt. Mit beiden Händen rüttle ich an dem Tor, aber es rührt sich nicht. Es bleibt verschlossen.
»Karlchen!« rufe ich voller Angst, und dann auch »Mutter!« Aber kein Karlchen kommt mir zu Hilfe, und die Mutter schon gar nicht. Der bin ich ja davon gelaufen, da wird sie sich denken: Recht geschieht es dem unartigen Kind!
Ich hämmere mit beiden Fäusten an das grässliche Eisentor und weine und schluchze zum Gotterbarmen. Plötzlich gibt das Tor unter meinen Fäusten nach und öffnet sich. Ach, bin ich froh und erleichtert! Dann bleibe ich wie erstarrt stehen. Da ist nichts hinter dem Tor, rein gar nichts. Ein graues, unheimliches Nichts! Und aus dem grauen, unheimlichen Nichts ertönt ein Weinen, ein klägliches Kinderweinen. Über alle Maßen jammervoll und traurig. Ich schreie, schreie gellend – und erwache.
Erstickt keuchend fahre ich aus dem Schlaf hoch und blicke mich verstört im Raum um. Ich bin allein, niemand weint. Zitternd atme ich einmal tief durch und vergrabe das Gesicht unter dem Kissen. Mein Körper entspannt sich, das Herz schlägt wieder regelmäßig.
Der Traum lässt ein Gefühl bohrender Angst und dumpfer Einsamkeit zurück – und eine Erinnerung an jemanden, der weint, traurig, hoffnungslos, echt.
Ich kenne den Traum, er plagt mich nicht zum ersten Mal. In Abständen kehrt er immer wieder. Genau wie der andere, in dem ich allein in der Dunkelheit liege, in einem feuchten, übelriechenden Bett – ich habe es nass gemacht – und mir wünsche, dass Mutter kommt.
Diese beiden Träume habe ich, so lange ich denken kann, allmählich sollte ich an sie gewöhnt sein. Und doch spüre ich jedes Mal die gleiche Angst, die gleiche schreckliche Einsamkeit.
Ich liege ausgestreckt auf meinem Bett und blinzle in den Morgen. Diffuses graues Morgenlicht drängt sich unter den zugezogenen Vorhängen in den Raum. Ich fühle mich schwer, träge, benommen. Vielleicht kommt das von den neuen Tabletten, die der Arzt mir gegeben hat. Oder ganz einfach von meinen unruhigen Nächten und den wirren Träumen.
Ich quäle mich aus dem Bett und tappe ans Fenster, ziehe die Vorhänge zurück. Ein grauer, verhangener Herbstmorgen. Zwei Frauen in Schwesterntracht eilen geschäftig den Sandweg zwischen den Rasenflächen entlang. Der Park dahinter liegt in rötlich gelbem Nebel. Ich öffne das Fenster und rieche den Herbst. Das Laub beginnt sich zu färben. Die Kronen der Kastanienbäume auf dem Rasen sind bereits dunkelrot und gelb und braun. Überall liegen Kastanien.
Was für ein melancholischer Ort ist dieses im Winter. Ich kenne das schon, es wird der zweite Winter sein, den ich in dieser Klinik zubringe. Ich erinnere mich gut, wie es vor einem Jahr war. Alles schien sich in einem Zustand des Verfalls zu befinden, der Garten, das Gelände hinter den Nebengebäuden mit den hohen Bäumen und Büschen, die angrenzende Wiese, der Park. Eine dicke Schicht Laub bedeckte den Boden und erfüllte die Luft mit Torfgeruch, herabgestürzte Äste waren verstreut, ein vom Sturm gefällter Baum am Rande des Parks. Weit und breit kein anderes Haus, kein Ort, nur kahle Felder, ein bisschen Wald. Und dann dieses Haus, mächtig und grau und düster. Voller Stimmen und Geräusche, Tag und Nacht.
Kalte Luft dringt ins Zimmer, ich zerre mir meinen alten blauen Bademantel über die Schultern und trete ans Waschbecken. Ein schaler, ungewohnter Geschmack in meinem Mund, wohl auch eine Begleiterscheinung der neuen Medikamente. Ich trinke ein Glas Wasser aus dem Hahn, es ist eiskalt und schmeckt nach Eisen. Ich mag das gern, den Geschmack von kaltem Wasser auf der Zunge.
Da vor mir ist der Spiegel, ein Spiegel ohne Rahmen und jegliche Verzierung, so einfach und billig wie möglich. Wie alles hier.
Im Spiegel nichts als ein verschwommener Fleck. Ich runzle die Stirn, kneife die Augen zusammen und schaue noch einmal hin. Beuge mich nach vorn, das Gesicht wird scharf. Mein Gesicht, ich kenne es in allen Einzelheiten. Obwohl es nicht mehr das runde Pausbackengesicht von einst ist, mag ich es immer noch nicht.
Aber das ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist eher so, dass ich mich daran gewöhnt habe, dass ich nicht mehr darüber nachdenke. Vielleicht habe ich es sogar akzeptiert in all seiner Unschönheit und Unregelmäßigkeit.
Was für Worte ich für mich finde! Nun ja, hässlich soll ich mich nicht nennen, laut Dr. Oskar Grabowski. Ich soll mich akzeptieren und mögen lernen (um nicht zu sagen: lieben – was wohl niemals passieren wird). Er findet mein Gesicht nicht hässlich, eher interessant. Sagt man das nicht von Frauen, wenn sie hässlich sind: Interessant? Mir soll’s Recht sein. Wenn Oskar es so haben will …
Ich mustere mich im Spiegel. Ein sehr blasses Gesicht, unreine, teigige Haut (wahrscheinlich von der Klinikluft und all den Medikamenten), umrahmt von sehr kurzem Haar, schwarz und schlecht geschnitten. Dunkle Brauen unter einer weißen Stirn, ein Paar trübe, dunkle Augen mit kurzen, geraden Wimpern, eine unscheinbare Nase, ein zu großer Mund mit unregelmäßigen Zähnen.
Ich starre mich im Spiegel an. Dies ist Jasmin van Hayden. Hier ist sie gelandet, und das hier ist ihr Leben! Sie erschrickt nicht, wenn sie ihr Gesicht oder ihren Körper im Spiegel sieht, das hat sie sich abgewöhnt. Sie ist 24 Jahre alt und hat bereits eine Menge hinter sich. Eine ganze Menge, und das Wenigste davon war gut.
Jasmin! Was für ein Name für eine Person wie mich! Als mein Vater den für mich aussuchte, hatte er nicht die geringste Ahnung davon, wie ich mich entwickeln und wie schlecht er für mich passen würde.
Jasmin – das klingt nach duftendem Sommer und weißen Blüten, zart und lieblich. Zart und lieblich – ich muss lachen. Mein Lachen klingt hart und heiser.
Zart und lieblich bin ich mein Lebtag nicht gewesen, soviel steht fest. Wie ich am Tage meiner Geburt aussah, weiß ich nicht. Vielleicht war ich lieblich und süß und zart.
Ich bin wohl als Wonneproppen auf die Welt gekommen, was bei einem Baby immerhin den Vorteil hat, dass es gleich glatt und schier aussieht. Mit dem Tuff schwarzer Haare auf dem Kopf, den weichen runden Bäckchen und den großen Augen mag ich damals ganz niedlich gewesen sein. Nur hielt das nicht an. Leider. Aber davon später.
Immerhin, den Namen Jasmin Melusine hatte ich weg. Wie Vater auf Melusine gekommen ist, weiß ich nicht. Es klang in seinen Ohren wohl romantisch und verheißungsvoll. Als Kind habe ich einmal in einem Wörterbuch nachgeschlagen (ich konnte schon mit 5 Jahren lesen), demnach soll Melusine eine vorchristliche Wassernixe gewesen sein, die zur Verwandlung fähig war. Eine Abbildung zeigte sie mit Flügeln und zwei Schwänzen. Die Flügel fand ich sehr schön und nützlich, die Schwänze weniger, zumindest hätte mir einer gereicht. Auf die Verwandlung habe ich als kleines Mädchen lange Zeit gewartet, sie trat aber nicht ein.
Jasmin Melusine van Hayden, welch klangvoller, hochtrabender Name für eine Person wie mich! Ich habe gelernt, damit zu leben. Zwar hat es Zeiten gegeben, in denen ich lieber eine Inge Müller oder Katrin Schmidt gewesen wäre, aber da half ja nun nichts.
Ich blieb Jasmin Melusine.
Mein Bruder nannte mich Jassi, meine Mutter ganz vornehm Jasmin – da kam nichts Anderes in Frage. Und Vater verstieg sich eine Zeitlang sogar dazu, mich Jasmin Melusine zu nennen. Das verging ihm aber bald, vielleicht fand er es selber lächerlich. Dann ging er dazu über, mich Mine zu nennen. Das war schon passender. Bis Mutter einschritt. Mine – was sollte das? Mine klingt nach Dienstboten, und von denen waren die van Haydens Welten entfernt. Also wurde ich für Vater irgendwann auch Jasmin.
Das Haus um mich herum erwacht zum Leben. Stimmen und Geräusche sind zu hören, Türenklappen, Rufe und Schritte auf dem Flur. Es ist ein lautes Haus mit dünnen Wänden, sehr hellhörig. Mich stört das nicht, im Gegenteil. Oft höre ich die Geräusche außerhalb meines Zimmers gar nicht, so weit fort bin ich – oder so tief in mir selbst.
Es ist noch früh. Viel zu früh, um sich fertig zu machen und zum Frühstück zu gehen. Außerdem habe ich sowieso keinen Hunger. Ich friere, also schlüpfe ich zurück ins Bett.
Dort liege ich und starre an die Decke. Ein brauner Fleck hat sich da oben ausgebreitet, der im Laufe der Zeit immer größer geworden ist. An den Rändern haben sich Zacken gebildet, fast wie bei einem vielzackigen Stern. Als ich hier einzog, war der Fleck noch nicht einmal halb so groß. Welche Größe wird er angenommen haben, wenn ich dieses Haus verlasse?
Wenn ich die Augen schließe, verwandelt sich mein Kopf in eine Höhle, und da sind sie – die Bilder.
Sie haben sich verändert, seitdem ich hier bin. Oder vielmehr: es sind mehr geworden. Besonders seitdem man meine Tablettenration herabgesetzt hat.
Es geht dir besser, hat Oskar gesagt. Möglich, ich fühle mich auch anders. Ist also etwas dran an der alten Weisheit: die Zeit heilt alle Wunden? Oder sind es die Medikamente, die ich kiloweise geschluckt haben muss? Ich habe nicht viel Vertrauen in das Zeug, aber vielleicht irre ich mich ja.
Vater sagte stets: Was von allein gekommen ist, muss auch von allein verschwinden. Womit er sämtliche Krankheiten meinte, angefangen beim Schnupfen und endend bei Krebs und Syphilis. Wobei ich von Syphilis keine Ahnung habe.
In meinem Kopf jedenfalls hat sich einiges verändert. Die verschwommenen Bilder in dieser nebligen, dunklen Landschaft meines Hirns sind klarer geworden, die Stimmen hinter der Stirn auch.
Das ist gut, sagt Oskar. Du wirst dich erinnern. Du kannst wieder klar denken und urteilen. Eines Tages kannst du deine Vergangenheit hinter dir lassen und an die Zukunft denken …
Es gibt ein Loch in meinem Leben. Darin verbirgt sich ein schmutziges, dunkles Kapitel. Das weiß ich, obwohl mir die Erinnerung daran fehlt. Vor einiger Zeit drohte ich in unzähligen Nächten immer wieder hinein zu fallen, in dieses Loch. Aber immer wieder ist es mir gelungen, das Loch zu schließen. Den Bogen hatte ich ganz gut raus. Ich weiß nämlich, es ist nichts Gutes, was darin lauert. Früher hat es gegärt und gebrodelt. Heute ist es still.
Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls nicht alles, nicht das Schlimmste. Dabei weiß ich längst, was sich zugetragen hat. Mutter hat es mir oft aufs Butterbrot geschmiert. Es sind aber nur Worte – ihre Worte, und das ist etwas ganz Anderes als eine eigene Erinnerung.
Seit kurzem nun kommen andere Erinnerungen, ganz normale Kindheitserlebnisse, wie sie vielleicht jeder hat. Auch die hatte ich lange Zeit vergessen. Als ich hierher kam, war in mir nur ein brodelnder Müllhaufen, ein scheußliches, widerwärtiges Gewirr von Geräuschen, Gedanken, Stimmen - in mir und um mich herum. Mein Inneres und das ganze Zimmer schienen voll davon. Und voll von der grauenhaften, würgenden Angst …
Im Laufe der Zeit haben die Stimmen sich verwandelt, bewegten sich hin und her wie Geräusche fahrender Züge. Das habe ich heute noch manchmal. Ich beuge mich vor, um den Wind zu hören, der vor dem Fenster tobt, dann sind da die Stimmen. Leos Stimme ist auch darunter. Mein Bruder Leonhard, mein Bruder und einziger Freund …
Und manchmal, wenn der Wind leiser wird, höre ich den zarten Klang des Mobiles darin, das Leo als Junge gebastelt hat. Es war gemacht aus silbrigen Metallstäben, Holz und Federn, und es hing auf der Veranda, vor Vaters Fenster.
Es war ein Geburtstagsgeschenk für Vater gewesen, und Vater liebte es sehr.
Mitunter spüre ich im Halbschlaf Leos Hände, seine Arme. Dann ist es wie warme, alles umfassende Liebe. Als wäre er bei mir im Zimmer und hielte mich, wie er mich als Kind oft gehalten und getröstet hat.
Wenn ich dann zu mir komme, ist da nur Kälte, eine fest zupackende Kälte, die von außen und innen gleichzeitig zu kommen scheint, und die mich erschreckt und zittern lässt.
Und dann das Weinen, ein Kinderweinen – das ist am schlimmsten. Ich glaube ein Kind weinen und klagen zu hören. Es ist so deutlich, dass ich das Gefühl habe, nur die Arme ausstrecken zu müssen, um sie zu fühlen, an mich zu ziehen, sie zu beschützen – wie ich es mir an dem Tag gewünscht hätte, als sie starb, meine arme Kleine…
Aber in Wirklichkeit sitze ich still und steif da und lausche nur in mich hinein, versuche zu verstehen, woher das Geräusch kommt, das Klimpern einer Spieldose …
Da ist das Loch. Ich will nichts mehr hören, nichts mehr denken; das Weinen und das Spieldosen-Geklimper sind nur Einbildung. In Wirklichkeit war alles ganz anders …
Ich erinnere mich, was für ein Gefühl es war, mein Kind auf dem Arm zu halten. Es war so gut, den warmen, festen Körper zu fühlen, das Windelpaket unter dem weißen Höschen, den runden Arm im Nacken, und das Babygesicht so dicht vor meinen Augen. Ein hübsches Kind, ein süßes Kind. Mein Kind.
Amelie.
Ich vergrabe meinen Kopf im Kissen und weine.
Klinik-Leben
Es ist Nachmittag. Ich sitze im Aufenthaltsraum, neben mir auf dem Boden kauert Nele. In der rechten Hand hält sie ihre Zigarette, die linke fährt unruhig über ihren Schoß. Nele qualmt unentwegt. Ihre Finger sind teilweise gelblich braun vom Nikotin. Wie oft hat sie schon gesagt: Ich will es mir nun abgewöhnen, diese elende Qualmerei. Dann lässt sie eine Weile die Finger davon – eine Stunde, auch zwei. Einmal hat sie es bis zu vier Stunden geschafft. Da rannte sie wie gehetzt in der Halle auf und ab, die Hände in den Hosentaschen, den Blick zu Boden gesenkt.
Ich will den Scheiß nicht mehr, nun ist Schluss damit, murmelt sie vor sich hin. Dann kapituliert sie. Ach was, warum gerade jetzt. Das nehme ich mir für später vor. Wenn es mir besser geht. Wenn ich hier raus bin aus diesem Chaotenstall …
Sie wirft sich neben mich auf das eingebeulte, altersschwache Sofa, dass es in seinen Eingeweiden quietscht und kracht. Dann wühlt sie in ihren Taschen nach den Zigaretten. Nele ist groß und mager, weißblondes, halblanges Haar mit gelblichen Strähnen darin. Ich kenne sie nun, solange ich hier bin. Das heißt, eigentlich so lange ich mich erinnere. In der ersten Zeit war ich nicht wirklich »hier«. Ich lebte in einer anderen, unwirklichen Welt, zu der niemand Zugang fand.
Dann waren da noch die Medikamente. Ich schätze mal, ganze Wagenladungen davon, immer was Neues, Anderes. Ich erinnere mich kaum daran. Sie haben mich ruhiggestellt und wer weiß, was noch. Anfangs muss ich wohl ziemlich aus der Spur gewesen sein, soll getobt und geschrien haben. Und nur wirres Zeug geredet. Darum die Medikamente, eine andere Therapie war nicht möglich. Mit der Zeit wurde es besser, irgendwann nahm ich die Umwelt wieder wahr. Ich wachte auf in einer Welt, die nichts zu tun hatte mit meinem früheren Leben: in einer Klinikwelt unter halb oder ganz Verrückten. Ich sollte das nicht sagen, ich weiß. Aber jeder, der hier ein paar Tage und Nächte zugebracht hat, wird mir beipflichten.
Ich habe Freunde gefunden, kann jetzt an der Beschäftigungstherapie außerhalb dieser Abteilung teilnehmen. Ich versuche mich im Emaillieren und Batiken, habe einen schiefen Ascher aus Ton geformt und ein Halstuch mit grässlichen Gestalten bemalt.
Und dann ist da mein Therapeut Oskar. Er hat viel Geduld mit mir. Seit kurzem sehen wir uns zwei bis dreimal in der Woche für eine Stunde. Das ist nicht viel. Oskar ist der einzige Psychologe für zwei Stationen. Sparmaßnahmen. Diese Klinik ist nicht die feudalste, für eine bessere war kein Geld.
Ich habe Oskar gefragt: »Bin ich verrückt? Das hier ist doch eine Irrenanstalt! Was ist los mit mir? Wie nennt man die Krankheit, die ich habe? Ist es Schizophrenie oder Zyklothymie? Oder irgendeine Psychose? Was ist überhaupt eine Psychose?«
»Nun klammere dich nicht an diese Begriffe. Dein seelisches Gleichgewicht ist gestört. Bestimmte Erlebnisse in deiner Vergangenheit waren so schlimm für dich, dass du sie vergessen hast, ein Selbstschutz, würde ich sagen. Wenn du soweit bist, es mit deiner Vergangenheit aufzunehmen, werden die Erinnerungen zurück kehren. Dann werden wir uns gemeinsam damit befassen.
Der Begriff Psychose ist für meinen Geschmack so abstrakt und schwer erklärbar. Er beinhaltet unter anderem Halluzinationen, wahnhafte Störungen oder bestimmte Formen abnormen Verhaltens, wie schwere Erregungszustände, Überaktivität, katatone Störungen.
Ich betrachte es manchmal als Versteck.
Es geht darum, dass alle normalen Verteidigungsmechanismen zusammen gebrochen sind. Der Weg in die Seele steht offen, alle Welt kann dort herum trampeln. Auch der unschuldigste Annäherungsversuch wird als feindlicher Angriff erlebt. Der Kranke hat sich ein Versteck gesucht. Er versucht zu überleben, indem er eine Überlebensstrategie entwickelt. Eine Art korrigierende Instanz, die nach und nach vollständig die Oberhand gewinnt und seine Freiheit und die Möglichkeit zu eigenen Entscheidungen einschränkt.
So ähnlich ist es auch bei dir gewesen, als du hier ankamst. Aber inzwischen sind wir doch ein ganzes Stück weiter gekommen, meinst du nicht?«
Das war am Anfang unserer Therapiestunden. Sicher bin ich heute anders davor als damals.
Und doch, ich bin ungeduldig. Nun, da ich wieder einen annähernd klaren Kopf habe, soll meine Gesundung schneller voran gehen.
Da ist zum Beispiel meine Therapiestunde bei Oskar, ich kann mich nicht immer konzentrieren. Ich hocke auf meinem Stuhl, habe feuchte Hände und fange an zu zittern. Wenn er mich auffordert, von mir zu reden, ihm zu sagen, wie es mir geht, verschwimmt sein Gesicht vor meinen Augen; es beginnt in meinen Ohren zu rauschen, ich höre ihn kaum. Ganz langsam komme ich wieder zu mir. Dann ist meine Zeit bei Oskar fast um. Was für ein Jammer, denn kaum bin ich wieder in meinem Zimmer, fallen die Dinge über mich her.
Die Dinge – damit meine ich etwas von dem, was in mir schwelt. Was langsam zum Leben erwacht und scheinbar nach oben will. Es sind Bilder und Gesichter, Erinnerungsfetzen, Teile eines Puzzles.
»Die Zeit bei dir reicht mir nicht,« jammere ich, wenn Oskar einen demonstrativen Blick auf seine Armbanduhr wirft. »Ich brauche mehr Zeit, um mich zu konzentrieren. Jetzt – jetzt könnte ich reden …«
Oskar ist unerbittlich. Er ist streng. Nun zuckt er die Schultern.
»Die nächste Patientin wartet,« sagt er ruhig. »Du weißt, Jassi, dass du nicht die Einzige bist.«
»Aber was soll ich denn tun?« schreie ich los. »Ich kann doch nichts dafür, wenn ich mich so schlecht konzentrieren kann. Jetzt könnte ich …«
»Tut mir leid, die Zeit ist herum.«
Er blickt mich forschend an. Was mag er denken, wenn er mich so sieht: mit verkniffenem Gesicht, wilden Augen und gesträubtem Gefieder?
»Es wird schon besser werden,« tröstet er mich. »Du bist zu ungeduldig mit dir. Weißt du, Jassi, ich mache dir einen Vorschlag. Hol dir aus dem Büro Schreibpapier und Bleistift. Schreib es auf! Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Egal, was es ist. Schreiben kann helfen.«
Schreiben kann helfen? Was faselt er da? Ich kann nicht aufschreiben, was in meinem Kopf vorgeht. Das ist doch Unsinn. Ich brauche ein Gegenüber zum Reden. Ich brauche ihn.
»Versuch es,« sagt Oskar abschließend. »Einen Versuch ist es wert.«
Damit bin ich entlassen. Die nächste Therapiestunde ist übermorgen.
Später hocke ich neben Nele auf dem morschen Sofa in der Halle und hadere mit mir selber. Warum will mein Kopf mir nicht gehorchen? Mein Körper ebenso wenig, der macht doch auch, was er will. Ich kriege beides nicht unter einen Hut. Mein ganzes Ich scheint gespalten.
Was ist das für eine Konfusion? Ich kann meine Gedanken nicht ordnen, mein Gehirn schwimmt zeitweise in dichtem Nebel, und manchmal glaube ich in einer früheren Zeit zu leben.
Das geht vorbei, tröstet Nele mich. Ähnlich erging es mir auch. Zum Teil kommt das von den verdammten Pillen, die sie einem einflößen. Leider scheint es nicht ohne das Zeug zu gehen.
Oskar nennt es eine geistige Konfusion, eine Störung vorübergehender Art. Ich soll mir Zeit lassen. Als ob nicht schon genug Zeit vergangen ist in diesem elenden Loch!
Nele neben mir qualmt, was das Zeug hält. Ich sitze stumm da und beobachte das Leben um mich herum. Wenn man es denn Leben nennen kann. Zum Teil ist es ein Wahnsinn. Allein diese Geräuschkulisse. Wir haben hier alles, was das Herz begehrt, von Neurosen über Paranoia bis hin zu Psychosen. Es ist Abteilung Sieben Nord der Psychiatrischen Klinik, die mit den schlimmsten Fällen.
Die skurrilsten Gestalten bevölkern die Halle. Von irgendwoher ertönt Musik, dazwischen Stimmengewirr, Seufzen, Stöhnen, Flüstern, ab und zu ein Schrei der Angst oder das Krachen eines Stuhls, der zu Boden geschleudert wird. Hin und wieder ein Brüllen von Patienten, die ihren Schmerz oder ihre Wut ausagieren.
Was für eine verrückte Welt. Sie erscheint mir nicht mehr schrecklich oder unerträglich, ich bin an sie gewöhnt. Bin ein Teil von ihr geworden. Ob ich wohl auch irgendwann so in einer Ecke gehockt und gewimmert habe? Vielleicht habe ich so wie die zornige Marie HalmaSteinchen und Trinkbecher an die Wand geschmissen oder die Betreuer mit unflätigen Schimpfwörtern bedacht. So wie die kleine Manu mit ihren Wutausbrüchen.
Maren mit dem langen Zopf ist magersüchtig. Ständig hat sie Angst, jemand könnte ihr im Schlaf etwas einflößen, was dick macht.
»Seht mich doch an, Kinder! Schaut auf meine Hüften! Die werden immer dicker. Welches Miststück hat mir da was ins Essen getan, was mir den Bauch so aufschwemmt.«
Dabei hat sie weder einen aufgeschwemmten Bauch noch runde Hüften. Im Gegenteil.
Aber niemand sagt noch: »Sieh doch mal in den Spiegel. Da sind nur Haut und Knochen.«
Denn so ist es, die ganze Maren besteht aus Haut und Knochen. Es hat aber keinen Zweck, ihr das zu sagen, sie glaubt es nicht. Wenn sie in den Spiegel blickt, sieht sie etwas anderes als wir. Wahrscheinlich eine Maren mit fettem Hintern und dickem Bauch. Ihr Blick ist getrübt.
»Es sind die Injektionen, verdammt noch mal,« flucht sie lauthals. »Die machen mich so dick.«
Damit rennt sie ins Klo, um sich den Finger in den Hals zu stecken.
Wir haben hier Helfer auf der Station. Es sind Kriegsdienstverweigerer. Sie spielen mit den Patienten Halma und »Mensch ärgere dich nicht«, gehen mit ihnen in den Park und reden mit ihnen. Sie hören zu, trösten und schlichten Streitereien, die hier auch zum Alltag gehören.
Nele ist manisch depressiv. Ich kenne nun schon ihre unterschiedlichen Phasen. Wenn sie mit glänzenden Augen in ihren exzentrischen bunten Klamotten auftaucht, ist die manische Periode angesagt. Dann lebt sie in einem Zustand unvorstellbarer Euphorie und Aufregung, dass man vor Neid erblassen könnte.
Sie tanzt lachend und singend herum, erzählt Witze mit feuerwehrartiger Geschwindigkeit. Sie kann nicht ruhig sitzen, läuft durch die Station und vergisst sämtliche Regeln.
Manchmal geht sie herum und lacht über alles und jeden. Sie verhöhnt die arme Anna mit ihren Phobien und äfft den langen Axel nach, wie er den Gang entlang schlurft. Dabei wird sie oft ausfallend, reißt obszöne Witze und lacht selbst am tollsten darüber.
Ihre Sinne sind viel schärfer als im normalen Zustand. Es kommt vor, dass sie für kurze Zeit in einer Ecke hockt und vor sich hin kritzelt. In Windeseile hat sie ein Gedicht oder eine kleine Erzählung verfasst.
Lange kann sie sich nicht konzentrieren, dann springt sie wieder auf und rennt herum. Beim geringsten Widerstand wird sie zornig, schlägt um sich oder reißt sich die Kleider vom Leib.
Ich habe ein paar ihrer Geschichten und Gedichte gelesen, die sie geschrieben hat, und ich habe über die absurde, poetische Schönheit gestaunt, die sie enthalten. Sie waren voller freier, sinnloser Assoziationen, und die unbeschreibliche Euphorie kam ständig zum Ausdruck.
Nach ihren fröhlichen Ausschweifungen der manischen Periode kommt die Depression, die Melancholie. Ich habe erlebt, wie Nele buchstäblich zusammenfällt. Sie fühlt sich unwürdig und schuldig, nennt sich selbst eine gemeine Lügnerin, die anderen nur wehtut. An solchen Tagen wird sie sorgfältig überwacht, um eine Kurzschlusshandlung zu verhindern. Ständig ist ein Betreuer in ihrer Nähe, sitzt sogar nachts vor ihrer Tür und schaut ab und zu ins Zimmer hinein.
So wie gestern. Am Morgen, als ich zur Beschäftigungstherapie ging, hat sie mich gebeten, ihr eine Schere aus dem Bastelraum zu besorgen, mit der sie sich die Pulsadern aufschneiden wollte.
»Ich will ein Ende machen,« sagt sie und saugt wütend an ihrer Zigarette. »Ich habe es satt, bis obenhin. In dieser Nacht mache ich Schluss, schneide mir die Pulsadern auf. Das ist ein angenehmer Tod, sagt man. Vielleicht viel zu angenehm für mich, eigentlich habe ich Schlimmeres verdient. Am liebsten wären mir ja Schlaftabletten, das muss schön sein. Man schluckt das Zeug, schläft sanft ein und wacht nie mehr auf. Aber da kommen wir nicht ran …«
Schlaftabletten! Man schluckt das Zeug, schläft sanft ein und wacht nie mehr auf – muss das schön sein …
Ein seltsames Gefühl steigt in mir hoch. Und mit ihm die Gewissheit: oh nein, das ist nicht schön. Vielleicht manchmal. Aber nicht immer.
Dieses seltsame Gefühl was ist das nur? Schmerz, eine bohrende Verzweiflung, mein Herz klopft wild und meine Augen sind so trocken, dass sie sich wie Schmirgelpapier anfühlen …
Eine Erinnerung!
Sie überkommt mich so jäh und überwältigend, dass mir die Knie zittern. Während Nele neben mir mit monotoner Stimme über ihr elendes Leben lamentiert, hat sich für mich die Zeit zurück gespult. Ich bin wieder 17, im Haus meiner Eltern, in meinem eigenen Zimmer. Ich hocke auf dem Teppich wie ein kranker Hund, starre vor mich hin, kraftlos und leer. Versuche zu begreifen, was geschehen ist. Er hat mich verlassen, der Junge, von dem ich glaubte, er liebt mich. Er war der einzige Junge, der mich je angesehen hat. Und nun ist er fort. Er hat mich niemals geliebt, hat mich nur ausgenutzt – ganz so, wie Vater immer sagte. Du hässliches Pummelchen, schau dich doch an. Bildest dir ein, er liebt dich! Was glaubst du denn! Nur das Eine will er von dir, dann wirft er dich weg wie einen alten Schuh.
Mutter hatte bekräftigend genickt. Auch sie war dieser Meinung, oh ja. Welcher Junge würde die dicke Jassi schon lieben! Der musste erst noch geboren werden.
Aber sie, die dicke Jassi mit den Pausbacken – sie war dumm genug gewesen, es zu glauben.
Und nun war genau das geschehen, was Vater angekündigt hatte: Er hat mich weggeworfen wie einen alten Schuh!
Jetzt war er fort, ließ sich nicht mehr blicken. Aus und Ende, und ich bin wieder allein.
Da sitze ich nun am Boden, hinter mir auf dem Regal meine Bücher, Plüschbären und Kuscheltiere, und vor mir das Fenster mit der rabenschwarzen Nacht dahinter. Draußen so schwarz wie innen in mir drin. Rings herum nur Dunkelheit und Schwärze.
Ich sitze da und zittere, klappere mit den Zähnen, zucke an allen Gliedern. Ich kann nicht weinen, noch nicht. Wird schon noch kommen, ich kenne mich. Jetzt sind meine Augen trocken wie Sandpapier.
Ich blicke um mich mit diesen Sandpapier-Augen, in mir Enttäuschung und Schmerz. Was ist das da unter dem Bett, was für ein Bündel? Es jagt mir Angst ein. Dann erkenne ich, was es ist. Die alte Reisetasche mit meinen Geheimnissen darin. Die tun mir nichts. Hier in meinem Zimmer ist alles sicher und vertraut. Die Stimme am Telefon kam von außen – seine Stimme. Die mir sagte, dass es vorbei ist …
Aber die Stimme, sie war schrecklich, so schrecklich wie das, was sie sagte – rau, heiser, dumpf. Als wäre es gar nicht seine Stimme …
Und dann der Anrufbeantworter, ich sehe mich wieder unten in der Halle stehen, den Hörer in meiner feuchten Hand. Aber er lässt sich verleugnen. Vielleicht ist er wirklich nicht da. Es ist ja auch egal. Alles ist egal. Er will mich nicht mehr. Weggeworfen wie einen alten Schuh …
Die Erinnerungen an unsere kurze gemeinsame Zeit stürzen auf mich ein. Musik. Küsse. Sein Lachen. Die kurzen gemeinsamen Nächte …
Felix! Ach, wenn er jetzt nur hier wäre. Bei mir. Die Sehnsucht ist wie ein wahnsinniger Schmerz. Und dazu der Kummer, ihn verloren zu haben.
Warum nur? Was ist passiert?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines: ich ertrage es nicht. Ich ertrage den Gedanken nicht, dass es ihm gut geht, dass er seine Zeit an der Seite einer anderen genießt. Sich um eine andere sorgt, eine andere liebt. Mit ihr lacht und all das tut, was er mit mir getan hat.
Und dann kommt mir der Gedanke an Mord, während ich da unten kauere. Mord an der Anderen! Ich weiß, ich brächte es fertig, jetzt in diesem Augenblick. Wenn ich diese Andere jetzt vor mir hätte.
Aber wer ist sie? Gibt es sie überhaupt?
Natürlich muss es sie geben. Warum sonst will er mich nicht mehr sehen? Ich habe mich doch nicht verändert, bin die Gleiche wie gestern und vorgestern. Immer noch die Jasmin, in die er sich verliebt hat.
Oder war das alles gelogen? Schon von Anfang an!
Ich will es nicht glauben, nein, ich will nicht.
Und doch … was weiß ich schon von ihm?
Lüge! Alles Lüge! Von Anfang an!
Wie weh das tut.
Und das Kind – oh Gott, was soll nun werden?
Wie schrecklich, wie entsetzlich. Es den Eltern erzählen müssen. Unvorstellbar. Zunächst ihre Ungläubigkeit, ein Nichtbegreifen, das langsam in Spott und Hohn übergeht, dann die Wut, schließlich auch so etwas wie – Triumph? Und endlich das völlige Begreifen und diese alles überdeckende Angst: Oh Gott, was werden die Leute sagen! Diese Schande! Dieser Makel auf dem Namen der Familie van Hayden! Ein uneheliches Kind in dieser Sippe und nicht mal ein Mann dazu – das hat es noch nicht gegeben …
Ich sehe Mutter vor mir, aufsteigende Panik im Blick, die alles andere hinwegschwemmt …
Vaters gnadenloser Zorn – hinter der weißen Stirn rotiert es bereits: was ist die unauffälligste und effektivste Lösung aus diesem Dilemma …
Ich sehe mich im Geist zitternd vor ihnen stehen und ihr Urteil erwarten. Ich habe auch Angst. Vielleicht weniger vor der Schmach und Schande, die ich über diese Familie gebracht habe, als vor dem Mitleid der Anderen, aber die sind mir sowieso gleichgültig. Die größte Angst habe ich vor der Zukunft.
Ich sitze auf meinem Bett und die Tränen kommen…
Später sehe ich mich wieder auf dem Teppich kauern, in meinen Fingern eine Packung Tabletten. Mutters Tabletten. Wie viele muss ich nehmen, um meinem Leben ein Ende zu setzen, um dieser Hölle zu entkommen? Sie sind stark, das weiß ich. Mutter hat höchstens mal eine halbe davon genommen.
Ich sitze am Boden und stelle mir vor, wie erleichtert sie sein werden, wenn ich tot bin. Oder auch nicht? Schließlich ist es doch eine Schande, wenn die Tochter sich das Leben nimmt.
Fragt sich nun, welche Schande größer ist: eine schwangere 17-Jährige ohne Mann oder ihr Selbstmord. Für Eltern wie meine, die so unglaublich stolz auf ihren Status sind (was immer das zu bedeuten hat), ist beides gleich schlimm. Bei den van Haydens hat beides nicht vorzukommen!
Aber vielleicht kann man einen Selbstmord leichter vertuschen …
Ich sehe das weiße Tablettenhäufchen vor mir auf dem Teppich. Eine kleine Todespyramide. Ein Schlaf ohne Ende, ohne Erwachen. Wie schön das sein muss. Nie mehr aufwachen. Hab ich mir das nicht schon oft gewünscht?
Ich finde mich vor dem Waschbecken im Badezimmer wieder. Als mein Blick auf mein Spiegelbild fällt, richte ich mich auf und starre mich an. Ein rundes, blasses Mondgesicht, die neue Frisur ( ihm zuliebe) zerzaust, das Mascara über die Wangen verteilt, der Lippenstift bis zum Kinn verschmiert. Alles für ihn, für Felix, von dem ich glaubte, er liebt mich.
Was wird er sagen, wenn ich tot bin. Schuldgefühle? Kummer?
Ich sinke vor dem Spiegel zusammen, meine aufgerissenen Augen machen mir Angst. Sie glänzen so seltsam … Ich sehe aus wie eine Verrückte, und vielleicht bin ich genau das …
Ich liege auf dem Bett, starre in die Dunkelheit und warte darauf, dass die Wirkung der 20 Tabletten einsetzt. Mein Magen scheint mit flüssigem Blei gefüllt, dann steigt es heiß und ätzend in die Kehle. Mit knapper Not schaffe ich es ins Bad und übergebe mich. Wieder und wieder. Würge das ganze Zeug aus mir heraus. Nur nicht all meinen Kummer, meinen Groll, meine Not und Verlassenheit.
Anschließend weine ich mich in den Schlaf. Weine mich durch den Traum, der meine Nacht in tausend Stücke reißt. Übrig bleiben eine noch größere Einsamkeit, ein schwelender Zorn und die Angst. Denn da ist immer noch das Kind …
Ein grauroter Morgen folgt.
Diese ganze schreckliche Nacht bleibt mein Geheimnis – bis heute.
Verwirrt und verirrt
Wie muss es sein, in einem dieser Stühle zu sitzen, nicht mehr zwischen Wachen und Schlafen unterscheiden zu können? Die dünnen Haare fallen ihr wirr bis über den Rücken, der graublaue Pullover spannt sich über mageren Schultern, dazu eine ausgebeulte Trainingshose, ein Paar schmutzig-graue Pantoffeln an den Füßen. Eine Frau unbestimmbaren Alters mit unbewegter Miene. Vielleicht irre ich mich, vielleicht kann sie sehr wohl zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Was geht wirklich vor hinter dieser glatten Stirn?
Hat sie sich nur hinter diese starre Fassade zurück gezogen, um dahinter ein anderes, leichteres Leben zu führen? Starrt sie vielleicht in die Vergangenheit, weil sie keine Zukunft für sich mehr sieht? Ich glaube, sie leidet an Katalepsie oder Katatonie. Vor ein paar Tagen hat man sie auf diese Station verlegt. Seitdem sitzt sie da, starrt vor sich hin, wird gefüttert und versorgt. Manchmal hier in der Halle, manchmal in einem der Zimmer.
Schrecklich ist das, so hilflos und auf andere angewiesen zu sein. Sich füttern und waschen zu lassen, diese ganze alltägliche Routine über sich ergehen zu lassen, ohne etwas dagegen tun zu können. Routinemäßige Freundlichkeit und Mitgefühl – wenn überhaupt. Vielleicht manchmal auch Ekel? Wie jämmerlich und traurig und würdelos!
Gemocht zu werden ist eine Voraussetzung fürs Leben, denke ich. Immer. Auch und vielleicht vor allem wenn man alt und verletzlich oder krank ist und schlecht riecht oder einfach nur einsam ist. Nur fällt es den Anderen dann schwerer.
Ich sitze auf dem alten Sofa und beobachte das konfuse Treiben um mich herum. Ich bin erschöpft und träge, habe eine unruhige Nacht hinter mir.
Eine der Pflegerinnen walzt auf knarzenden Gummisohlen vorüber. Sie heißt Ernestine, ist füllig und grauhaarig, auf ihrer Oberlippe sitzt ein Anflug von Schnurrbart. Ihre ewig hurtigen Füße stecken in weichen kleinen Schuhen. Sie sieht aus wie eine Eieruhr in ihrem grauen Kleid.
Ihre kleinen, dunklen Sirupaugen huschen flink umher.
An einem der langen Tische spielen zwei Männer Dame, unterbrechen ihr Spiel immer wieder, um sich wegen nichts und wieder nichts zu zanken oder lautstark Geschichten zu erzählen, die niemandem mehr neu sind.
Eine der Helferinnen fährt unablässig mit Wischtuch und Desinfektionsmitteln durch alle Räume, um die Tische abzuwischen. Ich höre von irgend woher, dass über Nacht jemand gestorben ist. Marion, ein dünnes blasses Ding mit dunklen, ständig umher flitzenden Augen. Ein spitzes Gesicht taucht in meinem Geist auf, liederlich hochgestecktes Haar. Ich kenne sie nicht gut, sie war immer für sich. Woran mag sie gestorben sein? Waren es aufgeschnittene Pulsadern oder Tabletten? Vielleicht lag sie einfach nur da in ihrem Bett, und leise und heimlich kam der Tod geschlichen.
»Hallo Betty, meine Matratze muss umgedreht werden,« kräht der Eine da am Tisch und packt die Helferin am Rock.
»Unsinn, Karl, hab ich gerade gestern erst getan,« ist die kühle Antwort. Karl packt das Mädchen fester und kneift ihr ins Bein, dass Betty laut aufkreischt.
»Du alter Bock, lass mich gefälligst los!«
»Alt, von wegen!« Karl und sein Dame-Partner Udo brechen in schallendes Gelächter aus.
»Ich bin noch keine fünfzig und bestens beieinander, kann’s dir beweisen. Wie wär’s heut Abend?«
Betty schwenkt grinsend ihr Wischtuch und macht sich eilig davon.
Paul kommt aus seinem Zimmer gewankt, in langen Unterhosen und schmutzig-grauem Hemd.
»Nana, Paul, geh dich mal erst richtig anziehen,« sagt die Pflegerin und bleibt vor ihm stehen. »So kannst du dich doch hier nicht sehen lassen.«
Paul schüttelt den Kopf. Er hat Wichtigeres im Sinn als seine Bekleidung. Er tappt auf Strümpfen zum Tisch und zeigt mit dem Finger auf Karl.
»Dem könnt ihr nicht trauen. Er hat ein Hackmesser unter seiner Matratze. Heute Nacht war er in meinem Zimmer und wollte mir den Kopf abschlagen.«
Er sticht mit einem schmutzigen Zeigefinger in die Luft und rollt mit den Augen.
»Das macht er mit uns allen, wenn wie nicht aufpassen. Seine Frau hat er auch umgebracht. Er hat’ s mir selbst erzählt. Sie hat ihm immer nur Pferdefleisch vorgesetzt, das wollte er sich nicht gefallen lassen. Was ich verstehen kann. Aber gleich mit dem Hackmesser auf sie loszugehen – das kann doch nicht sein. Ins Kittchen gehört er, nicht hierher!«
Die Pflegerin nimmt den Zeternden beim Arm und zieht ihn in sein Zimmer zurück.
»Komm Paul. Gleich gibt’s Kaffee im Speisesaal, da willst du doch nicht in diesem Aufzug erscheinen. Es sind doch Damen anwesend.«
Widerstrebend lässt Paul sich wegführen. Mit eingeknickten Knien, rundem Bauch und seiner einzigen Haarsträhne, die er stets sorgfältig über den Schädel verteilt. Hinter der geschlossenen Zimmertür hört man ihn noch eine Weile weiter lamentieren.
Am nächsten Tag ist Paul wieder in Unterhosen unterwegs. Dazu trägt er einen zerbeulten Hut und blitzblanke Schuhe. Scheinbar hat er sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Und gleich wird ihm eine hektisch-fröhliche halbe Stunde zu verdanken sein, indem er das Radio brüllend laut stellt und sich die dicke Ella aus ihrem Zimmer holt. Er hat Lust aufs Tanzen gekriegt, und niemand der Pflegerinnen ist in Sicht.
Paul kann gar nicht tanzen. In seiner langen Unterhose schaukelt er von rechts nach links und schurrt begeistert mit den lackschuhbewehrten Füßen, den Hut locker in der Luft schwenkend, während seine Tanzpartnerin um ihn herum hüpft und sich ihr Körper zu den absonderlichsten Stellungen verrenkt, als wären ihre Knochen verkehrt herum eingeschraubt.
Ein Dutzend Patienten stehen um sie herum und klatschen und kreischen Beifall. Andere schließen sich an und schwingen ebenfalls das Tanzbein. Übermut und Ausgelassenheit kennen keine Grenzen. Die Wogen schlagen hoch, und es ist ein unglaubliches Tohuwabohu, ein ohrenbetäubender Lärm: das brüllende Radio, das Johlen und Kreischen der Patienten und dazwischen das Stampfen und Klatschen von Dutzenden von Füßen und Händen.
Die herbei geeilten Pfleger haben einige Mühe, Ruhe und Ordnung wieder herzustellen.
Das Radio ist längst ausgeschaltet, die Musik ist verstummt, die Patienten sind auseinander gescheucht. Einige haben sich in ihre Zimmer verzogen, andere hocken auf Stühlen in den Ecken. Der gewohnte Alltagstrott ist eingekehrt.
Noch eine ganze Weile hallt die Musik in meinem Kopf nach, während Schreien und Stampfen längst verstummt sind. Vor allem Elvis Presleys samtige Stimme: »As the snow flies. On a cold und gray Chicago morning a poor little baby child is born – in the ghetto. And his mama cries …«
Musik – ich habe sie einmal sehr geliebt. Ich erinnere mich daran …
Ich sehe mich auf der Vordertreppe unseres Hauses sitzen. Es ist Sommer, und die Sonne brennt auf mein Haar. Es reicht mir bis auf die Schultern, und es ist glatt wie Wasser. Gleichgültig, wie man es kämmt, es fällt sofort in flüssige Wellen, und man kann es nicht mehr in Unordnung bringen als einen Wasserfall. Ich bin stolz auf mein Haar – habe ich doch nicht viel, worauf ich stolz sein kann. Nur muss ich es leider meistens in Zöpfe flechten, die so streng nach hinten gekämmt sind, dass sie Kopfschmerzen verursachen, ein schnurgerader Scheitel in der Mitte …
Die Klänge des neuen Cliff-Richard-Songs von drüben wehen zu mir herüber. Ich sitze da und lausche. Warte, bis Elvis dran ist. Elvis Presley! Den liebe ich! Die Eltern glauben nicht, dass ich einen Plattenspieler brauche, auch keinen CD-Player. Eine absolut überflüssige Ausgabe. Schließlich hatten sie in dem Alter auch keinen …
Ich seufze laut, schlinge beide Arme um meine Knie und male meinen Namen in den Staub auf der Treppenstufe. Mir ist fürchterlich langweilig, und heiß ist mir auch. Aber nun – endlich! Elvis samtweiche Stimme weht zu mir herüber. Ganz still sitze ich da und lausche andächtig – »As the snow flies. On a cold und gray Chicago morning a poor little baby child is born – in the ghetto. And his mama cries – «
Dann folgt sein Song: »Always on my mind« und schließlich mein absoluter Lieblingssong »Love me tender.«
Die Stimme in meinem Kopf verändert sich. Ich höre nicht länger »love me tender« in samtweicher ElvisManier. Es ist eine Frauenstimme, die in meinem Kopf klingt – diese Stimme kenne ich doch. Ist das Karlchen, die da singt? Karlchen, die lustige, liebe Begleitung meiner ersten Kinderjahre … der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar … ja, Karlchen ist es, sie hat es mir manchmal vorgesungen!
Die Töne sind nicht länger sanft, sondern laut und unmelodisch – etwas ist erschreckend verändert im Zimmer … ich sinke ein wenig tiefer in den Brunnenschacht, wo der Tod unten wartet … der Tod kreischt und dröhnt, wie splitterndes Glas … nun ist es wieder Elvis, der da singt – aus dem Radio da vor mir im Auto … der Sitz neben mir … mein Arm, meine Hand, die suchend tastet … dunkel und kalt … wo ist mein Kind … diese Dunkelheit und das Dröhnen … Gedanken, die mich überfluten, da in dem Auto … und irgendwo spielt eine Spieldose – ist das der Tod?
Stirbt man denn wirklich, oder ist es nur ein Übergang – Wilma sagte immer … Splittern und Krachen – keine Schmerzen … ich habe keine Angst vor dem Tod … aber mein Kind, es ist noch so klein …
Ich zwinge mich, zurückzukehren.
Zurück in die Wirklichkeit.
Ich bin wieder in der Halle, starre auf meine Hände hinunter. Sie liegen auf den Knien, sind kalt und feucht und zittern, mein Herz rast, dass es mir in den Ohren dröhnt.
Ich kann nicht mehr still sitzen, stehe auf und gehe herum. Ich stehe am Fenster und blicke hinaus. Draußen seufzt der Wind und treibt grauen Schnee gegen die hellen Scheiben. Nirgends bleibt er hängen, er gleitet ab und tropft als Schneeregen hinunter.
Das hier ist Einsamkeit, intensiv und unsichtbar. Die Tage strecken sich zu endlosen Wochen. Der metallene Deckel des Winters legt sich über das Tal und versiegelt es. Wir sind hier wie abgeschnitten. Dieses düstere graue Haus ist wie eine Festung, und wenn wir eines Tages eingeschneit sind, wird niemand mehr den Weg zu uns finden. Wozu auch? Hier haben wir doch alles, was wir brauchen, oder?
Zu mir kommt ja sowieso niemand. Ich habe keinen Menschen, der zu mir kommen könnte. Schmerzhaft wird mir bewusst, wie alleine ich bin.
Aber da ist doch immer noch Mutter …
Ich erinnere mich, wie ich einmal von zu Hause fortgelaufen bin. Ich war mit Stubenarrest bestraft worden und mit ein paar harten Ohrfeigen von Mutter.
Vater machte das nicht, Bestrafungen waren Mutters Angelegenheit. Wofür ich mir diese Strafe eingehandelt hatte, weiß ich nicht mehr. Nur, dass ich mich ungerecht behandelt fühlte und beschloss, fortzulaufen.
Ich kann nicht älter als fünf Jahre alt gewesen sein, denn mein Bruder war nicht mehr da. Ich habe ihn sehr vermisst. Er war mein Beschützer und mein Held, dreizehn Jahre älter als ich. Leonhard, genannt Leo. Er war der wichtigste Mensch in meinem Leben, und als er fort war, schien für mich alles zu Ende, jegliche Freude, alles Lachen und auch alle Liebe.
Nach seinem Fortgehen fühlte ich mich einsam und elend.
Auch an diesem Tag fühlte mich ungeliebt und dazu noch voller Zorn über eine ungerechte Behandlung. Ich war überzeugt davon: Meine Eltern lieben mich nicht, mein Bruder ist fort. Niemand ist für mich da.
Wilma, die Köchin, und die lustige Karlchen hatten mich scheinbar auch im Stich gelassen. Blieb nur Onkel Friedolin, ein Vetter meines Vaters. Hin und wieder kam er zu Besuch, und ich liebte ihn abgöttisch. Eigentlich war er nicht so recht standesgemäß, benahm sich nicht immer so, wie es angemessen war. Vielleicht gerade darum liebte ich ihn so sehr. Bei ihm fand ich alles, was ich mir bei meinem Vater gewünscht hätte.
Also auf zu Onkel Friedolin. Dabei wusste ich nicht einmal, wo er wohnte. Ich hatte nur in Erinnerung, dass es eine schöne, helle, von Bäumen gesäumte Straße in einem anderen Stadtteil war.
Ich sehe mich konfus und verweint durch die rostbraunen Blätter die breite Straße hinunter laufen. Mir ist jämmerlich zumute. Die ganze Welt scheint in meinen Kopf zu drängen, drückt gegen meine Stirn wie eine zu enge Gummikappe. Am Straßenrand, wo die entlaubten Linden stehen, höre ich ein Rascheln, ein Hund vielleicht, eine Katze. Andere Leute sind auf dem Weg nach Hause, mit Aktentaschen und Regenschirmen bewaffnet. In ihren Gesichtern sieht man Langeweile oder Stress, aber keines zeigt Anzeichen von Angst – so wie meines.
Ich renne, renne blindlings drauflos. Es beginnt zu regnen. Ich spüre im Nacken den heftigen, kalten Regen. Warum habe ich keine Regenjacke mitgenommen? Das Tageslicht schwindet, um diese Zeit kommt der Abend schnell. Ampeln spiegeln sich auf den nassen Straßen, die Rücklichter der Fahrzeuge zerschmelzen zu roten Flecken in der blanken Nässe. Inzwischen bin ich bis auf die Haut durchnässt.
Ich will die Angst nicht an mich heranlassen, aber irgendwann gelingt mir das nicht mehr. Panisch kommt sie in mir hoch und verschlägt mir den Atem.
Ein triefendes, schlotterndes Häufchen Elend bin ich jetzt nur noch, drücke mich an eine Hauswand und schluchze zum Gotterbarmen.
So entdeckt mich eine mitleidige Seele in Gestalt einer mütterlichen dicken Dame, die mich heimbringt. Die letzten Meter bis zu unserem Haus laufe ich ihr davon.
Heimlich schleiche ich mich durch die Hintertür hinein und die Treppe zu meinem Zimmer hinauf. Ich schlüpfe aus den nassen Kleidern und krieche ins Bett. Jetzt, in Wärme und Sicherheit, verfliegt meine Angst, und der Zorn kriecht wieder in mir hoch.
Und nicht nur Zorn, sondern auch unsäglicher Kummer und eine bodenlose Einsamkeit. Ich liege zusammengerollt in meinem Bett und horche. Im Haus ist es still. Die Eltern sitzen seelenruhig im Wohnzimmer, ich habe das Licht in den Fenstern gesehen, als ich kam.
Niemand hat mich vermisst. Genauso gut hätte ich fortbleiben können. Für immer. Ein Auto hätte mich überfahren können, ein böser Mann hätte mich mitnehmen können. Niemand hätte mich vermisst. Vielleicht wären sie sogar froh gewesen, wenn ich für immer weggeblieben wäre.
Alles bleibt still. Keine eiligen Schritte, die sich meiner Zimmertür nähern, um zu schauen, wie es mir geht. Keine besorgten Stimmen, die von unten zu mir her dringen. Nun gut, dann nicht. Hier will ich bleiben, bis irgend etwas geschieht. Ich will mich nicht bewegen, nichts essen, nichts trinken. Wenn ich lange genug liegen bleibe, wird das Wunder geschehen. Und wenn nicht, werde ich mich durch die Matratze sinken lassen. In der Polsterung verschwinden. Andere könnten sich auf mich legen und schlafen. Sie könnten ins Zimmer kommen und wieder fortgehen, ich würde nichts bemerken. Ich würde nichts mehr spüren, nie mehr.
Aber vielleicht wird doch das Wunder geschehen. Mama wird kommen. Sie wird in der Tür stehen und dann vielleicht ans Bett herantreten. Meine arme Kleine, was ist denn nur? Es tut mir ja so leid …
Kein Wunder. Nichts.
Ein unbändiges Verlangen packt mich. Ich sehe in Gedanken Mamas strafende Augen, ihre herab gezogenen Mundwinkel – und da packt es mich. Ich möchte aufspringen und schreien. So stark und so laut, dass die Fensterscheiben bersten, damit alle es hören, damit die ganze Welt ins Zittern gerät. Alle Menschen auf den Straßen würden stehen bleiben, lauschen und sich wundern.
Zitternd vor Erregung liege ich da. Nichts geschieht. Ich bleibe liegen, warte und warte, und irgendwann bin ich eingeschlafen.
Es beginnt als Traum.
Ich liege allein in der Dunkelheit. Ich friere und habe Angst. Mein Magen krampft sich zusammen vor Hunger. Ich liege in einem feuchten, stinkenden Bett, denn ich habe mich nass gemacht. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass Mama kommt, sich an mein Bett setzt, mich in die Arme nimmt und tröstet …
Der Traum dauert an in endloser Traumzeit … Stunden, Tage in einer seltsamen, unwirklichen Zeit.
Und dann ist meine Mutter plötzlich bei mir im Zimmer, aber sie antwortet nicht, als ich nach ihr rufe. Das Zimmer dreht sich, und dann sehe ich sie ganz deutlich. Sie liegt ausgestreckt am Boden, direkt neben dem Fenster. Ihr Kleid ist hochgerutscht. Sie liegt da wie tot. Oh mein Gott!
Ich gleite aus dem Bett, krieche auf allen Vieren durchs Zimmer. Ich fasse sie an, ihre Haut ist klamm, sie atmet schwer und geräuschvoll. Und sie riecht nach etwas – ein ekelhaft süßer Geruch, bei dem sich mir vor Angst die Kehle zuschnürt. Ich weiß, es wird mir nicht gelingen, sie zu wecken …
Ein Traum – es ist doch nur ein Traum, denke ich plötzlich. Und ich schreie, um mich selbst zu wecken. Schreie aus Leibeskräften, hocke am Boden, die Hand auf der Wange meiner Mutter …
Das Licht geht an, ich bin wach, und immer noch schreie ich. Der Pfleger Jochen steht in der Tür, hinter ihm taucht eine Schwester auf.
»Oh mein Gott, was ist hier passiert?«
Ich starre auf Neles bleiches Gesicht vor mir am Boden…
Die Familie
»Natürlich hast du Besuch gehabt,« sagt Oskar. »Deine Mutter war ein paarmal hier.«
Ich erinnere mich dunkel. Richtig, sie war hier. In meinem Zimmer haben wir gesessen. Es war schrecklich. Sie hat mich angestarrt, als hätte sie ein Monster vor sich. Und dann das Jammern. Wie schrecklich es in der neuen Wohnung sei. Was für eine armselige Gegend, geradezu proletenhaft und unzumutbar für eine Frau ihres Standes. Sie, eine Johanna van Hayden, gewöhnt an ein anspruchsvolles Leben in einem Haus in einer feinen Villengegend – und nun dieser Abstieg.
»Und diese – Leute!« Sie spuckt das Wort aus, als wäre es aus Essig. »Primitiv und dumm, du kannst es dir nicht vorstellen. Erinnerst du dich an das Ehepaar nebenan? Diese schmierigen, neugierigen Menschen! Und wie sie gekleidet waren! Dazu diese Sprache – derart ungebildet und ordinär, da war kein vernünftiges Gespräch möglich. Weißt du noch, als sie …«
Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht an sie.
»Zum Glück sind sie fortgezogen. Ich war ganz erleichtert. Aber nun – du glaubst es nicht! Eine junge Frau ist eingezogen mit zwei Kindern – eines noch ein Säugling – ich sage dir, nicht auszuhalten ist es. Das Baby schreit Tag und Nacht. Die Mutter ist nämlich oft auf Achse – allerhand das! Lässt ihre Kinder allein und geht – Anschaffen, wenn du mich fragst. Ich will ja nichts sagen, aber so etwas sieht man einer Frau doch an. Ich jedenfalls habe es sofort gesehen –«
So geht das Palavern weiter, ohne Punkt und Komma. Ich höre nur mit halbem Ohr hin.
Erst als der Satz »und an alledem bist du Schuld« kommt, bin ich wieder bei der Sache. Obwohl auch der nicht neu für mich ist. Ich weiß schon, an allem Übel, das meiner Mutter zugestoßen ist, bin ich Schuld. Und Vater! Immer abwechselnd.
Zum Teil bin ich es wohl, glaube ich. Genau genommen weiß ich gar nicht, was von allem Schicksal ist oder das Werk anderer, und wo meine Schuld beginnt. Die Dinge verwischen sich. Wenn man meiner Mutter jedoch glauben darf, so sind Vater und ich an allem Schuld, was in ihrem Leben schiefgegangen ist. Eigentlich erstaunlich, wie viel Macht sie uns zutraut.
Endlich geht sie wieder. Ich bleibe verstört zurück. Diese neue Wohnung – keine Erinnerung daran. Obwohl ich nach dem Verkauf der Villa mit Mutter dort hingezogen bin. Ich war beim Umzug dabei, habe gepackt und geräumt. Dann auch eine Weile dort mit Mutter gewohnt, eine kurze Zeit. All das ist fort, ich erinnere mich nicht daran.
Früher hat Mutter stets in Wohlstand gelebt. Sie stammt aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie, war einziges Kind und ist bis zu ihrer Heirat verwöhnt und verhätschelt worden. Sie hat leidlich Klavierspielen und feine Handarbeiten gelernt, konnte Dienstboten befehligen und Gesellschaften geben. Sie konnte leichthin plaudern, fabelhafte Hochfrisuren stecken und ausgezeichnet tanzen. In den Schränken stapelte sich eine reichhaltige Aussteuer, und ein ansehnliches Mitgift-Konto gab es auch. So aufs Beste präpariert und vorbereitet, konnte also der passende Ehemann kommen. Er kam dann auch.
Mit 25 Jahren heiratet die hübsche, zur Rundlichkeit neigende Johanna Bardowicz den dreizehn Jahre älteren Beamten in gehobener Laufbahn Hilmar van Hayden und zieht zu ihm in die von den van Haydens geerbte, beeindruckende Villa in einer vornehmen Wohngegend.
Hilmar van Hayden ist ein Beamter reinsten Wassers, äußerlich und innerlich. Hochgewachsen mit gerader Haltung, das dunkle Haar schon früh von grauen Fäden durchzogen und tadellos geschnitten, die Augen graubraun mit geraden Brauen darüber, ein schmaler Kopf auf dünnem Hals. Eine scharfe Habichtnase über einer langen Oberlippe.
Früher habe ich gedacht: Wäre er eine Pflanze, dann wäre er ein Gummibaum. Groß und sperrig und etwas staubig.
Und dann seine Hände! Ich habe immer viel auf die Hände geachtet. Seine waren lang und weiß und dünn. (Hebammenhände, sagte Onkel Friedolin einmal und zwinkerte mir dabei heimlich zu).
Vater hatte einen stark ausgeprägten Hang zur Disziplin. Alles musste nach festen Regeln gehen, nach seinen Regeln – versteht sich.
Zwar lautete sein Wahlspruch: man kann doch über alles reden, jedoch sah das dann so aus, dass er redete und die anderen taten, was er sagte. Und wenn er sagte: mach die Ecke rechtwinklig, machte man sie rechtwinklig, und wenn man den ganzen Tag dafür brauchte.
Er hatte zwei Kinder eingeplant. Zunächst einen Sohn, den er nach seinen Vorstellungen und Prinzipien großziehen wollte. Dann nach zwei oder drei Jahren eine Tochter, eine reizende Prinzessin, die eines Tages Furore in der feinen Gesellschaft machen würde.
Hier versagten Vaters Einflüsse. So sehr er sich auch bemühte, Johanna wollte nicht schwanger werden. Genau das warf er ihr vor: du willst nicht. Bist viel zu bequem, um schwanger zu werden.
Vielleicht war etwas Wahres daran. Ich kenne doch meine Mutter. Vielleicht war das auch ihre Art, sich ihm zu widersetzen. Eine andere fand sie wohl nicht.
Nach fünf Jahren endlich wird der heiß ersehnte Sohn geboren. Leonhard Hilmar Johannes. Der Vater ist besänftigt und versöhnt. Das kann er aber auch, bei diesem Prachtexemplar von Sohn. Ein hübscher Junge, klug und lebhaft. Vielleicht eine Spur zu lebhaft, wie sich in späteren Jahren zeigen soll. Und ein Quäntchen zu eigenwillig. Aber davon später.
Nun wartet also der Vater auf die Geburt seines Töchterchens. Wo bleibt sie denn, die hübsche kleine Prinzessin, die er im Geiste schon vor sich sieht? Auch der Name steht längst fest: Jasmin Melusine – weiß der Kuckuck, woher ihm ausgerechnet das in den Sinn kam, war er doch zeitlebens weder romantisch noch besonders gefühlvoll.
Johanna ist das egal. Eigentlich reicht ihr schon das Prachtexemplar von Sohn. Inzwischen ist sie auch nicht mehr die Jüngste. Eine Schwangerschaft ab vierzig ist schließlich keine einfache Angelegenheit.
Endlich nach dreizehn Jahren wird die ersehnte Tochter geboren. Eine schwere Geburt, zumal das Kind ein beträchtliches Gewicht hat. Ein kleiner Pummel mit glattem Gesichtchen, einer Tolle glänzend schwarzer Haare und runden Augen, die bald so graubraun wie die des Vaters werden.
Der stolze Papa – er geht herum wie ein Pfau. Was ist das für ein reizendes Ding, diese Jasmin Melusine. Und wie wird sie ihren Eltern Freude bereiten. Der dreizehnjährige Bruder freut sich über den Zuwachs, und er schließt das kleine Pummelchen sofort in sein Herz.
Mit der Zeit jedoch zeigt sich, dass die kleine Jasmin sich nicht so entwickelt, wie die Eltern erhofft haben. Sie schreit viel in den Nächten, und am Tage hat sie ständig Hunger. Jedenfalls scheint es der Mutter so, weil sie oft greint und schreit. Also muss Futter her, damit das Kind still ist.
Vielleicht steht das kleine Pummelchen von Anfang an im Schatten des außergewöhnlichen Bruders. Es stellt sich heraus, dass die rundliche Prinzessin weder Charme, natürliche Anmut noch das gewinnende Wesen des Bruders hat. Im Gegenteil, sie ist still, trotzig und bockig und mürrisch.
Oh, diese Enttäuschung!
Jedoch der Vorzeigesohn – von Jahr zu Jahr wird er hübscher. Ein Junge mit schmalem Gesicht und welliger Haarmähne. So hübsch, dass er es zu leicht im Leben hat. Sagen die Nachbarn. Er stolziert mit seinem schönen Gesicht durch die Welt und hält alles für selbstverständlich. Es tut keinem Menschen gut, so auszusehen. Der nimmt das Leben zu leicht, glaubt, dass die ganze Welt sich nur um ihn zu drehen hat. Das ist ein altbekanntes Muster. Man muss ihm Respekt beibringen, das vor allem.
Und daran fehlt’s! Sagen die Leute.
Die Eltern halten ihren Jungen für außergewöhnlich. Und das ist er wirklich. Die Zeit zeigt es. Er lernt nahezu im Schlaf, überspringt zwei Klassen, mit 13 schauen ihm die Mädchen sehnsüchtig nach, die Jungen zeigen sich außergewöhnlich bemüht um ihn. Er hat ein gewinnendes Wesen, ein offenes Lächeln mit strahlend weißen Zähnen und eine natürliche Anmut.
Ja, das ist mein Bruder Leo, wie er damals war.