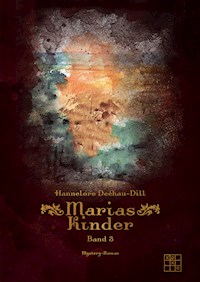Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Günna lebt auf einer idyllischen Insel. Doch die paradiesische Fassade wird jäh zerstört, als sie von ihrem Halbbruder schwanger wird. Kurz darauf findet man die 16-jährige Carlotta tot am Strand. Die Gerüchte schwanken zwischen Mord und Selbstmord, doch die Ermittlungen deuten auf einen Unfall hin. Günna glaubt das nicht. Obwohl sie keine Erinnerungen an die Nacht hat, ist sie sich sicher, jemanden am Strand gesehen zu haben. In der folgenden Zeit hat sie das Gefühl, verfolgt zu werden, fühlt sich bedroht und hat seltsame Albträume. Schließlich flieht sie aufs Festland. In einem Hafenstädtchen will sie sich ein neues Leben aufbauen, aber die Schatten der Ereignisse auf der Insel scheinen sie zu verfolgen. Ausgerechnet, als sie eine Entscheidung für sich und ihr ungeborenes Kind treffen muss, wird ihr Leben erneut auf den Kopf gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Unter dem Inselmond
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-087-3
E-Book-ISBN: 978-3-96752-587-8
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 247558939
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Schmerz ist Vergessen.
Erlösung ist:
sich an das Warum erinnern
(H. Hesse)
Prolog
Im Traum renne ich den Strand entlang. Ich bin barfuß, der Sand ist warm und gibt unter meinen Füßen nach. Winzige Muscheln, die das Meer an Land gespült hat, knirschen unter meinen Fußsohlen. Die letzten Sonnenstrahlen wärmen meinen Nacken, aber vom Wasser spüre ich den kühlen Wind.
Der Sand behindert mich in meinem Lauf. Ich komme kaum vorwärts - und ich fliehe doch! Ich will dem entkommen, der hinter mir ist. Er ruft meinen Namen: »Günna! Günna!«
Ich weiß, wenn er mich fängt, wird mir Schreckliches passieren.
Ich verlasse den Strand, biege seitwärts ein in den schmalen Weg zwischen den Dünen. Inmitten von Strandhafer und wilden Heckenrosen lasse ich mich keuchend in den Sand fallen. Ich höre das leichte Rauschen des Meeres. Es ist das gleiche Geräusch, das mich meine ganze Kindheit hindurch begleitet hat.
Ich lausche und höre mein Herz klopfen.
Von weither meine ich immer noch seine Stimme zu hören.
»Günna! Günna«!
Ich schreie laut und erwache.
Zitternd setze ich mich im Bett auf, meine Stirn ist feucht von Schweiß.
Vorbei ist der Traum. Aber es bleibt doch eine Ahnung des Bösen in mir zurück, das mich damals verfolgte, bevor ich die Insel verließ.
Meine geliebte Insel – bevor ich weglief.
In meiner Erinnerung höre ich wieder das Brausen des Meeres, das Klatschen der Wellen an den Strand, vertraute Geräusche meiner Kindheit.
Das lang vergessene Gefühl für die Geheimnisse der Insel erfasst mich.
Bilder steigen vor mir auf.
Im bläulichen Mondlicht liegt die Insel schimmernd in der Frühlingsnacht. Ich schlage den Weg zwischen den alten Bäumen ein. Das riesige alte Haus steht vor mir.
Das Haus der Rosenfelds ist ein imposantes Gebäude, umgeben von Zypressen, umrundet von einer breiten Terrasse. Lebensbäume und Pinien, Mondlicht zwischen den Zweigen.
Von meinem Fenster im oberen Stock kann ich den alten Friedhof erkennen. Wie unheimlich war es dort bei Nacht, wenn Teresa, Marvin und ich herumstreiften.
Wir waren viel unterwegs damals, bei Tag und auch nachts. Wir hielten die Insel immer für einen Ort voller Mysterien und Geheimnisse, und wir waren entschlossen, ihnen nachzuspüren.
Wie unbeschwert und fröhlich waren wir doch in jenen Jahren.
Teresa, Marvin und ich.
Irgendwann kam dann auch Carlotta dazu.
Carlotta, die Enkelin des alten Dienerpaares Lukas und Henriette Rintel.
Als Kind kam sie oft in den Ferien in unser Haus. Als sie 15 war, sah sie aus wie 18. Eine schwarzhaarige, glutäugige Schönheit. Schlank und rank wie eine Gerte, dabei jedoch wohlproportioniert.
Und sie konnte singen. »Eine Stimme wie Nacht und Flut,« sagte Marvin.
Ich hielt sie für eine kleine schlaue Heuchlerin, die es verstand, sich bei Menschen einzuschmeicheln, wenn es ihr der Mühe wert schien. Sie konnte in verschiedene Rollen schlüpfen, anderen Leuten vormachen, sie sei so, wie man es von ihr erwartete.
Viele, sehr viele Jahre später – sozusagen in meinem »neuen Leben« - kam mir beim Gedanken an Carlotta ein Zitat von Max Frisch in den Sinn. Es lautet:
Auch wir sind die Verfasser der anderen: wir sind auf heimliche und unentrinnbare Weise verantwortlich für das Gesicht, das sie uns zeigen, verantwortlich nicht für ihre Anlage, aber für die Ausschöpfung dieser Anlage…
Aber wie gesagt: das war viel später.
Wann änderte sich alles? Wann nahm das Unheil seinen Anfang?
Oh, diese Bilder.
Verzweifelt beschwöre ich die magischen Erinnerungen herauf: sehe uns durch die Dünen laufen, im Meer baden, durch das nahe Wäldchen streifen.
Keuchend richte ich mich auf. Ich hocke im Bett, zerre mir die Decke über die Schultern, während ein verschwommener Gedanke durch das Labyrinth meiner Erinnerungen schießt. Ich will ihn fassen und festhalten. Oder lieber nicht? Vielleicht sind diese Erinnerungen, die mich seit kurzem bedrängen, gar nicht wahr! Vielleicht sind es Trugbilder, die mir etwas zeigen, das nie geschehen ist. So etwas ist doch möglich. Suggestion.
Aber nein, es ist alles wahr. Carlotta ist tot. Sie ist ertrunken in jenem Sommer dort unten in der Bucht. Sie konnte nicht schwimmen.
Ein Unfall?
Wir alle möchten es glauben. Es ist schließlich nicht unmöglich.
Und doch -
Könnte es nicht Selbstmord gewesen sein?
Ach nein, doch nicht Carlotta, die lustige, schwarzäugige Carlotta mit der Engelsstimme.
Oder gar Mord?
Das Misstrauen ist gesät. Wir schleichen umeinander herum, belauern einander. Das Grauen hat Einzug gehalten in dem alten Haus auf der Insel.
Ihr Tod wurde nie aufgeklärt.
Da hatten wir nun unser Mysterium. Es ist bis heute eines geblieben.
Ich hielt das Leben dort nicht mehr aus.
Ich lief fort.
Kapitel 1
Abschied von der Insel
Ja, ich lief davon. Ich flüchtete bei Nacht und Nebel.
Das klingt nach einer überstürzten, unüberlegten Flucht. Als wäre ich einem Augenblickimpuls gefolgt und blindlings davongestürzt, aber ganz so war es nicht.
Seit vielen Tagen, ja vielleicht schon seit Wochen, war der Plan in mir herangereift - anfangs noch ganz unbewusst. Ich war unentschlossen, zögerte, schob meine Entscheidung hinaus.
Vermutlich in der Hoffnung, irgendetwas müsse geschehen und die Dinge zum Guten wenden, so dass ich jeder eigenen Entscheidung enthoben wurde.
Wenige Tage zuvor waren wir zusammen gewesen, Marvin und ich.
Draußen war es dunkel. Den ganzen Nachmittag über hatten sich Wolken zusammengezogen, und nun grollte der Donner in der Ferne.
Wir waren in der alten Bibliothek. Im Haus war es ganz still. Nur draußen wütete der Sturm. Ich wollte mit Marvin reden. Es war schwer, ich konnte die richtigen Worte nicht finden. Ich wusste, dass er mich überreden würde zu bleiben.
Blitze zerrissen die riesigen schwarzen Gewitterwolken am Himmel, der Regen würde im Garten alle Blumen niederdrücken.
Marvin hatte das Licht angemacht. Die Hündin Senta saß verschreckt unter dem Tisch und drückte ihre kalte Nase an mein Bein. Ein Donnerschlag schien das Haus zu erschüttern. Senta fing an zu winseln. Ich kniete mich auf den Boden und kraulte ihr beruhigend den Kopf.
Marvin ließ sich neben mir auf dem Boden nieder und fasste mich bei den Schultern. »Geh nicht, Günna,« flüsterte er.
»Wir müssen zusammenbleiben.«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wie albern – wir beide hier auf dem Boden hockend,« dachte ich flüchtig.
»Das ist unmöglich«, sagte ich.
Seine Augen waren dicht vor den meinen.
»Du bist ein Teil von mir, und ich gehöre zu dir, es ist anders als bei anderen Liebenden, weißt du das nicht? Wir könnten zusammen fortgehen - irgendeine Lösung finden.«
Mir wurde leicht schwindelig, immer wieder schüttelte ich den Kopf.
»Nein, nein, das ist unmöglich.«
Ich machte mich frei, erhob mich. Er sah mich beschwörend an, so einen wilden Blick in seinen Augen hatte ich noch nie gesehen.
»Lass mich.«
Er zog mich wieder zu Boden. Ich spürte, dass seine Arme zitterten, fühlte seine Tränen an meiner Wange. Ich legte beide Arme um ihn und fühlte den Pulsschlag an seinem Hals.
»Aber geh noch nicht gleich. Warte noch! Versprich es mir!«
Ich versprach aber nichts. Ich wartete.
Jemand hat mal gesagt: das Hirn funktioniert am besten, wenn du es in Ruhe lässt. Gib ihm die Fragen und Infos, die du hast, und dann denke an was Anderes.
In den darauffolgenden Nächten schlief ich schlecht. Ich wanderte am Strand entlang. Ein Vollmond hing über der Bucht und malte eine Silberstraße ins Wasser, unheimlich und beklemmend sah es aus.
Und dann geschah tatsächlich etwas.
Es traf mich wie ein eiskalter Stoß aus dem Hinterhalt. Ich spürte, wie ich fast ins Wanken geriet, klammerte mich an der Mauer fest, um nicht zu stürzen. Ich hatte etwas gesehen, dass ich nicht sehen wollte, das ich nicht für möglich gehalten hätte.
Oder hatte ich es etwa geahnt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich wollte nicht, dass es real war und hatte es vielleicht verdrängt.
Plötzlich wusste ich, dass mein jetziges Leben ein jähes Ende genommen hatte, alles war in neue wahnwitzige Bahnen geschleudert worden.
Für einen Moment überkam mich ein Schwindelgefühl, ein Zeichen von Schwäche und Erschöpfung, einer Ahnung, dass ich kurz davor war, den festen Boden unter den Füßen zu verlieren.
So ist das also, wenn plötzlich alles zu Ende ist.
Das Leben ist nicht nur ein gleichmäßig plätschernder Strom, manchmal kommt man an einen Punkt, an dem man Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen muss.
Dann kam der Abschied.
Es war fast Nacht, ich schlich durch das stille Haus zum Zimmer meines Vaters.
Er schlief allein in einem Raum. Julius ging sehr spät zu Bett. Er hatte so seine eigenen schrulligen Gewohnheiten, so dass meine Mutter schon vor vielen Jahren ein anderes Zimmer bezogen hatte, weil er sie oft störte. Ihm selber war es auch lieber so. Die peinliche Ordnung seiner Frau hatte ihn schon in jungen Jahren zur Weißglut gebracht.
Ich fand ihn versunken in einem verschlissenen Ledersessel, ganz hinten zwischen seinen Bücherregalen, mit einem seiner dicken Wälzer auf den Knien und einem Glas Rotwein auf dem Tischchen neben sich. Eine Leselampe brannte, ein kleiner, leuchtender Lichtkegel in der Dunkelheit.
Er saß da wie eingeschlossen in diesem Lichtkreis, abgeschirmt von allem, von dem er nichts wissen wollte, von der Dunkelheit und allem anderen in diesem Haus, das ihm lästig war.
Er war schon ein seltsamer Kauz, aber wir verstanden einander gut. Ich liebte ihn so viel mehr als meine kühle, distanzierte Mutter.
Als ich das Zimmer betrat, schien er auf mich gewartet zu haben. Er war nicht verwundert über meinen Entschluss fortzugehen. Ich vermutete schon lange, dass er mehr ahnte oder gar wusste, als jeder andere im Haus. Nur sprach er nicht darüber.
Der Abschied fiel mir schwer.
»Du kommst wieder,« sagte er und drückte mich an sich.
Dann schob er an seiner Brille herum, damit ich nicht sehen sollte, dass er weinte.
Draußen blieb ich stehen und horchte auf die Stille.
Wo mochte Marvin sein?
Das Licht in der Küche brannte noch. Ich sah es als gelbe Vierecke auf dem dunklen Rasen liegen. Zitternd beobachtete ich die Lichtquadrate und hoffte, wenigstens noch einmal die Silhouette seines Körpers oder seines schmalen, kantigen Gesichts zu sehen.
Das Licht ging aus, und der Garten lag im Mondenschein. Die halbe Dunkelheit zwischen Bäumen und Büschen des kleinen Parks kamen mir tröstlich wie eine Umarmung vor, es war sehr still ringsumher.
Vollmond.
Die große helle Scheibe hing soeben über dem Dach des ehrwürdigen alten Hauses und warf schwarze Schatten über den Hof, schimmerte hell auf dem stillen Wassers des kleinen Teichs, glatt wie ein Spiegel im fahlen, silbrigen Licht.
Kein Fisch regte sich, und die schimmernde Wasserfläche gab der ganzen Szene etwas Traumhaftes.
Marvin.
Werde ich ihn wohl jemals wiedersehen?
Ich erinnerte ich mich an die Berührung seiner Hände, und ich schämte mich.
Je fester ich die Augen schloss, umso deutlicher sah ich ihn vor mir, seine sehnige Gestalt, seine lachenden Augen. Er konnte bald grausam, bald gütig sein, mein Halbbruder Marvin.
»Du bist ein Teil von mir, und ich gehöre zu dir, es ist anders als bei anderen Liebenden, weißt du das nicht - wir könnten zusammen fortgehen, irgendeine Lösung finden -«
Dann war ich fort.
Kapitel 2
Neubeginn auf dem Festland
Draußen peitscht ein hartnäckiger Regen gegen das Fenster, wir haben schon Mitte November, und das Wetter ist, wie es zu dieser Jahreszeit zu sein pflegt. Dunkel, nass und schwermütig.
Böige Winde jagen durch die Straßen und Gassen, und die Temperatur ist in den letzten Wochen zwischen Null und einigen Graden darüber hin und her gependelt.
Hier sitze ich am Fenster meines kleinen Appartements, das ich inzwischen gefunden habe, und starre in die Nacht hinaus.
Ich bin hergekommen, um mein Leben und meine Gedanken neu zu ordnen. Und um eine Entscheidung zu fällen, eine lebenswichtige Entscheidung.
Ich wollte Abstand und Ruhe finden von allem, was mich in den letzten Monaten bedrängt und beunruhigt hat.
Von allem, was auf der Insel geschehen ist.
Aber es will mir nicht gelingen.
Sie tauchen auf in meiner Erinnerung, all die schlaflosen Nächte, in denen die Stunden träge verrinnen – wie ein schwarzer Brunnen, in dem mein Kummer, meine ganze Verzweiflung und Ausweglosigkeit lauern.
Sehnsucht, Leidenschaft, Missverständnisse, Zweifel, Tränen und Schweigen – das war meine Liebe. Und sie ist noch nicht vorbei. Ich kann sie nicht auslöschen, so gern ich es auch möchte. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich sein Gesicht vor mir.
Marvin.
Wir kannten uns so viele Jahre, unsere ganze Kindheit hindurch, bis ich mich in ihn verliebte.
Wir verstanden uns prächtig.
Schon im Sandkasten hockten wir zusammen.
Später sprachen wir über alles zwischen Himmel und Erde. Was wir werden wollen, wenn wir groß sind, was Jungs im tiefsten Herzen eigentlich denken und wie es so mit den Mädels ist, ob es immer schlimm ist zu lügen und ob der Pastor tatsächlich ein Auge auf seine Haushälterin geworfen hat.
Wir sprachen auch über Gott.
Er war stets davon überzeugt, dass es ihn gibt, ich hatte da eher meine Zweifel. Die Welt könnte nicht so aussehen, wie sie eben aussieht, wenn ein guter Geist dort oben an den Strippen zöge, finde ich. Aber er sagte, dass sich alles nach und nach noch finden werde, nur der Weg dahin sei oft steinig und beschwerlich.
Wir fuhren mit dem Boot hinaus. Die Sonne brannte, das Meer lag vollkommen spiegelblank da, wir unterhielten uns. Ein Sommertag unserer Jugendzeit … ein Tag, der sich durch das ganze Leben ziehen kann - wertbeständig und Sinnbild dessen, wovon alles handelt, wenn es darauf ankommt.
In meiner Erinnerung sehe ich das alte Haus vor mir.
Der Garten ist in den letzten Jahren wegen Geldmangels ziemlich heruntergekommen, der Kräutergarten von Unkraut überwuchert.
Eine niedrige alte Ziegelmauer umgibt ihn teilweise, so warm und rau an den Knien, wenn man darüberstieg – es kommt mir alles wieder in den Sinn. Die prallen Birnen, die sich zwischen den Ackerwinden triumphierend behaupten, die aufgeplatzten, violetten Pflaumen auf dem Boden, das Wespengesumm – ihr warmer, süßer Duft - und wie einem der Saft am Kinn herunterläuft.
Die Erinnerung an die Insel ist mit Freude, mit Heiterkeit und jenem strahlenden Sommerhimmel verbunden, unter dem wir damals dahinlebten.
Dann aber sind andere Erinnerungen da. Die Bilder der letzten Monate erstehen vor meinen Augen.
Und auch die Menschen, meine Familie - wie sie war, als ich sie verließ.
Die Rosenfelds, ein großer Name – seit Generationen auf der Insel beheimatet.
Meine Eltern Julius und Liliane, beide inzwischen über 60. Es ist die 2. Ehe meines Vaters. Ich hing sehr an meinem Vater, der sich gern unnahbar und streng gab, es in Wirklichkeit aber gar nicht war.
Wir beide hatten jedenfalls ein herzliches Verhältnis, das er nach außen hin unter seiner Ruppigkeit verbarg. Unsere Zuneigung war fast so etwas wie unser Geheimnis.
Meine Mutter war eine schöne Frau, stets kühl und beherrscht, die keine Schwächen gelten ließ. Neben ihr kam ich mir immer wie das hässliche Entlein vor.
Aus dem Spiegel blickte mir mein recht farbloses Gesicht entgegen mit den grauen Augen meines Vaters und seinem dichten, schwarzen Haar.
Meine Schwester Teresa hatte Mutters lockiges braunes Haar und die violetten Augen von ihr geerbt, und sie war immer stolz darauf.
Auch im Wesen unterschieden Teresa und ich uns. Sie war empfindsam und weichherzig, fast ein wenig naiv und leicht zu beeinflussen. So empfand ich das damals.
Ich liebte sie und hatte oft das Gefühl, sie beschützen zu müssen. Ich glaube, sie rührte jeden. Diese schmalen, kindlichen Schultern - sie war so zerbrechlich, verletzlich. Äußerlich so ähnlich unserer Mutter, aber im Wesen doch so gänzlich verschieden von ihr.
»Du bist wie Vater,« sagte sie zu mir. »So verschlossen und eigensinnig - und eigenbrötlerisch,« fügte sie lachend hinzu.
Eigenbrötlerisch? Das war mir nie in den Sinn gekommen. Aber vielleicht wirkte ich nach außen hin so, verschlossen und nicht gerade offenherzig.
Aus der 1. Ehe meines Vaters stammt Marvin, unser Halbbruder. Er war hübsch, mutig und unbekümmert. »Leichtsinnig« sagte Mutter.
Wir Mädels bewunderten ihn – und für mich war er ein Idol – später dann eine Offenbarung.
Richard ist Vaters Neffe. Zwischen seinen Konzertreisen lebt er im Haus. Er hat eine Scheidung hinter sich.
Teresa ist 20, als ich die Insel verlasse.
Das Ehepaar Rintel lebt bei uns, seit Vater ein Kind war. Ihre Enkelin Carlotta zog als blutjunges Mädel ganz bei den Großeltern ein.
Ich bin nur wenig über 23 Jahre zur Zeit meiner »Flucht«, wie ich das insgeheim immer nenne.
Noch jung bin ich, oh ja. Und doch scheint mir mein Leben schon zu Ende. Es ist aber nur ein Wendepunkt, rede ich mir ein.
Ein Wendepunkt, der ein neues Leben für mich bringen wird. Das hoffe ich, aber noch bin ich mit meinem alten Leben nicht im Reinen.
Denn da ist immer noch meine Liebe, die ich nicht abstreifen kann wie ein altes Kleid. Leider! Meine unselige Liebe zu ihm, meinem Halbbruder Marvin.
Marvin, der zu mir sagte: »Bleib bei mir - wir werden einen Ausweg finden - warte noch -«
Nun aber bin ich hier, in diesem trostlosen Appartement in einem kleinen Hafenstädtchen auf dem Festland.
Hier bin ich also, habe mein finsteres Geheimnis mit mir genommen, um hier eine Entscheidung zu fällen.
Niemand ahnt, wie es um mich steht. Man denkt, ich laufe vor der unheilschwangeren Atmosphäre auf der Insel davon.
Diese Atmosphäre, die nach dem Tode Carlottas bei uns Einzug gehalten hat.
Natürlich auch das.
Dieser nagende Verdacht, das Misstrauen, das unter uns lauerte - es wurde schlimmer, stärker von Tag zu Tag.
Wie ist Carlotta zu Tode gekommen?
Ich denke, sie wurde ermordet. Also muss es in unserer Familie einen Mörder geben – oder eine Mörderin …
Vielleicht wird sich diese unselige Sache niemals aufklären. Die Polizei hat es nicht geschafft. Man ging schließlich von einem Unfall aus. Carlotta ist ertrunken, nach einer turbulenten Party-Nacht mit viel Alkohol. Sie ging ans Meer und auf die Mole hinaus, stolperte, stürzte und fiel ins Wasser. Sie konnte nicht schwimmen, also ertrank sie.
Niemand konnte sie hören, falls sie denn geschrien hat, denn scheinbar war sie allein.
Oder?
Ich glaube es nicht, aber ich will darüber jetzt nicht grübeln. Vielleicht kehre ich eines Tages auf die Insel zurück und finde es heraus.
Jetzt aber – jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss mir darüber klar werden, ob ich das Kind behalten will.
Mein Kind von Marvin, meinem Halbbruder, von dem niemand weiß - nur ich.
Kapitel 3
Trostlosigkeit
Als ich aufwache, weiß ich nicht, wo ich bin. Es ist noch schummrig im Zimmer. Langsam komme ich zu mir.
Ich höre das Plätschern des Regens, ein gleichmäßiges, trostloses Geräusch.
Morgens überfallen mich mitunter schwarze Augenblicke, eingefrorene Augenblicke, in denen die Zeit stillsteht, nachdem ich aus dem Schlaf in die stumme, graue Wirklichkeit geworfen wurde.
Ich versuche mich daraus zu lösen, mir einen Ruck zu geben, etwas zu unternehmen. Ich kann nicht länger hier herumsitzen und grübeln. Schließlich lebe ich noch, und ich will doch auch leben.
Auch wenn mir der Tod zeitweise so viel verlockender erscheint. Carlotta ist tot, ich nicht!
Aber Trostlosigkeit und Trauer halten mich in den Fängen.
Nicht Trauer über Carlotta. Es ist Trauer über das Leben an sich. Über dessen Ungerechtigkeiten und blinden Flecke. Über Verfehlungen, die wir unter den Teppich kehren und verdrängen, die uns schließlich doch einholen, wenn wir ihnen lange genug den Rücken zugekehrt haben.
Wenn wir nicht achtsam genug waren.
Wieder und wieder gehe ich in Gedanken in der Zeit zurück, versuche mich an Daten und Ereignisse zu erinnern. Der Regen rauscht leise, ich bin eingeschlummert, werde dann jäh aus einem Traum geschleudert, in dem ich sein Gesicht plötzlich ganz deutlich vor mir sehe - ein stummes Gesicht mit unergründlichen Augen.
Als ich in die Stadt komme, hört der Regen auf.
Ich fühle mich als Fremde in den vom Wind gefegten Straßen, zwischen den hastenden Menschen.
Unter all den Gesichtern, die mir begegnen, wird nie mehr das eine auftauchen, nach dem ich mich immer noch sehne.
Die Häuser stehen in langen, hohen Reihen. Viele haben kleine Balkons mit schmiedeeisernen Gittern. Das Ganze wirkt auf mich ungemein trostlos. Die Straße, baumlos und eintönig grau, erscheint mir wie eine Reflexion des winddurchpeitschten Himmels.
Ich haste durch die Straßen, stundenlang. Am Nachmittag lande ich in einem kleinen Café, bestelle mir Tee und ein Sandwich.
Ich hocke in der halbdunklen Ecke auf einem alten Sofa und schlürfe meinen Tee. Essen mag ich nicht.
Das schummrige Licht im Raum macht mich müde. Mit geschlossenen Augen sitze ich da.
Habe ich mich nun entschieden?
Meine Schuldgefühle machen mir zu schaffen.
Ein Verhältnis mit dem Halbbruder – wie verwerflich, entsetzlich, eine Schande!
Und nun das Kind! Ein Kind, das nie geboren werden sollte.
Danach wird alles gut sein. Niemand wird davon erfahren. Ich werde es vergessen, wenn ich es hinter mir habe.
Vergangen und vergessen?
Das ist nicht dasselbe.
Aber das Leben wird weitergehen, für alle.
Für mich und für die Menschen auf der Insel.
Kapitel 4
Eine dunkle Zeit
Der Regen schlägt gegen das Fenster, als ich erwache. Ich fühle mich schlecht. Das Blut hämmert dröhnend in meinen Schläfen. Mein Hals brennt. Hinter den Augen erwacht langsam ein stark pochender Schmerz.
Und dann kommen die Tränen.
Während ich daliege und schluchze, setzen stechende Kopfschmerzen ein. Messerscharf und weißglühend.
Was ist bloß los? Muss ich sterben?
Aber nein, nein. Es ist alles in Ordnung.
Es ist vorbei. Es ist entschieden.
Habe ich gedacht: Alles wird gut sein?
Ich werde alles vergessen, wenn es erst vorbei ist?
Vergangen heißt aber nicht vergessen.
Immer wieder sage ich mir: Das Leben wird weitergehen. Irgendwie geht es immer weiter!
Nur werde ich jetzt allein sein, ganz allein. Ich habe Angst, wenn ich darüber nachdenke.
Was ist mir geblieben?
Ich mache Bilanz, und das ist schnell geschehen. Ich habe nur mein Abitur, keine Ausbildung. Nach meinem Abschluss konnte ich mich nicht entscheiden. Ich half Vater bei seiner Rosenzucht und in der Biogärtnerei unserer Familie, wenn ich Lust hatte. Und dann war da ja Marvin …
Vater drängte mich nicht zu einer Entscheidung, aber Mutter war ständig hinter mir her.
»Was ist los mit dir? Warum kannst du dich nicht für ein Studium entschließen. Du musst doch wissen, was du willst. Bist doch schließlich alt genug. Ich in deinem Alter -«
Ja, sie in meinem Alter!
Mutters Litanei, mit der sie all ihre Vorhaltungen begann.
Sie in meinem Altern wusste längst, was sie wollte. Sie hatte es mit den Sprachen. Verbrachte ein Jahr in Amerika. Es folgten ein paar »Studienreisen« in alle Welt, die ihren Sprachkenntnissen und allgemeinen Erfahrungen nützlich sein sollten. Ihr Vater war reich, sie konnte es sich leisten.
Sie nannte sich eine freie Journalistin, aber damit war es nicht weit her. In Wirklichkeit hielt sie vor allem Ausschau nach einem reichen Mann mit vorzüglichem Hintergrund.
Den fand sie dann auch in meinem Vater. Und nun gehörte sie zu den »Rosenfelds«. Hinfort konnte sie große Dame in der »besseren Gesellschaft« sein und musste nichts anderes mehr tun. Sie führte natürlich ein »großes Haus,« spielte sich als perfekte Gastgeberin auf.
Ein paar Jahre funktionierte das, dann wurde das Geld knapp. Ihr Vater war nun auch bankrott. Es war vorbei mit großen Festen und Partys. Die illustren Gäste blieben aus. Das kleine Gästehaus blieb leer. Vater war ohnehin nicht der Mann für diesen Lebensstil.
Er hatte so sein eigenes Leben, ging mit Freunden zur Jagd, besuchte regelmäßig seinen kleinen »Club«, wie er das nannte. Was sich da genau abspielte, wusste ich nicht. Vater hatte so seine Geheimnisse.
Ich denke, es könnte auch andere Frauen gegeben haben. Vielleicht sogar eine ganz besondere. Ich hatte ihn bei einem Besuch auf dem Festland einmal mit einer gesehen. Eine angenehme Erscheinung von unauffälliger Eleganz, von anderem »Format« als Mutter, wie ich damals fand.
Trennung oder Scheidung kam natürlich nicht in Frage. So lebten denn beide, Liliane und Julius, nebeneinander her. Jeder hatte sein eigenes Leben, natürlich in streng begrenztem Rahmen, so dass es keinen Klatsch gab. Das war vor allem Mutter sehr wichtig. Man musste den Schein, den guten Ruf, wahren.
Ich habe also keine Ausbildung, aber ich habe Geld, eine kleine Erbschaft meiner Patentante, die seit langem tot ist. Das ist alles.
Langsam kriecht Panik in mir hoch. Ich fange an zu begreifen, dass es vielleicht ein Fehler war fortzulaufen. Warum hat Vater mich nicht zurückgehalten? Wusste er, dass ich mich nicht hätte aufhalten lassen? Oder wollte er sich wieder mal nur aus allem heraushalten, das ihm lästig war?
Ich denke an all die schlaflosen Nächte, in denen ich dalag und versuchte, Pläne zu machen. Ich dachte nicht darüber nach, wie jung und unerfahren ich bin. Ich wollte nur fort.
Ich wollte ein neues Leben anfangen und mich von dem quälenden Albtraum befreien, der damals über mir hing. Ich sah nur meine unselige Liebe, das ungeborene Kind meines Halbbruders und Carlottas Tod.
Und dann war da dieses seltsame Böse, das sich unter uns eingenistet hatte. Es machte sich unter uns allen breit und schwelte irgendwo im Untergrund.
Ich kann es nicht benennen, aber es war da, und ich konnte nicht damit leben. Ich wollte ihm entkommen. Ihm und meiner unseligen Liebe.
Was hätten sie alle gesagt zu Marvin und mir, zu meiner Schwangerschaft. Hätten sie sich voller Ekel von mir abgewandt? Ich wollte es nicht darauf ankommen lassen.
Wieder sind da diese Schuldgefühle.
Es ist noch etwas hinzugekommen: der Tod meines ungeborenen Kindes, den ich zu verantworten habe.
Ja, mein Kind ist tot. Ich habe diese Abtreibung hinter mir.
Wird das alles jemals aufhören, mich zu verfolgen?
Ich liege ganz still, lausche dem Regen, versuche dann vorsichtig, den Kopfschmerz durch leichtes Massieren zu lindern. Es hilft nicht, ein Gefühl von Übelkeit kommt hinzu.
Irgendwann verschwindet der Schmerz, die Übelkeit ist fort.
Gedanken und Bilder, die durch meinen Kopf ziehen: Ich liege auf dem Rücken, über mir kreisen die Möwen in einer hohen, blauen Himmelssphäre … die Sonne wärmt… ich höre das Meer und den Wind, der im hohen Strandhafer raschelt - Sommer, wie es für mich keine mehr geben wird -
Mein Kind ist tot.
Monate, Jahre später, wenn ich mich an diesen seltsamen, grauen Albtraum erinnere, der sich über mich gebreitet hatte, werde ich wieder dieses Geräusch des Regens hören, das mich in die Gegenwart zurückholte – zurück zu meiner abgrundtiefen Verzweiflung. Niemand kann etwas für mich tun. Vielleicht kann man Freude teilen, aber Kummer und Schande, die die Unglücklichen zu Ausgestoßenen stempeln, nicht.
Die Dämmerung senkt sich schnell, das Dunkel wächst aus den Winkeln heraus. Ich liege auf meinem Bett und sehe, wie die Konturen des Zimmers verschwimmen.
Und dann sind wir wieder im alten Garten hinter dem großen Haus, pflücken Johannisbeeren, Henriette will Saft machen. Die Sonne scheint, Schmetterlinge und Hummeln taumeln durch die blaue Luft.
Und auch Wespen sind da, vor denen wir uns in Acht nehmen. Teresa und ich tragen Sandalen und kurze Hosen, Carlotta einen winzigen Minirock und eine rote Bluse. Ihre braunen Beine sind makellos, das schwarze Haar im Nacken zum Pferdeschwanz gebunden. Sie lacht Marvin an, ihre dunklen Augen blitzen. Und Marvin lacht auch -
Kapitel 5
Das neue Leben
Draußen neben der Terrasse ist an meiner Kletterrose die erste Blüte dieses Sommers aufgegangen. Den Namen der Rose kenne ich nicht. Sie ist blassrosa und eigentlich recht unscheinbar, aber ihr Duft ist wie reife Orangen und Jasmin mit einem Hauch Muskat. Der Duft erinnert mich an den wunderbaren, halb verwilderten Garten auf der Insel. Ich will gar nicht erinnert werden, aber immer wieder taucht etwas auf, das die alten Bilder aufleben lässt.
Viel Zeit ist vergangen.
Ich habe ein neues Zuhause gefunden.
Und ich habe Thilo gefunden.
Thilo Sanwald ist ein großer, hagerer Mann mit schmalem Gesicht und glattem, schwarzem Haar, dunklen, forschenden Augen. Er hat eine tiefe, warme Stimme. Sein Gesicht hat einen grüblerischen, fast melancholischen Zug.
Er ist fürsorglich und liebevoll.
Man könnte eher sagen: Thilo hat mich gefunden. Buchstäblich von der Straße aufgelesen hat er mich. Viele Tage war ich ziellos und verwirrt durch die Straßen gelaufen. Ich versuchte klarzukommen mit mir und der neuen Situation. Ich fühlte mich verloren und wie entwurzelt.
Inzwischen war der Winter da. Es war kalt geworden. Der Frost legte sich wie eine eisige Maske auf mein Gesicht, wenn ich lange unterwegs war.
Wenn ich mein düsteres, winziges Appartement verließ, stürzte das Licht so gleißend auf mich ein, dass ich geblendet die Augen schließen musste.
Schräge weiße Strahlen der winterlichen Sonne fielen auf Hausdächer und die Wipfel der kahlen Bäume.
Wie eine weißlich graue Dunstwolke stand der Atem vor meinem Gesicht. Der Nordwind blies tückisch um die Hausecken. Mit eingezogenen Schultern rannte ich durch die Straßen, zum Hafen und zurück. Es war, als wollte ich meinen düsteren Gedanken entkommen, die mich nicht zur Ruhe kommen ließen.
Die kalte Luft auf Stirn und Wangen sollte endgültig allen Kummer, allen Schmerz abwaschen. Meine Haut war gefühllos geworden, ich spürte den eisig peitschenden Wind nicht mehr.
Und doch – könnte nicht er jetzt hier an meiner Seite gehen, den Arm um meine Schultern gelegt … vielleicht eines Tages doch noch …
Wohin verirrten sich meine Gedanken?
Würde ich denn nie, nie Ruhe finden?
Und dann war es geschehen.
Ich wollte die Straße überqueren und rannte direkt in das Auto hinein. Später erinnerte ich mich nur an einen gewaltigen, dumpfen Stoß, dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, war ich in Thilos Haus. Ich lag auf einer Couch, und ein Arzt beugte sich über mich.
Ich hatte keine schlimmen Verletzungen davongetragen, ein paar Prellungen, Blutergüsse und einen Schock. Eine zierliche alte Dame mit grauem Lockenhaar und freundlichem Gesicht beugte sich über mich. So lernte ich Mathilde Sanwald und ihren Sohn Thilo kennen.
Als sie erfuhren, dass ich allein lebte, bestanden sie darauf, mich im Haus zu behalten und gesund zu pflegen. Ich muss ihnen recht jämmerlich und hilfsbedürftig vorgekommen sein. Dabei fehlte mir nicht viel, und ich hätte schon nach wenigen Tagen gehen können.
Es war jedoch so unglaublich wohltuend, mich umsorgen zu lassen, dass sie mich nicht lange zum Bleiben überreden mussten. Ich fühlte mich geborgen wie schon seit langem nicht mehr.
Wir kamen schließlich überein, dass ich mein kleines Appartement aufgab und im oberen Geschoss des Hauses 2 Räume mietete. Die Küche im Erdgeschoss durfte ich mitbenutzen.
Am Tage kam stundenweise eine Frau zum Putzen, sie kochte auch, und ich wurde gebeten, die Mahlzeiten mit ihnen gemeinsam einzunehmen. Das tat ich mitunter, aber nicht immer.
Das Haus stand in der Nähe des Hafens. Es war ein großes Haus, das aus drei Stockwerken bestand, es war aus roten Ziegelsteinen erbaut. Thilo war Antiquitätenhändler, und seine Mutter half ihm dabei.
Das gesamte Erdgeschoss war vollgestellt mit Möbeln. Standuhren, chinesische Schränke, Stühle und antike Sesselchen, Bücherschränke und Tischchen reihten sich aneinander.
Wenn ich in der Dämmerung durch die unteren Räume ging, ragten sie wie sonderbare Schatten um mich auf. Das Ticken all der Uhren erschien mir sehr laut in der Stille.
Hin und wieder fuhr Thilo zu Versteigerungen. Er nahm dafür weite Entfernungen in Kauf. Nach seiner Rückkehr wurde das Haus dann noch voller.
Es gab noch ein Geschäft im Stadtzentrum, wo er ausstellte, aber die wertvollsten Sachen standen hier im Haus. Es kamen ständig Interessenten und Kunden, um sie sich anzuschauen.
Mathilde Sanwald hatte das Geschäft zusammen mit ihrem Mann vor Jahrzehnten aufgebaut. Sie verstand eine Menge von Antiquitäten, ebenso wie Thilo. Beide waren erfahrene und beschlagene Kunstexperten.
Auch meine Räume waren mit alten Möbeln unterschiedlicher Epochen ausgestattet. Es wirkte überladen und düster, aber das störte mich nicht. Im Gegenteil, es passte eigentlich sehr gut zu meiner damaligen depressiven Stimmung.
Zwar war ich körperlich wieder ganz in Ordnung, aber um meinen seelischen Zustand war es nicht allzu gut bestellt. Ich hockte stundenlang am Fenster oder lag auf dem Bett. Hin und wieder zwang ich mich, nach draußen zu gehen. Dann lief ich ziellos durch die Straßen, mitunter ohne wahrzunehmen, was um mich her geschah.
Die Sanwalds ließen mich meistens in Ruhe. Sie ahnten, dass ich auf der Insel Schlimmes erlebt hatte und Zeit brauchte, um das zu verarbeiten. Ich hatte von Familienproblemen gesprochen, und ich glaube, sie dachten, ich hätte mein Zuhause wegen eines Mannes verlassen. Vielleicht vermuteten sie eine große Liebestragödie, eine unglückliche Liebe, von der ich mich erholen musste. Ich ließ sie in dem Glauben, und so sprachen wir nicht davon.
Manchmal baten sie mich abends nach unten ins Wohnzimmer. Mathilde Sandwald spielte Klavier, wir lasen oder unterhielten uns. Sie wollten mich aufheitern, mich in die Familie einbeziehen.
Ich spürte auch, dass Thilo mich zunehmend mehr mochte, er zeigte es mir auf sehr unterschiedliche Weise in seiner zurückhaltenden, einfühlsamen Art.