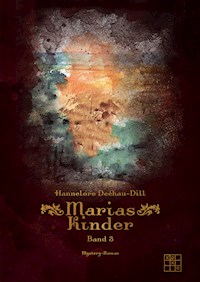Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: XOXO-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Rebecca sich auf die Reise zum Gut ihrer Großeltern macht, ahnt sie nicht, was dieser Sommer für sie bereithält. Nicht nur flimmernd-warme Tage, sondern auch die erste Liebe. Doch über Gut Erlengrund scheint ein düsteres Geheimnis zu liegen, das seinen Ursprung in der Vergangenheit hat und bis in die Gegenwart hineinwirkt. Viel zu oft muss sich Rebecca fragen, ob das, was sie sieht, Wirklichkeit ist oder ihrer Fantasie entspringt. Doch eines steht fest, irgendetwas Böses brodelt unter der perfekten Oberfläche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hannelore Dechau-Dill
Die Zeit der hellen Nächte
Roman
Impressum
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://www.d-nb.deabrufbar.
Print-ISBN: 978-3-96752-071-2
E-Book-ISBN: 978-3-96752-571-7
Copyright (2021) XOXO Verlag
Umschlaggestaltung und Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag
unter Verwendung folgender Bilder von Shutterstock: 256923322
Hergestellt in Bremen, Germany (EU)
XOXO Verlag
ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH
Gröpelinger Heerstr. 149, 28237 Bremen
Alle Personen und Namen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieser Roman wurde bewusst so belassen, wie ihn die Autorin geschaffen hat, und spiegelt deren originale Ausdruckskraft und Fantasie wider. Alle Personen und Namen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Mein Glück bestand aus dem gleichen Geheimnis
wie das Glück der Träume,
es bestand aus der Freiheit,
alles irgend Erdenkliche gleichzeitig zu erleben,
Außen und Innen spielend zu vertauschen,
Zeit und Raum wie Kulissen zu verschieben.
(H. Hesse)
Prolog
Manchmal wache ich in der Nacht auf und habe das Gefühl, nicht alleine zu sein. Meine Hand tastet nach dem Lichtschalter, die Lampe erhellt das dunkle Zimmer. Niemand ist da. Und doch ist es mir so vorgekommen, als hätte ich Schritte auf dem Holzfußboden gehört. Schritte, und vielleicht auch das Wispern von Stimmen.
Dann weiß ich, es sind wieder die Schritte und Stimmen der Vergangenheit, die mich eingeholt haben. Und unter ihnen die Stimme meines Vaters.
Ich mache das Licht wieder aus und drehe mich auf die Seite. Der Schlaf kommt bald und mit ihm der Traum. Ich befinde mich inmitten eines sanften, schwarzen Gewässers.
Es ist der See meines letzten Sommers, unser See, und das Wasser ist kalt. So kalt, wie es den ganzen Sommer über war. Es ist Nacht, in der Ferne entdecke ich Lichter an einem sichelförmigen, wunderschönen, abfallenden Ufer. Und dort wartet er auf mich. Ich erkenne im Mondlicht seine hohe, hagere Gestalt, sein Gesicht ist im Schatten.
Mein Kinn wird von kleinen, leichten Wellen umspült, während ich langsam auf ihn zu schwimme.
Ich schwimme und schwimme, und plötzlich merke ich, dass ich keinen Meter vorankomme.
Die Lichter und die Gestalt meines Vaters bleiben fern und unerreichbar, so wie die tausend sich spiegelnden Sterne auf dem schwarzen Wasser. Und allmählich begreife ich: dieser Strand wird mir immer unerreichbar bleiben, der Strand, die fernen Lichter und mein Vater.
Die Gestalt am Ufer wendet sich ab.
Das Bild verändert sich. Die Nacht ist fort und mit ihr die Sterne. Ich aber paddle immer noch im Wasser, hilflos und verzweifelt, denn ich kann nicht ans Ufer.
Da geht der Tod, denke ich zusammenhanglos. Der Tod, der kommt und geht. Jetzt ist es zu Ende, denke ich und sehe meinen Vater in seinem wiegenden Gang um den dunklen See wandern, an einem frühen Morgen, wenn die Feuchtigkeit Schleier über die Wasseroberfläche wirft. Dann ist die Gestalt verschwunden, vom Morgennebel verschluckt.
Im Traum will ich schreien, ihn rufen: Vater! Warte doch auf mich! Aber kein Laut kommt über meine Lippen.
Ich wache auf und spüre den Schweiß auf meiner Stirn. Ich setze mich im Bett auf und wische mir mit dem Handrücken die Stirn ab. Schweiß läuft mir in kleinen Strömen den Rücken hinunter. Ich sitze auf der Bettkante und warte, dass mein Herz aufhört zu hämmern, meine Atemzüge wieder ruhig und gleichmäßig werden.
Ich friere, denn es ist kalt im Zimmer. Ich ziehe die Bettdecke über meine Schultern und versuche den Traum abzuschütteln. Den Traum und die schweren Gedanken, die ihn begleiten. Aber es sind gar keine Gedanken, es ist nur schwer – eine unsichtbare Last, die mich niederdrücken will. Eine Last der Enttäuschung, der Bitterkeit und das Gefühl, dass etwas misslungen ist.
Oder nein, vielleicht nicht misslungen – eher verloren. Ein Gefühl von Verlust. Ich habe das seltsame Gefühl, etwas verloren zu haben, das ich nie besessen hatte.
Winter
Es ist Winter. Ein kalter Winter mit viel Schnee. Draußen wirbeln Flockenschleier. Seit Dezember geht das nun so. Ich stehe am Fenster und blicke in den Garten hinunter. Die Erde kommt mir wie ausgesogen vor, alle fröhlichen Farben sind fort – nun so lange schon. Meine herrlichen, fröhlichen Farben des Sommers …
Nichts als Weiß und Schwarz da draußen. Aus einem kalten Himmel fallen unaufhörlich schwere, weiße Flocken, sie ersticken jedes Geräusch, verwischen alle Konturen, bilden Wälle, die weich werden, zusammensinken, nur um schwer und weich wieder emporzuwachsen. Wann hat es je soviel Schnee gegeben?
Wie mag der Winter dort sein? Dort ist für mich das alte Landhaus meiner Großeltern, wo ich den vorigen Sommer verlebt habe. Der bedeutsamste Sommer meines ganzen 17jährigen Lebens. Der schönste und der schrecklichste! Oh ja, er war beides: unglaublich schön und doch auch schrecklich, oder vielleicht eher traurig. Beängstigend und erschütternd. Er war alles. Er hat mich verändert. Uns alle. Er hat alles verändert.
Ich spüre wieder die leise Wehmut über den vergangenen Augenblick. Kann man denn von seinen beängstigenden Erinnerungen mit Traurigkeit Abschied nehmen?
Aber es war ja nicht alles so schlimm, oh nein. Es war soviel Schönes dabei. Herrliche, wunderbare Augenblicke, die die Macht hatten, alles Schreckliche jenes Sommers zu mildern, zu dämpfen, es zeitweise zu überstrahlen und in den Hintergrund zu drängen. Er war alles, jener Sommer. Die paar Wochen waren wie ein ganzes Leben.
Ich sehne mich nach dem Frühling. Nach einem neuen Sommer. Und doch weiß ich, dass es nie wieder so einen geben wird wie den vorigen. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Morgen, als ich am Fenster stand und dachte: Soviel Schönheit ringsumher. Und all das gehört in diesem Sommer mir. Und dann die seltsame, erschütternde Erkenntnis: Nie wieder werde ich einen Sommermorgen wie diesen sehen. Nie wieder mit den gleichen Augen! Im nächsten Sommer wird alles anders sein … Ich werde eine Andere sein …
Ich erinnere mich an ihn, Julian, an unseren letzten gemeinsamen Abend. Wir wissen, der Abschied ist da. Wir gehen nebeneinander durch den Abend. Meine Augen sind voller Tränen, ich kann kaum etwas sehen. Und doch gehe ich und mir ist, als müsste ich immer so weitergehen, diese graue Straße entlang. Ihn neben mir fühlen, mich nach ihm sehnen, laut heraus schreien und doch nicht sprechen können, wie unter einem Albdruck, als müsste ich weiter und weiter gehen, bis ich taumele und falle. Er geht neben mir, spricht zu mir, ich höre seine Stimme und verstehe doch nicht, was er mir sagt. Vielleicht verstehe ich es auch und will es nicht hören …
Er redet tröstend auf mich ein … wir kehren um, müssen in den Graben ausweichen, um einem Lastwagen aus dem Wege zu gehen. Der Graben ist ausgetrocknet und voll verstaubter Goldraute und Margeriten. Ich stolpere, er fasst meinen Arm und stützt mich. Und dann sind wir in der goldgrünen Tiefe des Waldes, den ich in diesem Sommer so oft durchstreift habe. Die rote Sonne steht tief. Über uns schwimmt der Mond als blasse Sichel am Himmel.
Einen Augenblick stehen wir und horchen auf das Pochen unserer Herzen. Er beugt sich zu mir herunter und küsst mich – ein letztes Mal? Ich schließe die Augen.
Wir sprechen nur wenig, als wir zurückgehen. Halbblind vor Tränen und Müdigkeit stolpere ich neben ihm her, ganz erfüllt von der Traurigkeit des Lebens, all meiner Sehnsucht, meinem Tasten im Dunkeln und meinen Trennungen.
Es ist fast kalt unter den Bäumen. Aus einem Haselgebüsch ertönt das unruhige Zwitschern kleiner Vögel, das zarte Zirpen einer Grille…
Der Abschied ist da. Das Ende unserer gemeinsamen Zeit? Auch das Ende unserer Liebe?
Ich stehe am Fenster und blicke auf die schimmernde Welt hinaus: die weiß bestäubten Bäume, die blendende Weiße der Schneedecke, die zum Teil von der Sonne rosig überhaucht ist, die blauen Schatten.
Im Dezember hat es angefangen mit diesem vielen Schnee. Die weißen Wolken, die tagelang majestätisch über den Himmel gezogen waren, hörten auf, sich zu bewegen. Sie sammelten sich, schlossen die Sonne ab, hüllten das Land in frostiges Schweigen.
Dann fielen die ersten schweren Flocken. Am nächsten Morgen war die Welt verwandelt. Ohne Wind, ganz leise und heimlich, war der Schnee gefallen, tief und lautlos, hatte die Wege zugedeckt und die Straßen unpassierbar gemacht. Bäume und Häuser wie auf einer Weihnachtspostkarte! Immer noch hingen die Wolken schwer von Schnee tief herunter.
Der Schneepflug räumt die Straßen, aber das Gehen ist immer noch mühsam. Wieder wirbeln die Flockenschleier. Auf meinem Weg zur Schule bläst der Wind mir Schnee in die Augen, wie kleine Glassplitter. Die Welt ist weiß, unmöglich zu unterscheiden zwischen Erde und Wasser. Die Bäume am Straßenrand stehen müde und beladen in ihren weißen Kleidern.
Ein kalter Winter mit viel Schnee. Mir gefällt das nicht. Ich werde ganz melancholisch beim Anblick von soviel Weiß.
Und dann die Schule.
Dort ist mir alles fremd geworden. Seit dem Herbst bin ich nun wieder da, und doch kann ich mich nicht eingewöhnen. Ich bin ihr entwachsen, scheint mir. Mit den Freundinnen weiß ich nichts mehr anzufangen. Sie spüren meine abweisende Haltung und ziehen sich zurück. Die Klassenräume bedrücken mich, der Geruch der staubigen Korridore erstickt mich fast. Die Stimmen der Lehrer dröhnen mir in den Ohren. Ich fühle mich gefangen, unterdrückt – ich sitze wie in einer Falle.
Ich sehne mich nach dem Frühling. Aber was wird dann anders sein? Ich werde immer noch zur Schule gehen, ein und ein halbes Jahr habe ich noch vor mir. Dann das Abitur – und dann?
All meine Pläne von früher erscheinen mir kindisch und unreif. Graphikerin wollte ich werden, für Design habe ich mich interessiert. Jetzt aber weiß ich gar nicht mehr, was ich will.
Lass dir Zeit, mein liebes Kind, sagt meine Mutter. Du hast soviel mitgemacht in den letzten Monaten. Lass dir Zeit, um all das zu verkraften.
Wenn ich traumverloren und verzagt am Fenster hocke, trübe in die winterliche Landschaft starre, kommt sie manchmal zu mir. Zögernd öffnet sie die Tür, fragt mich mit leiser Stimme: darf ich? Dann erst betritt sie mein Zimmer. Das hat sie früher nicht getan. Sie ist so vorsichtig geworden, behutsam und fast ein wenig ängstlich. So als wüsste sie nicht, wie ich auf ihre Anwesenheit in meiner Nähe reagiere.
Wie eine Kranke behandelt sie mich. Oder wie eine Genesende? Jedenfalls gibt sie sich große Mühe. So große Mühe. Täte sie das nicht, wäre alles einfacher. Glaube ich. Aber möglicherweise täusche ich mich auch. Denn es ist alles anders geworden. Wir haben uns verändert. Nie mehr wird es so sein wie früher.
Auch nicht zwischen uns beiden …
Sie steht neben der Tür und blickt mich traurig an. Fragend und ernst. Und auch besorgt, so besorgt.
Geht es dir gut, Rebecca? Kann ich etwas für dich tun?
Aber ja, es geht mir gut. Du sagst ja selbst, alles braucht seine Zeit.
Glaube ich wirklich, dass Zeit die Wunden heilt?
Ich weiß es nicht. Sicher ist es doch nicht die Zeit allein. Es ist das Ritual des Körpers und der Seele, das sie heilt. Die Zeit tut nichts, außer Distanz schaffen zwischen dem Menschen und dem, was ihm die Wunden zugefügt hat.
Und wie ist es mit der Erinnerung? In der Erinnerung verklären oder verstärken sich häufig die Dinge. Die Erinnerung an Kummer oder Angst kann stärker sein, als die ursprüngliche Angst selbst. Und ist es nicht dasselbe mit dem Glück? Wie sonst sollen wir Sehnsucht erklären? Die Sehnsucht nach etwas, das bereits vergangen ist. Sehnsucht ist wie Schmerz, wirklicher Schmerz.
Ich fahre zusammen, als meine Mutter spricht. Ich habe ganz vergessen, dass sie noch im Zimmer ist.
Ach, mein liebes Kind. Ich wollte, ich könnte dir helfen … sagt sie leise. Wartend und ratlos steht sie da. Wie ein Bettler, der an einer Tür steht und Einlass begehrt. Sie tut mir leid, trotzdem stehe ich nicht auf und gehe zu ihr. Ich weiß, dass sie auf mich wartet. Auf ein liebes Wort, eine Umarmung. Aber das kann ich jetzt nicht. Es ist alles so schwierig geworden.
Schweigen hängt zwischen uns, breitet sich aus.
Ich antworte nicht, blicke nur wieder hinaus in den Schnee. Bald wird es dunkel sein. Ich habe die Dämmerung früher so geliebt. Jetzt macht sie mich traurig. Ich warte. Warte, dass meine Mutter das Zimmer verlässt, die Türe hinter sich schließt. Denn ich will allein sein. Allein mit meinen Gedanken und Erinnerungen.
Ich kann es nicht lassen. Immer wieder geraten meine Gedanken auf die alten Wege. Die Wege des vergangenen Sommers. Ich kann es nicht lassen, die Bilder jenes Sommers herauf zu beschwören. Wieder und wieder …
Es ist wie eine Krankheit, wie eine Sucht …
Ich kann es nicht lassen, es ist nun einmal so.
Ich kann es nicht lassen …
Und während draußen das letzte Tageslicht schwindet und dicke Schneeflocken durch die Luft taumeln, ist in mir und um mich wieder Sommer.
Sommer
Ich schließe die Augen und sehe sie vor mir, die Bilder des Sommers. Sie sind so viel stärker als das, was jetzt in der Realität um mich ist. Sie haben sich mir eingeprägt, fast als hätte ich mein Leben dort im Erlengrund zugebracht, nicht nur wenige Monate. Eine kleine Ewigkeit.
Und eine kleine Ewigkeit ist es, die mich von den unwirklichen, hellen Nächten des letzten Sommers trennt, von dem großen Licht über dem Wald, von dem goldenen Sonnenschein über dem See in seiner grünen Mulde, dessen Wasser sich wie blaue Seide kräuselt, vom Duft des Jasmins in der Nacht, die schwer ist von der Sommerhitze und hell von einem schwülen Mond …
Ich sehe sie vor mir, höre ihre Stimmen: Großvater Jonas und Großmutter Anthea, beide so unglaubliche Persönlichkeiten. Und all die anderen. Die kleine Sammy, die mir wie ein Schatten folgt. Tamar, ihre Mutter, schlank und drahtig auf ihrer Stute Reseda. Die schweigsame und seltsame Bernadette, Mutters Schwester, früher einmal ein gefeierter Star am Theaterhimmel. Und die alte Tante Clarissa in ihrem Seitenflügel, mit ihren Stickereien und Orakeln. Ach, und all die anderen …
Und dann er, Julian!
Ach, Julian … Und nun ist für nichts anderes mehr Platz in mir und meinen Gedanken. Nur noch für ihn… Julian… Julian …
Die Erinnerungen brechen über mich herein, und ich verspüre diese tiefe Trauer, von der ich weiß, dass sie niemals ganz in Vergessenheit geraten wird …
Es ist der Anfang des Sommers, und es ist Nacht. Der Himmel ist voller Sterne. Eine leichte Brise streicht an meinen nackten Beinen entlang. Ich gehe durch das nasse Gras, meine Füße sind kalt.
Da ist der See, ich schlinge die Arme um mich und gehe hinaus auf den Steg. Er schwankt unter mir, es ist wie auf einer schwingenden Brücke. Ich knie mich hin und halte die Hand ins Wasser. Es ist kalt, still. Ich spüre, wie die Kälte meinen Arm hinauf kriecht. Als ich wieder aufblicke, sehe ich ihn. Er steht etwa drei Meter hinter mir, groß und dunkel gegen den nächtlichen Himmel. Er ist also gekommen.
Mein Herz fängt heftig an zu klopfen. Wir sind ganz allein in dieser weichen, samtigen Nacht. Ich bin in seinen Armen, mein Kopf an seiner Schulter, die raue Wolle seines Ärmels an meinem Gesicht … und dann sein Gesicht nah über mir …
Aber nein! Nein, es ist ja nicht wahr. Ein Streich, den mir meine Sinne gespielt haben. Er hat nur die Arme gehoben, um seinen Pullover auszuziehen.
Du frierst ja, sagt er und kommt die paar Schritte auf mich zu. Komm, zieh ihn an.
Er zieht mir seinen Pullover über den Kopf, ich stehe unbeweglich. Kann mich nicht rühren, spüre eine schmerzliche Erleichterung. Und doch auch Enttäuschung …
Wir binden das alte Boot von dem Baumstamm los, er lässt mich zuerst einsteigen. Das Boot schaukelt unter unserem Gewicht. Er greift nach den Rudern. Breit und riesig kommt er mir vor, wie er da mit ausgebreiteten Armen rudert.
Wir sprechen nicht. Alles scheint so selbstverständlich. Als hätten wir uns hier für diese Nacht verabredet. Ich blicke zum sternenübersäten Himmel auf. Das Wasser unter uns ist glatt und dunkel.
Ich denke an das nächtliche Haus, aus dem ich mich soeben leise und heimlich davon gestohlen habe. Dunkel und massig liegt es hinter mir, seine schlafenden Bewohner jeder für sich in seinem eigenen Traum befangen.
Großvater in seinem gewaltigen Eichenbett mit dem geschnitzten Kopfteil, leise schnarchend, das weiße Haar so weiß wie das Kissen unter seinem Kopf. Der alte Schäferhund schnaufend auf dem Läufer neben seinem Bett. Großmutter im anderen Zimmer unter ihrem hellblauen Baldachin, fast lautlos atmend, würdig und geordnet, mit gefalteten Händen auf der Bettdecke. Bernadette im hochgeschlossenen Nachtgewand, das Gesicht dem Fenster zugekehrt – oder der Tür, als würde sie beides misstrauisch im Auge behalten. Was könnten ihr in so einer sanften Nacht für Dämonen begegnen?
Die alte Clarissa wird vielleicht die Einzige sein, die nicht schläft. Sie wandert manchmal im Haus herum, in wallendem Schlafrock und mit hochgesteckten Haaren.
Und dann all die anderen, in den anderen Gebäuden, der Verwalter Bertold Skabowsky, der Gehilfe Philip, das Mädchen Lilli. Dann ist da noch Matilda, die stramme Köchin, die mich unter ihre speziellen Fittiche genommen hat (dich müssen wir erst mal richtig herausfüttern, so mager wie du bist!).
Und nicht zu vergessen Sammy, die dunkellockige Samantha, Tamars sechsjähriges Töchterchen. In Gedanken sehe ich sie mit verwuscheltem Haar in ihren Kissen, eine braune Kinderhand unter die Wange gedrückt, die Bettdecke von sich geschoben. Ja, und dann noch Tamar, die schlanke, anmutige Tamar, die man sich gar nicht ohne die Pferde vorstellen kann. Auch in ihren Träumen nicht.
Morgen kommen auch die Eltern, um hier Urlaub zu machen, ein paar Wochen lang. Dann werde vielleicht auch ich wieder manchmal nachts im Hause herum wandern, weil ich nicht schlafen kann. Weil mich seltsame Gedanken nicht zu Ruhe kommen lassen.
In diesen letzten Nächten konnte ich schlafen. Tief und traumlos – jedenfalls wusste ich nichts von Träumen.
Oder nur von anderen Träumen, wunderbaren, romantischen Träumen, von Julian.
Diese anderen, seltsamen Gedanken und Träume haben mich hier in meinen ersten Nächten in Ruhe gelassen. Bis jetzt …
Julian hält im Rudern inne, und das Boot treibt reglos auf dem Wasser.
Warum bist du hergekommen? frage ich.
Ich mache das oft, sagt er. Seit ich ein Kind war, habe ich meine Sommer im Erlengrund verlebt. Nachts bin ich manchmal hier rausgekommen, bin auf den See hinausgerudert, und dann bin ich auf dem Boden des Bootes eingeschlafen. Ich wurde wach, wenn ich anfing zu frieren.
Er sieht mich an.
Aber heute, sagt er, heute bin ich deinetwegen gekommen. Ich sah dich aus dem Fenster zum See hinunter gehen.
Also doch. Er ist meinetwegen gekommen. Dann wird dies der Anfang sein. Unser Anfang …
Ich lege mich auf den Rücken und wende den Kopf zur Seite. Ich drücke mein Ohr auf den hölzernen Boden und lausche den Geräuschen des Wassers. Dann blicke ich in sein Gesicht, das mir nun sehr nah ist.
Mir scheint, da ist auch Musik. Über uns ein weiter nächtlicher Sommerhimmel und unter uns das sanfte Schwanken des Bootes und das Murmeln des Sees.
Und dann ist da der süße Geruch des Sommers und der Liebe – und alles zusammen macht mich schwindlig.
Dies ist der Anfang unserer Liebe …
Der Verdacht
Ich weiß nicht, wann in mir zum ersten Mal diese sonderbare Vermutung auftauchte. Diese fixe Idee - oder besser: dieser fatale Verdacht, der sich in meinem Bewusstsein festsetzte, wo er im Laufe der Zeit zur Gewissheit wurde.
Es ist schon eine ganze Weile her. Jahre, um genau zu sein. Vielleicht sieben Jahre, vielleicht auch zehn? Jetzt bin ich 17.
Mit meinem Zeitgefühl gibt es da eine Merkwürdigkeit. Ich kann mich nicht meiner einzelnen Geburtstage entsinnen! In meiner Erinnerung gibt es zwar verschiedene Geburtstage, aber ich kann mich nicht an mein jeweiliges Alter erinnern.
Ich sehe Kinderfeste vor mir, Freundinnen an einer langen Kaffeetafel, Spiele im Garten und Toben durchs Haus. Ich sehe mich in kurzen Röckchen, längeren Röcken, langen Hosen. Mal mit kurzem Haar, dann mit Zöpfen oder auch mit Pferdeschwanz. Die Gesichter der Kinder an der Kaffeetafel wechseln, verändern sich, die Spiele auch. Andere Spiele, andere Gesichter, andere Kaffeetafeln. Und nie weiß ich in der Erinnerung, wie alt ich gerade geworden bin.
Dieses Kind, das kleine Mädchen in meiner Erinnerung, ist stets alterslos – ganz gleich wie groß es ist oder welche Frisur es trägt.
Nun zu der seltsamen Idee, die mir eines Tages in den Kopf kam. Ich war vielleicht acht oder neun Jahre alt. Es geschah am Anfang eines Sommers. Da tauchte der verrückte Gedanke in mir auf: Mein Vater ist gar nicht mein Vater!
Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich belauschte. Dieses Gespräch schien plötzlich die Erklärung für so vieles zu sein, was ich bis dahin nicht verstand. Bis zu diesem Tag hatte es mitunter Ungereimtheiten, unverständliche kleine Erlebnisse gegeben, die mir nach diesem Gespräch auf einmal logisch erschienen. Als hätte sich eines zum anderen gefügt, und alles zusammen ergäbe nun ein vollständiges Bild.
Eine einzige richtige Erklärung für alles, was mir bis dahin unbegreiflich und rätselhaft erschienen war. Von da an überfiel mich von Zeit zu Zeit schlagartig ein Gefühl von Unwirklichkeit, als würden Körper und Geist unabhängig voneinander existieren.
Es ist ein warmer Sommerabend. Ich komme vom Spielen heim. Es ist nicht spät. Ich habe noch Zeit bis zum Abendessen. Der Rasen vor dem Küchenfenster ist frisch gemäht. Es riecht nach Gras und Erde. Das Küchenfenster steht weit offen. Die weiße Gardine weht leicht im Wind. Ich setze mich auf die Bank und lehne mich an die sonnenwarme Ziegelwand.
Gedämpfte Stimmen aus der Küche dringen zu mir heraus. Sie machen mich stutzig.
Es sind die Stimmen der Eltern, aber sie klingen anders als sonst. Zunächst begreife ich gar nicht, wovon sie reden. Es klingt irgendwie beängstigend, und in der Stimme der Mutter schwingen Tränen.
Es war doch bisher alles gut, sagt der Vater. Warum sollte es nicht so bleiben. Haben wir sie nicht immer geliebt, als ob sie unser gemeinsames Kind wäre?
Ich drücke den Hinterkopf an die warme Hauswand, blinzle in die rötliche Abendsonne und versuche, den Sinn des merkwürdigen Gesprächs zu begreifen. Schließlich verstehe ich doch eines: Sie reden über mich. Aber es klingt, als ob diese Worte nicht für mich bestimmt sind.
Ich kauere auf der harten Holzbank und verstehe die Welt nicht mehr. Was bedeutet das: wir haben sie geliebt, als ob sie unser gemeinsames Kind wäre?
Bin ich es denn nicht? Aber wie ist das möglich?
Verschwommen entsinne ich mich des Gefühls, das da in mir hochkriecht: eine diffuse Mischung aus Ratlosigkeit, Schmerz und Angst – ja, auch Angst ist dabei. Als ob das feste Gefüge meines Leben auf einmal auseinanderzubrechen droht.
Mir ist, als ob alles Blut aus meinem Kopf weicht und irgendwo in meinem Körper versickert, wie Sand, der aus der oberen Hälfte eines Stundenglases zu Boden rieselt.
Ich verkrampfe die Finger im Schoß und kämpfe verzweifelt gegen die Tränen: Ich werde nicht weinen, ich werde nicht weinen. Mein Gesicht ist verzerrt vor Anstrengung.
Was ist mit mir geschehen? Mit meinem Leben, meiner Welt?
Dieses Kind Rebecca, das hier draußen im harmlosen Abendsonnenschein sitzt, ist nicht das Kind der beiden da drinnen? Nicht ihr gemeinsames Kind! Das kann nur eines bedeuten: Eines von beiden ist nicht mein wirkliches, richtiges Elternteil.
Aber wer ist es?
Urplötzlich weiß ich es: der Vater ist es. Der Vater ist nicht mein richtiger Papa. Auf einmal ist alles so klar. So deutlich und sonnenklar. Viele Dinge, die bisher merkwürdig und rätselhaft schienen, finden nun ihre Erklärung.
Ich sehe den Vater vor mir, wie er sich am Abend über mein Bett beugt, um mir Gute Nacht zu sagen. Er streicht mir übers Haar, aber er gibt mir keinen Gute-Nacht-Kuss, wie die Mutter es tut. Ich erinnere mich an die vielen Male, wenn ich als ganz kleines Mädchen zu ihm auf den Schoß kletterte, ihm die Arme um den Hals legte. War er nicht immer ganz schnell und verlegen dabei gewesen, meine Arme von seinem Hals zu lösen?
Wie oft hatte ich mit ihm herumtoben, mit ihm spielen wollen. Und meistens wehrte er mich ab. Stets mit einem seltsam verlegenen Ausdruck im Gesicht. Manchmal gab er sich einen Ruck. Dann zwang er sich, mir den Arm um die Schultern zu legen, mich an sich zu ziehen. Einen winzigen Augenblick nur, schon ließ er mich wieder los.
Oh ja, er gab sich auch Mühe. Vielleicht hatte die Mutter ihn ermahnt, dem kleinen Mädchen doch ein wenig mehr Zärtlichkeit zu zeigen. Und er bemühte sich. Aber das kleine Mädchen spürte sehr deutlich mit dem Instinkt eines empfindsamen Kindes, dass er sich dazu überwinden musste.
Dann sein seltsamer, forschender Blick, der mir mitunter folgte. Als beobachtete er mich, um etwas ganz Bestimmtes herauszufinden. Vielleicht eine Ähnlichkeit mit meinem richtigen Vater zu entdecken? Oder um auf diese Weise dahinter zu kommen, wer es denn sein könnte? Hat er nie erfahren, wer es ist?
Im Laufe der Jahre hat mich dieser Verdacht, er sei nicht mein richtiger Vater, stets begleitet. Was heißt Verdacht? Es ist für mich ja längst zu einer Gewissheit geworden.
Nur habe ich nicht ständig und Tag für Tag daran gedacht. Ich war ein Kind, das älter und größer wurde. Ein sehr sensibles Kind, das auch Anderes zu denken und zu verkraften hatte. Es gab stets vieles für mich, was ich bedenken und verarbeiten musste: Mich selbst, meine Freundinnen, die Schule, meine ganze Umwelt, all das, was um mich herum geschah. Und die Ehe meiner Eltern.
So war ich damals, und so bin ich noch heute.
Ich lebte also mit diesem Wissen, ohne ständig darüber nachzugrübeln. Es gab Zeiten, da schien es fort zu sein, als hätte ich es vergessen. Oder in den tiefsten Winkel meines Geistes zurückgedrängt. Einfach ausgeblendet, ganz unbewusst. Ich weiß es nicht. Heute ist mir das immer noch nicht ganz klar.
Dann wieder war es da irgendwo aus dem Hintergrund meines Bewusstseins aufgetaucht.
Ich erinnere mich, dass ich Mama einmal danach fragte.
Ist Papa nicht mein richtiger Vater? sage ich. Völlig entgeistert und erschrocken blickt sie mich an.
Wie um Himmels willen kommst du darauf? bringt sie schließlich hervor. Natürlich ist er dein richtiger Vater. Schlag dir nur solche dummen Gedanken aus dem Kopf.
Sie schafft es, mich zu überzeugen. Ich glaube ihr. Sicher habe ich mich damals an jenem Sommerabend am Küchenfenster verhört. Oder etwas missverstanden. Es ist ja nun eine Weile her, und in der Erinnerung ist manches ganz anders.
Mit der Zeit jedoch kam er wieder, dieser Verdacht, wurde zu einem festen Bestandteil meines Bewusstseins. Ich begann mehr und mehr darüber nachzugrübeln. Zu beobachten. Mir fiel wieder auf, wie zurückhaltend mein Vater stets zu mir war. Wie vorsichtig und geradezu ängstlich darauf bedacht, mir nicht zu nahe zu kommen. Ich konnte es ihm nicht verdenken, ich verstand es sogar. Schließlich musste er mit dem lebenden Beweis für die Untreue seiner Frau unter einem Dach leben. Trotzdem fühlte ich mich zurückgewiesen, und es tat weh.
In jener Zeit hatte ich diesen Albtraum, den ich nie vergessen werde. Meine Schreie in den frühen Morgenstunden hallten wie Schockwellen durch das ganze Haus.
Im Traum irre ich wie eine Verrückte durch eine düstere, unheimliche Landschaft. Ich suche ihn, meinen Papa. Er ist verschwunden. Einfach fort, ohne Abschied. Ich haste durch einen pechschwarzen Tunnel, der kein Ende nehmen will. Und ich habe Angst. Unglaubliche Angst. Angst davor, was in dieser schaurigen Dunkelheit um mich herum auf mich lauern könnte. Und noch viel mehr Angst davor, dass ich ihn nicht finden werde. Ihn, meinen Papa. Dann sehe ich ein kleines Licht da vorn am Ende des Tunnels. Ich schreie und renne schneller. Schreie und laufe und kriege die Füße auf einmal nicht mehr vom Boden hoch. Irgend etwas scheint sich wie Fallstricke um meine Beine zu winden.
Ich erwache von meinen eigenen Schreien, die beide Eltern auf den Plan gerufen haben.
Ich reiße die Augen auf und erblicke in der Tür die verschwommene, zerzauste Gestalt meines Vaters, den das Flurlicht wie ein Heiligenschein umgibt. Dann ist Mama da, hält mich im Arm, streicht mir übers Haar. Es ist ja alles gut. Das war nur ein Traum. Ein dummer Albtraum.
Ich hocke im Bett, schweißnass und verstört, noch zucken Fetzen der Bilder meines Traums durch mein Hirn. Mama streicht mir über den Rücken, Papa steht neben dem Bett und hält meine feuchte Hand. Allmählich verblassen die Bilder, und nur ein schmerzhaftes Gefühl von Trauer bleibt zurück.
Ich packe die Hand meines Vaters und halte sie ganz fest. Erstaunt blickt er auf mich herunter.
Ich habe geträumt, du wärst verschwunden, sage ich zu ihm und spüre die Tränen auf meinem Gesicht.
Aber nein, stottert er verlegen. Wie kommst du nur darauf. Es ist ja alles in Ordnung.
Ja, es war doch alles in Ordnung. Papa war da, und alles war nur ein Traum. Aber als ich dann wieder allein in meinem Zimmer lag und an die Decke starrte, dachte ich: Warum – warum hat Papa mich nicht auch in den Arm genommen. Warum ist es zwischen uns so schwierig?
Mama und ich – das war etwas ganz Anderes. Wir liebten uns zärtlich, waren eine Einheit, die den Vater draußen ließ. Ich habe das oft bedauert, denn ich liebte ihn auch. Sehr sogar. Ich erinnere mich gut daran, wie sehr ich mich als kleines Mädchen um seine Gunst bemühte. Was ich mir alles ausdachte und unternahm, um mir seine Liebe zu sichern.
Und doch gab es auch die anderen Zeiten. Zeiten, in denen er nicht so verschlossen und abweisend mir gegenüber war. Besonders als ich älter wurde. Da hatten wir mitunter gute Gespräche, und zwischen uns entstand so etwas wie eine liebevolle Kameradschaft. Ich spürte, dass er mich mochte und sich um mich sorgte. Und dafür liebte ich ihn umso mehr.
Obwohl ich eine Zeitlang oft über »Mutters Untreue« nachdachte (denn so muss es ja gewesen sein, wenn ich das Kind eines anderen Mannes bin), konnte ich ihr doch nicht böse sein. Zwar spürte ich dann so etwas wie Mitleid mit meinem Vater, aber keinerlei Wut oder Ärger über meine Mutter.
Wer weiß, wie damals alles war. Ich sagte mir, dass ich es nicht beurteilen konnte. Es war ein Geheimnis für mich. Und nicht nur für mich. Wer mochte davon wissen?
Je älter ich wurde, desto stärker wuchsen meine Neugier und der Drang, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Herauszufinden, was sich damals zugetragen hatte.
Ich stand vor dem Spiegel und studierte meine Züge. Ich entdeckte weder Ähnlichkeit mit meiner Mutter, noch mit meinem Vater. Aber ich glaube, das ist immer schwierig. Das sehen wohl nur Andere. Ich jedenfalls sah nichts. Ich erblickte dort im Spiegel nur Rebecca, das Mädchen, das ich war und bin: ein schmales, sonnengebräuntes Gesicht unter kurzem, schwarzem Haar, dunkle Brauen über braunen Augen, hohe Wangenknochen und ein voller Mund. Mein Haar ist erst seit dem Herbst wieder so kurz. Im Sommer war es noch eine wilde lange Mähne.
Ich fand, ich könne ohne weiteres von Zigeunern abstammen, mit diesem dunklen Teint und den dunklen Farben. Jedenfalls habe ich mir so ähnlich immer die Zigeuner vorgestellt. Sekundenlang kam mir sogar der Gedanke, ich könnte tatsächlich ein Zigeunerkind sein. Vielleicht haben die Eltern mich eines Tages vor ihrer Türschwelle gefunden. Es kommen ja immer mal Zigeuner vorbei und lagern vor der Stadt.
Dann aber verwarf ich diese dummen Spinnereien.
Ich ging zu meiner Mutter und fragte sie aus.
Woher kommen meine braunen Augen, wollte ich wissen. Deine Augen sind grau und deine Haare blond. Und Vater hat blaue Augen.
Mama runzelte die Stirn und blickte mich forschend an.
Dann sagte sie: In der Familie Gerlach, also die Familie, der ich entstamme, gibt es graue und braune Augen, und alle haben blondes Haar – so wie ich. In Vaters Familie, der Familie Engelbrecht, haben fast alle blaue Augen und dunkles Haar. Zufrieden?
Ich dachte einen Augenblick darüber nach.
Also habe ich die braunen Augen aus der Familie Gerlach.
Diese Sache hatte sich also geklärt. Und was bewies das nun? Rein gar nichts. Oder jedenfalls nur, dass ich aus der Familie meiner Mutter stammte, aber das hatte ich schließlich schon vorher gewusst.
Was hatte ich denn erwartet? So würde ich nicht hinter das Geheimnis meiner Abstammung kommen, das wurde mir klar. Da musste ich schon anders vorgehen, aber wie?
Wie sollte ich herausfinden, welche Männer vor meiner Geburt im Leben meiner Mutter eine Rolle gespielt hatten?
Ein Tagebuch gab es nicht, und die Eltern meiner Mutter kannte ich nicht. Wenn ich es recht bedachte, kannte ich überhaupt niemanden von der Gerlach-Familie. Die Verbindung zu ihnen war vor meiner Geburt abgebrochen. Ich hatte nie erfahren, warum. Schlagartig wurde mir das in diesem Augenblick klar. Noch ein Geheimnis!
Warum hatte ich nie darüber nachgedacht? Schließlich ist es doch durchaus nicht normal, dass es zu den Großeltern der Mutter keinerlei Verbindung gibt!
Wie seltsam, all diese Geheimnisse. Ich war ja geradezu von Geheimnissen umgeben.
Die Eltern antworteten mir ausweichend. Es habe Meinungsverschiedenheiten mit den Großeltern Gerlach gegeben, die in einen bösen Streit ausarteten. Das war das Ende der Beziehungen.
Mehr erfuhr ich nicht.
Es war aussichtslos. Ich kannte niemanden, der mit mir über diese Sache reden wollte. Ich konnte das Ganze wohl vergessen. Würde ich also nie erfahren, wer mein richtiger Vater war?
Oder war mein Verdacht eben doch eine fixe Idee von mir? Eine Fata Morgana, eine Einbildung meiner ausgeprägten Fantasie? Schließlich hatte ich die schon immer besessen.
Jenes Gespräch lag nun so viele Jahre zurück. Wer weiß, worum es damals gegangen war? Worte, die eine völlig andere Bedeutung beinhalteten, als ich ihnen zugedacht hatte. Mein kindlicher Kopf mit den verrückten Fantasien darin hatte sich womöglich das belauschte Gespräch zu etwas völlig anderem zurechtgedreht, als es wirklich war.
So muss es sein, sagte ich mir energisch und beschloss, diese Sache endgültig ad acta zu legen. Was sollte das Ganze auch? Wem sollte es nützen? Ich war und bin das Kind meiner Eltern, und damit basta!
So mein fester Entschluss.
Der fatale Verdacht jedoch ist hartnäckig. So schnell lässt er sich nicht beiseite drängen. Schon bald kriecht er aus seinem Versteck hervor und streckt erneut seine Fühler aus.
Und ich vernehme sein hämisches Wispern:Haben wir sie nicht geliebt, als ob sie unser gemeines Kind wäre? … unser gemeinsames Kind … gemeinsames Kind …
Und nun weiß ich: Es ist doch wahr. Genau diese Worte waren es. Jahre hin oder her, Fantasien hin oder her. Genau diese Worte habe ich gehört. Ich bin ganz sicher.
Und passt dieses andere Geheimnis nicht vielleicht auch dazu? Dieser endgültige Bruch zwischen den Gerlachs und den Engelbrechts? Auf irgend eine Weise hat auch er damit zu tun.
Ja, so muss es sein. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie das alles zusammenhängen soll. Oder vielmehr: Ich kann mir eine ganze Menge dazu vorstellen. Meine Fantasie reicht dafür völlig aus.
Die unterschiedlichsten Möglichkeit fallen mir ein, warum alles so gekommen ist, wie es nun mal ist. Aber letztlich sind es alles Vermutungen, Spekulationen, schlichtweg: Fantastereien, die meiner verrückten Fantasie entsprungen sind.
Nimmt man jedoch nur die schlichten Tatsachen, so bleibt für mich zweifelsohne eine Schlussfolgerung: Es ist wahr. Mein Verdacht ist nicht nur ein unbegründeter Verdacht. Es ist Wahrheit, Gewissheit.
Papa ist nicht mein richtiger Vater.
Ich bin nun bereit, diese Tatsache zu akzeptieren, wenngleich es weh tut. Es schmerzt wirklich, denn ich liebe meinen Papa. Ich liebe ihn, seitdem ich Kind bin. Genau darum habe ich mich zeitlebens um seine Liebe und Anerkennung bemüht.
Andererseits ist in mir eine bohrende Neugier auf meinen richtigen Vater gewachsen. Will nicht jeder Mensch wissen, woher er stammt?
Ach, das Leben ist so kompliziert!
Die Engelbrechts und die Gerlachs
Die Engelbrechts – das ist die Familie meines Vater, und so heiße natürlich auch ich: Rebecca Engelbrecht.
Mein Vater stammt aus einer sehr reichen Familie, und also sind auch wir nicht gerade arm.
Großvater Engelbrecht ist von Keksen reich geworden. Ja, genau so war es. Er hat seine Keksfabrik gegründet, da war er noch recht jung. Wie genau das geschah, weiß ich nicht. Ich weiß nur, mein Urgroßvater hatte eine Bäckerei. Die ganze Familie war in dieses Unternehmen eingespannt.
Irgendwann entstand daraus eine Fabrik zur Herstellung von Keksen aller Art. Auch Kuchen und andere Leckereien gehören dazu, aber vor allem Kekse. Kekse in allen Variationen, so gut und so köstlich, dass die Engelbrecht-Kekse eines Tages sehr berühmt wurden.
Die beiden Söhne Gerald (der Bruder meines Vaters) und Sebastian (das ist mein Vater) stiegen natürlich ein in diese gewaltige Keksherstellerei. Aus einer kleinen Fabrik war längst eine große geworden, aus einer einfachen längst eine moderne. Dazu kamen verschiedene Zweigstellen in allen Teilen des Landes. Ja, und so kam der Reichtum in die Familie Engelbrecht.
Großvater Engelbrecht ist inzwischen tot, die Großmutter lebt bei dem Sohn Gerald und seiner Familie. Wir besuchen sie hin und wieder. Ich mag sie alle, aber ein herzlicher Kontakt ist eigentlich nie entstanden.
Mehr Verwandte aus der Engelbrecht-Familie kenne ich nicht. Ich glaube, es gibt da noch einen alten Onkel in Amerika, einen Bruder meines Großvaters. Ebenfalls steinreich und schon recht betagt. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, habe ihn nie gesehen.
Papa ist 42 Jahre alt, dunkelhaarig und blauäugig. Er ist sehr groß, dünn und sportlich. Er spielt Tennis und Golf, ist in seinem Beruf tüchtig und gewissenhaft, und man merkt es ihm nicht unbedingt an, dass er nie einen Cent hat umdrehen müssen. Er ist immer einfach geblieben und trägt die Nase wegen seines vielen Geldes nicht hoch. Er hat immer viel zu tun, ist auch oft unterwegs. Zu mir ist er stets ein nachsichtiger Vater gewesen. Ich habe ihn nie streng erlebt. Wenn jemand mir die Leviten gelesen hat, so war das immer Mama. Sie war es auch, die Verbote ausgesprochen hat und vorgab, was ich durfte und was nicht.
Vielleicht liegt es daran, dass sie Lehrerin ist und ihr diese Dinge mehr liegen als Papa. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass Papa nicht mein richtiger Vater ist, und sie darum das Sagen über mich hat.
Nun zu den Gerlachs.
Mama heißt Katharina, ist 36 Jahre alt, hat helles blondes Haar (wunderschönes Haar übrigens) und graue Augen. Sie ist mittelgroß und schlank. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Lehrerin an der Grund- und Hauptschule in der Stadt. Sie hat meistens mit den jüngeren Klassen zu tun, obwohl sie auch ältere Jahrgänge unterrichten könnte. Mama liebt Kinder, und eigentlich wundert es mich, dass ich ein Einzelkind bin. Auf meine Frage, warum das so ist, bekam ich zur Antwort: Es hat halt nicht geklappt mit einem Geschwisterchen.
Nun ja, ich habe mich nie sonderlich nach Geschwistern gesehnt. Im Grunde war es mir gleich, ob ich welche hatte oder nicht. Ich hatte immer Freundinnen, das genügte mir.
Mama ist ein hübsche Frau. Die Männer schauen ihr heute noch nach. Ich habe es selbst beobachtet.
Sie hat noch eine Schwester, Bernadette. Sie war früher eine Schauspielerin, hat gute Rollen am Theater gehabt. Bernadette Gerlach war wohl schon ein bekannter Name. Ich allerdings kannte ihn nicht. Eines Tages fand ihr Ruhm ein jähes und trauriges Ende: Sie hatte einen Unfall. Vom Pferd geschlagen, hieß es. Seitdem ist sie gehbehindert. Sie lebt nun im Hause der Großeltern Gerlach. Vielleicht schreibt sie ihre Memoiren – ich weiß es nicht.
Die Großeltern Anthea und Jonas Gerlach haben ein kleines Gestüt und betreiben außerdem eine Obstfarm. Die Pferdezucht war von jeher die Leidenschaft des Großvaters, auch wenn sie nicht immer rentabel war. Da hat es wohl manche Flauten gegeben, besonders nach dem Kriege. Heutzutage geht es ihnen gut. Sie leben mit einigen Bediensteten auf dem schönen Landsitz Gut Gerlach im Erlengrund. Das liegt außerhalb eines kleinen Städtchens namens Szegenbrück inmitten von Hügeln und Wäldern, in der Nähe des Flusses Elaas.
Im Hause lebt noch eine alte Tante, wohl etwa 80 Jahre alt. Clarissa, die Schwester von Großvater Jonas. Sie ist eine etwas schrullige alte Dame, die nie von zu Hause weggekommen ist. Sie wohnt in einem Seitenflügel des Hauses.
Großvater Jonas hat in der Vergangenheit wohl nie allzu viel Geschäftssinn bewiesen. Sein Hauptinteresse galt zwar stets seinen Pferden, aber er hat es nicht verstanden, viel Geld damit zu machen. Heutzutage mag das anders sein, das weiß ich nicht.
Es gibt einen Verwalter auf dem Hof, Bertold Skabowsky, der sich um alle geschäftlichen Belange kümmert.
Und dann natürlich die Bediensteten. Da ist der Gehilfe Philip Steinhoff; die Perle, Köchin und der gute Geist des Hauses Matilda Rodolphi, das Mädchen Lilli. In einem der Nebengebäude wohnt Tamar Lombardi. Sie hilft bei der Stallarbeit und beim Zureiten von Pferden. Sie hat ein Töchterchen: Samantha, sechs Jahre alt.
Während ich über meine Verwandtschaft Gerlach nachdenke, habe ich noch niemanden von ihnen kennen gelernt. Was ich weiß, habe ich von Mama erfahren. Es ist wenig genug.
Dabei interessieren sie alle mich brennend. Besonders, seitdem jener Verdacht wieder so stark in mir aufgeflammt ist. Und mit ihm der heiße Wunsch, herauszufinden, wer mein richtiger Vater ist.
Wer sonst könnte mir von der Vergangenheit erzählen? Von der Kindheit und Jugend meiner Mutter, von ihrem damaligen Leben. Ich weiß so wenig von ihr. Immer wieder wird mir das klar. Sie hat keine Freunde und Bekannten aus jener Zeit. Keine Freundin von früher kommt mal zu Besuch, mit der sie über die alten Zeiten plaudert. Ist das nicht merkwürdig?
Meine Eltern pflegen viele Kontakte. Es gibt Geschäftsfreunde, die eingeladen werden müssen. Da sind bestimmte Verpflichtungen, die sie haben. Ein paar Einladungen in der Nachbarschaft. Aber richtige Freunde? Mir fallen gar keine ein.
Ich durfte stets alle meine Freunde mit nach Hause bringen. Nicht etwa, dass ich Mengen davon hatte. Aber ein paar gab es immer. Ich besuchte auch meine Freundinnen und lernte deren Familien kennen. Das war jedes Mal ein merkwürdiges Erlebnis für mich, da es in anderen Häusern scheinbar sehr viel lebendiger und lauter zuging. Bei uns herrschte immer eine gedämpfte Atmosphäre. Bei den Eltern der Freundinnen gab es schon mal Geschrei unter den Geschwistern, Kämpfe und Gezanke unter Brüdern. Sogar die Eltern stritten sich hin und wieder, und das war für mich das Allerseltsamste. Ich kannte das nicht.
Meine Eltern waren stets sehr bemüht, mich aus solchen Streitereien heraus zu halten, ja, sie sogar vor mir zu verbergen. Immer schon. Als ich klein war, gelang ihnen das auch meistens. Und doch! Wie gesagt, ich war ein sehr empfindsames Kind. Fast als hätte ich übersensible Fühler und Sinne für die Stimmungen in unserem Haus entwickelt. Ich spürte immer, wenn etwas Unangenehmes in der Luft lag. Und stets machte mir das Angst.
Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Eltern einfach einen Krach gehabt hätten. Lauten Zank und Streit um irgend welche Dinge wie zum Beispiel, wer in dieser oder jener Sache Recht hätte. So kannte ich das aus den Familien meiner Freundinnen. Da kam es schon mal vor, dass die Mutter den Vater ausmeckerte, weil er den Rasen nicht gemäht oder vergessen hatte, irgend etwas aus der Stadt mitzubringen. Dann gab es Gemecker und Gezeter, ein lautes Geschrei und fertig. Hinterher war die Luft wieder rein. Man entschuldigte sich und lachte schließlich darüber. Jedenfalls war alles einfach und sonnenklar, ohne heimliches Flüstern hinter der Tür, weil die Kinder den Streit nicht mitkriegen sollten.
Das erschien mir ganz normal und richtig.
Nicht so in unserer kleinen Familie. Eigentlich wusste ich nie, worum es ging. Ich spürte nur, da lag etwas in der Luft. Irgend etwas war verkehrt gelaufen, und nun bemühten sich Mama und Papa, die Sache möglichst unbemerkt und geräuschlos vorüber gehen zu lassen. Sicher hatten sie auch ihren Streit gehabt, nur kriegte ich nie etwas davon mit.
Vielleicht dachten sie, es sei aus pädagogischer Sicht nicht gut für ein Kind, wenn es die gelegentlichen Unstimmigkeiten der Eltern miterlebt. Ich weiß es nicht. Ich habe immer gefunden, Kinder sollten an allem teilhaben. Vielleicht ganz kleine Kinder nicht. Aber von einem bestimmten Lebensalter an begreifen sie ganz gut, dass Eltern auch Menschen sind, die Fehler machen. Können Kinder nicht gerade davon lernen? Von den Debatten und Diskussionen, die zwischen den Partnern ablaufen?
Warum werden Kinder immer unterschätzt?
Sicher wollten meine Eltern mich schützen. Dachten, es würde mir Angst machen – so ein deftiger Streit mit allem Drum und Dran.
Dass mir aber diese andere Sache Angst machen könnte, diese unheilschwangere Atmosphäre, dieses Unausgesprochene, Schwelende zwischen ihnen – darauf kamen sie nicht.
Ich habe mal gehört, wie Leute sagten, dieses oder jenes begreift ein Kind noch nicht. Es merkt und spürt gar nichts davon. Was für ein Unsinn!
Gerade Kinder spüren und fühlen mehr, als Erwachsene glauben. Und besonders ich, scheint mir.
Oft denke ich, Eltern kennen von ihren Kindern nur einen Teil. Sie sehen nur eine Seite, vielleicht auch mehrere, aber nie den ganzen Menschen.
Sicher ist das umgekehrt genauso: Kinder kennen von ihren Eltern nur den Teil, den sie ihnen zeigen. Ist das nur während der Kindheit so? Oder bleibt das für den Rest eines jeden Lebens?
Der Gedanke macht mich traurig.
Auf einmal kommt mir eine Erinnerung zurück. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der es mich sehr verwirrte, meine Mutter anzusehen. Ich stellte sie mir mit einem anderen Mann vor. Ich hatte inzwischen begriffen, dass meine Eltern nicht nur Vater und Mutter und geschlechtslose Wesen waren, sondern auch Mann und Frau!
Und meine Mutter hatte dieses Unverzeihliche begangen, sich mit einem anderen Mann abzugeben. In dieser Zeit kam es vor, dass ich ihren Arm abwehrte oder mich ihrer Umarmung entzog. Dann fiel ihr Gesicht in sich zusammen, und ich hatte ein grausames Vergnügen daran, ihr weh zu tun. Ich wollte es ihr heimzahlen, dass sie alles durcheinandergebracht hatte und versuchte, mich innerlich für einen Hass auf sie zu stählen. Aber der war gar nicht da. Es war nur Ratlosigkeit, Unsicherheit und Kummer. Ich vermisste ihre Berührung und ihre Umarmungen, denn es war nun einmal so: Ich liebte sie über alle Maßen.
Später wurde es mir dann klar, dass diese ganze Geschichte sich vor ihrer Ehe mit Papa abgespielt haben musste. Ich spann neue Geschichten um meine mysteriöse Abstammung. Vielleicht war Mama von meinem wirklichen Vater im Stich gelassen worden, und dann war Papa gekommen und hatte sich ihrer und dem armen Ungeborenen angenommen. Diese Version gefiel mir am besten, und irgendwie erschien sie mir auch die wahrscheinlichste.
Das Leben ist ein großer Fluss
Mir ist eine Begebenheit in den Sinn gekommen, die ich bis jetzt vergessen hatte. Wie merkwürdig.
Es war vor etwa drei Jahren. Papa musste auf eine Geschäftsreise. Er wollte ein paar Tage fortbleiben.
Vor dieser Reise hatte eine düstere Stimmung über unserem Haus gehangen. Ich erinnere mich dunkel, dass es einen Streit gegeben hatte. Er fand wie immer hinter geschlossenen Türen statt. Ich bekam ein paar Sätze mit.
Es ist vielleicht ganz gut, dass ich ein paar Tage wegfahre, hörte ich Papa sagen. Du kannst in Ruhe über alles nachdenken. Bitte fasse keine voreiligen Entschlüsse.
Am nächsten Tag war Papa fort.