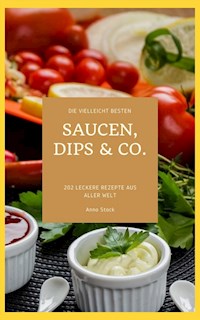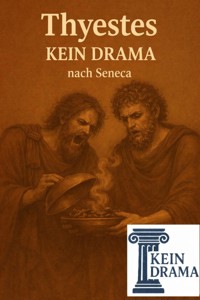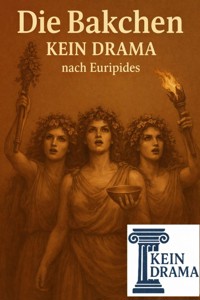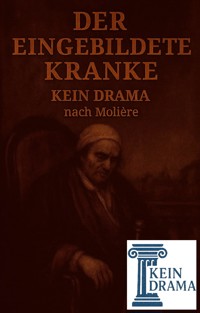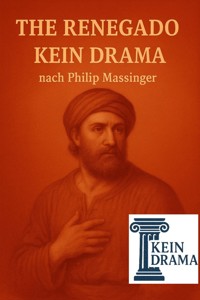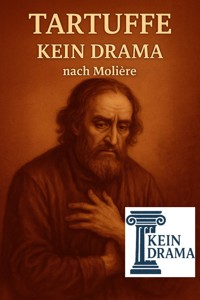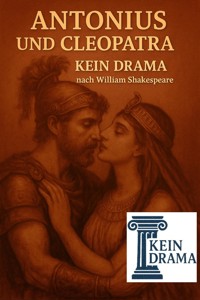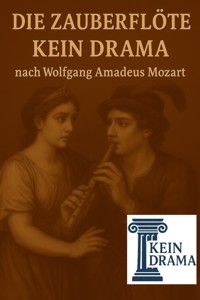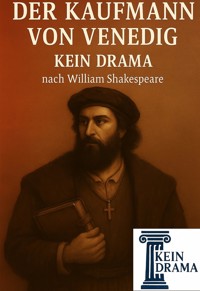
6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Lustspiele, Komödien, Tragödien, Dramen – viele klassische Werke sind für die meisten Menschen heute Bücher mit sieben Siegeln. Insbesondere die altertümliche Sprache und der sprachliche Aufbau als Bühnenstück lassen nicht nur Schülerinnen und Schüler verzweifeln. Die Reihe "Kein Drama" bringt alte Klassiker in Prosa neu heraus. So werden sie endlich für jede und jeden verständlich. Inhaltlich bleiben die Neufassungen stets dicht am Original. Daher sind teilweise Begriffe enthalten, die heute gemeinhin als diskriminierend wahrgenommen werden. Auch die Struktur des mit KI-Unterstützung übersetzten Textes ist jeweils abhängig von der genutzten Vorlage – daher sind missverständliche Passagen nicht ganz ausgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Der Kaufmann von Venedig - Kein Drama von William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
PROLOG
Kapitel 1: Der traurige Kaufmann
Kapitel 2: Bassanios Geheimnis
Kapitel 3: Im Ghetto
Kapitel 4: Die Unterzeichnung
Kapitel 5: Der seltsame Vertrag
Kapitel 6: Portia
Kapitel 7: Das Kästchen-Rätsel
Kapitel 8: Die Parade der Freier
Kapitel 9: Die Nacht des Wartens
Kapitel 10: Jessica im goldenen Käfig
Kapitel 11: Die Flucht
Kapitel 12: Shylocks Entdeckung
Kapitel 13: Glück und Schatten
Kapitel 14: Vergebliche Bitten
Kapitel 15: Der junge Doktor
Kapitel 16: Der Gerichtssaal
Kapitel 17: Das Urteil und seine Folgen
Kapitel 18: Rückkehr nach Belmont
Kapitel 19: Die Enthüllung
EPILOG: Sechs Monate später
NACHWORT DES AUTORS
Impressum neobooks
Table of Contents
DER KAUFMANN VON VENEDIG
Eine Romanadaption nach William Shakespeare
Anno Stock
PROLOG
Die alte Rechnung
Venedig, Herbst 1591
Die Sonne stand bereits tief über der Lagune, als Shylock ben Abraham die Stufen zur Rialtobrücke hinaufstieg. In seiner rechten Hand hielt er eine Ledermappe, die die Schuldscheine von einem Dutzend venezianischer Kaufleute enthielt. Ehrbare Christen, die bei Tageslicht seine Dienste in Anspruch nahmen und ihn bei Sonnenuntergang „Wucherer" nannten.
Es war ein milder Tag gewesen. Die Geschäfte liefen gut – zu gut vielleicht, dachte Shylock mit jenem bitteren Lächeln, das sich über die Jahre in sein Gesicht gegraben hatte. Jeder zusätzliche Dukat, den er verdiente, jeder Zins, den er einforderte, war ein weiterer Nagel im Sarg seiner Reputation. Die Christen brauchten ihn, aber sie hassten ihn dafür, dass sie ihn brauchten.
„Da ist ja unser geliebter Shylock!"
Die Stimme gehörte Antonio, dem Kaufmann, der auf dem Rialto mehr galt als jeder andere Händler. Er stand inmitten einer Gruppe junger Venezianer, allesamt in prächtigen Gewändern, ihre Gesichter gerötet vom Wein, den sie in der nahen Taverne genossen hatten.
Shylock verlangsamte seinen Schritt, aber er wich nicht aus. Der kürzeste Weg nach Hause führte an dieser Gruppe vorbei, und das Gesetz verbot ihm nicht, die öffentlichen Plätze zu betreten – noch nicht, jedenfalls.
„Guten Abend, Signori," murmelte er und senkte den Kopf in einer Geste, die Respekt vortäuschen sollte, aber vor allem Vorsicht war.
„Halt!" Antonios Hand schoss vor und packte Shylocks Arm. Der Griff war fest, schmerzhaft sogar. „Wohin so eilig? Hast du heute wieder die Taschen gefüllt mit dem Blut ehrlicher Christen?"
Die anderen lachten. Einer von ihnen, ein junger Mann namens Gratiano, den Shylock als besonders lärmend kannte, klatschte in die Hände. „Gut gesagt, Antonio! Das Blut der Christen! Der Wucherer trinkt es wie Wein!"
„Ich verleihe Geld," sagte Shylock mit mühsam beherrschter Stimme. „Wie es das Gesetz erlaubt. Wenn Ihr es nicht mögt, Signor Antonio, dann borgt nicht bei mir."
„Nicht bei dir borgen?" Antonios Gesicht kam näher. Shylock konnte den Wein in seinem Atem riechen, aber es war nicht die Trunkenheit, die aus dem Kaufmann sprach – es war etwas Tieferes, Kälteres. „Nicht bei dir borgen, sagst du? Als ob ein ehrlicher Christ eine Wahl hätte! Du und deine Sippschaft, ihr habt euch an unsere Stadt gekrallt wie Blutegel. Ihr nehmt und nehmt, aber ihr gebt nichts zurück."
„Ich gebe Kredit," erwiderte Shylock. Seine Stimme zitterte leicht, aber er zwang sich, dem Blick des Kaufmanns standzuhalten. „Ohne uns würde der Handel in Venedig stillstehen. Eure eigene Kirche verbietet euch, Zinsen zu nehmen, also kommt ihr zu uns."
„Wir kommen zu Hunden," sagte Antonio und spuckte aus.
Die Spucke traf Shylocks Kaftan, ein dunkler Fleck auf dem abgetragenen Stoff. Die Gruppe lachte wieder, lauter diesmal. Ein paar Passanten blieben stehen, schauten zu, aber niemand griff ein. Niemand griff jemals ein.
Shylock stand reglos da. Er hätte zurückschlagen können – in Worten zumindest. Er hatte einen scharfen Verstand, schärfer als die meisten dieser weinseligen Gecken. Aber er hatte auch Frau und Tochter zu Hause, ein Haus im Ghetto, ein Leben, das so zerbrechlich war wie Glas. Ein falsches Wort, eine falsche Bewegung, und alles konnte zerbrechen.
„Ich habe dir nichts getan, Signor Antonio," sagte er schließlich, so ruhig er konnte. „Warum behandelst du mich so?"
„Weil du ein Jude bist," antwortete Antonio schlicht, als ob das die natürlichste Erklärung der Welt wäre. „Weil ihr unseren Herrn gekreuzigt habt. Weil ihr nicht zu uns gehört und niemals gehören werdet."
Er ließ Shylocks Arm los und wandte sich ab, als wäre die Sache damit erledigt. Die Gruppe folgte ihm, ihre Stimmen und ihr Gelächter entfernten sich über die Brücke.
Shylock blieb zurück, die Hand immer noch auf dem fleckigen Kaftan. Um ihn herum hatte sich das normale Treiben des Rialto bereits wieder aufgenommen. Händler priesen ihre Waren an, Boote glitten durch die Kanäle, das Leben ging weiter, als wäre nichts geschehen.
Aber etwas war geschehen. Nicht heute – heute war nur ein weiterer Tag in einer langen Kette solcher Tage. Aber die Kette selbst, die Last all dieser Demütigungen, wurde schwerer.
Als Shylock das Ghetto erreichte, war die Sonne bereits untergegangen. Die schweren Tore würden bald geschlossen werden, und alle Juden mussten drinnen sein. So wollte es das Gesetz. Bei Nacht war Venedig eine christliche Stadt, unbefleckt von der Anwesenheit jener, die man tagsüber brauchte, aber nachts nicht sehen wollte.
Sein Haus lag in einer engen Gasse. Es war klein, aber solide gebaut, mit dicken Mauern, die den Lärm der Stadt draußen hielten. Als er die Tür öffnete, umfing ihn sofort der vertraute Duft von Leahs Küche – Zwiebeln, Knoblauch, das Brot, das sie jeden Freitag für den Sabbat buk.
„Vater!" Jessica, seine Tochter, kam die schmale Treppe heruntergelaufen. Sie war sechzehn, mit dunklen Locken und Augen, die ihre Mutter hatten – warm, lebendig, voller Fragen. „Du bist spät. Mutter hat sich schon Sorgen gemacht."
„Es gab viel zu tun," murmelte Shylock und legte die Mappe auf den Tisch. Er versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nicht recht.
Leah erschien in der Tür zur Küche, die Hände noch mehlig von der Arbeit. Sie war eine kleine Frau, zierlich gebaut, aber mit einer Kraft in den Augen, die alle Stürme des Lebens überstanden hatte. Als sie Shylocks Gesicht sah, verstanden ihre Augen sofort.
„Wieder Antonio?" fragte sie leise.
Shylock nickte. Er wollte nicht darüber sprechen, nicht vor Jessica, aber Leah kannte ihn zu gut. Dreißig Jahre waren sie verheiratet, dreißig Jahre, in denen sie Seite an Seite gestanden hatten gegen eine Welt, die sie nicht wollte.
„Eines Tages," sagte Shylock und seine Stimme wurde hart, „eines Tages wird er zu mir kommen und um Hilfe bitten. Und dann..."
„Dann wirst du ihm helfen," unterbrach Leah sanft. „So wie du allen hilfst, die zu dir kommen. Das ist unser Weg, Shylock. Wir sind keine Monster, auch wenn sie uns so nennen."
„Warum?" Die Frage brach aus ihm heraus, roh und schmerzhaft. „Warum sollen wir immer die Besseren sein? Warum sollen wir immer vergeben, immer dulden, immer den Kopf senken?"
Leah trat zu ihm und legte ihre Hand auf seine Wange. Ihre Berührung war kühl, beruhigend. „Weil wir sonst werden wie sie. Und das dürfen wir nicht."
Shylock schloss die Augen. Er wusste, dass sie recht hatte. Er wusste es im Kopf, im Herzen, in jenem Teil von ihm, der noch an Gerechtigkeit und Menschlichkeit glaubte. Aber es gab auch einen anderen Teil, einen dunklen, wachsenden Teil, der sich nach etwas anderem sehnte.
Nach Vergeltung.
Fünf Jahre später starb Leah.
Es war im Winter, als eine Krankheit durch das Ghetto fegte. Viele starben, vor allem die Alten und die Schwachen. Leah war nicht alt – sie war kaum fünfzig – aber die Jahre der Härte hatten ihren Tribut gefordert.
Shylock saß an ihrem Bett und hielt ihre Hand, während das Leben aus ihr wich. Jessica weinte leise in der Ecke, aber Leah selbst war ruhig, fast friedlich.
„Versprich mir," flüsterte sie, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch, „versprich mir, dass du nicht bitter wirst. Dass du Jessica lehrst, mit Liebe zu leben, nicht mit Hass."
„Ich verspreche es," log Shylock, denn was sollte er sonst sagen? Sollte er einer sterbenden Frau sagen, dass die Bitterkeit bereits in ihm wuchs wie ein Tumor? Dass er nachts wach lag und sich Szenen der Rache ausmalte?
Sie starb in dieser Nacht, und mit ihr starb der letzte Rest von Shylocks Hoffnung auf Versöhnung.
Bei der Beerdigung – einer kleinen, stillen Zeremonie auf dem jüdischen Friedhof auf dem Lido – stand Shylock am offenen Grab und sah zu, wie der Mann, den er am meisten liebte, in die Erde gelegt wurde. Neben sich spürte er Jessica, ihre Hand in seiner, ihre Tränen heiß und echt.
Aber seine eigenen Augen blieben trocken.
Etwas in ihm war zerbrochen, oder vielleicht hatte es sich auch nur verhärtet zu etwas Neuem, etwas Gefährlichem. Er erinnerte sich an Leahs letzte Worte, an ihr Flehen, nicht bitter zu werden. Aber wie konnte er nicht bitter werden in einer Welt, die seine Familie jeden Tag aufs Neue demütigte?
„Hat nicht ein Jude Augen?" murmelte er, so leise, dass nur er selbst es hören konnte. „Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Sinne, Neigungen, Leidenschaften?"
Die Worte waren für niemanden bestimmt, aber sie brannten in ihm wie Feuer.
Als die Zeremonie vorbei war und die wenigen Trauergäste sich entfernten, blieb Shylock noch einen Moment stehen. Er sah hinüber zu den Türmen Venedigs, die sich in der Ferne gegen den grauen Winterhimmel abhoben. Irgendwo dort lebte Antonio, unbekümmert, reich, geliebt von allen.
„Eines Tages," flüsterte Shylock dem Wind zu, „eines Tages wird die Rechnung beglichen."
Er wandte sich um und führte Jessica nach Hause. Hinter ihnen blieb nur das frische Grab und der Wind, der durch die Grabsteine pfiff wie ein Versprechen – oder eine Warnung.
TEIL I: DIE MELANCHOLIE VENEDIGS
Kapitel 1: Der traurige Kaufmann
Venedig, Frühling 1596
Die Stadt erwachte wie jeden Morgen zum Klang der Glocken. Erst San Marco, dessen bronzene Stimme über die Piazza hallte, dann Santa Maria della Salute, dann all die anderen Kirchen, eine nach der anderen, bis ganz Venedig in einem Konzert der Läute vibrierte. Die Gondolieri riefen ihre Warnungen, wenn sie um enge Ecken fuhren, die Händler priesen ihre Waren an, und das ewige Plätschern des Wassers bildete den Bass zu dieser Symphonie des Alltags.
Antonio stand am Fenster seines Palazzo und betrachtete all das, ohne es wirklich zu sehen. Die Schatten unter seinen Augen verrieten schlaflose Nächte. Sein Haar, einst rabenschwarz, zeigte die ersten silbernen Fäden. Mit sechsunddreißig war er in der Blüte seines Lebens – ein erfolgreicher Kaufmann, dessen Name am Rialto mehr zählte als geschriebene Verträge. Wenn Antonio bürgte, war das Geschäft besiegelt. Wenn Antonio seine Meinung äußerte, hörten die Ratsherren zu.
Und doch war er tief unglücklich.
„Signore?" Die Stimme seines Dieners Francesco unterbrach seine Gedanken. „Signor Salarino und Signor Solanio sind hier. Sie warten im Empfangssaal."
Antonio nickte, ohne sich umzudrehen. „Ich komme gleich."
Er nahm sich noch einen Moment Zeit, sammelte seine Gedanken wie verstreute Perlen. Es war wichtig, eine Maske zu tragen – die Maske des erfolgreichen Kaufmanns, des selbstsicheren Freundes, des unerschütterlichen Antonio. Die Welt durfte nicht sehen, was in ihm vorging, denn er selbst verstand es ja nicht.
Der Empfangssaal seines Palazzo war großzügig gestaltet, mit venezianischen Spiegeln an den Wänden und Möbeln aus dunklem Walnussholz. Durch die hohen Fenster fiel das Morgenlicht in goldenen Streifen, die den Marmorboden zum Leuchten brachten. Salarino und Solanio, beide Mitte Zwanzig und voller Lebensenergie, sprangen auf, als Antonio eintrat.
„Antonio!" Salarino, der Größere der beiden mit dem rotblonden Haar, kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. „Du siehst aus, als hättest du mit den Geistern gerungen. Was quält dich, Freund?"
„Nichts," antwortete Antonio automatisch. Dann, als er ihre besorgten Gesichter sah, korrigierte er sich: „Oder alles. Ich weiß es selbst nicht. Es ist, als ob eine Last auf mir liegt, die ich weder benennen noch abschütteln kann."
Solanio, dunkelhaarig und schlau wie ein Fuchs, musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. „Es sind deine Schiffe, nicht wahr? Du machst dir Sorgen um deine Handelsflotte."
Antonio schüttelte den Kopf. „Meine Schiffe sind gut gebaut, meine Kapitäne erfahren. Ja, die Meere bergen Gefahren – Stürme, Piraten, Klippen. Aber ich habe gelernt, meine Waren klug zu verteilen. Nicht alles auf einem Schiff, nicht alles in einem Hafen. Sollte ein Unglück geschehen, wäre der Schaden begrenzt."
„Dann ist es ein Geschäft, das dir Sorgen bereitet?" fragte Salarino.
„Nein."
„Eine Frau?" Solanio grinste vielsagend.
„Auch nicht." Antonio musste trotz allem lächeln. „Ich bin nicht verliebt, wenn ihr das meint. Mein Herz gehört niemandem, außer vielleicht Venedig selbst, und die alte Dame gibt ihre Liebe nicht zurück."
Die beiden jungen Männer wechselten einen Blick. Sie kannten Antonio seit Jahren, hatten mit ihm gefeiert und gehandelt, hatten seine Großzügigkeit erlebt und seine Weisheit bewundert. Aber sie hatten ihn noch nie so gesehen – so verloren, so in sich gekehrt.
„Vielleicht," sagte Salarino vorsichtig, „liegt die Ursache tiefer. Manchmal trägt die Seele Lasten, die der Verstand nicht begreifen kann."
Antonio wandte sich ab und trat ans Fenster. Draußen zog eine Gondel vorbei, beladen mit Gemüse vom Festland. Der Gondoliere sang eines jener melancholischen Lieder, für die Venedig berühmt war – Lieder von verlorener Liebe und verschwundenen Zeiten.
„Ich fühle mich wie ein Schauspieler," sagte Antonio leise, „der eine Rolle spielt, ohne das Stück zu kennen. Jeden Morgen wache ich auf und frage mich: Wozu? Ich habe Reichtum angehäuft, der mehrere Generationen ernähren könnte. Ich habe Freunde, die mir treu ergeben sind. Mein Name ist geachtet in ganz Venedig. Und dennoch..." er brach ab.
„Und dennoch?" drängte Solanio.
„Und dennoch fühlt sich alles leer an. Als ob ich mein ganzes Leben darauf verwendet hätte, ein Gebäude zu errichten, nur um festzustellen, dass es keine Türen hat. Ich kann nicht hinein, kann nicht verstehen, warum ich es überhaupt gebaut habe."
Die Stille, die folgte, wurde nur vom fernen Ruf eines Obsthändlers unterbrochen.
Salarino, der normalerweise nie um Worte verlegen war, rang sichtlich nach einer Antwort. „Vielleicht," begann er schließlich, „fehlt dir ein Ziel. Ein großes Projekt, etwas, das deinen Geist fordert und—"
„Meine Schiffe segeln bis nach Indien," unterbrach Antonio. „Ich handle mit Gewürzen, Seide, Edelsteinen. Ich finanziere Expeditionen, die die Grenzen unserer bekannten Welt erweitern. Was für ein größeres Projekt könnte es geben?"
„Ein persönliches," sagte Solanio. „Etwas, das dein Herz berührt, nicht nur deinen Geldbeutel."
Antonio schwieg. Das Wort „Herz" hallte in ihm nach wie ein Echo in einer leeren Kathedrale. Hatte er ein Herz? Oder hatte er es irgendwann auf dem Weg zu Erfolg und Ansehen zurückgelassen, wie man vergessene Gepäckstücke auf einer langen Reise verliert?
Schritte im Korridor kündigten weitere Besucher an. Francesco erschien in der Tür, gefolgt von drei Männern: Bassanio, Lorenzo und Gratiano.
„Antonio!" Gratianos Stimme erfüllte den Raum wie eine Fanfare. Er war groß, breitschultrig, mit einem Gesicht, das vor Leben und Humor nur so sprühte. „Wir haben dich überall gesucht! Es ist viel zu schön, um in düsteren Palästen zu sitzen und philosophische Gespräche zu führen."
Aber es war Bassanio, auf den Antonios Blick fiel und dort verweilte. Bassanio, sein engster Freund, sein teuerster Vertrauter. Der junge Edelmann war schön auf eine fast gefährliche Weise – hohe Wangenknochen, dunkle Augen, die Intelligenz und Charme ausstrahlten, eine Haltung, die natürliche Eleganz mit einer gewissen Verletzlichkeit verband.
Wenn Antonio ein Herz hatte, gehörte es diesem Mann.
„Bassanio," sagte er, und seine Stimme war wärmer als zuvor. „Es ist gut, dich zu sehen."
Die anderen verstanden das Signal. Salarino und Solanio verabschiedeten sich mit höflichen Gesten, ebenso Lorenzo und Gratiano, wenn auch Letzterer nicht ohne einen letzten Scherz: „Versinkt nicht ganz in der Melancholie, ihr beiden! Das Leben ist zu kurz für lange Gesichter."
Als sie allein waren, setzte sich Bassanio auf einen der Sessel und musterte Antonio lange und aufmerksam.
„Du siehst müde aus," sagte er schließlich.
„Ich bin müde," gab Antonio zu. „Müde vom Leben vielleicht, oder müde davon, nicht zu wissen, was ich vom Leben erwarten soll."
Bassanio nickte langsam. Es war eines der Dinge, die Antonio an ihm liebte – diese Fähigkeit, auch unausgesprochene Dinge zu verstehen. Sie kannten sich seit Jahren, seit Bassanio als junger Mann nach Venedig gekommen war, voller Träume und Pläne, die sein bescheidenes Erbe bei Weitem überstiegen.
Antonio hatte ihm geholfen. Immer wieder, ohne zu zählen, ohne zurückzufordern. Er hatte Bassanios Schulden bezahlt, seine verschwenderischen Unternehmungen finanziert, seine gesellschaftlichen Eskapaden ermöglicht. Nicht aus Pflicht, sondern aus etwas, das tiefer ging als Freundschaft, auch wenn er es nie beim Namen genannt hatte.
„Antonio," Bassanios Stimme wurde ernst, „ich muss mit dir über etwas sprechen. Etwas Wichtiges."
Und Antonio, der die Zeichen kannte, die Nuancen in Bassanios Gesicht lesen konnte wie andere Männer Geschäftsbücher, wusste bereits, was kommen würde.
Bassanio brauchte Geld. Wieder einmal.
Und Antonio würde es ihm geben. Wie immer.
Denn das war vielleicht der einzige Sinn, den sein Leben noch hatte – diesem einen Menschen zu dienen, auch wenn es bedeutete, dass er eines Tages alles verlieren würde.
„Sprich," sagte er ruhig. „Du weißt, dass ich dir zuhöre."
Und in dem Moment, als Bassanio zu sprechen begann, vergaß Antonio für einen Augenblick seine Melancholie. Denn wenn er Bassanio helfen konnte, hatte sein Leben wenigstens einen Zweck.
Auch wenn es ein Zweck war, der ihm das Herz brechen würde.
Kapitel 2: Bassanios Geheimnis
Bassanio erhob sich von seinem Sessel und trat ebenfalls ans Fenster. Einen Moment lang standen sie nebeneinander, zwei Silhouetten gegen das Licht der Stadt. Antonio konnte die Anspannung in Bassanios Schultern sehen, die Art, wie seine Finger nervös den Saum seines Wamses berührten – eine Geste aus Kindertagen, die er nie ganz abgelegt hatte.
„Ich schulde dir bereits so viel," begann Bassanio schließlich, ohne Antonio anzusehen. „Zu viel, wenn ich ehrlich bin. Und doch komme ich wieder zu dir, wie ein Bettler, der zum selben Brunnen zurückkehrt."
„Du bist kein Bettler," sagte Antonio sanft. „Und ich bin kein Brunnen, der versiegt. Was immer du brauchst, Bassanio, du musst nur fragen."
Bassanio fuhr sich durch das dunkle Haar – eine weitere nervöse Geste. „Es ist genau diese Großzügigkeit, die mich quält. Du gibst und gibst, und ich nehme und nehme. Wie ein Parasit, der seinen Wirt aussaugt."
„Hör auf." Antonios Stimme wurde schärfer, als er beabsichtigt hatte. „Rede nie wieder so über dich. Du bist mein Freund, mein..." er stockte, suchte nach einem Wort, das nicht zu viel verriet, „mein teuerster Gefährte. Was ich für dich tue, tue ich aus freien Stücken."
Bassanio wandte sich ihm zu, und in seinen dunklen Augen lag etwas, das Antonio nicht deuten konnte – Dankbarkeit gewiss, aber auch etwas anderes. Scham vielleicht, oder Unbehagen.
„Du erinnerst dich an meine Jugend," sagte Bassanio. „An die Zeit, bevor wir uns kannten. Ich war der jüngere Sohn eines kleineren Edelmanns aus Padua. Mein älterer Bruder erbte Titel und Land, mir blieben nur ein Name und eine bescheidene Summe."
„Das weiß ich alles," sagte Antonio.
„Aber du weißt nicht, wie verschwenderisch ich war." Bassanio lachte bitter. „Oder vielleicht weißt du es doch, und bist zu höflich, es zu sagen. Ich lebte wie ein Prinz, obwohl ich nur die Mittel eines Kaufmanns hatte. Prächtige Kleider, teure Pferde, Festmähler, Glücksspiel... Ich wollte glänzen, Antonio. Ich wollte zu jenen gehören, die bewundert werden, die in jedem Saal die Aufmerksamkeit auf sich ziehen."
Er wandte sich wieder dem Fenster zu, und seine Stimme wurde leiser. „Innerhalb von drei Jahren hatte ich mein gesamtes Erbe durchgebracht. Ich stand mit nichts da, nur mit Schulden und einem Namen, der durch meine Torheit beschmutzt war. Und dann trafst du mich."
Antonio erinnerte sich gut an jene erste Begegnung. Es war auf einem Ball gewesen, im Palazzo eines venezianischen Senators. Bassanio, damals kaum dreiundzwanzig Jahre alt, hatte in einer Ecke gestanden, sein Gesicht eine Maske der Verzweiflung hinter dem aufgesetzten Lächeln. Ihre Blicke hatten sich getroffen, und Antonio hatte sofort gewusst, dass dieser junge Mann in Schwierigkeiten steckte.
Er hatte nicht gewusst – konnte nicht gewusst haben –, dass diese Begegnung sein Leben verändern würde. Dass er sich in einen Schuldner verlieben würde, der seine Hilfe brauchte, aber niemals seine Liebe erwidern konnte.
„Du hast mir geholfen," fuhr Bassanio fort. „Du hast meine Gläubiger bezahlt, mir eine Wohnung gegeben, mich in die Gesellschaft eingeführt. Du hast mir einen Neuanfang ermöglicht, ohne je nach Rückzahlung zu fragen."
„Weil ich keine Rückzahlung erwarte," sagte Antonio schlicht.
„Aber ich erwarte es von mir selbst!" Bassanio fuhr herum, sein Gesicht plötzlich leidenschaftlich. „Verstehst du nicht, Antonio? Diese endlose Schuld drückt mich nieder. Ich bin nun dreißig Jahre alt, und was habe ich vorzuweisen? Nichts außer dem, was du mir gegeben hast. Ich bin ein gescheiterter Edelmann, der vom Wohlwollen eines Freundes lebt."
„Du bist mehr als das," begann Antonio, aber Bassanio unterbrach ihn.
„Nein, lass mich ausreden. Ich habe in den letzten Monaten viel nachgedacht. Über mein Leben, meine Zukunft, darüber, was ich sein möchte. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen."
Antonio spürte, wie sich sein Magen zusammenzog. Was auch immer Bassanio sagen würde, er hatte das Gefühl, dass es sein Leben erneut verändern würde. Und diesmal vielleicht nicht zum Besseren.
„Es gibt eine Frau," sagte Bassanio.
Drei Worte. Nur drei einfache Worte. Und doch trafen sie Antonio wie Pfeile. Er hatte es gewusst, natürlich hatte er es gewusst. Bassanio war ein Mann, der Frauen liebte, der eines Tages heiraten und Kinder haben würde. Antonio hatte niemals etwas anderes erwartet. Und doch, als die Worte ausgesprochen wurden, fühlte es sich an, als würde etwas in ihm zerbrechen.
„Eine Frau," wiederholte er tonlos.
„Ihr Name ist Portia. Sie lebt in Belmont, einem Anwesen unweit von Venedig." Bassanios Stimme nahm einen träumerischen Klang an. „Ich habe sie vor zwei Jahren kennengelernt, auf einer Reise. Es war nur eine kurze Begegnung, ein paar Gespräche, ein paar getauschte Blicke. Aber ich habe sie nie vergessen können."
Er zog ein kleines, in Seide gehülltes Medaillon aus seiner Tasche und öffnete es. Darin war das Miniaturportrait einer Frau – golden gelocktes Haar, intelligente Augen, ein Gesicht, das sowohl Schönheit als auch Charakter ausstrahlte.
„Sie ist wunderschön," sagte Antonio, weil er wusste, dass es von ihm erwartet wurde.
„Sie ist mehr als wunderschön," antwortete Bassanio mit einer Inbrunst, die Antonio noch nie bei ihm gehört hatte. „Sie ist gebildet, spricht mehrere Sprachen, hat Philosophie und Rechtswissenschaften studiert. Ihr Vater war ein angesehener Richter, der ihr vor seinem Tod ein gewaltiges Vermögen hinterlassen hat."
Natürlich, dachte Antonio bitter. Natürlich ging es auch ums Geld. Aber er verwarf den Gedanken sofort. Das war unfair gegen Bassanio. Der junge Mann mochte verschwenderisch sein, aber er war nicht berechnend.
„Und sie... erwidert deine Gefühle?" fragte Antonio.
„Ich glaube schon." Bassanio lächelte, ein echtes, warmes Lächeln, das sein ganzes Gesicht erhellte. „Es gab Zeichen, Andeutungen. Die Art, wie sie mich ansah, wie sie bei unseren Gesprächen lachte. Ich bin mir nicht sicher, Antonio, aber ich habe Hoffnung. Und Hoffnung ist mehr, als ich seit langem hatte."
Er schloss das Medaillon und sah Antonio direkt an. „Ihr Vater hat eine eigenartige Bedingung für ihre Heirat aufgestellt. Es gibt ein Rätsel, eine Prüfung, die alle Freier bestehen müssen. Aber die Details sind kompliziert, und viele haben bereits versucht und versagt."
„Was hat das mit mir zu tun?" fragte Antonio, obwohl er die Antwort bereits kannte.
„Edle Männer aus ganz Europa reisen nach Belmont, um um ihre Hand zu werben. Prinzen, Herzöge, reiche Kaufleute. Sie alle kommen mit prächtigen Geschenken, großen Gefolgen, allem Prunk, den ihr Stand ermöglicht." Bassanio machte eine Pause. „Ich kann nicht als mittelloser Edelmann dort erscheinen. Ich würde mich lächerlich machen, und schlimmer noch, ich würde Portias Ansehen schaden."
„Wieviel brauchst du?" Antonios Stimme war ruhig, geschäftsmäßig fast.
„Dreitausend Dukaten."
Die Summe hing zwischen ihnen in der Luft wie eine physische Präsenz. Es war viel Geld, sogar für Antonio. Nicht genug, um ihn zu ruinieren, aber genug, um einen beträchtlichen Teil seines verfügbaren Vermögens zu binden.
„Ich weiß, dass es viel ist," sagte Bassanio hastig. „Zu viel vielleicht. Aber ich habe einen Plan. Wenn ich Portias Hand gewinne, kann ich alles zurückzahlen – alles, was ich dir über die Jahre geschuldet habe. Ihr Vermögen würde es mir ermöglichen, endlich selbstständig zu werden, ein Mann von Substanz zu sein, kein Schmarotzer mehr."
Antonio wandte sich ab. Die Ironie war bitter: Bassanio wollte seine Schuld bei ihm begleichen, indem er eine reiche Frau heiratete. Und Antonio sollte ihm dabei helfen, sich in die Arme einer anderen zu begeben.
Aber was war die Alternative? Bassanio seine Gefühle zu gestehen? Ihn zu bitten, zu bleiben, für immer in dieser seltsamen Schwebe zwischen Freundschaft und etwas, das nie sein konnte? Das wäre nicht nur töricht, es wäre grausam – für sie beide.
„Antonio?" Bassanios Stimme klang unsicher. „Wenn es zu viel verlangt ist, verstehe ich das. Ich habe kein Recht—"
„Du hast jedes Recht," unterbrach Antonio. Er zwang sich, sich umzudrehen und Bassanio anzusehen. „Du bist mein Freund. Mehr noch, du bist..." er suchte wieder nach Worten, „du bist derjenige, dem ich am meisten auf dieser Welt vertraue. Wenn diese Heirat dich glücklich macht, dann werde ich alles tun, um sie möglich zu machen."
Erleichterung breitete sich auf Bassanios Gesicht aus. Er trat vor und ergriff Antonios Hände. „Danke. Du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Du bist der beste Mensch, den ich kenne, Antonio. Der großzügigste, der treueste..."
„Hör auf," sagte Antonio, und es klang schärfer, als er wollte. Er zog seine Hände zurück. „Es ist nicht nötig, mich mit Lob zu überschütten. Ich tue nur, was ein Freund tun sollte."
Eine kurze, unangenehme Stille entstand. Bassanio sah verwirrt aus, als könnte er Antonios plötzliche Schroffheit nicht verstehen.
„Ich muss dir allerdings etwas gestehen," sagte Antonio schließlich, seine Stimme wieder unter Kontrolle. „Mein gesamtes Vermögen ist momentan gebunden. Meine Schiffe sind auf See – drei nach Tripolis, zwei nach Indien, eines nach Mexiko. Sie transportieren Waren im Wert von Hunderttausenden von Dukaten, aber bis sie zurückkehren, habe ich keine liquiden Mittel."
Bassanios Gesicht fiel. „Oh. Ich verstehe. Dann war es töricht von mir, zu fragen. Ich hätte—"
„Lass mich ausreden," unterbrach Antonio. „Ich habe keine liquiden Mittel, aber ich habe etwas anderes: Kredit. Mein Name hat Gewicht in Venedig. Wenn ich bürge, wird jeder Geldverleiher mir vertrauen."
„Du meinst, wir sollten Geld leihen?"
„Genau das meine ich. Geh in die Stadt, finde einen Geldverleiher – vielleicht einen der jüdischen Händler im Ghetto, sie haben gewöhnlich die besten Konditionen. Sage ihm, dass ich für das Darlehen bürge. Meine Schiffe werden lange vor Ablauf der Frist zurückkehren, und dann zahlen wir alles zurück."
Bassanio zögerte. „Bist du sicher? Geldverleih ist immer riskant, und wenn etwas mit deinen Schiffen passiert..."
„Meine Schiffe sind gut versichert, auf verschiedene Häfen verteilt. Das Risiko ist minimal." Antonio legte Bassanio die Hand auf die Schulter. „Tu das für mich – lass mich dir helfen. Es würde mir Freude bereiten zu wissen, dass du glücklich bist, dass du das Leben führst, das du verdienst."
Die Worte waren wahr, in gewisser Weise. Antonio wollte tatsächlich, dass Bassanio glücklich war. Nur nicht so sehr, wie er wollte, dass Bassanio bei ihm blieb.
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll," murmelte Bassanio. „Außer danke. Immer wieder danke."
„Dann sag nichts." Antonio lächelte, ein trauriges, müdes Lächeln. „Geh stattdessen und finde einen Geldverleiher. Je früher du das Geld hast, desto früher kannst du nach Belmont reisen."
Bassanio nickte. Er schien noch etwas sagen zu wollen, aber die Worte kamen nicht. Stattdessen umarmte er Antonio kurz, eine männliche, kameradschaftliche Umarmung, die Antonio sowohl Trost als auch Qual bereitete.
Als Bassanio gegangen war, kehrte Antonio zum Fenster zurück. Die Sonne stand nun höher am Himmel, und die Stadt glänzte in ihrem Licht wie eine Bühne, auf der tausend Dramen gleichzeitig aufgeführt wurden. Irgendwo da draußen würde Bassanio nun einen Geldverleiher suchen. Irgendwo da draußen wartete Portia in Belmont, ahnungslos, dass ihr Schicksal bereits in Bewegung gesetzt worden war.
Und hier stand Antonio, gefangen in einem Käfig aus eigenen Gefühlen, die er nie aussprechen durfte.
Er dachte an die Melancholie, die ihn in letzter Zeit so geplagt hatte. Jetzt verstand er sie besser. Es war nicht die allgemeine Leere eines erfolgreichen Mannes, der sich nach Sinn sehnte. Es war die spezifische Leere eines Mannes, der den einzigen Menschen liebte, den er nie haben konnte.
„Du Narr," murmelte er zu sich selbst. „Du alter, töricher Narr."
Aber selbst während er die Worte aussprach, wusste er, dass er alles wieder genauso tun würde. Er würde Bassanio helfen, diese Frau zu heiraten. Er würde lächeln bei der Hochzeit, würde Geschenke schicken, würde der treue Freund sein, der er immer gewesen war.
Denn das war die Natur seiner Liebe – sie forderte nichts, erwartete nichts, wollte nur das Glück des anderen, selbst wenn es das eigene Unglück bedeutete.
Antonio schloss die Augen und lehnte die Stirn gegen das kühle Glas des Fensters. Draußen läuteten die Glocken von San Marco erneut – Mittag, die Stunde der Geschäfte und Verträge, der Versprechungen und Schulden.