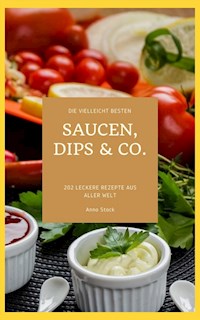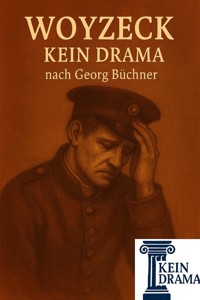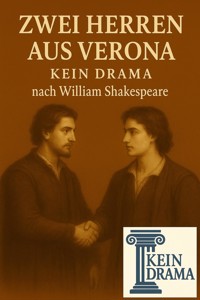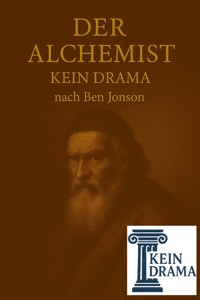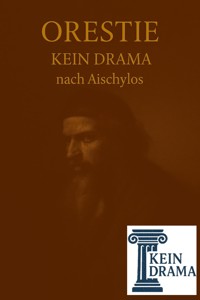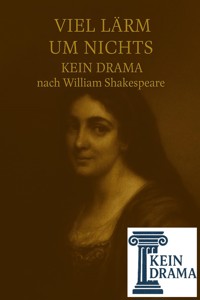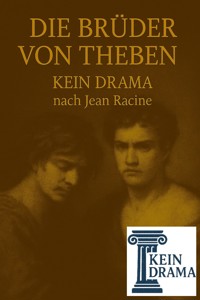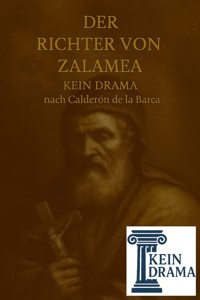6,49 €
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Er hat die Welt erobert – doch nicht sein eigenes Herz. Alexander der Große steht auf dem Höhepunkt seiner Macht. Persien ist gefallen, sein Name flößt Königen Furcht und Völkern Bewunderung ein. Doch zwischen Triumph und Untergang liegt nur ein Schritt: Die Rivalität seiner Generäle, der Verrat in den eigenen Reihen – und die Liebe zu einer gefangenen Königin bringen den jungen Eroberer an seine Grenzen. Diese moderne Adaption des Klassikers von Jean Racine erzählt die Geschichte Alexanders als spannungsgeladenes, emotionales Psychodrama. Zwischen Machtgier, Leidenschaft und Ehre wird sichtbar, wie dünn die Linie ist, die Helden von Tyrannen trennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Alexander der Grosse - Kein Drama nach Jean Racine
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Prolog
Kapitel 1: Das Lager am Hydaspes
Kapitel 2: Die indischen Könige
Kapitel 3: Taxiles' Dilemma
Kapitel 4: Cléofile, Königin zwischen zwei Welten
Kapitel 5: Axiane, die unbeugsame Kriegerin
Kapitel 6: Die Vorbereitungen
Teil II: Konflikt und Intrige
Kapitel 7: Die erste Begegnung
Kapitel 8: Porus' Entschlossenheit
Kapitel 9: Taxiles' gefährliches Spiel
Kapitel 10: Ephestions Warnung
Kapitel 11: Die Vorbereitungen zur Zeremonie
Kapitel 12: Das Gift der Eifersucht
Kapitel 13: Cléofiles Herrschaftsantritt
Kapitel 14: Porus' Rückkehr nach Paurava
Kapitel 15: Axianes Zerrissenheit
Kapitel 16: Alexanders Entscheidung
Kapitel 17: Alexandreia am Hydaspes
Kapitel 18: Bewährungsproben
Kapitel 19: Ein Jahr später – Früchte und Prüfungen
Kapitel 20: Die letzte Prüfung
EPILOG
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
Alexander der Grosse
Ein Roman nach Jean Racine
Anno Stock
Prolog
Der Staub von tausend Wegstunden hing noch immer in der Luft, als die makedonische Armee am Ufer des Hydaspes ihr Lager aufschlug. Es war das Jahr 326 vor Christus, und Alexander, den manche bereits den Großen nannten, hatte die Grenzen der bekannten Welt erreicht – und überschritten.
Zehn Jahre waren vergangen, seit er aus Makedonien aufgebrochen war. Zehn Jahre voller Siege, die seinen Namen in Marmor und Mythos verwandelt hatten. Persien lag hinter ihm, ein Imperium, das er nicht erobert, sondern verschlungen hatte. Ägypten hatte ihn als Pharao begrüßt, als Sohn des Ammon. Babylon hatte seine Tore geöffnet wie für einen längst erwarteten Herrscher.
Doch hier, am Rand der Welt, wo die Flüsse breiter wurden und die Wälder dichter, wo Elefanten die Schlachtfelder beherrschten und fremde Götter aus Tempeln aus Gold und Stein blickten – hier war Alexander nicht mehr nur der unbesiegte Eroberer. Hier war er ein Fremder.
Der Hydaspes glitzerte in der Nachmittagssonne wie flüssiges Bronze. Jenseits des Flusses, im Land der fünf Ströme, das die Griechen Punjab nannten, warteten Königreiche, deren Namen wie ferne Musik klangen: Taxila, Paurava, das Reich der Kathäer. Und in diesen Königreichen herrschten Männer, die Alexanders Namen zwar kannten, seine Macht aber noch nicht am eigenen Leib erfahren hatten.
Am fernen Ufer, kaum sichtbar durch den Dunst des Tages, erkannte man die Umrisse von Befestigungen. Porus, der König von Paurava, hatte seine Armee versammelt. Man sprach von zweitausend Streitwagen, von dreihundert Kriegselefanten, von vierzigtausend Mann. Zahlen, die in der heißen Luft zu flimmern schienen wie Trugbilder.
In Alexanders Zelt herrschte trotz der Hitze geschäftige Betriebsamkeit. Karten wurden studiert, Boten kamen und gingen, Befehle wurden erteilt. Doch der König selbst stand am Eingang seines Zeltes und blickte auf den Fluss hinaus, die Arme verschränkt, das Profil scharf gegen das helle Licht geschnitten.
Ephestion, sein Jugendfreund und engster Vertrauter, trat zu ihm.
„Taxiles ist eingetroffen", sagte er leise. „Er wartet auf Audienz."
Alexander wandte sich nicht um. „Der König, der vor der Schlacht kapituliert hat?"
„Er nennt es Klugheit, nicht Kapitulation. Seine Stadt war nicht zu verteidigen gegen unsere Belagerungsmaschinen, sagt er. Warum also sinnlos Blut vergießen?"
„Eine Philosophie, die ich schätzen könnte", murmelte Alexander, „wenn ich nicht wüsste, dass Klugheit oft nur ein anderes Wort für Feigheit ist."
„Er bringt Geschenke. Und Informationen über Porus."
Jetzt drehte Alexander sich um. Seine grauen Augen – das eine, wie manche behaupteten, etwas dunkler als das andere – fixierten Ephestion mit jener Intensität, die selbst erfahrene Krieger verstummen ließ.
„Informationen", wiederholte er. „Über einen Mann, der sich weigert, vor mir niederzuknien. Über einen König, der lieber kämpft als sich zu unterwerfen." Ein schmales Lächeln umspielte seine Lippen. „Weißt du, mein Freund, was das Interessanteste an diesem endlosen Feldzug ist? Nicht die Siege. Die Siege sind vorhersehbar geworden. Das Interessante sind die Männer, die sich weigern zu verlieren."
Ephestion kannte diesen Ton. Es war der Ton des Sammlers, des Jägers seltener Dinge. Alexander sammelte keine Schätze – er sammelte außergewöhnliche Menschen.
„Soll ich Taxiles hereinbitten?"
„Ja. Aber vorher..." Alexander trat zurück in den Schatten des Zeltes, zu dem großen Tisch, auf dem eine Karte des Punjab ausgebreitet lag. Seine Finger fuhren die blaue Linie des Hydaspes entlang. „Vorher möchte ich wissen: Was weißt du über Cléofile?"
Der Name klang fremdartig auf Alexanders Lippen, schön und seltsam zugleich.
„Die Königin von Taxila", antwortete Ephestion. „Taxiles' Schwägerin, wenn ich richtig informiert bin. Eine Witwe."
„Eine Witwe, die ein Königreich regiert. In diesem Land voller Götter und Wunder." Alexander lächelte wieder, diesmal breiter. „Ich glaube, Ephestion, unser Feldzug wird interessanter, als ich dachte."
Draußen hörte man das Geschrei der Lastentiere, das Hämmern der Schmiede, die Rufe der Offiziere. Die makedonische Kriegsmaschine bereitete sich vor, wie sie es hundertfach getan hatte. Routine, Perfektion, tödliche Effizienz.
Aber während die Armee sich auf den Krieg vorbereitete, dachte ihr Anführer bereits an das, was nach dem Krieg kommen würde. An Bündnisse und Hochzeiten, an die Kunst, fremde Völker nicht nur zu erobern, sondern zu gewinnen.
Alexander war noch nicht dreißig Jahre alt. Er hatte die Welt erobert. Doch erst hier, am Rand dieser Welt, würde er lernen, dass es Dinge gab, die sich nicht mit dem Schwert gewinnen ließen.
Die Geschichte, die folgen sollte, war eine von Krieg und Großmut, von Liebe und Verrat, von Ehre und dem Preis, den Menschen für ihre Überzeugungen zahlen. Sie begann an jenem Nachmittag am Hydaspes, als König Taxiles das Zelt Alexanders betrat.
Und sie sollte niemanden unverändert lassen.
Kapitel 1: Das Lager am Hydaspes
Die Hitze des Punjab war nicht wie die Hitze Persiens. Sie war schwerer, feuchter, sie legte sich wie ein nasses Tuch über Haut und Lungen. Die makedonischen Soldaten, gehärtet durch Jahre des Marsches von Griechenland über Ägypten bis nach Baktrien, spürten dennoch, dass sie eine Grenze überschritten hatten – nicht nur eine geografische, sondern eine der erträglichen Welt.
Das Lager erstreckte sich über mehrere Stadien entlang des Flussufers. Zelte reihten sich in perfekten Linien, wie es die makedonische Disziplin verlangte. Zwischen ihnen bewegten sich Männer in verschiedenen Trachten: die Makedonen in ihren kurzen Chitonen, persische Verbündete in wallenden Gewändern, Söldner aus allen Teilen des bereits eroberten Reiches. Es war eine Armee, die ein Imperium repräsentierte – polyglott, multikulturell, zusammengehalten nur durch die Person ihres Anführers.
Am Rand des Lagers, dort wo die militärische Ordnung in das Chaos der Marketender und Trosswagen überging, stand eine Gruppe von Neuankömmlingen. Ihre Kleidung verriet sofort, dass sie keine Griechen waren. Die Männer trugen weite Hosen und lange Tuniken aus feinstem Leinen, verziert mit Stickereien in Gold und Purpur. Ihre Turbane waren kunstvoll gewickelt, und an ihren Gürteln hingen krumme Schwerter, deren Griffe mit Edelsteinen besetzt waren.
Taxiles, König von Taxila, war ein Mann mittleren Alters, dessen Gesichtszüge eine eigenartige Mischung aus Sanftheit und Berechnung zeigten. Seine dunklen Augen musterten das makedonische Lager mit der Aufmerksamkeit eines Mannes, der gewohnt war, Risiken abzuwägen. Hinter ihm warteten zwanzig Diener mit Geschenken: Truhen voller Goldmünzen, Ballen kostbarer Seide, ein junger Elefant, kaum höher als ein Pferd, mit Ketten aus Silber geschmückt.
„Beeindruckend", murmelte einer seiner Begleiter, ein älterer Mann namens Cléon, der als Berater diente. „Aber nicht unbesiegbar."
Taxiles warf ihm einen warnenden Blick zu. „Schweig, alter Freund. Unbesiegbarkeit ist eine Frage der Perspektive. Frag die Perser, ob diese Armee unbesiegbar ist. Frag die Ägypter. Frag Darius, wenn du sein Grab in Babylon findest."
„Darius war ein Feigling, der vom Schlachtfeld floh."
„Darius war ein Mann, der erkannte, wann eine Schlacht verloren war. Das ist nicht Feigheit, das ist Vernunft." Taxiles strich sich über den sorgfältig gestutzten Bart. „Und Vernunft, mein Freund, ist die einzige Tugend, die in diesen Zeiten zählt."
Ein makedonischer Offizier, erkennbar an der Bronzerüstung und dem roten Umhang, näherte sich. Er war jung, kaum älter als fünfundzwanzig, aber sein Gang verriet militärische Disziplin.
„König Taxiles von Taxila?" Seine Aussprache des Namens war unbeholfen, aber respektvoll.
„Der bin ich."
„Alexander erwartet Euch. Folgt mir."
Sie durchquerten das Lager, vorbei an Waffenschmieden, wo Schwerter geschärft und Rüstungen repariert wurden, vorbei an den Stallungen, wo Pferde wieherten und Stallknechte Stroh verteilten. Überall herrschte kontrolliertes Chaos, die Maschinerie des Krieges in Vorbereitung.
Taxiles beobachtete alles mit geschultem Auge. Die Anzahl der Zelte, die Qualität der Ausrüstung, die Moral der Soldaten. Was er sah, bestätigte, was er bereits wusste: Widerstand gegen diese Armee war Selbstmord.
Das königliche Zelt erhob sich im Zentrum des Lagers, größer als alle anderen, aber nicht protzig. Es war ein Zelt, das oft auf- und abgebaut worden war, praktisch und zweckmäßig. Zwei Wachen mit langen Speeren flankierten den Eingang.
„Wartet hier", befahl der Offizier und verschwand im Inneren.
Taxiles stand in der Sonne und spürte, wie der Schweiß seinen Rücken hinunterlief. Hinter ihm warteten seine Männer, nervös und still. Der junge Elefant trompetete leise, ein klagendes Geräusch.
„Erinnere dich an unseren Plan", flüsterte Cléon. „Keine Schwäche zeigen, aber auch keine Arroganz. Alexander schätzt Ehrlichkeit, sagt man."
„Alexander", antwortete Taxiles ebenso leise, „schätzt vor allem nützliche Menschen. Ich beabsichtige, sehr nützlich zu sein."
Der Vorhang des Zeltes wurde zurückgeschlagen, und Ephestion trat heraus. Selbst wer ihn nicht kannte, hätte sofort erkannt, dass dies jemand von Bedeutung war. Seine Haltung, sein Blick, die Art, wie sich seine Hand lässig auf den Schwertknauf legte – alles verriet einen Mann, der an Macht gewöhnt war.
„König Taxiles. Alexander wird Euch jetzt empfangen. Eure Geschenke können hier bleiben; sie werden später begutachtet."
„Natürlich." Taxiles nickte seinen Dienern zu, dann folgte er Ephestion ins Zelt.
Das Innere war überraschend spartanisch. Ein großer Tisch dominierte den Raum, übersät mit Karten und Schriftrollen. Einige Hocker, ein Feldbett in der Ecke, Rüstungsteile auf einem Ständer. An den Zeltwänden hingen Waffen – nicht zur Dekoration, sondern griffbereit.
Und dort, über eine Karte gebeugt, stand Alexander.
Taxiles hatte Beschreibungen gehört: jung, von mittlerer Größe, mit hellen Haaren und durchdringenden Augen. Aber keine Beschreibung hatte die Intensität erfasst, die von dieser Gestalt ausging. Es war, als sei ein Teil der Sonne in dieses Zelt eingetreten.
Alexander richtete sich auf und musterte seinen Besucher. Für einen Moment herrschte Stille, während zwei Könige einander abschätzten.
„Taxiles von Taxila", sagte Alexander schließlich. Seine Stimme war klarer als erwartet, ohne die Rauheit, die viele Feldherrn auszeichnete. „Man sagt mir, Ihr habt Eure Stadt ohne Kampf übergeben."
Taxiles neigte den Kopf, nicht unterwürfig, aber respektvoll. „Ich habe meine Stadt vor sinnlosem Blutvergießen bewahrt, Herr. Es erschien mir weiser, den kommenden Herrscher Asiens als Freund zu begrüßen als als Feind zu sterben."
„Herrscher Asiens." Alexander lächelte, aber das Lächeln erreichte seine Augen nicht ganz. „Ein großer Titel für einen Mann, der gerade dreißig geworden ist."
„Große Titel wachsen aus großen Taten, und Eure Taten sprechen für sich."
Alexander trat näher, seine Bewegungen geschmeidig wie die einer Raubkatze. „Sprecht klar, Taxiles. Ihr seid nicht hierhergekommen, um mir Komplimente zu machen. Was wollt Ihr wirklich?"
Taxiles atmete tief durch. Dies war der Moment, auf den alles ankam. „Ich will, dass Taxila gedeiht unter Eurer Herrschaft. Ich will, dass mein Volk verschont bleibt von den Schrecken des Krieges. Und im Gegenzug biete ich Euch mehr als eine Stadt – ich biete Euch Wissen über Eure Feinde."
„Porus."
„Ja. Porus von Paurava." Taxiles trat zum Tisch und deutete auf die Karte. „Ein stolzer Mann, Herr. Ein Krieger, wie es in diesem Land wenige gibt. Er wird nicht kapitulieren. Er wird kämpfen."
„Gut", sagte Alexander leise, und in seiner Stimme lag etwas, das Taxiles einen kalten Schauer über den Rücken jagte. „Ich würde enttäuscht sein, wenn er es nicht täte."
Ephestion, der an der Zeltwand gelehnt hatte, mischte sich ein: „Was könnt Ihr uns über seine Streitkräfte sagen?"
„Vierzigtausend Mann zu Fuß, zweitausend Reiter, dreihundert Elefanten." Taxiles zählte die Zahlen mechanisch auf. „Seine Armee ist gut ausgebildet, seine Generäle erfahren. Die Elefanten werden Eure Pferde erschrecken."
„Unsere Pferde haben schon Elefanten gesehen", erwiderte Alexander. „Bei Gaugamela stand Darius' Elefantenkorps gegen uns. Es machte keinen Unterschied."
„Darius' Elefanten waren zahm verglichen mit denen des Porus. Hier in Indien werden diese Tiere von Kindheit an für den Krieg trainiert. Sie tragen Türme auf ihren Rücken, aus denen Bogenschützen schießen. Sie durchbrechen Phalanxen wie Wasser eine Mauer aus Sand."
Alexander ging zum Eingang des Zeltes und blickte hinaus auf den Fluss. „Der Hydaspes", sagte er nachdenklich. „Wie tief ist er?"
„An den meisten Stellen zu tief zum Waten. Die Strömung ist stark. Eine Überquerung unter feindlichem Beschuss wäre... schwierig."
„Schwierig", wiederholte Alexander mit einem Unterton von Belustigung. „Ephestion, erinnerst du dich an den Granikos?"
„Wir haben ihn überquert, während persische Speere auf uns niederregneten", antwortete Ephestion mit einem Lächeln.
„Genau. Schwierig ist ein relativer Begriff, Taxiles." Alexander drehte sich wieder um. „Aber ich schätze Eure Offenheit. Sagt mir: Warum hasst Ihr Porus?"
Die Frage kam so direkt, dass Taxiles einen Moment brauchte, um zu antworten. „Ich hasse ihn nicht."
„Lügt nicht. Niemand verrät einen Nachbarn ohne Grund."
Taxiles Kiefer verkrampfte sich. „Porus ist arrogant. Er glaubt, dass nur derjenige Ehre besitzt, der im Kampf stirbt. Er verachtet jeden, der durch Diplomatie erreichen will, was andere durch Krieg erstreben."
„Diplomatie", sagte Alexander leise. „Ein schönes Wort für Unterwerfung."
„Nennt es, wie Ihr wollt, Herr. Ich habe meine Stadt und mein Volk gerettet. Porus wird die seinen in den Untergang führen. Die Geschichte wird zeigen, wer weiser war."
„Die Geschichte", sagte Alexander und in seiner Stimme lag plötzlich etwas Melancholisches, „urteilt oft grausam. Sie liebt Krieger mehr als Denker, Draufgänger mehr als Diplomaten." Er kam zurück zum Tisch. „Aber das ist nicht meine Sorge. Meine Sorge ist der Fluss dort draußen und der Mann jenseits davon. Ihr bietet mir Informationen. Was erwartet Ihr dafür?"
„Die Bestätigung meiner Herrschaft über Taxila. Schutz für mein Volk. Und..." Taxiles zögerte.
„Und?"
„Die Hand Cléofiles."
Stille breitete sich im Zelt aus. Ephestion richtete sich auf, plötzlich hellwach. Alexander runzelte die Stirn.
„Cléofile", wiederholte er. „Die Königin von Taxila. Eure Schwägerin."
„Die Witwe meines Bruders, ja. Sie ist jung, schön, und sie regiert de facto über einen Teil meines Königreichs. Eine Verbindung zwischen uns würde meine Position stärken."
„Ihr wollt also", sagte Alexander langsam, „dass ich Euch helfe, eine Frau zu heiraten, die offenbar kein Interesse an Euch hat?"
„Sie ist eine Frau. Ihr Interesse ist nicht relevant."
„Nicht relevant." Alexander lachte, ein kurzes, scharfes Geräusch. „Taxiles, Ihr seid ehrlich, das muss man Euch lassen. Und dumm, aber das ist eine andere Sache."
Taxiles Gesicht rötete sich. „Herr, ich—"
„Schweigt." Alexanders Stimme hatte plötzlich die Schärfe eines Befehls. „Ich werde Eure Informationen annehmen, weil sie nützlich sind. Ich werde Eure Herrschaft über Taxila bestätigen, weil ich loyale Vasallen brauche. Aber in die Angelegenheiten von Frauen mische ich mich nicht ein, außer sie bitten mich selbst darum."
„Sie ist nur eine Frau, Herr. In unserem Land—"
„In Eurem Land mag es Brauch sein, Frauen wie Schachfiguren zu behandeln", unterbrach ihn Alexander. „Aber ich bin nicht aus Eurem Land. Meine Mutter war Königin von Makedonien, und sie war mächtiger als die meisten Männer, die ich kenne. Wenn Cléofile Eure Gemahlin werden soll, dann muss sie es wollen."
Taxiles biss sich auf die Lippe. Dies lief nicht wie geplant. Er hatte gehofft, Alexander würde seine Hilfe mit politischen Gefälligkeiten belohnen, aber stattdessen stieß er auf unerwartete Prinzipien.
„Ich verstehe, Herr", sagte er schließlich, seine Stimme kontrolliert. „Vielleicht könnt Ihr zumindest... mit ihr sprechen? Sie von den Vorteilen einer Verbindung überzeugen?"
„Vielleicht", sagte Alexander unverbindlich. „Wenn ich sie treffe. Wann wird sie hier eintreffen?"
„Sie ist bereits hier. Sie begleitet mich, zusammen mit ihrer Gefährtin Axiane."
„Axiane?" Ephestion hatte den Namen aufgeschnappt.
„Die Schwester von Porus", erklärte Taxiles. „Sie lebte am Hof meines Bruders als... nun, als eine Art Geisel, obwohl wir das Wort nie verwendeten. Nach seinem Tod blieb sie bei Cléofile."
Alexander und Ephestion tauschten einen Blick. „Die Schwester unseres Feindes", sagte Ephestion langsam, „lebt in Eurem Lager?"
„Sie ist keine Kriegerin", versicherte Taxiles hastig. „Nur eine Frau. Allerdings eine mit einem gewissen... Temperament."
„Faszinierend", murmelte Alexander. „Nun, Taxiles von Taxila, Ihr habt mir viel zu denken gegeben. Ephestion wird Euch zu Euren Unterkünften führen. Wir werden später weiter sprechen."
Es war eine Entlassung, und Taxiles erkannte sie als solche. Er verneigte sich – tiefer diesmal – und folgte Ephestion aus dem Zelt.
Als sie allein waren, wandte sich Alexander wieder der Karte zu. Seine Finger fuhren über das Pergament, über die eingezeichneten Flüsse und Berge, über die Namen fremder Städte.
„Was denkst du?", fragte er, ohne aufzublicken.
Ein anderer Mann war leise aus dem Schatten getreten – Ptolemaios, einer von Alexanders ältesten Gefährten, ein Mann mit dem kühlen Blick eines Strategen.
„Ich denke, Taxiles ist ein Opportunist", sagte Ptolemaios. „Aber ein nützlicher. Seine Informationen über Porus sind wertvoll."
„Und die Frauen?"
„Die Frauen", wiederholte Ptolemaios mit einem leichten Lächeln, „sind möglicherweise interessanter als Taxiles selbst. Eine Königin, die regiert, und die Schwester unseres Feindes – das sind Schachfiguren, die man mit Bedacht einsetzen sollte."
„Ich bin kein Schachspieler", sagte Alexander.
„Nein", stimmte Ptolemaios zu. „Du bist ein König, der ein Imperium baut. Und Imperien werden nicht nur auf Schlachtfeldern gebaut, sondern auch in Thronsälen und Schlafgemächern."
Alexander schwieg lange. Dann sagte er leise: „Lass Cléofile und Axiane zu mir bringen. Morgen, wenn die Sonne nicht mehr so brennt. Ich möchte wissen, mit wem wir es wirklich zu tun haben."
„Wie du befiehlst."
Ptolemaios verschwand wieder, und Alexander blieb allein mit seinen Karten und seinen Gedanken. Draußen ging die Sonne unter über dem Hydaspes, und der Fluss färbte sich rot wie Blut.
In der Ferne, jenseits des Wassers, wartete ein Feind, der nicht fliehen würde. Und im Lager, näher als erwartet, warteten zwei Frauen, die in diesem Spiel aus Krieg und Politik ihre eigenen Rollen spielen würden.
Alexander, Sohn Philipps, Eroberer der persischen Welt, stand am Rand einer Geschichte, die er noch nicht verstand. Eine Geschichte, die nicht mit Schwertern, sondern mit Worten, nicht mit Schlachten, sondern mit Entscheidungen geschrieben werden würde.
Der erste Akt hatte begonnen.
Kapitel 2: Die indischen Könige
Am entgegengesetzten Ende des makedonischen Lagers, dort wo man den Verbündeten und Vasallen Unterkünfte zugewiesen hatte, stand ein kleineres Zelt aus indischer Seide. Die Stoffbahnen waren in leuchtenden Farben gehalten – Safrangelb, Indigoblau, Karmesinrot – und bewegten sich sanft im Abendwind wie die Flügel exotischer Vögel.
Im Inneren dieses Zeltes saß Cléofile auf einem niedrigen Diwan und starrte auf ihre Hände. Sie waren schmal und feingliedrig, die Hände einer Königin, die nie ein Schwert geführt, aber viele schwierige Entscheidungen getroffen hatte. An ihren Fingern glänzten Ringe, Erbstücke ihres verstorbenen Gemahls.
„Du musst essen", sagte eine Stimme hinter ihr.
Cléofile wandte sich nicht um. „Ich habe keinen Hunger, Axiane."
„Hunger ist keine Frage des Appetits, sondern der Notwendigkeit." Axiane trat in ihr Blickfeld, eine Schale mit Datteln und Nüssen in den Händen. „Wir wissen nicht, was die kommenden Tage bringen werden. Schwäche können wir uns nicht leisten."
Die beiden Frauen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Cléofile war zierlich, ihre Bewegungen von einer Anmut, die Jahre höfischer Erziehung verrieten. Ihr Gesicht war oval, die Züge fein und regelmäßig, gerahmt von dunklem Haar, das in kunstvollen Flechten geordnet war. Sie trug ein Gewand aus weißer Seide, bestickt mit Goldfäden – die Kleidung einer Witwe, die dennoch ihre königliche Würde bewahrte.
Axiane hingegen war größer, ihre Gestalt athletisch und muskulös. Sie bewegte sich wie eine Kriegerin, mit der Ökonomie und Zielstrebigkeit eines Raubtiers. Ihr Haar war kürzer geschnitten als bei den meisten Frauen, praktisch für den Kampf. Ihre Kleidung war eine Mischung aus weiblicher Tracht und Kriegerausrüstung – weite Hosen aus festem Stoff, ein kurzer Waffenrock, darüber eine leichte Rüstung aus Lederplatten. An ihrem Gürtel hing ein krummes Schwert.
„Du gehst bewaffnet", bemerkte Cléofile leise. „Hier, im Lager unserer... Verbündeten?"
„Verbündeten?" Axianes Lachen war bitter. „Nenne die Dinge beim Namen, Schwester. Wir sind Gefangene in einem goldenen Käfig. Taxiles hat uns hierhergebracht wie Geschenke, die er dem makedonischen Wolf darbringen will."
„Sprich leiser." Cléofile blickte sich nervös um, obwohl sie allein waren. „Die Wände haben Ohren."
„Zelte haben keine Wände, nur Stoff." Aber Axiane senkte dennoch ihre Stimme. „Verzeih. Ich weiß, dass du in einer unmöglichen Situation bist."
Cléofile stand auf und trat zum Zelteingang. Durch den schmalen Spalt sah sie makedonische Soldaten patrouillieren, ihre Rüstungen glänzend im letzten Licht der Abendsonne. Weiter entfernt hörte sie die Geräusche des Lagers – Männerstimmen, das Wiehern von Pferden, das metallische Klirren von Waffen.
„Kennst du die Geschichte von der Gazelle zwischen zwei Tigern?", fragte sie, ohne sich umzudrehen.
„Nein."
„Meine Großmutter erzählte sie mir, als ich ein Kind war. Eine Gazelle stand auf einer Wiese zwischen zwei hungrigen Tigern. Wenn sie zum einen lief, würde der andere sie fangen. Wenn sie zum anderen lief, das Gleiche. Also blieb sie stehen und wartete."
„Und?", fragte Axiane. „Was geschah?"
„Die Tiger fraßen sich gegenseitig." Cléofile drehte sich um, und in ihren dunklen Augen lag eine Härte, die Axiane überraschte. „Die Gazelle überlebte."
„Das ist eine Kindergeschichte."
„Alle wichtigen Wahrheiten sind Kindergeschichten." Cléofile setzte sich wieder. „Taxiles ist der eine Tiger, Alexander der andere. Beide wollen mich verschlingen, auf ihre Art. Taxiles will mich heiraten, um sein Königreich zu festigen. Alexander... Alexander will mich als politisches Werkzeug nutzen."
„Alexander hat dich noch nicht einmal gesehen."
„Er hat nach mir geschickt. Morgen sollen wir vor ihm erscheinen." Cléofile griff nach einer Dattel, mehr um ihre Hände zu beschäftigen als aus Hunger. „Taxiles hat es mir erzählt. Er wirkte... nervös."
„Gut." Axiane ließ sich auf einem Kissen nieder, ihre Hand ruhte auf dem Schwertgriff. „Der Mann sollte nervös sein. Er hat meinen Bruder verraten."
„Porus ist nicht verraten worden. Es gab kein Bündnis zwischen Taxila und Paurava."
„Es gab gegenseitigen Respekt. Es gab jahrhundertealte Tradition, dass die Königreiche des Punjab zusammenstehen gegen äußere Feinde." Axianes Augen blitzten gefährlich. „Und jetzt hat Taxiles seine Tore für einen fremden Eroberer geöffnet."
„Um sein Volk zu retten."
„Um seine eigene Haut zu retten. Verwechsle das nicht mit Edelmut, Cléofile."
Eine lange Stille breitete sich zwischen ihnen aus. Trotz ihrer unterschiedlichen Temperamente verband die beiden Frauen eine tiefe Freundschaft, geschmiedet in den Jahren nach dem Tod von Cléofiles Gemahl, als Axiane die einzige gewesen war, die der jungen Witwe beigestanden hatte.
„Erzähl mir von deinem Bruder", sagte Cléofile schließlich leise. „Du sprichst so selten über ihn."
Axianes Gesicht wurde weich, eine seltene Verwandlung. „Porus ist... er ist alles, was ein König sein sollte. Stark, gerecht, unerschütterlich in seinen Prinzipien. Als Kinder spielten wir im Palast von Paurava, und schon damals wusste ich, dass er für Größeres bestimmt war."
„Und dennoch ließest du dich als Geisel nach Taxila bringen."
„Ich war keine Geisel. Ich war ein Symbol des Friedens zwischen unseren Reichen." Axiane lächelte bitter. „Ein Symbol, das nun wertlos geworden ist."
„Glaubst du, er wird kämpfen?"
„Porus?" Axiane lachte, aber es klang nicht fröhlich. „Er wird nicht nur kämpfen – er wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. Kapitulation ist ein Wort, das in seinem Wortschatz nicht existiert."
„Dann wird er sterben", sagte Cléofile leise. „Niemand besiegt Alexander. Nicht die Perser, nicht die Ägypter, nicht die Baktrier. Was macht dich glauben, dass dein Bruder es könnte?"
„Vielleicht kann er es nicht. Aber er wird es versuchen, und darin liegt seine Größe." Axiane stand auf und trat zum Zelteingang. „Siehst du den Fluss dort draußen? Auf der anderen Seite steht mein Bruder mit seiner Armee. Er weiß, dass die Chancen gegen ihn stehen. Er weiß, dass er wahrscheinlich sterben wird. Aber er steht dort trotzdem, weil Ehre mehr bedeutet als Leben."
„Ehre ist ein Luxus der Lebenden", sagte Cléofile. „Die Toten haben keine Ehre, nur Gräber."
„Dann lebe lieber mit Schande als zu sterben mit Ehre?"
„Ich lebe, um zu überleben. Für mein Volk, für die Menschen, die von mir abhängen. Ist das Schande?"
Axiane schwieg lange. Dann sagte sie leise: „Nein. Es ist nur eine andere Art von Mut."
Ein Diener kratzte am Zelteingang – das diskrete Signal, dass jemand eintreten wollte. Cléofile richtete ihren Sari, strich sich eine Haarsträhne zurück. „Herein."
Der Vorhang teilte sich, und Taxiles trat ein, gefolgt von Cléon. Der König von Taxila wirkte erschöpft, aber auch aufgeregt, wie ein Mann, der ein riskantes Geschäft abgeschlossen hat und noch nicht weiß, ob es sich auszahlen wird.
„Cléofile. Axiane." Er neigte den Kopf, eine Geste, die formal höflich, aber ohne echte Wärme war. „Ich hoffe, eure Unterkunft ist angemessen."
„Sie ist ausreichend", antwortete Cléofile kühl.
„Gut, gut." Taxiles rieb sich die Hände, eine nervöse Geste. „Ich komme soeben von Alexander. Die Audienz verlief... interessant."
„Interessant", wiederholte Axiane spöttisch. „Was für ein faszinierendes Wort. Hat der Eroberer dir die Füße geküsst oder nur die Stiefel geleckt?"
Taxiles Gesicht rötete sich. „Vorsicht, Axiane. Deine Zunge könnte uns alle in Gefahr bringen."
„Meine Zunge ist das geringste eurer Probleme."
„Genug." Cléofiles Stimme war leise, aber mit einer Autorität, die beide innehalten ließ. „Was will Alexander von uns, Taxiles?"
Der König zögerte. „Er will euch morgen sehen. Beide."
„Warum?"
„Er... er ist neugierig. Ihr seid ungewöhnlich, müsst ihr wissen. Eine regierende Königin und eine Kriegerin – solche Frauen gibt es in seiner Welt nicht oft."
„Wir sind keine Kuriositäten, die man begutachtet", sagte Axiane gefährlich leise.
„Natürlich nicht, natürlich nicht." Taxiles versuchte ein beschwichtigendes Lächeln. „Aber ihr müsst verstehen – Alexander ist nicht wie andere Könige. Er ist gebildet, philosophisch interessiert. Er schätzt außergewöhnliche Menschen."
„Er schätzt nützliche Menschen", korrigierte Cléofile. „Das ist etwas anderes."
Taxiles musterte sie mit einem Blick, in dem Berechnung und Frustration lagen. „Du warst immer klug, Cléofile. Zu klug für eine Frau, sagte mein Bruder manchmal."
„Dein Bruder", sagte Cléofile eisig, „ist tot. Und ich regiere sein Königreich, weil sonst niemand dazu fähig war. Verwechsle Klugheit nicht mit Unmöglichkeit."
„Ich verwechsle gar nichts." Taxiles trat näher, seine Stimme wurde dringlicher. „Hör mir zu, Cléofile. Wir stehen an einem Wendepunkt. Alexander wird Porus besiegen – das ist unvermeidlich. Danach wird er dieses Land neu ordnen. Wenn wir klug sind, wenn wir uns als wertvolle Verbündete erweisen, können wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen."
„Gestärkt", wiederholte Cléofile. „Du meinst: unterworfen, aber am Leben."
„Ist das nicht genug? Sieh dir die Alternative an – Porus wird kämpfen und sterben. Sein Königreich wird zerstört werden. Ist das besser?"
„Das hängt davon ab, was man unter 'besser' versteht", mischte sich Axiane ein. „Mancher Tod ist besser als manches Leben."
„Philosophie", schnaubte Taxiles verächtlich. „Luxus für Menschen, die nie Verantwortung trugen. Ich trage die Verantwortung für Tausende. Ihre Leben sind wichtiger als abstrakte Konzepte von Ehre."
„Dann sind wir fundamental verschieden", sagte Axiane schlicht.
Cléon, der bisher geschwiegen hatte, räusperte sich. „Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf – die Frage ist nicht, wer recht hat, sondern wie wir überleben. Und dafür müssen wir morgen bei Alexander einen guten Eindruck hinterlassen."
„Einen guten Eindruck", sagte Cléofile nachdenklich. „Was erwartet er von uns?"
„Ehrlichkeit", antwortete Taxiles. „Er schätzt Ehrlichkeit über alles. Und Intelligenz. Täuscht keine Unterwürfigkeit vor – das durchschaut er sofort. Seid, wer ihr seid, aber seid vorsichtig."
„Widersprüchliche Ratschläge", bemerkte Axiane.
„Willkommen in der Welt der Politik."
Taxiles wandte sich zum Gehen, hielt dann aber inne. „Noch etwas, Cléofile. Alexander fragte nach dir. Nach deiner... Situation. Ich glaube, er empfindet Sympathie für eine Witwe, die regieren muss."
„Wie rührend."
„Unterschätze ihn nicht. Er mag jung sein, aber er ist kein Narr. Und er mag Frauen respektieren, aber er ist immer noch ein König, der ein Imperium baut. In seinen Plänen sind wir alle nur Figuren."
„Dann", sagte Cléofile leise, „müssen wir lernen, unsere eigenen Züge zu machen."
Als Taxiles und Cléon gegangen waren, herrschte lange Stille im Zelt. Draußen war die Nacht vollständig hereingebrochen, und über dem makedonischen Lager leuchteten Tausende von Feuern wie gefallene Sterne.
„Morgen also", sagte Axiane schließlich.
„Morgen", bestätigte Cléofile. Sie stand auf und trat wieder zum Zelteingang, ihr Blick richtete sich über das Lager hinweg zum unsichtbaren Fluss. „Irgendwo dort drüben steht dein Bruder."
„Ja."
„Glaubst du, er denkt an uns?"
„Porus denkt an seine Armee, an seine Strategie, an seinen kommenden Kampf." Axiane trat neben sie. „Aber ja, irgendwo in seinen Gedanken sind auch wir. Seine Schwester und die Witwe seines Verbündeten, gefangen im Lager des Feindes."
„Wir sind nicht gefangen."
„Sind wir nicht?"
Cléofile schwieg. Die Frage hing zwischen ihnen wie eine unausgesprochene Wahrheit.
In der Ferne, jenseits des Hydaspes, jenseits der Dunkelheit, die zwischen zwei Armeen lag, stand tatsächlich Porus auf einer Plattform und blickte über sein Lager. Er war ein großer Mann, breit in den Schultern, mit dem Körperbau eines Kriegers, der sein ganzes Leben trainiert hatte. Sein Gesicht war hart, geprägt von Sonne und Wind und zahllosen Schlachten.
Neben ihm stand sein General Mérée, ein älterer Mann mit grauen Strähnen im Bart und einer Narbe, die von der Stirn bis zum Kinn verlief.
„Sie haben ihr Lager gut aufgebaut", sagte Mérée. „Diszipliniert, organisiert. Diese Makedonen sind keine Barbaren."
„Nein", stimmte Porus zu. „Sie sind Krieger. Vielleicht die besten, die die Welt je gesehen hat."
„Und doch werden wir gegen sie kämpfen."