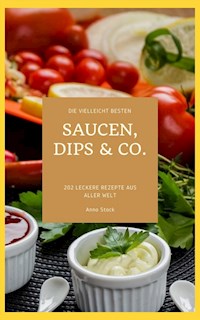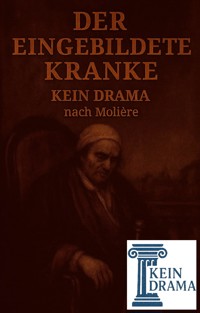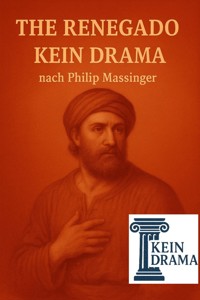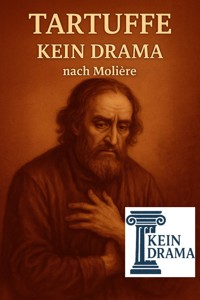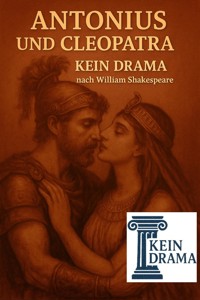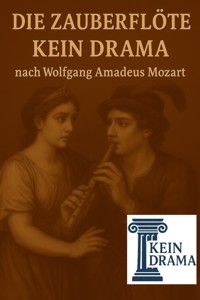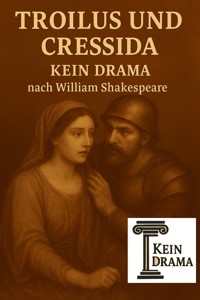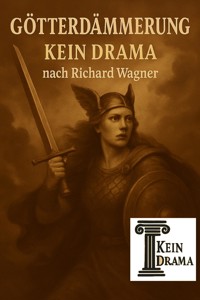6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Preußen, 1675. Prinz Friedrich von Homburg träumt von Ruhm und Ehre – doch sein Traum wird zum Albtraum.In der Schlacht bei Fehrbellin führt der junge Kavallerieoffizier eigenmächtig eine Attacke gegen die Schweden an. Der Sieg ist überwältigend, der Preis jedoch fatal: Friedrich hat den direkten Befehl des Kurfürsten missachtet. Statt Lorbeeren erntet er ein Todesurteil.Gefangen zwischen Pflicht und Selbstbestimmung, zwischen militärischem Gehorsam und persönlicher Freiheit, kämpft Friedrich nun um sein Leben. Doch was wiegt schwerer – die Ehre eines Soldaten oder das nackte Überleben? Als die Frau, die er liebt, ihn zur Flucht drängt, muss Friedrich eine Entscheidung treffen, die alles verändern wird.Eine zeitlose Geschichte über Mut, Angst und die Frage: Was macht einen Menschen wirklich frei?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Prinz Friedrich von Homburg - Kein Drama nach Heinrich von Kleist
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
PROLOG: Der Träumer im Mondlicht
KAPITEL 1: Die Morgendämmerung des Krieges
KAPITEL 2: Die Reiterin in Schwarz
KAPITEL 3: Die Schlacht bei Fehrbellin
KAPITEL 4: Triumph und Schatten
KAPITEL 5: Die Vorladung
KAPITEL 6: Die Anklage
KAPITEL 7: Das Todesurteil
KAPITEL 8: Der Abgrund
KAPITEL 9: Der Brief der Verzweiflung
KAPITEL 10: Natalies Kampf
KAPITEL 11: Die unmögliche Wahl
KAPITEL 12: Die Nacht der Erkenntnis
KAPITEL 13: Der Brief der Reife
KAPITEL 14: Das Erwachen
EPILOG: Der Preis der Freiheit
NACHWORT: Von Kleists Drama zum zeitgenössischen Roman
Impressum neobooks
Table of Contents
Prinz Friedrich von Homburg
Anno Stock
Eine Roman-Adaption nach Heinrich von Kleist
PROLOG: Der Träumer im Mondlicht
Die Nacht lag schwer über Fehrbellin. Schwer wie eine wollene Decke, durchzogen vom süßlichen Duft der Lindenblüten und dem fernen, beißenden Gestank der Feldlager, wo Tausende von Männern auf den Morgen warteten. Auf die Schlacht. Auf den Tod oder den Ruhm. Der Mond stand hoch am Himmel, eine silberne Münze, die ihr kaltes Licht über die Gärten des Schlosses warf und lange Schatten auf die akkurat gestutzten Buchsbaumhecken malte.
In diesen Schatten bewegte sich eine Gestalt.
Sie schritt langsam, fast gleitend, als gehöre sie nicht ganz zu dieser Welt. Ihre Bewegungen waren seltsam entrückt, mechanisch und doch von einer eigentümlichen Anmut. Die weiße Uniform des brandenburgischen Reiterregiments leuchtete im Mondlicht wie frischer Schnee. An der Seite hing ein Säbel, der bei jedem Schritt leise klirrte – ein rhythmisches Geräusch, das sich mit dem fernen Zirpen der Grillen vermischte.
Der Mann ging zu einer Steinbank unter einer alten Eiche. Seine Augen waren geöffnet, doch sie sahen nichts. Sie blickten durch die Welt hindurch, in eine andere Dimension, wo andere Gesetze galten. Seine Lippen bewegten sich lautlos, formten Worte, die niemand hören sollte.
Prinz Friedrich Arthur von Homburg, Oberbefehlshaber der Reiterei, Held von drei Schlachten, Liebling des Kurfürsten, schlafwandelte.
Seine Hände griffen nach etwas Unsichtbarem. Sie bewegten sich suchend durch die Luft, als wollten sie einen Gegenstand greifen, der nur in seinen Träumen existierte. Dann bückte er sich, pflückte einen Weidenzweig, der neben der Bank wuchs, und begann mit konzentrierten Bewegungen, ihn zu einem Kranz zu winden. Seine Finger arbeiteten geschickt, obwohl sein Bewusstsein in fernen Welten weilte. Blatt um Blatt, Zweig um Zweig formte sich unter seinen Händen ein Kranz. Ein Siegeskranz. Ein Lorbeerkranz für einen Helden.
Für ihn selbst.
„Sieh dir das an", flüsterte eine Stimme aus der Dunkelheit.
Hinter der Buchsbaumhecke, verborgen im Schatten einer Statue, standen drei Gestalten. Sie hatten die seltsame Szene beobachtet, seit der Prinz vor zehn Minuten aus dem Seiteneingang des Schlosses getreten war – ohne zu stolpern, ohne zu zögern, als führe ihn eine unsichtbare Hand.
„Ist er krank?", fragte eine weibliche Stimme besorgt.
„Nein, Natalie", antwortete der Mann in der Mitte, dessen Stimme Autorität und Alter ausstrahlte. „Er träumt. Sieh genau hin."
Friedrich Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg, genannt der Große Kurfürst, trat einen Schritt näher. Er war ein Mann in seinen besten Jahren, Ende vierzig, mit einem von Sorgen und Schlachten gezeichneten Gesicht. Unter der Feldherrenuniform verbarg sich ein Körper, der noch immer kräftig war, aber bereits die ersten Spuren der Vergänglichkeit trug. Eine Musketenkugel hatte ihn vor zwei Jahren an der Schulter getroffen. Die Wunde war verheilt, doch sie schmerzte noch immer in kalten Nächten.
Neben ihm stand seine Nichte, Prinzessin Natalie von Oranien. Erst zwanzig Jahre alt, schlank wie eine junge Birke, mit dunklen Augen, die im Mondlicht fast schwarz wirkten. Sie trug ein schlichtes Nachtkleid und einen Umhang, hastig übergeworfen, als der Kurfürst sie aus ihren Gemächern geholt hatte.
„Ich verstehe nicht", murmelte sie. „Wie kann er gehen und doch schlafen?"
„Die Ärzte nennen es Somnambulismus", erklärte die dritte Gestalt, ein junger Offizier mit einem schmalen, intelligenten Gesicht. Graf Heinrich von Hohenzollern, Oberstleutnant und engster Freund des Prinzen. „Manche Menschen wandeln im Schlaf. Sie führen Handlungen aus, als wären sie wach, doch ihr Geist weilt anderswo."
„Und was träumt er?", fragte Natalie.
Der Kurfürst lächelte bitter. „Das werden wir gleich sehen."
Der Prinz hatte seinen Kranz vollendet. Er hielt ihn hoch, betrachtete ihn prüfend, und ein Lächeln – selig, kindlich, voller Hoffnung – breitete sich auf seinem Gesicht aus. Dann setzte er sich den Kranz auf den Kopf. Er richtete sich auf, die Brust herausgedrückt, und salutierte vor einem imaginären Publikum.
„Er sieht sich als Sieger", flüsterte Hohenzollern. „Er träumt vom Triumph."
„Von der morgigen Schlacht", ergänzte der Kurfürst. Seine Stimme war neutral, doch dahinter lauerte etwas. Missbilligung? Sorge? „Er träumt davon, was noch nicht geschehen ist."
Natalie trat unwillkürlich einen Schritt vor, doch der Kurfürst hielt sie zurück. „Warte."
Der Prinz stand nun still. Seine Augen, leer und doch voller innerer Visionen, blickten in die Ferne. Seine Lippen bewegten sich wieder. Diesmal waren Worte zu hören, leise, kaum verständlich.
„...Ruhm... ewiger Ruhm... sie wird mich sehen..."
„Wen?", fragte Natalie.
Der Kurfürst antwortete nicht. Stattdessen griff er nach dem Handschuh, den Natalie an einem Band um ihren Hals trug – ein Erinnerungsstück an ihren verstorbenen Vater. Mit einer schnellen Bewegung löste er ihn und bedeutete Natalie zu schweigen, als sie protestieren wollte.
„Vertrau mir", sagte er leise.
Dann trat er aus dem Schatten hervor. Langsam, vorsichtig, jeden Schritt sorgfältig setzend, näherte er sich dem träumenden Prinzen. Hohenzollern und Natalie folgten ihm im Abstand, fasziniert und beunruhigt zugleich.
Der Prinz bemerkte nichts. Er stand da, den Weidenkranz auf dem Kopf, die Arme leicht ausgebreitet, als erwarte er eine Umarmung. Ein Held, der auf seine Krönung wartete.
Der Kurfürst trat direkt vor ihn. Für einen Moment standen sie sich gegenüber, Fürst und Prinz, getrennt durch die unsichtbare Wand zwischen Wachen und Träumen. Dann hob der Kurfürst langsam die Hand und nahm dem Prinzen den Kranz vom Kopf.
Homburg zuckte leicht zusammen, doch er erwachte nicht. Seine Augen blieben glasig, sein Blick leer.
Der Kurfürst umwand den Kranz mit Natalies Handschuh, verknotete ihn kunstvoll, sodass das weiße Leder wie eine Schleife an dem grünen Geflecht hing. Dann hielt er den Kranz hoch, außerhalb von Homburgs Reichweite.
Der Prinz sah den Kranz. Sein Gesicht verzog sich zu einem Ausdruck kindlicher Verzückung. Er streckte die Hände aus, griff danach, doch der Kurfürst zog ihn zurück. Ein grausames Spiel, dachte Natalie. Warum tut er das?
Homburg machte einen Schritt nach vorn. Seine Hände griffen ins Leere. Der Kurfürst wich zurück. Wieder streckte sich der Prinz, wieder entglitt ihm der Preis. Seine Bewegungen wurden dringlicher, verzweifelter. Er stolperte fast, fing sich wieder.
„Genug", flüsterte Natalie. „Das ist grausam."
„Das ist lehrreich", korrigierte der Kurfürst, ohne den Blick vom Prinzen zu wenden.
Hohenzollern sagte nichts. Er kannte seinen Fürsten gut genug, um zu wissen, dass dieser Mann nichts ohne Grund tat. Jede Handlung war eine Lektion, jede Geste eine Prüfung.
Der Prinz griff wieder nach dem Kranz. Diesmal berührten seine Finger das Leder des Handschuhs. Er zog daran, und plötzlich hatte er den Handschuh in der Hand. Der Kranz jedoch blieb beim Kurfürsten.
Homburg hielt inne. Er starrte auf den Handschuh, als sei dieser Gegenstand von unermesslichem Wert. Seine Finger schlossen sich darum. Dann drückte er den Handschuh an seine Lippen. Ein Kuss, zärtlich und innig, der Kuss eines Liebenden.
„Natalie", murmelte er. Diesmal war der Name deutlich zu verstehen. „Natalie..."
Die junge Frau erstarrte. Ihr Atem stockte. Ihre Wangen färbten sich rot, dankenswerterweise vom Mondlicht verborgen.
Der Kurfürst beobachtete sie mit einem undurchdringlichen Blick. Dann wandte er sich ab und bedeutete den anderen, ihm zu folgen. Sie zogen sich zurück in den Schatten der Hecke.
Homburg blieb allein zurück. Er hielt den Handschuh immer noch an seine Lippen gedrückt. Dann, langsam, als käme er aus großer Tiefe zurück an die Oberfläche, begannen seine Bewegungen zu verlangsamen. Seine Augenlider zitterten. Ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust.
„Er wird gleich aufwachen", flüsterte Hohenzollern.
„Nein", sagte der Kurfürst. „Er wird zurück in sein Quartier gehen. Sieh."
Tatsächlich. Der Prinz drehte sich um, den Handschuh fest umklammert, und begann zurück zum Schloss zu gehen. Seine Schritte waren immer noch mechanisch, aber sicherer nun. Er fand den Weg wie von selbst, öffnete die Tür, verschwand im Inneren.
Einen Moment lang herrschte Stille.
„Was bedeutet das alles?", fragte Natalie schließlich. Ihre Stimme klang belegt, verwirrt.
„Es bedeutet", sagte der Kurfürst langsam, während er den Weidenkranz betrachtete, der immer noch in seiner Hand lag, „dass unser junger Held von zwei Dingen träumt. Von Ruhm..." Er hielt inne, wog den Kranz in der Hand. „...und von der Liebe."
„Ist das nicht natürlich?", fragte Hohenzollern. „Er ist jung. Morgen steht die Schlacht bevor. Da mögen solche Träume kommen."
„Träume sind gefährlich", erwiderte der Kurfürst. Sein Ton hatte sich verändert, war härter geworden. „Träume lenken ab. Ein Soldat muss wach sein, gegenwärtig. Er muss den Befehlen folgen, nicht seinen Phantasien."
„Ihr seid zu streng mit ihm", wagte Natalie einzuwenden. „Friedrich ist ein guter Soldat. Der beste Reiterführer, den Ihr habt."
„Er ist impulsiv", korrigierte der Kurfürst. „Er ist brillant, ja. Mutig, ja. Aber er folgt seinem Herzen statt seinem Verstand. Das kann ihn zum Helden machen..." Er ließ den Satz unvollendet, aber die Bedeutung war klar.
...oder zum Narren.
Sie kehrten ins Schloss zurück. Die Nacht war noch jung, doch in wenigen Stunden würde die Morgendämmerung anbrechen. Und mit ihr die Schlacht. Die Schlacht von Fehrbellin, die in die Geschichte eingehen würde als der Tag, an dem Brandenburg seine Stärke bewies. Als der Tag, an dem die Schweden besiegt wurden.
Als der Tag, an dem Prinz Friedrich von Homburg sein Schicksal erfüllte – oder besiegelte.
Oben in seinen Gemächern lag der Prinz in seinem Bett. Er hatte sich, immer noch schlafend, seiner Uniform entledigt und unter die Decke gelegt. Der weiße Handschuh lag auf seinem Nachttisch, sorgfältig drapiert, als wäre er ein heiliger Gegenstand.
Seine Lippen bewegten sich im Schlaf. Er lächelte.
Er träumte von Lorbeerkränzen und sanften Händen. Von Schlachtendonner und dem Rauschen eines weißen Kleides. Von einem Leben nach der Schlacht, einem Leben voller Ehre und Glück.
Er träumte nicht von Kriegsgerichten.
Nicht von Urteilen.
Nicht von einem Grab im Morgengrauen.
Die Zukunft lag noch verborgen hinter dem Schleier der Nacht. Und in dieser Nacht, für diese wenigen kostbaren Stunden, gehörte die Welt noch den Träumern.
Doch die Morgendämmerung kam immer.
Und mit ihr die Wirklichkeit.
KAPITEL 1: Die Morgendämmerung des Krieges
Das erste Licht des Tages kroch über die märkischen Ebenen wie eine zögerliche Hand. Noch war die Sonne nicht zu sehen, nur ihr Versprechen – ein blasser Streifen am östlichen Horizont, der das Schwarz der Nacht in ein schmutziges Grau verwandelte. Es war die Stunde zwischen Traum und Wachen, zwischen Nacht und Tag, zwischen Leben und Tod.
Die Stunde, in der Armeen zum Kampf aufbrachen.
Das Hauptquartier des Kurfürsten lag im Erdgeschoss des Schlosses Fehrbellin, in einem weitläufigen Raum, der einst als Festsaal gedient hatte. Jetzt hatten Landkarten die Wandteppiche ersetzt, Waffentische die zierlichen Möbel. In der Mitte des Raumes stand ein massiver Eichentisch, übersät mit Papieren, Tintenfässern und einer detaillierten Karte der Umgebung. Darauf waren Truppenbewegungen mit verschiedenfarbigen Stiften eingezeichnet – rot für die Schweden, blau für Brandenburg.
Die Luft war dick vom Rauch unzähliger Kerzen und Öllampen. Sie roch nach Wachs, nach Leder, nach dem säuerlichen Schweiß nervöser Männer. Draußen, durch die hohen Fenster sichtbar, bewegten sich bereits die ersten Soldaten. Schatten in der Dämmerung, die sich zu Regimentern formierten.
Feldmarschall Georg von Dörfling stand am Kopfende des Tisches. Er war ein Mann, den das Leben hart gemacht hatte – hart wie die norddeutschen Winter, hart wie die Schlachten, die er überlebt hatte. Sein Gesicht war wettergeberbt, durchzogen von tiefen Falten. Eine alte Narbe lief von seiner Schläfe bis zum Kinn, das Andenken an einen polnischen Säbelhieb vor zwanzig Jahren. Seine Stimme, wenn er sprach, war rau wie Schleifpapier, aber klar und durchdringend.
Um den Tisch versammelten sich die Obersten und Obristen der brandenburgischen Armee. Vierzehn Männer, jeder ein Kommandeur seiner Einheit, jeder verantwortlich für Hunderte von Leben. Sie trugen ihre Uniformen mit jenem Stolz, der nur denen eigen ist, die ihr Leben dem Krieg verschrieben haben. Manche waren alt, ihre Gesichter Landkarten vergangener Feldzüge. Andere jung, ihre Augen noch glänzend vor Tatendurst.
Einer von ihnen fehlte.
„Wo ist Homburg?", knurrte Dörfling und ließ seinen Blick über die Versammelten schweifen.
„Hier!", rief eine Stimme von der Tür her.
Prinz Friedrich von Homburg stürzte in den Raum. Seine Uniform war nicht richtig zugeknöpft, sein Haar unordentlich. Er sah aus, als wäre er gerade erst aufgewacht – was auch stimmte. Die Augen, die gestern Nacht noch so entrückt im Mondlicht geglänzt hatten, wirkten jetzt gerädert, übernächtigt. Dunkle Schatten lagen darunter.
„Verzeiht die Verspätung", keuchte er und versuchte, seinen Atem zu beruhigen. „Ich... mein Adjutant hat mich nicht rechtzeitig geweckt."
Das war gelogen, und alle im Raum wussten es. Der Adjutant hatte dreimal an seine Tür geklopft, hatte laut gerufen, hatte schließlich die Dienerin des Hauses geholt, die mit einem Hauptschlüssel das Zimmer öffnete. Sie hatten den Prinzen tief schlafend vorgefunden, zusammengerollt wie ein Kind, einen weißen Handschuh in der Hand gedrückt.
Dörfling musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. „Setzt Euch, Hoheit. Wir haben keine Zeit zu verlieren."
Homburg schlüpfte auf seinen Platz neben Graf Hohenzollern, der ihm einen besorgten Seitenblick zuwarf. Der Prinz antwortete mit einem schwachen Lächeln, das mehr Müdigkeit als Zuversicht ausdrückte.
„Meine Herren", begann Dörfling und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. „In weniger als drei Stunden werden wir die Schlacht beginnen. Der Feind lagert vier Meilen nordöstlich von hier, am Ufer des Rhin-Flusses. Fünfzehntausend Mann unter General Wrangel. Sie wissen, dass wir kommen. Sie erwarten uns."
Er deutete auf die Karte. „Ihre Position ist stark, aber nicht uneinnehmbar. Sie haben den Fluss im Rücken – das gibt ihnen Schutz, aber es schneidet auch ihre Rückzugsmöglichkeiten ab. Wenn wir sie schlagen, schlagen wir sie vernichtend."
Ein Raunen ging durch die Versammlung. Vernichtend. Das war ein großes Wort. Das bedeutete nicht nur Sieg, sondern Auslöschung.
„Unser Plan ist folgender", fuhr Dörfling fort. Seine knochigen Finger bewegten sich über die Karte wie die eines Schachspielers. „Das Zentrum, unter meinem Kommando, greift frontal an. Wir binden ihre Hauptstreitmacht. Oberst Hennings, Ihr führt die Infanterie auf dem linken Flügel. Oberst Truchsess, Ihr den rechten."
Die genannten Offiziere nickten.
„Die Entscheidung aber", Dörflings Stimme wurde eine Spur lauter, „wird auf unserem rechten Flügel fallen. Dort, wo ihre schwedische Kavallerie steht. Prinz von Homburg..."
Der Angesprochene zuckte zusammen, als hätte man ihn mit einem Stock gestoßen. Seine Augen, die einen Moment lang auf einem Fleck an der Wand geruht hatten, sprangen zurück zur Karte.
„...Ihr führt unsere Reiterei", vollendete Dörfling. „Zwölf Schwadronen. Dreitausend Mann. Die Besten, die wir haben."
Homburg nickte mechanisch. Sein Gesicht zeigte Konzentration, aber Hohenzollern, der neben ihm saß, sah die Wahrheit. Die Augen des Prinzen waren glasig. Er war körperlich anwesend, aber sein Geist... sein Geist war noch irgendwo anders.
Irgendwo in einem Garten, unter einem Mond, mit einem weißen Handschuh in der Hand.
„Hört gut zu, Homburg", sagte Dörfling, und seine Stimme nahm einen scharfen Ton an. „Dies ist der kritischste Teil des Plans. Eure Kavallerie muss hier bleiben..." Er tippte auf eine Stelle auf der Karte, südlich des Hauptkampfgebiets. „...hinter diesem Hügelkamm. Verborgen. Die Schweden dürfen Euch nicht sehen."
„Verborgen", wiederholte Homburg tonlos.
„Ihr wartet", betonte Dörfling, „bis Ihr mein Signal erhaltet. Oberst Hennings wird, sobald er die feindliche Flanke durchbrochen hat, eine weiße Fahne hissen und drei Mal sein Horn blasen lassen. Erst dann – erst dann! – stürmt Ihr vor und umzingelt den Feind von hinten."
„Drei Hornstöße", murmelte Homburg.
„Das Timing ist entscheidend", fügte ein anderer Offizier hinzu, Oberst Kottwitz, ein alter Knurrhahn mit einem Schnurrbart wie ein Walross. „Zu früh, und ihre Kavallerie zermalmt Euch. Zu spät, und wir verlieren die Schlacht."
„Ich verstehe", sagte Homburg.
Aber verstand er wirklich? Hohenzollern beobachtete seinen Freund genauer. Da war etwas... etwas Abwesendes in seinen Zügen. Als wäre ein Teil von ihm noch schlafend, noch träumend.
„Wiederholt die Befehle", forderte Dörfling unvermittelt.
Homburg blinzelte. „Was?"
„Die Befehle. Wiederholt sie. Ich will sichergehen, dass Ihr sie verstanden habt."
Eine peinliche Stille senkte sich über den Raum. Alle Augen richteten sich auf den jungen Prinzen. Homburg spürte die Blicke wie Nadelstiche auf seiner Haut. Sein Mund wurde trocken.
„Ich... ich führe die Reiterei", begann er stockend. „Auf dem rechten Flügel."
„Und dann?", bohrte Dörfling nach.
„Dann... warte ich auf das Signal."
„Welches Signal?"