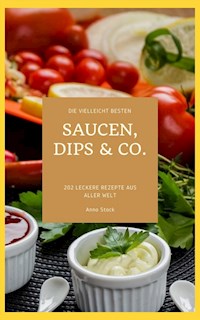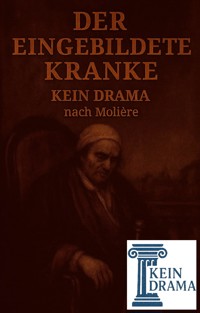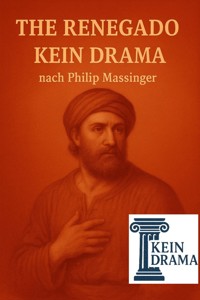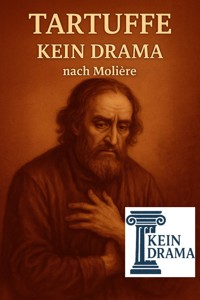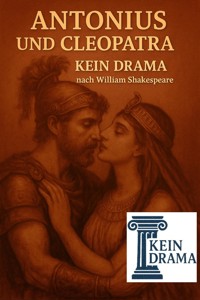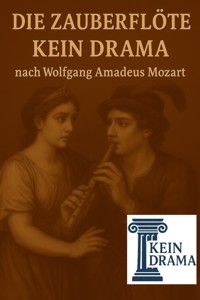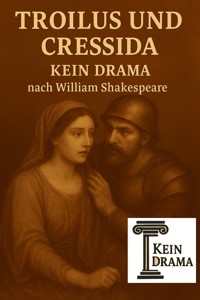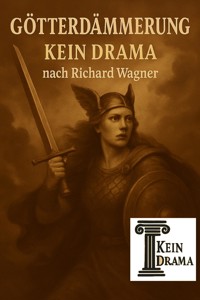6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Genie und Wahnsinn – die Geschichte einer unmöglichen LiebeFerrara, 1575. Nach sieben Jahren unermüdlicher Arbeit vollendet der Hofdichter Torquato Tasso sein Meisterwerk "Das befreite Jerusalem". Der Herzog krönt ihn mit dem Lorbeerkranz – der Triumph scheint perfekt. Doch hinter der glänzenden Fassade des Renaissance-Hofes verbirgt sich ein gefährliches Geheimnis: Tasso liebt die unerreichbare Prinzessin Leonore d'Este.Was als stille Verehrung beginnt, wird zur verzehrenden Leidenschaft. Als Leonore aus politischen Gründen mit einem französischen Grafen verheiratet werden soll, gerät Tassos fragile Seele aus dem Gleichgewicht. Ein fataler Moment der Verzweiflung – ein gezogener Degen im herzoglichen Saal – besiegelt sein Schicksal. Der gefeierte Dichter wird in das psychiatrische Hospital Sant'Anna eingewiesen, wo er Jahre in Dunkelheit und Isolation verbringt.Doch selbst in tiefster Verzweiflung findet Tasso einen Weg zurück: durch die Macht der Worte, durch die heilende Kraft der Literatur. Seine Geschichte ist eine eindringliche Erkundung von Liebe und Verlust, von künstlerischem Genie und menschlicher Zerbrechlichkeit, von der schmalen Grenze zwischen Wahnsinn und Kreativität.Ein fesselnder historischer Roman nach Johann Wolfgang von Goethes Drama – eine zeitlose Geschichte über die Unsterblichkeit der Kunst und den Preis, den ein Künstler dafür zahlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Torquato Tasso - Kein Drama nach Johann Wolfgang von Goethe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Torquato Tasso
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Impressum neobooks
Table of Contents
Torquato Tasso
Ein historischer Roman nach Johann Wolfgang von Goethe
Anno Stock
Erstes Buch
Kapitel 1
Der Garten von Belriguardo lag in der schwülen Hitze eines Julitages des Jahres 1575. Die Sonne stand hoch über den Mauern des herzoglichen Sommerpalastes, und ihre gnadenlosen Strahlen brachen sich in den Wassern der Brunnen, die in den gepflegten Anlagen plätscherten. Hier, weitab vom geschäftigen Treiben Ferraras, hatte sich der Hof des Alfonso II. d'Este zur Sommerfrische eingefunden, um der Hitze und dem Gestank der Stadt zu entfliehen.
Die Anlage war ein Meisterwerk der Gartenkunst. Akkurat geschnittene Buchsbaumhecken bildeten geometrische Muster, zwischen denen sich Wege aus weißem Kies schlängelten. Zypressen ragten wie dunkle Finger gen Himmel, und in regelmäßigen Abständen standen Marmorbüsten – die großen Dichter der Antike, jeder auf seinem Sockel, jeder mit seinem Lorbeerkranz. Vergil, Horaz, Ovid – sie alle blickten mit leeren Augen auf die Lebenden herab, stumme Zeugen einer vergangenen Größe.
Die Luft war erfüllt vom Duft der Rosen, die in üppiger Pracht blühten, vermischt mit dem süßen Aroma der Jasminbüsche. Bienen summten träge von Blüte zu Blüte, und irgendwo in den Baumkronen sang eine Nachtigall ihr einsames Lied, obwohl es längst Tag geworden war.
Zwischen den Lorbeerhecken und Marmorbüsten schritt Prinzessin Leonore d'Este, die Schwester des regierenden Herzogs. Sie war eine Frau von dreißig Jahren, in jenem Alter also, in dem eine Frau von Stand entweder längst vermählt oder dem Witwenstand anheimgefallen war. Leonore jedoch war unverheiratet geblieben – nicht aus Mangel an Bewerbern, sondern aus einer tiefen inneren Zurückhaltung, die ihre ganze Person prägte.
Sie trug an diesem Tag ein schlichtes weißes Gewand aus leichter Seide, das ihre vornehme Gestalt umfloß, ohne sie zu betonen. Um ihre Schultern lag ein hauchdünner Schal, mehr Zierde als Schutz vor der Hitze. Ihr dunkles Haar war kunstvoll geflochten und zu einer hohen Frisur aufgesteckt, die ihren schlanken Hals betonte. Keine Juwelen schmückten sie, bis auf eine einfache Perlenkette – denn Leonore verachtete jene Prunksucht, die am Hofe sonst üblich war.
Ihre Züge waren fein geschnitten, beinahe herb in ihrer Strenge. Die hohe Stirn zeugte von Klugheit, die schmalen Lippen von Selbstbeherrschung. Doch in ihren dunklen Augen lag jene Melancholie, die Menschen eigen ist, welche die Freuden des Lebens mit Maß genießen und stets den Schatten hinter dem Licht erkennen.
An ihrer Seite ging die Gräfin Leonore Sanvitale, ihre Hofdame und Vertraute. Die beiden Frauen bildeten einen reizvollen, ja beinahe absichtlichen Kontrast. Wo die Prinzessin zurückhaltend war, zeigte sich die Gräfin lebhaft. Wo jene schwieg, sprach diese. Die Sanvitale war eine Witwe von fünfunddreißig Jahren, die ihren verstorbenen Gemahl nicht übermäßig betrauert hatte – was am Hof Gegenstand mancher boshafter Bemerkung gewesen war.
Sie kleidete sich an diesem Tag in ein Gewand aus goldgelbem Damast, das ihre noch immer ansehnliche Figur vorteilhaft zur Geltung brachte. Ihr Haar, das bereits erste silberne Fäden zeigte, war mit kostbaren Bändern durchflochten, und an ihren Fingern funkelten mehrere Ringe. Die Sanvitale liebte es, gesehen zu werden, bewundert zu werden – sie war eine Frau der Welt, geschult in den feinen Künsten der Konversation und des Intrigenspiels, wie es an jedem größeren Hof üblich war.
"Seht nur", sagte die Gräfin und deutete mit einer theatralischen Geste auf die Büste des Vergil, die im Schatten einer mächtigen Steineiche stand, "wie friedlich unsere Dichter hier thronen. In Marmor gebannt für die Ewigkeit, können sie uns nicht mehr mit ihren Launen zur Verzweiflung bringen, nicht mehr mit ihren Forderungen belästigen, nicht mehr mit ihrer Empfindlichkeit das Leben am Hofe erschweren."
Sie lachte leise, ein Lachen, das sowohl Spott als auch eine gewisse Weltkenntnis verriet.
Leonore blieb stehen und betrachtete die Büste nachdenklich. Ihre schmale Hand berührte für einen Moment den kühlen Marmor des Sockels.
"Ihr seid hart, liebe Freundin", sagte sie mit ihrer ruhigen, melodischen Stimme. "Vergil war ein sanfter Geist. Er lebte zurückgezogen, fern vom Getümmel des Hofes. Seine Dichtung war sein Leben, und sein Leben war seine Dichtung. Ist das nicht beneidenswert?"
Die Gräfin zog eine Augenbraue hoch. "Beneidenswert? Eine Existenz ohne die Freuden der Gesellschaft, ohne Glanz, ohne..." Sie machte eine Pause und fügte dann mit einem vielsagenden Lächeln hinzu: "Ohne die süßen Verwicklungen, die das Leben erst lebenswert machen? Nein, meine Liebe, ich glaube nicht, dass Ihr wirklich so leben möchtet."
"Vielleicht nicht", gab Leonore zu. "Und doch... es muss eine große Ruhe sein, nur seiner Kunst zu leben, frei von den Zwängen und Erwartungen, die uns alle gefangen halten."
"Vergil ist tot", erwiderte die Gräfin und wandte sich von der Büste ab. "Die Toten sind immer sanft, immer ruhig, immer erhaben. Sie fordern nichts mehr, sie klagen nicht mehr, sie bedrängen uns nicht mit ihren Zweifeln und Ängsten. Die Lebenden hingegen..." Sie ließ den Satz bedeutungsvoll in der Luft hängen und blickte die Prinzessin mit einem wissenden Lächeln an.
Leonore verstand sofort, worauf die Sanvitale anspielte. Sie spürte, wie eine leichte Röte ihre Wangen färbte – eine Röte, die sie sogleich zu unterdrücken suchte.
"Ihr meint Signor Tasso", sagte sie leise, mehr eine Feststellung als eine Frage.
"Wen sonst?" Die Gräfin setzte sich auf eine Marmorbank im Schatten eines Lorbeerbaums und fächelte sich mit einem kunstvoll bemalten Fächer Kühlung zu. "Unser geliebter Hofdichter, der seit sieben Jahren an seinem großen Werk schreibt und den Hof mit seinen Launen unterhält. Bald ist er verzückt und himmelhoch jauchzend, bald niedergeschlagen und zu Tode betrübt. Er lebt in einer Welt, die nur er allein bewohnt."
"Er ist ein Künstler", verteidigte Leonore ihn. "Große Kunst erfordert große Opfer."
"Große Kunst", wiederholte die Sanvitale mit einem spöttischen Unterton. "Ich habe gehört, dass er nun endlich sein Epos vollendet haben soll. Nach sieben Jahren! Andere Dichter schreiben in dieser Zeit ein Dutzend Werke. Aber unser Torquato muss natürlich jedes Wort hundertmal überdenken, jede Zeile tausendmal verbessern, bis er endlich zufrieden ist – wenn er es denn jemals ist."
Leonore setzte sich neben ihre Hofdame, doch ihre Haltung blieb aufrecht, beinahe steif. Sie faltete die Hände im Schoß und blickte auf die Wasserspiele des Brunnens, die in der Sonne glitzerten.
"Ihr seid ungerecht", sagte sie nach einem Moment des Schweigens. "Signor Tasso trägt eine schwere Last. Mein Bruder hat große Erwartungen in ihn gesetzt. Das ganze Haus Este hofft darauf, dass sein Werk unserem Namen Ruhm bringen wird. Kein Wunder, dass er unter diesem Druck leidet."
"Leidet!" Die Gräfin lachte hell auf. "Er genießt es doch! Er kostet seine Qualen aus wie andere einen guten Wein. Seine Melancholie ist sein kostbarstes Gut, sein Leiden seine Zierde. Habt Ihr nicht bemerkt, wie er sich in seiner Schwermut geradezu suhlt?"
"Das ist grausam gesprochen", sagte Leonore, und in ihrer Stimme lag ein leiser Vorwurf.
Die Sanvitale wurde ernst. Sie ließ den Fächer sinken und legte ihre Hand auf die der Prinzessin.
"Verzeiht mir, meine Liebe. Ich vergesse manchmal, dass Ihr eine gütigere Seele habt als ich. Die Jahre am Hof haben mich gelehrt, hinter die Masken zu blicken, die wir alle tragen. Und was Signor Tasso betrifft..." Sie zögerte einen Moment, als überlege sie, ob sie fortfahren sollte. "Ihr wisst, dass er Euch mit einer Zuneigung betrachtet, die über die übliche Verehrung eines Dichters für seine Muse hinausgeht?"
Leonore entzog ihre Hand und stand auf. Ihre Bewegungen waren ruhig, beherrscht, doch die Gräfin erkannte die innere Erregung, die ihre Freundin zu verbergen suchte.
"Ihr irrt Euch", sagte die Prinzessin fest. "Signor Tasso ist ein Mann von Ehre. Er würde niemals..."
"Niemals was?" unterbrach die Sanvitale sie sanft. "Niemals lieben? Niemals hoffen? Niemals träumen? Meine Liebe, gerade Männer von Ehre sind es, die am gefährlichsten lieben – denn sie glauben an ihre Träume."
Ein unbehagliches Schweigen trat ein. Leonore wandte sich ab und ging einige Schritte den Kiesweg entlang. Die Gräfin beobachtete sie mit einem Ausdruck, der Sorge und Neugierde zugleich verriet.
"Was würdet Ihr tun", fragte Leonore schließlich, ohne sich umzudrehen, "wenn er tatsächlich... wenn er seine Gefühle offenbaren würde?"
"Ich?" Die Sanvitale stand ebenfalls auf und trat neben die Prinzessin. "Ich würde ihn sanft, aber bestimmt in seine Schranken weisen. Ich würde ihm klarmachen, dass zwischen einer Prinzessin des Hauses Este und einem Dichter, so begabt er auch sein mag, Welten liegen. Ich würde die Ordnung bewahren, die unser aller Leben regelt."
"Und wenn die Ordnung falsch ist?" fragte Leonore leise.
Die Gräfin sah sie überrascht an. "Meine Liebe, solche Gedanken ziemen sich nicht für..."
Doch sie brach ab, denn in diesem Moment näherte sich eine Gestalt auf dem Kiesweg. Beide Frauen wandten sich um und erkannten sogleich, wer da kam.
Kapitel 2
Torquato Tasso schritt durch den Garten wie ein Träumender, der noch nicht ganz erwacht ist. Sein Gang war unsicher, beinahe zögernd, als fürchte er, mit jedem Schritt eine unsichtbare Grenze zu überschreiten. Er war ein Mann von zweiunddreißig Jahren, in der Blüte seiner Mannesjahre also, und doch lag über seiner ganzen Erscheinung jener Schatten, den schwere innere Kämpfe hinterlassen.
Sein Gesicht war bleich – jene vornehme Blässe, die Menschen eigen ist, die mehr Stunden in geschlossenen Räumen über Büchern verbringen als unter freiem Himmel. Die Züge waren fein geschnitten, fast zu fein für einen Mann: hohe Wangenknochen, eine gerade Nase, ein schmaler Mund, der selbst im Ruhezustand eine leichte Traurigkeit verriet. Die Stirn war hoch und breit, die Stirn eines Denkers, und wurde von kastanienbraunem Haar umrahmt, das in weichen Wellen bis auf die Schultern fiel.
Doch am auffallendsten waren seine Augen. Groß, dunkel, von langen Wimpern beschattet, blickten sie weniger nach außen als nach innen. Es waren die Augen eines Menschen, der in einer anderen Welt lebte als seine Mitmenschen, eines Menschen, der Dinge sah, die anderen verborgen blieben – und der unter dieser Last litt.
Er trug ein schlichtes schwarzes Wams aus feiner Wolle, das seine schmale Gestalt umschloss. Keine Stickereien zierten es, keine goldenen Knöpfe, kein Prunk – Tasso verachtete jene äußerlichen Zeichen des Reichtums, die am Hof sonst zur Schau getragen wurden. An seiner Seite hing ein schmaler Degen, mehr Zierde als Waffe, denn Tasso verstand sich nicht auf das Fechten. Seine Waffen waren Worte, nicht Klingen.
Unter dem linken Arm trug er eine Pergamentrolle, sorgsam mit einem seidenen Band verschnürt. Es war sein vollendetes Werk, das Epos "Das befreite Jerusalem", an dem er sieben lange Jahre gearbeitet hatte. Sieben Jahre des Ringens, des Zweifelns, des verzweifelten Strebens nach Vollkommenheit. Heute Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Fenster seiner Kammer gefallen waren, hatte er die letzte Zeile niedergeschrieben.
Und doch empfand er keine Freude, keinen Triumph. Stattdessen überkam ihn eine tiefe Leere, gemischt mit einer nagenden Angst. War es gut genug? Würde es den Erwartungen entsprechen? Würde der Herzog zufrieden sein? Würde die Welt – und vor allem: würde sie es anerkennen?
Diese Gedanken jagten durch seinen Kopf, während er durch den Garten schritt. Er hatte nicht vorgehabt, hierher zu kommen. Eigentlich hatte er sich in seine Kammer zurückziehen wollen, um allein zu sein mit seiner Vollendung und seinem Zweifel. Doch seine Füße hatten ihn wie von selbst hierher getragen, an diesen Ort, an dem er wusste, dass er sie treffen würde.
Die Prinzessin Leonore.
Allein der Gedanke an sie ließ sein Herz schneller schlagen. Er wusste, dass es Wahnsinn war. Er wusste, dass zwischen ihnen Welten lagen – sie eine Prinzessin von königlichem Geblüt, er ein einfacher Dichter, abhängig von der Gunst des Hofes. Und doch konnte er nicht anders, als an sie zu denken, von ihr zu träumen, in ihr die Verkörperung all jener Ideale zu sehen, die er in seiner Dichtung besang.
Sie war seine Laura, seine Beatrice – unerreichbar und doch allgegenwärtig, real und doch unwirklich zugleich. In seinen einsamen Stunden, wenn er über seinen Versen brütete, war es ihr Bild, das vor seinen Augen schwebte. Ihre Güte, ihre Anmut, ihre stille Schönheit – all das hatte er in seine Heldin Armida einfließen lassen, ohne es je zu gestehen.
Als er nun die beiden Frauen zwischen den Lorbeerhecken erblickte, blieb er wie angewurzelt stehen. Einen Moment lang erwog er, sich zurückzuziehen, bevor sie ihn bemerkten. Doch es war bereits zu spät. Die Prinzessin hatte sich umgewandt und ihn gesehen.
Ihr Blick traf den seinen, und für einen Augenblick schien die Welt stillzustehen. Dann lächelte sie – jenes sanfte, gütige Lächeln, das sein Herz jedes Mal aufs Neue in Aufruhr versetzte – und wandte sich ihm zu.
"Signor Tasso", sagte sie, und ihre Stimme klang wie Musik in seinen Ohren. "Welch glücklicher Zufall, Euch hier zu treffen. Wir sprachen eben von den großen Dichtern der Antike. Ist es nicht wunderbar, wie ihre Werke die Jahrhunderte überdauern?"
Tasso trat näher, wobei er sich zwingen musste, seine Schritte gleichmäßig zu halten. Vor den beiden Frauen verneigte er sich tief, tiefer als nötig – eine Verbeugung, die nicht nur Respekt, sondern beinahe Unterwürfigkeit ausdrückte.
"Eure Hoheit sind zu gütig", erwiderte er, und seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. "Ich bin nicht würdig, in einem Atemzug mit den großen Meistern genannt zu werden. Sie waren Giganten, und ich... ich bin nur ein Zwerg, der auf ihren Schultern steht und versucht, einen Blick in den Himmel zu erhaschen."
Die Gräfin Sanvitale, die das Gespräch mit verschränkten Armen beobachtet hatte, konnte sich ein spöttisches Lächeln nicht verkneifen.
"Falsche Bescheidenheit steht einem Dichter schlecht zu Gesicht, Signor Tasso", warf sie ein, und ihre Stimme hatte jenen scharfen Unterton, der Tasso jedes Mal zusammenzucken ließ. "Sagt uns lieber, ob Ihr endlich Euer Werk vollendet habt. Der ganze Hof wartet darauf. Es wird schon gewettet, ob Ihr es jemals fertigstellen werdet oder ob wir alle als alte Greise sterben werden, während Ihr noch an der perfekten Formulierung eines einzelnen Verses feilt."
Tasso fühlte, wie die Hitze in sein Gesicht stieg. Die Worte der Gräfin trafen ihn wie Peitschenhiebe. Er wusste, dass sie ihn nicht mochte, dass sie in ihm nichts als einen lästigen Träumer sah. Und vielleicht hatte sie recht. Vielleicht war er wirklich ein Narr, der sich in seiner eigenen Welt verlor, während die reale Welt um ihn herum weiterging.
"Leonore", sagte die Prinzessin mit einem leichten Vorwurf in der Stimme, "seid nicht so hart."
Dann wandte sie sich wieder Tasso zu, und ihr Blick war voller Mitgefühl. "Ihr müsst meiner Hofdame nicht antworten, wenn Ihr es nicht möchtet, Signor Tasso. Ein Künstler schuldet niemandem Rechenschaft über sein Schaffen."
Doch Tasso schüttelte den Kopf. Er umklammerte die Pergamentrolle fester, bis seine Knöchel weiß hervortraten.
"Nein, Eure Hoheit. Die Gräfin hat recht, nach dem Werk zu fragen. Es ist vollendet." Er sprach die Worte aus, doch sie klangen nicht triumphierend, sondern beinahe gequält, als gestehe er eine Niederlage ein. "Heute Morgen, als die Sonne aufging, habe ich die letzte Zeile niedergeschrieben. Sieben Jahre... sieben Jahre meines Lebens sind in dieses Werk geflossen."
Er hielt inne und blickte auf die Pergamentrolle in seinen Händen, als sähe er sie zum ersten Mal.
"Und doch..." Seine Stimme wurde noch leiser. "Und doch fürchte ich, dass es nicht vollkommen ist. Dass ich versagt habe. Die Last der Erwartung, die Verantwortung gegenüber dem Stoff, gegenüber der Geschichte, gegenüber meinem Auftraggeber, gegenüber..."
Er hob den Blick und sah Leonore direkt in die Augen. Was er sagen wollte, blieb unausgesprochen, doch in seinem Blick lag alles: gegenüber Euch. Gegenüber Euch, die Ihr meine Inspiration wart, meine Muse, mein Licht in der Dunkelheit.
Leonore spürte die Intensität seines Blicks und wandte sich ab. Eine leichte Röte färbte ihre Wangen.
"Ihr seid zu streng mit Euch selbst, Signor Tasso", sagte sie leise. "Ich bin überzeugt, dass Euer Werk großartig ist. Der Herzog wird hocherfreut sein. Er hat stets großes Vertrauen in Euer Genie gesetzt."
"Vertrauen", wiederholte Tasso bitter. "Ein schweres Wort. Vertrauen zu rechtfertigen ist schwerer, als es zu gewinnen."
Kapitel 3
Die Gräfin Sanvitale wollte gerade eine weitere spitze Bemerkung anbringen, als in der Ferne Schritte auf dem Kiesweg erklangen. Alle drei wandten sich um und sahen zwei Gestalten näher kommen, die sich im Gegenlicht der Mittagssonne zunächst nur als Silhouetten abzeichneten.
Doch schon nach wenigen Augenblicken erkannte man, wer da nahte: Herzog Alfonso II. d'Este höchstpersönlich, begleitet von seinem Staatssekretär Antonio Montecatino. Die beiden Männer bildeten einen markanten Kontrast – der Herzog in seiner würdevollen Gelassenheit, Antonio in seiner geschmeidigen Eleganz.
Alfonso d'Este war ein Mann von vierzig Jahren, in der vollen Kraft seines Lebens. Seine Gestalt war hoch gewachsen und kräftig gebaut, ohne dabei zur Korpulenz zu neigen, wie es bei manchen Fürsten seiner Jahre der Fall war. Sein Gesicht zeigte jene ernsten, beinahe melancholischen Züge, die dem Haus Este eigen waren – eine hohe Stirn, eine markante Nase, ein festgeschlossener Mund. Der dunkle Bart, der sein Kinn und seine Wangen bedeckte, war sorgfältig gestutzt nach der neuesten spanischen Mode.
Er trug ein Gewand aus dunklem Samt, reich mit Gold bestickt, doch ohne jenen aufdringlichen Prunk, den manche italienische Fürsten zur Schau trugen. An seiner linken Hand funkelte der schwere Siegelring des Hauses Este mit dem Adlerwappen. Um seinen Hals hing an einer goldenen Kette das Ordenskreuz des Goldenen Vließes – eine Auszeichnung, die ihm der Kaiser persönlich verliehen hatte.