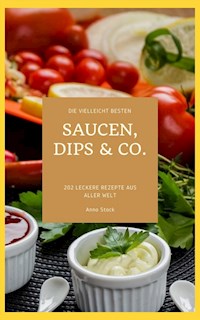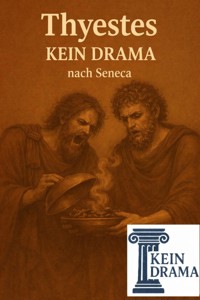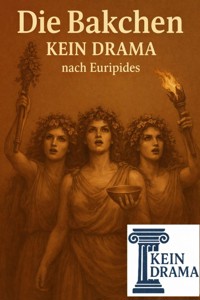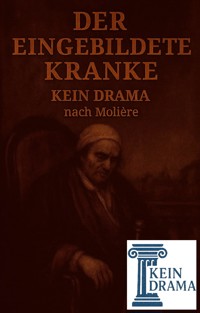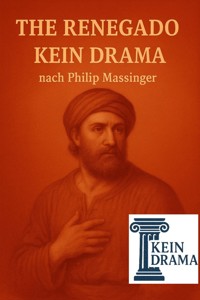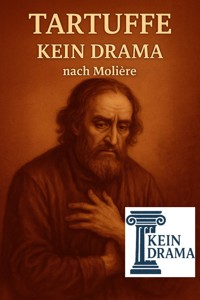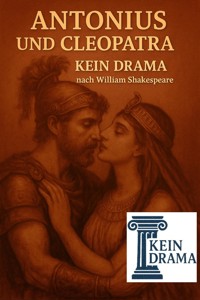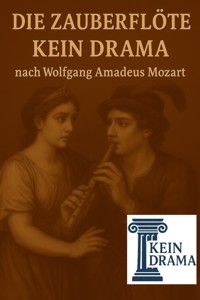6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Eine verbotene Liebe. Eine gefährliche Maskerade. Ein Wald voller Geheimnisse.Als Prinzessin Rosalind von ihrem tyrannischen Onkel verbannt wird, flieht sie in den Ardennenwald – verkleidet als junger Mann namens Ganymede. An ihrer Seite: ihre treue Cousine Celia und der weise Narr Touchstone. Im Exil hofft sie, ihren Vater, den rechtmäßigen Herzog, wiederzufinden.Doch das Schicksal hat andere Pläne. Orlando de Boys, der junge Ritter, der Rosalinds Herz beim Ringkampf eroberte, folgt ihr in den Wald – ohne zu ahnen, dass "Ganymede" die Frau ist, die er verzweifelt sucht. Als Rosalind ihm anbietet, ihn in der Kunst der Liebeswerbung zu unterrichten, beginnt ein gefährliches Spiel aus Wahrheit und Täuschung.Im grünen Dickicht des Ardennenwaldes vermischen sich Identitäten, erwachen unmögliche Lieben, und alte Feindschaften werden auf die Probe gestellt. Während Rosalind zwischen ihrer Maskerade und ihrem wahren Selbst gefangen ist, muss sie entscheiden: Wie lange kann sie die Wahrheit verbergen? Und wird Orlando ihr verzeihen, wenn die Masken fallen?Eine mitreißende Neuerzählung von Shakespeares zeitloser Komödie – über die Macht der Liebe, den Mut zur Verwandlung und die Frage, wer wir wirklich sind, wenn wir aufhören, eine Rolle zu spielen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Wie es euch gefällt - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Kapitel 1: Das Erbe der Brüder
Kapitel 2: Die verbannte Prinzessin
Kapitel 3: Der Ringkampf
Kapitel 4: Verbotene Gefühle
Kapitel 5: Verschwörungen
Kapitel 6: Die Verbannung
Kapitel 7: Der verbannte Herzog
Kapitel 8: Die Begegnung
Kapitel 9: Ganymedes Spiel
Kapitel 10: Liebesnärrische Spiele
Kapitel 11: Olivers Wandlung
Kapitel 12: Die Löwin
Kapitel 13: Die Enthüllung
Kapitel 14: Versöhnung
Kapitel 15: Wie es euch gefällt
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
Wie es euch gefällt
Eine Romanze nach William Shakespeare
Anno Stock
ERSTER TEIL: Am Hofe
Kapitel 1: Das Erbe der Brüder
Der Wind trieb welke Blätter über den Hof von Oliver de Boys' Anwesen, und mit ihnen schien er auch die letzten Reste brüderlicher Zuneigung fortzufegen. Orlando stand am Rand des Übungsplatzes, die Hände rau von der Arbeit, die Schultern breit geworden durch schwere körperliche Mühe, und beobachtete, wie sein ältester Bruder Oliver aus dem Herrenhaus trat.
Es war nun drei Jahre her, seit Sir Rowland de Boys gestorben war. Drei Jahre, in denen aus dem respektierten jüngsten Sohn eines Ritters ein Mann geworden war, der mehr einem Stallknecht glich als einem Edelmann. Orlando war neunzehn Jahre alt, und die Bitterkeit hatte in seiner Brust einen Platz gefunden, den einst kindliches Vertrauen bewohnt hatte.
Oliver schritt über den Hof, ohne seinen Bruder eines Blickes zu würdigen. Er trug einen samtenen Wams in tiefem Burgunderrot, die Ärmel mit Goldfäden bestickt, und seine Stiefel aus feinstem Leder glänzten im Herbstlicht. Alles an ihm sprach von Wohlstand und Stand – jenem Stand, der auch Orlando von Geburt her zustand, der ihm aber durch Olivers Geiz und Bosheit verwehrt wurde.
"Oliver," rief Orlando und trat vor.
Sein Bruder wandte sich um, das Gesicht eine Maske höflicher Gleichgültigkeit. "Was gibt es?"
"Ich muss mit dir sprechen. Es geht um meines Vaters Testament."
Ein kaltes Lächeln umspielte Olivers Lippen. "Unser Vater, meinst du wohl."
"Ja, unser Vater," wiederholte Orlando mit mühsam beherrschter Stimme. "Der Mann, der im Testament verfügte, dass du mir eine standesgemäße Erziehung zukommen lassen solltest. Der Mann, der mir tausend Kronen vermachte."
Oliver strich sich über den gepflegten Bart. Die Geste wirkte gelangweilt, beinahe theatralisch. "Und? Hast du nicht ein Dach über dem Kopf? Bekommst du nicht zu essen?"
"Ich werde gehalten wie ein Tier!" Die Worte brachen aus Orlando hervor, heißer und zorniger als beabsichtigt. "Du lässt mich im Stall schlafen, gibst mir zu essen mit den Knechten. Jaques, unser anderer Bruder, studiert in der Schule – wie es sich gehört. Ich aber, obwohl der Vater mir die gleiche Erziehung zugedacht hatte, ich werde auf diesem Hof gehalten wie ein Ochse!"
"Du übertreibst maßlos," erwiderte Oliver kühl.
"Tue ich das?" Orlando trat näher, seine Stimme ein gefährliches Flüstern. "Ich kann weder lesen noch schreiben, außer dem, was ich mir selbst beigebracht habe. Ich kenne keine Musik, keine höfischen Manieren, nichts von dem, was einen Gentleman ausmacht. Und das, obwohl das Blut eines Ritters in meinen Adern fließt – das gleiche Blut, das in den deinen fließt, Bruder."
Oliver lachte – ein hartes, freudloses Geräusch. "Wie dramatisch du geworden bist, Orlando. Vielleicht hättest du Schauspieler werden sollen."
Die Beleidigung saß. Orlando spürte, wie seine Hände sich zu Fäusten ballten. Er war stärker als Oliver, das wussten beide. Die Jahre harter Arbeit hatten seinen Körper gestählt, während Oliver in weichen Kissen und an reichgedeckten Tafeln gelebt hatte. Ein einziger Schlag würde genügen.
Aber das war es, was Oliver wollte. Das sah Orlando in den Augen seines Bruders – die Herausforderung, die Hoffnung sogar, dass Orlando die Beherrschung verlieren und zuschlagen würde. Dann hätte Oliver den Grund, ihn vom Anwesen zu jagen oder Schlimmeres.
Mit enormer Willenskraft zwang Orlando seine Hände, sich zu öffnen. "Ich verlange nur," sagte er langsam, jedes Wort abwägend, "was mir von Rechts wegen zusteht. Gib mir mein Erbe, Oliver. Lass mich gehen, mein eigenes Leben zu leben. Wenn du mich nicht als Bruder behandeln willst, so behandle mich wenigstens mit der Gerechtigkeit, die du einem Fremden zukommen lassen würdest."
"Gerechtigkeit?" Oliver trat näher, seine Stimme plötzlich von einer Kälte, die Orlando erschaudern ließ. "Du sprichst von Gerechtigkeit? Du, der du nichts bist als eine Erinnerung an Vaters Schwäche? Er liebte dich zu sehr, Orlando, unseren Jüngsten. Er sah dich mit Augen, die von Vaterliebe verblendet waren. Aber ich sehe klar. Ich sehe einen Niemand, einen Nichtsnutz, der sich einbildet, etwas Besseres zu sein."
"Ich bin Sir Rowlands Sohn!"
"Du bist ein Bastard im Geiste, wenn auch nicht im Fleisch," zischte Oliver. "Und du wirst bekommen, was ich dir gebe – nicht mehr und nicht weniger."
Adam, der alte Diener der Familie, hatte sich genähert und stand nun unsicher am Rand des Hofes. Er war in den Dienst des Hauses de Boys eingetreten, als Sir Rowland noch ein junger Mann gewesen war, und seine Loyalität galt noch immer dem Andenken seines toten Herrn. Jetzt sah er mit besorgter Miene, wie die beiden Brüder einander gegenüberstanden wie Hähne vor dem Kampf.
"Meine jungen Herren," wagte er sich vor, seine Stimme zittrig vor Alter und Sorge. "Bitte, bedenkt—"
"Schweig, Alter," fuhr Oliver ihn an, ohne den Blick von Orlando zu wenden.
Aber die Unterbrechung hatte genügt. Orlando wich einen Schritt zurück, zwang sich zur Ruhe. "Dies ist nicht das Ende," sagte er leise. "Ich werde bekommen, was mir zusteht, Oliver. Auf die eine oder andere Weise."
"Ist das eine Drohung?"
"Es ist eine Feststellung."
Oliver musterte seinen Bruder mit zusammengekniffenen Augen. Dann, unerwartet, entspannten sich seine Züge zu einem Lächeln – einem Lächeln, das Orlando mehr beunruhigte als der vorangegangene Zorn. "Weißt du was, Orlando? Du hast recht. Es ist Zeit, dass du die Möglichkeit bekommst, dich zu beweisen."
"Was meinst du?"
"Herzog Frederick veranstaltet morgen einen Ringkampf am Hof. Charles, der Hofringer, wird gegen alle Herausforderer antreten. Vielleicht solltest du dein Glück versuchen? Wenn du gewinnst, wird dein Name bekannt werden. Vielleicht findest du dann einen Patron, jemanden, der dir die Stellung gibt, die du so verzweifelt begehrst."
Orlando starrte seinen Bruder misstrauisch an. "Charles ist ein Profi. Er hat schon drei Männer verkrüppelt."
"Aber du bist stark," erwiderte Oliver glatt. "All diese Jahre harter Arbeit haben dich zäh gemacht. Und wenn du verlieren solltest... nun, dann wird niemand mir vorwerfen können, ich hätte dir keine Chance gegeben."
Die Falle war offensichtlich, und doch... Orlando spürte, wie etwas in ihm auf die Herausforderung reagierte. War es nicht besser, im Kampf zu fallen, als hier langsam zu verkümmern? Und vielleicht, nur vielleicht, war dies wirklich seine Gelegenheit.
"Ich werde kämpfen," sagte er.
Oliver nickte, das Lächeln noch immer auf seinen Lippen. "Ausgezeichnet. Ich werde die nötigen Arrangements treffen." Er wandte sich zum Gehen, hielt dann aber inne. "Ach, Orlando? Überlege es dir bis morgen früh. Charles ist ein furchterregender Gegner. Niemand würde es dir verübeln, wenn du kneifen würdest."
Mit diesen Worten schritt Oliver davon, und Orlando blieb zurück mit einem Gefühl der Vorahnung, das wie Blei in seinem Magen lag.
Adam trat näher, seine alten Augen feucht vor Sorge. "Junger Herr, Ihr dürft nicht gegen Charles antreten. Es ist eine Falle, so wahr ich hier stehe."
"Ich weiß, Adam."
"Charles hat Männer getötet. Er ist ein Riese, ein Ungeheuer. Und Euer Bruder... verzeiht einem alten Mann die Worte, aber Euer Bruder wünscht Euch nichts Gutes."
Orlando legte dem alten Mann die Hand auf die Schulter. "Was soll ich denn tun, Adam? Hier bleiben und langsam zugrunde gehen? Mein Leben als Stallknecht fristen, während mein Bruder das Erbe verprasst, das auch mir zusteht?"
"Es gibt andere Wege, junger Herr."
"Welche?" Orlando lachte bitter. "Ich habe keine Bildung, keine Mittel, keine Verbindungen. Alles, was ich habe, ist die Stärke meiner Arme und der Name meines Vaters. Vielleicht reicht das aus."
Adam schüttelte den Kopf, sagte aber nichts mehr. Er kannte Orlando gut genug, um zu wissen, dass der junge Mann, wenn er erst einmal einen Entschluss gefasst hatte, nicht mehr davon abzubringen war. Diese Sturheit hatte er von seinem Vater geerbt – Sir Rowland war ebenfalls ein Mann von unbeugsamer Entschlossenheit gewesen.
Während Orlando über den Hof ging, zurück zu dem kleinen Verschlag, der ihm als Unterkunft diente, beobachtete Oliver ihn von einem Fenster des Herrenhauses aus. Neben ihm stand Charles, der Ringer – ein Berg von einem Mann, dessen Schultern kaum durch die Türrahmen passten und dessen Hände groß genug waren, um einen Menschenkopf zu umfassen.
"Das ist er also," murmelte Charles. "Sieht stark aus für sein Alter."
"Er ist nichts," sagte Oliver verächtlich. "Ein Bauernjunge mit Illusionen. Aber ich will, dass Ihr diese Illusionen morgen zermalmt, Charles. Versteht Ihr mich? Ich will, dass er nicht mehr aufsteht."
Charles runzelte die Stirn. "Das ist Euer Bruder, Mylord."
"Das ist ein Dorn in meiner Seite," korrigierte Oliver. "Und Ihr werdet gut bezahlt werden, um ihn zu entfernen. Natürlich im Rahmen der Regeln des Ringkampfes. Ein tragischer Unfall, nicht wahr? Solche Dinge passieren."
Der Ringer zögerte. Er war ein brutaler Mann, aber nicht ohne ein gewisses Ehrgefühl. Einen Mann im fairen Kampf zu besiegen war eine Sache – aber Mord unter dem Deckmantel des Sports war etwas anderes.
Oliver schien seine Gedanken zu erraten. Er zog einen schweren Beutel aus seinem Wams und legte ihn auf den Tisch. Das Klirren der Münzen sprach eine deutliche Sprache.
"Hundert Goldkronen," sagte Oliver. "Und das Versprechen, dass der Herzog niemals erfahren wird, dass es mehr war als ein Unfall. Mein Bruder ist ein Niemand, Charles. Er wird nicht vermisst werden."
Charles' Blick wanderte zwischen dem Geldbeutel und dem Fenster hin und her, durch das man Orlando sehen konnte, wie er bei den Ställen verschwand. Schließlich griff er nach dem Beutel.
"Es wird getan werden, Mylord," sagte er.
Oliver lächelte. "Ich wusste, dass wir uns verstehen würden."
In jener Nacht konnte Orlando nicht schlafen. Er lag auf dem Stroh seines Verschlags und starrte durch die Ritzen in der Wand hinauf zu den Sternen. Irgendwo in der Ferne heulte ein Hund, und näher hörte er das ruhige Atmen der Pferde in ihren Boxen.
War er ein Narr, sich auf diese Herausforderung einzulassen? Wahrscheinlich. Aber was war die Alternative? Hier zu bleiben, Jahr um Jahr, während Oliver ihn demütigte und sein Geist langsam abstumpfte?
Nein. Besser, es beim Ringkampf zu wagen. Besser, mit einem letzten Funken Hoffnung zu kämpfen, als in dieser Hoffnungslosigkeit zu verkümmern.
Er dachte an seinen Vater, Sir Rowland de Boys. Ein guter Mann war er gewesen, wenn auch kein großer Lord. Er hatte an Ehre geglaubt, an Rechtschaffenheit, an die alte Ordnung der Dinge. Diese Werte hatte er seinen Söhnen weiterzugeben versucht.
Bei Oliver waren sie auf unfruchtbaren Boden gefallen. Aber Orlando... Orlando trug sie noch immer in sich, diese Ideale seines Vaters. Und morgen würde er für sie kämpfen, gegen einen Riesen von einem Mann, in der Hoffnung, dass Mut und Rechtschaffenheit mehr wögen als rohe Kraft.
Es war ein törichter Gedanke, das wusste er. Aber es war alles, was er hatte.
Draußen zog der Wind noch immer durch die Bäume, und die Blätter raschelten wie Geisterflüstern. Irgendwann, kurz vor der Morgendämmerung, glitt Orlando endlich in einen unruhigen Schlaf, in dem er von Ringkämpfen und roten Samtgewändern träumte, und von einem kalten Lächeln auf den Lippen seines Bruders.
Kapitel 2: Die verbannte Prinzessin
Am selben Morgen, an dem Orlando seine Entscheidung getroffen hatte, erwachte Rosalind in einer Kammer des herzoglichen Palastes mit einem Gefühl der Beklommenheit, das sie nicht abschütteln konnte. Durch die hohen Fenster fiel das frühe Licht herein und zeichnete goldene Muster auf die Wandteppiche, die Szenen aus alten Romanzen darstellten – Liebende in grünen Wäldern, Ritter auf edlen Rossen, Damen mit Blumenkränzen im Haar.
Ironische Bilder, dachte Rosalind, für jemanden in ihrer Lage.
Sie erhob sich von ihrem Lager und trat ans Fenster. Unten im Hof rüsteten Diener bereits für den heutigen Ringkampf. Tribünen wurden aufgebaut, Banner entrollt, und in der Küche würde man schon seit Stunden damit beschäftigt sein, das Festmahl vorzubereiten, das folgen würde. Herzog Frederick liebte solche Spektakel – sie gaben ihm Gelegenheit, seine Macht und seinen Reichtum zur Schau zu stellen.
"Du bist schon wach?" Die Tür hatte sich geöffnet, und Celia trat ein, noch im Nachthemd, das goldene Haar zerzaust vom Schlaf. Sie gähnte herzhaft und ließ sich auf Rosalinds Bett fallen. "Es ist kaum Tag."
"Ich konnte nicht schlafen," gestand Rosalind.
Celia musterte ihre Cousine mit besorgter Miene. Sie kannte diesen Ausdruck auf Rosalinds Gesicht – jene Mischung aus Melancholie und unterdrücktem Zorn, die manchmal über sie kam, wenn sie an ihre Situation dachte.
"Du denkst wieder an deinen Vater," stellte Celia fest. Es war keine Frage.
Rosalind nickte. Herzog Senior, ihr Vater, lebte seit einem Jahr im Exil. Vertrieben von seinem jüngeren Bruder Frederick, der sich die Herzogskrone durch Verrat und Gewalt angeeignet hatte. Ein Jahr, in dem Rosalind am Hof ihres Onkels hatte bleiben dürfen – aber nur, weil Celia, Fredericks Tochter, darauf bestanden hatte.
"Ich werde nicht ohne Rosalind bleiben," hatte Celia ihrem Vater erklärt, als dieser die Verbannung verkündet hatte. "Wenn sie geht, gehe ich mit ihr."
Das war Fredericks größte Schwäche – seine Liebe zu seiner einzigen Tochter. Für Celia würde er alles tun, und so hatte er nachgegeben. Rosalind durfte bleiben. Aber es war eine prekäre Existenz, ein Leben auf Messers Schneide. Jeden Tag konnte der Herzog seine Meinung ändern, und Rosalind wusste, dass es Höflinge gab, die ihm genau das ins Ohr flüsterten.
"Komm," sagte Celia und stand auf, entschlossen, die düstere Stimmung zu vertreiben. "Lass uns nicht an traurige Dinge denken. Heute ist der Ringkampf! Das wird unterhaltsam. Und vielleicht," fügte sie mit einem schelmischen Lächeln hinzu, "sehen wir dabei auch einen hübschen jungen Kavalier."
Trotz ihrer Melancholie musste Rosalind lächeln. "Du bist unverbesserlich."
"Ich bin praktisch," korrigierte Celia. "Wenn wir schon hier festsitzen und uns langweilen müssen, können wir wenigstens die Aussicht genießen." Sie klatschte in die Hände. "Komm, lass uns deine Zofe rufen. Du musst prächtig aussehen heute."
"Warum?"
"Weil es meinem Vater missfallen wird," antwortete Celia frank und frei. "Und alles, was ihm missfällt, ohne dass er es verhindern kann, erfreut mein rebellisches Herz."
Das war die Wahrheit, die zwischen ihnen bestand: Celia liebte ihren Vater, aber sie durchschaute ihn auch. Sie sah die Ungerechtigkeit in seinem Handeln, die Grausamkeit in seiner Herrschaft. Und in ihrer stillen, aber beharrlichen Weise rebellierte sie dagegen – indem sie an Rosalinds Seite blieb, indem sie ihre Cousine zu ihrer Vertrauten machte, ihrer Schwester in allem außer dem Namen.
Die beiden jungen Frauen könnten kaum unterschiedlicher aussehen. Rosalind war groß für ihr Geschlecht, mit dunklem Haar, das in sanften Wellen über ihre Schultern fiel, und Augen von einem tiefen Braun, in denen Intelligenz und Leidenschaft gleichermaßen brannten. Ihre Züge waren edel, aber nicht auf eine konventionelle Weise schön – es war mehr ein Gesicht von Charakter und Stärke.
Celia hingegen war klein und zierlich, mit Haar wie gesponnenes Gold und blauen Augen, in denen eine kindliche Unschuld lag, die über ihren scharfen Verstand hinwegtäuschte. Ihre Schönheit war von der Art, die Dichter besangen – weich, feminin, bezaubernd. Aber unter dieser zarten Oberfläche verbarg sich ein Wille von Stahl.
Sie waren, wie Rosalind einmal zu Celia gesagt hatte, wie Sonne und Mond – unterschiedlich in ihrer Art, aber einander ergänzend, und beide notwendig, um die Welt zu erhellen.
Während die Zofen sie für den Tag ankleideten – Rosalind in ein Gewand aus tiefem Smaragdgrün, das ihre Augen zum Leuchten brachte, Celia in zartes Himmelblau –, sprachen sie über belanglose Dinge. Die neue Ballade, die ein Troubadour am Hof sang. Das Gerücht, dass Lady Beatrice sich mit Lord Montfort vermählen würde. Der köstliche Apfelkuchen, den die Köchin gestern gebacken hatte.
Es war ihre Art, die Realität auf Abstand zu halten – durch Geplauder und Scherze eine Barriere zu errichten gegen die Unsicherheit, die über ihnen schwebte wie ein Damoklesschwert.
Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. "Herein," rief Celia.
Ein Page trat ein, verneigte sich tief. "Mylady, die Prinzessin," er wandte sich an Rosalind, "Seine Durchlaucht wünscht Euch vor Beginn des Ringkampfes zu sprechen."
Rosalind und Celia tauschten einen Blick. Das war ungewöhnlich. Herzog Frederick vermied es normalerweise, mit seiner Nichte zu sprechen, als könnte ihre bloße Anwesenheit ihn an sein Unrecht gegenüber seinem Bruder erinnern.
"Ich komme mit," sagte Celia sofort.
"Seine Durchlaucht wünscht Lady Rosalind allein zu sprechen," wagte der Page einzuwenden.
"Dann wird Seine Durchlaucht enttäuscht werden," erwiderte Celia mit einer Süße in der Stimme, die gefährlicher war als jeder Zorn. "Sag meinem Vater, dass ich dabei sein werde. Er mag es mögen oder nicht."
Der Page schluckte, verneigte sich erneut und eilte davon. Rosalind legte ihrer Cousine die Hand auf den Arm. "Celia, du musst nicht—"
"Natürlich muss ich," unterbrach Celia sie. "Du bist meine Schwester, Rosalind. In allem außer dem Blut. Und ich lasse nicht zu, dass mein Vater dich einschüchtert."
Herzog Frederick erwartete sie in seinem Audienzsaal, einem prächtigen Raum mit hohen Gewölbedecken und Wänden, die mit erbeuteten Waffen und Rüstungen geschmückt waren – Trophäen seiner militärischen Erfolge. Er stand am Fenster, den Rücken ihnen zugewandt, eine imposante Gestalt in schwarzem Samt mit silbernen Verschnürungen.
"Vater," sagte Celia, als sie eintraten.
Der Herzog wandte sich um. Er war ein Mann in den besten Jahren, mit einem Gesicht, das einst schön gewesen sein mochte, nun aber von Härte und Misstrauen gezeichnet war. Seine Augen – so blau wie die seiner Tochter – waren kalt wie Wintereis, wenn sie auf Rosalind ruhten.
"Ich wünschte dich allein zu sprechen, Celia," sagte er.
"Und ich wünsche, bei Rosalind zu bleiben," erwiderte sie ruhig.
Vater und Tochter maßen einander mit Blicken. Schließlich seufzte Frederick. "Du bist eigensinnig. Das hast du von deiner Mutter."
"Ich nehme das als Kompliment."
Ein Anflug von etwas, das fast wie Zuneigung aussah, huschte über das Gesicht des Herzogs. Aber als er sich wieder Rosalind zuwandte, war es verschwunden. "Ich werde kurz sein," sagte er. "Es sind Gerüchte zu meinen Ohren gedrungen. Gerüchte, dass gewisse Höflinge... Sympathien für deinen Vater hegen."
Rosalind hielt seinem Blick stand. "Mein Vater war ein guter Herzog. Es überrascht nicht, dass Menschen ihn vermissen."
"War," betonte Frederick. "Er war ein Herzog. Nun ist er ein Niemand, ein Verbannter, der in den Wäldern haust wie ein gemeiner Räuber."
Die Worte trafen wie Peitschenhiebe, aber Rosalind ließ sich nichts anmerken. Sie hatte gelernt, ihr Gesicht zu einer Maske zu machen, ihre Gefühle tief zu vergraben. Es war eine Fähigkeit, die jeder am Hof von Herzog Frederick lernen musste – oder unterging.
"Warum erzählt Ihr mir das, Onkel?" fragte sie höflich.
"Weil diese Gerüchte sich um dich ranken," antwortete Frederick scharf. "Es wird gemunkelt, dass du Botschaften zu deinem Vater schickst. Dass du eine Verschwörung webst, mich zu stürzen."
"Das ist lächerlich!" platzte Celia heraus.
"Ist es das?" Frederick wandte sich seiner Tochter zu. "Sie ist seines Blutes, Celia. Denkst du nicht, dass sie Rache für ihn sucht?"
"Rosalind hat nichts getan als hier zu bleiben und eine treue Gefährtin zu sein," verteidigte Celia ihre Cousine. "Diese Gerüchte werden von neidischen Höflingen gestreut, die eine Gelegenheit suchen, sich bei dir einzuschmeicheln."
Herzog Frederick schwieg einen Moment. Dann sagte er, langsam und bedächtig: "Vielleicht. Aber ich bin ein vorsichtiger Mann geworden, Celia. Vorsicht hat mich an die Macht gebracht, und Vorsicht wird mich dort halten." Er fixierte Rosalind erneut. "Ich behalte dich im Auge, Nichte. Ein falscher Schritt, ein einziger Anlass zum Misstrauen, und du wirst dich deinem Vater im Exil anschließen. Verstehen wir uns?"
"Vollkommen," antwortete Rosalind, ihre Stimme ruhig trotz des Zorns, der in ihr brodelte.
"Gut." Frederick wandte sich ab, das Gespräch offenbar beendet. Dann, als sie bereits zur Tür gingen, rief er: "Rosalind?"
Sie drehte sich um. "Ja, Mylord?"
"Dein Vater war nicht nur ein guter Herzog. Er war auch ein Narr." Der Herzog lächelte, ein Lächeln ohne Wärme. "Güte wird als Schwäche ausgelegt in dieser Welt. Er hätte das wissen sollen."
Rosalind erwiderte nichts. Was gab es auch zu sagen? Sie verneigte sich knapp und verließ den Raum, Celia dicht an ihrer Seite.
Erst als sie außer Hörweite waren, im Gewimmel eines Korridors voller Höflinge und Diener, gestattete Rosalind sich, die Maske fallen zu lassen. Celia sah die Tränen in ihren Augen und zog sie in eine Nische.
"Er ist ein Monster," flüsterte Rosalind, die Stimme gepresst vor unterdrücktem Schluchzen.
"Er ist mein Vater," sagte Celia leise. "Und ja, manchmal ist er auch ein Monster." Sie umarmte ihre Cousine fest. "Aber solange ich hier bin, wird er dir nichts tun. Das schwöre ich."
Rosalind klammerte sich an Celia, diese kleine, zierliche Frau, die mehr Mut besaß als ganze Heere. "Was würde ich ohne dich tun?"
"Das wirst du nie herausfinden müssen," versprach Celia. "Wir sind Schwestern, Rosalind. Und Schwestern lassen einander nicht im Stich."
Der Ringkampfplatz war ein Meer aus Farben und Stimmen. Tribünen waren auf drei Seiten des Platzes errichtet worden, geschmückt mit Bannern in den Farben des Herzogs – schwarz und silber. Auf der höchsten Tribüne saß Frederick selbst, umgeben von seinen Höflingen, ein prächtiger Baldachin über ihm, der Schatten spendete.
Rosalind und Celia fanden ihre Plätze in der Nähe des Herzogs – Celia auf seiner Rechten, wie es sich für seine Tochter gehörte, Rosalind eine Reihe tiefer, zwischen anderen Hofdamen. Es war eine subtile Herabsetzung, aber Rosalind war es gewohnt.
Um sie herum wogte die Menge. Kaufleute in ihren besten Gewändern, hoffend auf einen Blick des Herzogs. Bauern, die sich ans hintere Ende der freien Sitzplätze gequetscht hatten. Ritter und Edelleute, die Wetten auf den Ausgang der Kämpfe abschlossen. Damen, die hinter ihren Fächern kicherten und die männlichen Gäste musterten.
Ein Fanfarenstoß ertönte. Stille legte sich über die Menge wie ein Tuch. Alle Augen wandten sich dem Herzog zu.
Frederick erhob sich von seinem Sitz. "Gute Leute," seine Stimme trug weit über den Platz, "willkommen zu diesem Schauspiel der Stärke und des Mutes! Heute werden wir sehen, welcher Mann sich würdig erweist, den Titel des Champions zu tragen!"
Jubel brandete auf. Frederick lächelte – es war das Lächeln eines Mannes, der es liebte, bewundert zu werden, der in der Akklamation der Massen badete wie andere in warmem Wasser.
"Unser Champion," fuhr er fort, "ist euch allen bekannt. Charles der Unbesiegbare! Der Mann, der noch keinen Kampf verloren hat!"