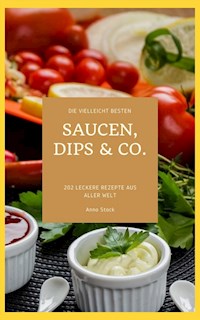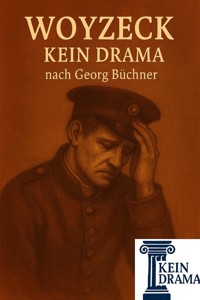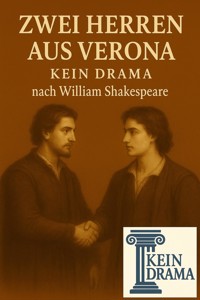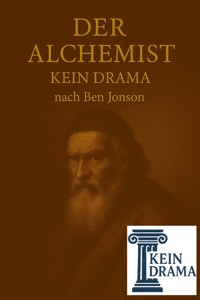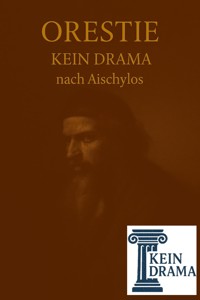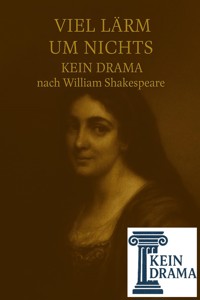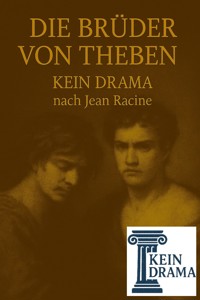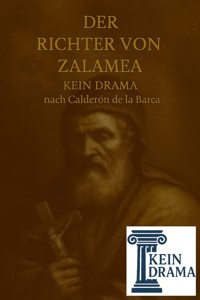6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Rom – ein Reich im Umbruch, ein Kaiser zwischen Genie und Wahnsinn. Nero herrscht über das größte Imperium der Welt, doch seine Macht steht auf wackelndem Fundament. Sein Halbbruder Britannicus, rechtmäßiger Thronerbe, wird zur Bedrohung – politisch wie persönlich. Zwischen Intrigen, Leidenschaft und tödlichem Ehrgeiz entfaltet sich ein Machtspiel, das in Blut enden muss. In dieser modernen Romanadaption des Klassikers von Jean Racine werden die historischen Figuren lebendig: Menschen zwischen Loyalität und Verrat, zwischen Liebe und Manipulation. Ein zeitloses Drama über Macht, Moral und den Preis des Ruhms – erzählt in einer Sprache von heute, mit der Wucht antiker Tragödien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Britannicus - Kein Drama nach Jean Racine
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
Britannicus – Ein Roman nach Jean Racine
Kapitel 1: Der junge Kaiser
Kapitel 2: Agrippinas Ehrgeiz
Kapitel 3: Der rechtmäßige Erbe
Kapitel 4: Liebe im Verborgenen
Kapitel 5: Burrus' Besorgnis
Kapitel 6: Die Entführung
Kapitel 7: Neros Begehren
Kapitel 8: Agrippinas Warnung
Kapitel 9: Britannicus' Verzweiflung
Kapitel 10: Narcissus' Intrigen
Kapitel 11: Die Konfrontation
Kapitel 12: Junies Dilemma
Kapitel 13: Der falsche Frieden
Kapitel 14: Das vergiftete Mahl
Kapitel 15: Neros erste Träne
EPILOG: Der Tyran erwacht
Impressum neobooks
Table of Contents
Britannicus – Ein Roman nach Jean Racine
Anno Stock
PROLOG: Rom, im Jahr 55 nach Christus
Die ersten Strahlen der Morgensonne tauchten den Palatin in ein blutiges Rot. Über den sieben Hügeln Roms lag noch die Kühle der Nacht, doch in den Gängen des kaiserlichen Palastes regte sich bereits das Leben. Sklaven huschten durch die Korridore, Wachen wechselten ihre Posten, und in den Küchen wurden die Feuer geschürt.
Doch die Geschäftigkeit dieser frühen Stunde konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass über dem Machtzentrum des römischen Imperiums eine unsichtbare Spannung lag – dicht wie der Rauch der Opferfeuer, schwer wie das Gold in den kaiserlichen Schatzkammern.
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, siebzehnter Kaiser Roms, war erst siebzehn Jahre alt. Drei Monate waren vergangen, seit er den Purpur übernommen hatte, drei Monate, in denen Rom aufmerksam jeden seiner Schritte beobachtet hatte. Der junge Herrscher hatte sich zunächst als mild und großzügig erwiesen, hatte dem Senat Respekt gezollt und versprochen, die Willkürherrschaft seines Vorgängers zu beenden.
Viele hofften. Einige glaubten. Die Weisen aber erinnerten sich an die Geschichte Roms und wussten: Macht verändert jeden, der sie berührt. Und absolute Macht? Sie verschlingt die Seele.
An diesem Morgen, während die Stadt unter ihm erwachte, stand Nero am Fenster seiner Gemächer und blickte hinaus auf das Forum Romanum. In seinen dunklen Augen spiegelte sich etwas, das noch keinen Namen trug, aber bereits Gestalt annahm – ein Hunger, der nicht nach Brot verlangte, eine Sehnsucht, die kein Lied stillen konnte.
Hinter den vergoldeten Türen des Palastes bewegten sich die Figuren eines tödlichen Spiels bereits auf ihren Positionen: Agrippina, die mächtige Mutter, die ihren Sohn auf den Thron gebracht hatte und nun die Früchte ihrer Intrigen ernten wollte. Britannicus, der rechtmäßige Erbe des Claudius, den das Schicksal um seine Krone betrogen hatte. Junie, die junge Prinzessin, deren Schönheit gefährlicher war als jedes Schwert. Und die Berater, die Vertrauten, die Diener – jeder mit seinen eigenen Plänen, seinen eigenen Träumen, seiner eigenen Vorstellung davon, wie die Zukunft Roms aussehen sollte.
Was in den kommenden Tagen geschehen würde, sollte den Verlauf der Geschichte verändern. Es würde den wahren Charakter eines Kaisers enthüllen und das Schicksal eines Imperiums besiegeln.
Rom hatte schon viele Kaiser gesehen – Tyrannen und Weise, Krieger und Diplomaten. Doch was es noch nicht erlebt hatte, war Nero. Nicht den milden Jüngling, der gerade seine Herrschaft begonnen hatte, sondern den Mann, zu dem er werden würde.
Die Sonne stieg höher über der ewigen Stadt. Ein neuer Tag begann.
Und mit ihm eine Tragödie, die niemand aufhalten konnte.
TEIL I: Die Schatten der Macht
Kapitel 1: Der junge Kaiser
Die Geschäfte des Imperiums begannen früh. Noch bevor die meisten Bewohner Roms ihre Augen öffneten, versammelten sich bereits die Berater des Kaisers in den Audienzsälen des Palatins. Seneca, der Philosoph und Erzieher Neros, war stets der Erste. Seine hagere Gestalt, in eine schlichte Toga gehüllt, wirkte wie ein Mahnmal der alten republikanischen Tugenden inmitten des imperialen Prunks.
An diesem Morgen erwartete er seinen kaiserlichen Schüler mit einer Mischung aus Hoffnung und Besorgnis. Drei Monate waren vergangen, seit Claudius unter mysteriösen Umständen gestorben war – die einen sprachen von vergifteten Pilzen, andere tuschelten von Agrippinas Gift. Seneca selbst hatte gelernt, über solche Dinge zu schweigen. In Rom überlebte man länger, wenn man die richtigen Fragen nicht stellte.
Die Tür öffnete sich, und Nero trat ein.
Mit seinen siebzehn Jahren besaß der junge Kaiser eine Präsenz, die Menschen unwillkürlich innehalten ließ. Er war nicht groß, aber seine Haltung verlieh ihm Würde. Sein Gesicht mit den weichen, fast femininen Zügen würde in späteren Jahren an Härte gewinnen, doch jetzt war es das Antlitz eines Jünglings, der zwischen Kindheit und Mannesalter schwankte. Die lockigen Haare trug er nach griechischer Mode, und in seinen Augen lag ein Ausdruck, den Seneca nur schwer deuten konnte – war es Neugier oder Langeweile, Ehrgeiz oder Gleichgültigkeit?
„Guten Morgen, verehrter Lehrer", sagte Nero, und seine Stimme klang melodisch, fast zu schön für einen Kaiser. „Welche Weisheiten der Stoa hast du heute für mich vorbereitet? Oder sollen wir über die langweiligen Angelegenheiten des Senats sprechen?"
Seneca verneigte sich knapp. „Majestät, die Angelegenheiten des Reiches mögen manchem langweilig erscheinen, aber sie sind das Fundament deiner Herrschaft. Ein weiser Herrscher vernachlässigt sie nicht."
Ein Lächeln huschte über Neros Gesicht – amüsiert, aber auch eine Spur spöttisch. „Natürlich, natürlich. Aber sage mir ehrlich, Seneca – hat Marcus Aurelius oder Augustus jemals einen Großteil seines Tages damit verbracht, Petitionen über Wasserrechte zu lesen?"
„Sie haben sich mit dem beschäftigt, was nötig war", erwiderte Seneca ruhig. „Und sie haben gelernt, zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen zu unterscheiden. Das ist die Kunst des Regierens."
Nero trat ans Fenster, die gleiche Stelle, an der er schon bei Sonnenaufgang gestanden hatte. Von hier aus konnte er das pulsierende Leben der Stadt überblicken – die Tempel auf dem Capitol, die Basiliken des Forums, die gewundenen Straßen, in denen sich bereits Händler und Bettler, Senatoren und Soldaten drängten.
„Manchmal frage ich mich", sagte er leise, mehr zu sich selbst als zu Seneca, „ob sie da unten wissen, wie es ist, hier oben zu stehen. Ob sie verstehen, dass jede meiner Entscheidungen Tausende betrifft, aber niemand mich fragt, was ich eigentlich will."
Seneca trat näher, seine Stimme wurde sanfter. „Das ist die Last der Macht, mein Schüler. Du bist nicht mehr nur Nero, der junge Mann mit Träumen und Wünschen. Du bist Caesar, und Caesar gehört Rom."
„Oder Rom gehört Caesar", murmelte Nero.
Bevor Seneca darauf antworten konnte, öffnete sich erneut die Tür. Sextus Afranius Burrus trat ein, der Präfekt der Prätorianergarde. Im Gegensatz zu Senecas philosophischer Zurückhaltung verkörperte Burrus die militärische Direktheit. Seine vernarbte Stirn und die stählerne Hand, die seine im Kampf verstümmelte Rechte ersetzte, erzählten von einem Leben im Dienst Roms.
„Majestät", seine Stimme war rau wie Kies, „die Morgenmeldungen der Garde. Alles ruhig in der Stadt. Keine Zwischenfälle."
Nero drehte sich um, und sein Gesicht hellte sich auf. Mit Burrus verstand er sich besser als mit Seneca – der Soldat verlangte nicht nach philosophischen Diskussionen, sondern bot klare Antworten auf klare Fragen.
„Gut, gut. Und wie steht es mit der Loyalität der Truppen? Gibt es Gerüchte?"
Burrus' Miene blieb unbewegt. „Die Prätorianer sind dir ergeben, Majestät. Du hast ihnen großzügig Donative gezahlt, und sie erinnern sich daran. Was die Legionen in den Provinzen angeht – bisher keine Anzeichen von Unruhe."
„Bisher", wiederholte Nero und kostete das Wort aus. „Ein interessantes Wort. Es impliziert, dass sich das ändern könnte."
„Alles kann sich ändern", sagte Burrus nüchtern. „Aber ein Kaiser, der seine Soldaten gut behandelt und das Reich in Frieden hält, hat wenig zu befürchten."
Seneca räusperte sich. „Wenn wir nun zu den heutigen Angelegenheiten kommen könnten? Der Senat erwartet eine Antwort bezüglich der Getreideversorgung aus Ägypten, und mehrere Provinzstatthalter haben um Audienz gebeten."
Nero seufzte theatralisch und ließ sich auf seinem Stuhl nieder – nicht auf dem prächtigen Thron, der für offizielle Empfänge reserviert war, sondern auf einem gepolsterten Sessel, der eher an ein griechisches Symposium erinnerte als an ein römisches Machtzentrum.
„Ägypten", sagte er. „Immer wieder Ägypten. Manchmal denke ich, Rom ist von diesem Land abhängiger als ein Säugling von seiner Amme. Können wir nicht einfach mehr Getreide aus Sizilien oder Africa beziehen?"
„Majestät, die Bevölkerung Roms ist auf über eine Million Menschen angewachsen", erklärte Seneca geduldig. „Ägypten liefert mehr als die Hälfte des Getreides, das wir benötigen. Ohne die ägyptischen Kornschiffe würde die Stadt innerhalb von Wochen verhungern."
„Und ein hungriges Rom ist ein gefährliches Rom", fügte Burrus hinzu. „Ich habe Aufstände gesehen, die mit leerem Mägen begannen."
Nero nickte, aber seine Gedanken schienen bereits abzuschweifen. Er spielte mit einem goldenen Stylus, drehte ihn zwischen den Fingern, betrachtete, wie das Licht auf dem Metall tanzte.
„Wir sollten mehr Theater bauen", sagte er plötzlich. „Mehr Veranstaltungen für das Volk. Nicht nur die ewigen Gladiatorenkämpfe, sondern wahre Kunst – griechische Tragödien, Musikwettbewerbe, Poesie."
Seneca und Burrus wechselten einen Blick. Es war ein Thema, das Nero in letzter Zeit oft ansprach, und beide wussten, dass dahinter mehr steckte als bloße Kulturliebe.
„Das ist eine edle Absicht", sagte Seneca vorsichtig. „Aber vielleicht sollten wir zunächst die dringenden Staatsgeschäfte..."
„Die dringenden Staatsgeschäfte", unterbrach Nero ihn, und zum ersten Mal schwang Ungeduld in seiner Stimme mit, „sind doch nur Routine. Ihr beide könntet die meisten dieser Entscheidungen auch ohne mich treffen. Aber Kunst, Kultur – das ist es, woran die Menschen sich erinnern werden. Glaubst du, irgendjemand erinnert sich an Augustus' Getreideimporte? Nein! Sie erinnern sich an die Tempel, die er baute, an die Dichter, die er förderte, an das Goldene Zeitalter, das er schuf."
„Augustus war zunächst ein geschickter Staatsmann", gab Seneca zu bedenken. „Die Künste kamen später."
Nero stand abrupt auf und begann im Raum auf und ab zu gehen. „Ich bin nicht Augustus. Ich bin auch nicht Claudius oder Tiberius. Warum versucht ihr ständig, mich in ihre Formen zu pressen?"
Die Anspannung im Raum war mit Händen zu greifen. Burrus legte die Hand an sein Schwert – eine unbewusste Geste, die Nero nicht entging.
„Beruhige dich, Burrus", sagte der Kaiser, und plötzlich war das Lächeln wieder da, charmant und entwaffnend. „Ich bin nicht verrückt. Noch nicht jedenfalls." Er lachte, ein melodisches Geräusch, das die Spannung auflöste wie Sonnenlicht Morgennebel. „Verzeiht mir. Ich bin... ungeduldig. Ihr habt recht, natürlich. Erst die Staatsgeschäfte, dann die Träume."
Er kehrte zu seinem Sessel zurück, und für die nächste Stunde besprachen sie die Angelegenheiten des Reiches – Grenzstreitigkeiten in Britannia, Steuereinnahmen aus Asia, die Ernennung neuer Magistrate. Nero hörte zu, stellte gelegentlich Fragen, nickte seine Zustimmung zu den meisten Vorschlägen. Er war höflich, aufmerksam, kompetent.
Doch Seneca, der ihn seit seiner Kindheit kannte, sah die Anzeichen, die andere übersehen hätten. Die Finger, die ungeduldig auf der Armlehne trommelten. Die Blicke, die immer wieder zum Fenster wanderten. Die kaum merklichen Seufzer, wenn ein besonders langweiliges Thema zur Sprache kam.
Als die Besprechung endlich vorbei war und Burrus sich verabschiedet hatte, hielt Seneca Nero noch einen Moment zurück.
„Majestät", sagte er, „darf ich dir einen Rat geben? Von Herzen, als dein alter Lehrer?"
Nero sah ihn an, und für einen Moment fiel die kaiserliche Maske. „Du hast mich immer beraten, Seneca. Warum fragst du jetzt um Erlaubnis?"
„Weil du jetzt Kaiser bist, und Kaiser hören nicht immer gern, was sie hören sollten." Seneca trat näher. „Du bist jung, Nero. Du hast das Glück, in einer Zeit der Stabilität zu herrschen. Das Reich ist stark, die Grenzen sind sicher, die Staatskassen sind voll. Nutze diese Zeit, um zu lernen, um dich zu festigen. Die Geschichte wird dich nicht nach deinen ersten Monaten beurteilen, sondern nach dem, was du aus deiner gesamten Herrschaft machst."
„Und was, wenn ich nicht lernen will?" Neros Stimme war leise, fast kindlich. „Was, wenn ich einfach nur... leben will? Kunst schaffen, Musik machen, frei sein?"
„Dann hättest du nicht Kaiser werden sollen", sagte Seneca, und der Ernst in seiner Stimme ließ keinen Zweifel zu. „Aber du bist es. Und nun musst du entscheiden, was für ein Kaiser du sein willst."
Nero starrte ihn lange an. „Meine Mutter sagt, ich solle ein großer Kaiser werden. Wie Augustus. Wie Julius Caesar."
„Und was sagst du?"
„Ich weiß es nicht." Die Ehrlichkeit in diesen Worten war erschütternd. „Ich weiß nur, dass ich mehr will, als in diesem goldenen Käfig zu sitzen und Dokumente zu unterschreiben."
Bevor Seneca antworten konnte, ertönte draußen ein Gong – das Signal, dass die nächsten Besucher warteten. Nero richtete sich auf, und die kaiserliche Maske kehrte zurück.
„Ich sollte meine Mutter nicht warten lassen", sagte er mit einem Lächeln, das nicht seine Augen erreichte. „Sie hat so wenig Geduld."
Seneca verneigte sich und verließ den Raum. Als er durch die Korridore ging, konnte er nicht umhin, sich zu fragen, was aus dem begabten Jungen geworden war, den er einst unterrichtet hatte. Nero besaß Intelligenz, Charme, künstlerisches Talent – alles Eigenschaften, die einen großen Menschen ausmachen konnten. Aber würden sie auch einen großen Kaiser ausmachen?
Die Tür zu Agrippinas Gemächern stand bereits offen.
Julia Agrippina, Tochter des Germanicus, Urenkelin des Augustus, Schwester eines Kaisers, Ehefrau eines anderen und Mutter des dritten, war eine Frau, die es gewohnt war, ihren Willen durchzusetzen. Mit fünfunddreißig Jahren besaß sie eine Schönheit, die durch Intelligenz und Ehrgeiz nur noch gefährlicher wurde. Ihre Augen waren dunkel und durchdringend, ihr Lächeln konnte Männer bezaubern oder vernichten, je nachdem, was sie wollte.
Als Nero eintrat, erhob sie sich nicht. Sie saß auf einem prächtigen Stuhl – fast einem Thron – umgeben von Sklavinnen, die sie frisierte und schmückten. Es war eine subtile Demonstration der Macht: Der Kaiser kam zu ihr, nicht umgekehrt.
„Mein Sohn", sagte sie, und ihre Stimme war Honig und Gift zugleich. „Wie war deine Besprechung mit den alten Männern?"
„Aufschlussreich wie immer, Mutter." Nero küsste sie pflichtschuldig auf die Wange und ließ sich auf einem gegenüberliegenden Stuhl nieder. „Seneca predigt Weisheit, Burrus predigt Vorsicht, und ich nicke und tue, was von mir erwartet wird."
Agrippina musterte ihn scharf. „Langweilt es dich?"
„Sollte es das nicht?"
„Macht langweilt nur die Schwachen", sagte sie. „Die Starken wissen sie zu nutzen." Sie entließ die Sklavinnen mit einer Handbewegung, und als sie allein waren, beugte sie sich vor. „Erzähl mir, was denkst du wirklich?"
Nero zögerte. Seine Mutter war die einzige Person, vor der er sich nicht völlig sicher fühlte. Sie hatte ihn auf den Thron gebracht – durch Intrigen, Manipulation und möglicherweise Mord. Was sie gegeben hatte, konnte sie theoretisch auch wieder nehmen.
„Ich denke", sagte er langsam, „dass ich Kaiser bin, aber nicht herrschen darf. Jede meiner Entscheidungen wird von Seneca überprüft, jede militärische Frage von Burrus kontrolliert, und du..." er hielt inne.
„Und ich?", ermunterte ihn Agrippina.
„Du wachst über alles."
Sie lächelte, zufrieden. „Jemand muss es tun. Du bist jung, unerfahren. In ein paar Jahren, wenn du gelernt hast..."
„In ein paar Jahren", unterbrach Nero sie, „werde ich immer noch jung und unerfahren sein, weil niemand mir erlaubt, Erfahrungen zu sammeln."
Die Atmosphäre im Raum veränderte sich. Agrippinas Lächeln gefror.
„Sei vorsichtig mit solchen Gedanken, mein Sohn. Viele junge Kaiser haben gedacht, sie bräuchten keine Berater mehr, und sie endeten schlecht."
„Wie Claudius?", fragte Nero, und die Frage hing schwer zwischen ihnen.
Agrippina erhob sich, trat ans Fenster. „Claudius war alt und krank. Sein Tod war eine Gnade für Rom."
„Und für dich."
„Und für dich", korrigierte sie scharf. „Vergiss nie, wem du deinen Thron verdankst."
Nero stand ebenfalls auf, und zum ersten Mal seit langem standen Mutter und Sohn sich als Gleiche gegenüber. „Ich vergesse nichts, Mutter. Aber ich frage mich manchmal, ob du auch nichts vergisst – zum Beispiel, dass nicht mehr du Augusta bist, sondern ich Augustus."
Die Stille, die folgte, war eisig. Dann, unerwartet, lachte Agrippina – ein langes, musikalisches Lachen.
„Oh, mein Sohn. Du hast tatsächlich Feuer in dir. Gut. Das wird dir nützen." Sie strich ihm über die Wange, eine Geste, die gleichzeitig liebevoll und herablassend war. „Aber lerne, dein Feuer zu kontrollieren. Ein Kaiser, der zu impulsiv ist, macht Fehler. Und Fehler können tödlich sein."
„Ich werde es mir merken", sagte Nero steif.
„Tu das." Sie kehrte zu ihrem Stuhl zurück. „Jetzt zu wichtigeren Dingen. Heute Abend gibt es ein Bankett. Wichtige Senatoren werden anwesend sein. Du musst charmant sein, aufmerksam, großzügig. Zeig ihnen den gütigen Kaiser, den sie sehen wollen."
„Und was bin ich wirklich?"
Agrippina sah ihn lange an. „Das, mein Sohn, musst du noch herausfinden."
Nach dem Gespräch mit seiner Mutter zog sich Nero in seine privaten Gemächer zurück. Hier, fern von den Augen des Hofes, konnte er er selbst sein – oder zumindest versuchen herauszufinden, wer das war.
Er griff nach seiner Lyra, einem exquisiten Instrument aus Schildpatt und Gold, und begann zu spielen. Die Melodie, die er improvisierte, war melancholisch und sehnsüchtig, ein Klagelied für eine Freiheit, die er nie besessen hatte.
Wenn Nero spielte, veränderte er sich. Die Maske des Kaisers fiel ab, die Anspannung wich aus seinem Gesicht, und für einen Moment war er nur ein junger Mann mit einem Instrument und einem Traum.
Er hatte Talent, das wusste er. Seine Lehrer hatten es bestätigt, auch wenn sie gleichzeitig darauf bestanden hatten, dass ein römischer Kaiser sich nicht öffentlich als Künstler präsentieren sollte. Aber warum nicht? Die griechischen Herrscher hatten es getan. Alexander der Große hatte Homer geliebt, hatte Dichter zu seinen Feldzügen mitgenommen. Warum sollte er, Nero, sich für seine Liebe zur Kunst schämen?
Ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Gedanken. „Herein", rief er, ohne aufzuhören zu spielen.
Acté trat ein, seine Geliebte. Sie war eine Freigelassene, keine adlige Römerin, und gerade das machte ihre Beziehung so besonders. Mit ihr musste Nero nicht Kaiser sein. Mit ihr konnte er einfach nur Nero sein.
„Ich hörte dich spielen", sagte sie leise und schloss die Tür hinter sich. „Es klang traurig."
„Ich bin traurig", gab er zu und legte die Lyra beiseite. „Oder frustriert. Oder beides."
Acté setzte sich neben ihn, nahm seine Hand. „Deine Mutter wieder?"
„Meine Mutter. Seneca. Burrus. Das ganze verdammte Imperium." Er seufzte. „Manchmal wünschte ich, ich wäre nie Kaiser geworden. Manchmal träume ich davon, einfach zu verschwinden – nach Griechenland vielleicht, wo die Kunst geschätzt wird und Musik keine Schande ist."
„Aber das kannst du nicht", sagte Acté sanft. „Du bist Caesar."
„Ich weiß." Nero stand auf und trat ans Fenster – die gleiche Stelle, an der dieser lange Tag begonnen hatte. Die Sonne stand nun hoch am Himmel, und Rom pulsierte vor Leben. „Aber manchmal frage ich mich, ob Caesar sein und glücklich sein nicht Widersprüche sind."
Acté trat zu ihm, legte ihren Kopf an seine Schulter. „Vielleicht musst du einen Weg finden, beides zu sein."
„Vielleicht", murmelte Nero. Aber in seinem Herzen wusste er, dass die Wahl bereits getroffen war – nicht von ihm, sondern von anderen, von der Geschichte, vom Schicksal. Er war Kaiser, und ein Kaiser konnte nicht einfach verschwinden, konnte nicht einfach sein, was er wollte.
Die Frage war nur: Wie lange würde er sich damit abfinden?
Als der Abend kam und Nero sich für das Bankett vorbereitete, betrachtete er sein Spiegelbild. Der junge Mann, der ihm entgegenblickte, trug die Insignien der Macht – den purpurnen Mantel, den goldenen Lorbeerkranz, die kostbaren Ringe. Er sah aus wie ein Kaiser.
Aber war er es auch?
Diese Frage, wusste Nero, würde Zeit brauchen, um beantwortet zu werden. Vielleicht Jahre. Vielleicht sein ganzes Leben.
Und während Rom schlief und träumte, träumte auch sein junger Kaiser – von Ruhm und Kunst, von Macht und Freiheit, von einem Leben, das mehr sein könnte als nur Pflicht.
Doch Träume, das sollte Nero bald lernen, hatten in Rom einen hohen Preis.
Kapitel 2: Agrippinas Ehrgeiz
Das Bankett an diesem Abend war eine sorgfältig choreographierte Demonstration kaiserlicher Großzügigkeit. Im größten Speisesaal des Palastes, dessen Wände mit Fresken aus dem Leben der Götter geschmückt waren, hatten sich die mächtigsten Männer Roms versammelt. Senatoren in ihren weißen Togen, Militärkommandeure in prächtigen Uniformen, Priester und Magistrate – alle gekommen, um den jungen Kaiser zu ehren und gleichzeitig ihre eigenen Interessen zu verfolgen.
Nero thronte auf seinem Platz, lächelte, scherzte, trank – und langweilte sich zu Tode. Neben ihm saß Agrippina, nicht auf einem niedrigeren Platz, wie es sich für eine Kaisermutter gehört hätte, sondern auf einem Stuhl, der dem seinen in Größe und Pracht fast gleichkam. Es war eine subtile, aber deutliche Botschaft: Der Kaiser herrschte nicht allein.
Die Gäste bemerkten es natürlich. Einige tuschelten hinter vorgehaltener Hand, andere nickten anerkennend. Agrippina war eine Macht, mit der man rechnen musste, das wusste jeder in Rom.
Sie selbst genoss jeden Moment.
„Konsul Piso", rief sie einem der älteren Senatoren zu, der mehrere Plätze entfernt lag, „wie geht es deiner charmanten Ehefrau? Ich habe gehört, sie ist wieder schwanger. Ihr drittes Kind, nicht wahr?"
Piso, ein korpulenter Mann mit gerötetem Gesicht, neigte sein Haupt. „Augusta, deine Anteilnahme ehrt uns. Ja, die Götter waren gnädig."
„Die Götter", wiederholte Agrippina mit einem Lächeln, „sind immer gnädig zu denen, die ihnen dienen. Und du dienst Rom treu, nicht wahr?"
„Mit jedem Atemzug, Augusta."
„Das freut mich zu hören." Ihr Blick wanderte über die Versammelten, registrierte jede Geste, jedes Flüstern, jede Nuance der Körpersprache. Sie war eine Meisterin darin, die unausgesprochenen Gedanken der Menschen zu lesen, ihre Ängste zu erkennen, ihre Wünsche zu erahnen.
Nero beobachtete sie aus dem Augenwinkel. Seine Mutter war in ihrem Element – eine Spinne im Zentrum ihres Netzes, jeder Faden unter Kontrolle. Er fragte sich, nicht zum ersten Mal, ob sie ihn auch als einen solchen Faden betrachtete.
„Majestät", wandte sich Senator Thrasea Paetus an Nero, ein Mann, der für seine stoische Philosophie und seine republikanischen Ansichten bekannt war, „darf ich deine Meinung zur Frage der Provinzsteuern hören? Es gibt Beschwerden aus Gallia, dass die Last zu schwer geworden sei."
Nero öffnete den Mund, um zu antworten, doch Agrippina war schneller.
„Die Provinzen klagen immer", sagte sie mit einem nachsichtigen Lächeln. „Es ist ihre Natur. Aber sie vergessen, was Rom ihnen gibt – Frieden, Ordnung, Zivilisation. Ein kleiner Preis für so große Geschenke, findest du nicht?"
Thrasea neigte höflich den Kopf, aber in seinen Augen lag etwas, das Nero als Missbilligung deutete. „Zweifellos, Augusta. Aber vielleicht wäre es weise, gelegentlich..."
„Mein Sohn und ich werden die Angelegenheit prüfen", unterbrach ihn Agrippina sanft, aber bestimmt. „Rom ist großzügig, aber auch gerecht. Wenn die Beschwerden begründet sind, werden wir handeln."
Nero sagte nichts. Er hatte gelernt, dass Widerspruch bei solchen Gelegenheiten nur Spannungen erzeugte, die später in privaten Auseinandersetzungen ausgetragen werden mussten. Also trank er seinen Wein und spielte seine Rolle – der junge, nachsichtige Kaiser, klug beraten von seiner erfahrenen Mutter.
Aber unter der Oberfläche brodelte etwas, das mit jedem Tag stärker wurde.
Nach dem Bankett, als die Gäste sich zurückgezogen hatten und nur noch die engsten Vertrauten blieben, zog Agrippina sich in ihre Privatgemächer zurück. Hier, in diesen prachtvollen Räumen, die einst Livia gehört hatten, der Frau des Augustus, führte sie ihre wahren Geschäfte.
Pallas wartete bereits auf sie. Der griechische Freigelassene war einer der reichsten und mächtigsten Männer Roms, Finanzberater des verstorbenen Claudius und Agrippinas wichtigster Verbündeter. Sein Verstand war scharf wie eine Klinge, seine Loyalität – solange sie sich lohnte – unerschütterlich.
„Augusta", begrüßte er sie mit einer Verbeugung, die respektvoll, aber nicht unterwürfig war. Pallas wusste genau, wie wertvoll er war, und er ließ es andere spüren.
„Pallas. Berichte." Agrippina ließ sich in ihren Stuhl sinken und gestattete ihren Sklavinnen, ihr die schweren Schmuckstücke abzunehmen. Die Maske der öffentlichen Würde fiel ab, und darunter kam die Frau zum Vorschein, die sie wirklich war – härter, kälter, gefährlicher.
„Die Finanzen des Reiches sind stabil", begann Pallas. „Die Steuereinnahmen übersteigen die Ausgaben, die Schatzkammern sind gut gefüllt. Deine... Investitionen entwickeln sich wie erwartet."
„Und Nero?"
„Er unterschreibt, was man ihm vorlegt. Seneca und Burrus halten ihn gut unter Kontrolle." Pallas zögerte. „Allerdings gibt es Anzeichen von Ungeduld."
Agrippina winkte ab. „Er ist jung. Die Jungen sind immer ungeduldig. Es wird vergehen."
„Vielleicht", sagte Pallas vorsichtig. „Aber du solltest bedenken, dass Ungeduld zu Unvorhersehbarkeit führen kann. Und Unvorhersehbarkeit ist gefährlich."
„Was schlägst du vor?"
„Gib ihm etwas, womit er sich beschäftigen kann. Ein Projekt, das ihn bindet, aber keine wirkliche Macht verleiht. Vielleicht seine künstlerischen Neigungen – lass ihn ein Theater bauen, ein Fest organisieren. Irgendetwas, das sein Ego streichelt, aber seine Position nicht verändert."
Agrippina dachte nach. „Eine kluge Idee. Ich werde darüber nachdenken." Sie griff nach einem Kelch Wein, den eine Sklavin ihr reichte. „Und Britannicus?"
Bei diesem Namen veränderte sich die Atmosphäre im Raum. Pallas' Gesicht wurde undurchdringlich.
„Er lebt zurückgezogen. Zeigt sich selten in der Öffentlichkeit. Seine Lehrer berichten, dass er ein ernster, studierter junger Mann ist."
„Zu ernst", murmelte Agrippina. „Ein vierzehnjähriger Junge sollte spielen, nicht studieren. Es macht ihn gefährlich."
„Gefährlich?", wiederholte Pallas. „Er ist ein Kind ohne Unterstützung. Sein Vater ist tot, seine Mutter auch. Er hat keine Armee, keine Verbündeten im Senat. Was kann er tun?"
Agrippina sah ihn scharf an. „Er kann existieren. Das allein ist gefährlich genug. Britannicus ist der leibliche Sohn des Claudius. Es gibt Menschen in Rom – alte Männer mit langen Erinnerungen – die glauben, dass er der rechtmäßige Kaiser sein sollte, nicht Nero."
„Solche Menschen flüstern in dunklen Ecken, aber sie handeln nicht", erwiderte Pallas. „Sie sind zu feige."
„Die Feigen von heute sind die Verschwörer von morgen", sagte Agrippina. „Ich habe zu viel riskiert, zu hart gearbeitet, um Britannicus zu unterschätzen. Solange er lebt, ist Neros Position nicht absolut sicher."
Eine lange Stille folgte. Dann fragte Pallas mit leiser Stimme: „Was beabsichtigst du?"
Agrippina trank von ihrem Wein, und ihr Blick verlor sich in der Ferne. „Noch nichts. Britannicus ist jung, harmlos, und ihn jetzt zu beseitigen würde Fragen aufwerfen. Claudius' Tod war schon heikel genug. Nein, wir beobachten. Wir warten. Und wenn die Zeit kommt..."
Sie musste den Satz nicht beenden. Pallas verstand.
„Du spielst ein gefährliches Spiel, Augusta."
„Ich spiele das einzige Spiel, das es gibt", korrigierte sie ihn. „Macht. Alles andere ist Illusion."
In einem anderen Teil des Palastes, weit entfernt von Agrippinas luxuriösen Gemächern, lag Britannicus in seinem bescheidenen Zimmer und starrte an die Decke. Er konnte nicht schlafen. Draußen hörte er die gedämpften Geräusche des Palastes – das Lachen betrunkener Gäste, die sich zurückzogen, das Klirren von Waffen, während die Wachen ihre Runden drehten, das ferne Plätschern der Brunnen.
Britannicus Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus – sein vollständiger Name war ein Hohn. Er trug die Titel, aber nicht die Macht. Er war ein Caesar nur dem Namen nach.
Mit vierzehn Jahren hatte er bereits mehr Verluste erlebt als die meisten Menschen in einem ganzen Leben. Seine Mutter Messalina, hingerichtet wegen Hochverrats. Sein Vater Claudius, plötzlich gestorben unter mysteriösen Umständen. Seine Schwester Octavia, verheiratet mit Nero, ihm entrissen und entfremdet. Und seine Position – die eines kaiserlichen Prinzen, eines Thronfolgers – genommen von seinem Adoptivbruder.
Er hasste Nero nicht. Das war das Seltsame. Nero war nicht grausam zu ihm, nicht offen feindlich. Sie hatten als Kinder zusammen gespielt, hatten die gleichen Lehrer gehabt, die gleichen Spiele gespielt. Aber dann hatte Agrippina Claudius geheiratet, hatte Nero adoptieren lassen, und alles hatte sich verändert.
Jetzt war Nero Kaiser, und er, Britannicus, war... was? Ein Schatten. Ein Geist im eigenen Haus.
Ein leises Klopfen an der Tür ließ ihn aufschrecken. „Herein", sagte er, obwohl er nicht wusste, wer um diese Stunde noch kommen würde.
Narcissus trat ein, und Britannicus entspannte sich ein wenig. Der alte Freigelassene war einer der wenigen Menschen im Palast gewesen, die ihm nach Claudius' Tod die Treue gehalten hatten. Narcissus war alt, gebrechlich, sein Einfluss war mit Claudius gestorben, aber er war klug und loyal.
„Herr", flüsterte Narcissus und sah sich vorsichtig um, als könnte jemand in den Schatten lauern. „Ich muss mit dir sprechen."
„Was gibt es?" Britannicus setzte sich auf. „Ist etwas geschehen?"
„Nichts Konkretes. Aber ich höre Dinge, Gerüchte. Agrippina lässt dich beobachten."
„Das tut sie schon seit Jahren."
„Ja, aber jetzt ist es anders. Intensiver. Sie spricht mit Pallas über dich, lange, private Gespräche." Narcissus trat näher, seine Stimme wurde noch leiser. „Herr, ich fürchte um dein Leben."
Britannicus lachte bitter. „Mein Leben? Was ist das schon wert? Ich bin ein Gefangener in goldenen Ketten. Wenn Agrippina mich töten wollte, hätte sie es schon längst getan."
„Damals hattest du noch Unterstützer. Menschen, die sich an deinen Vater erinnerten, die Fragen gestellt hätten. Aber mit jedem Tag, der vergeht, vergessen die Menschen mehr. Bald wirst du nur noch eine Fußnote in der Geschichte sein, und dann..." Er machte eine bedeutsame Geste.