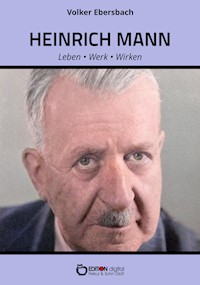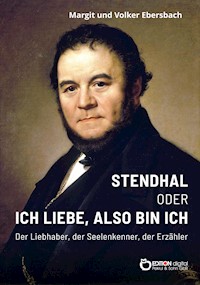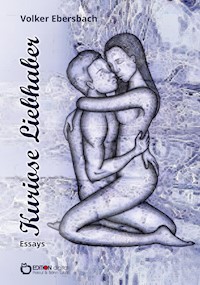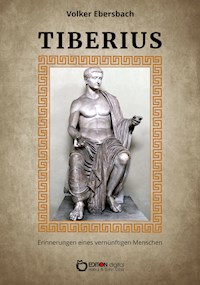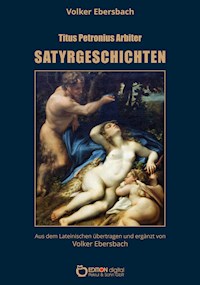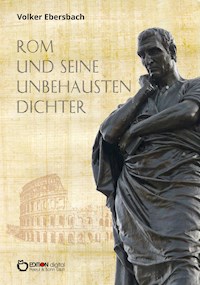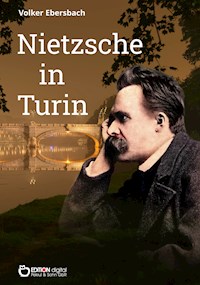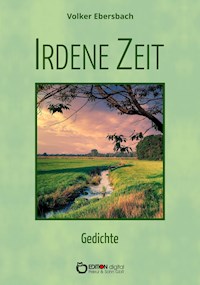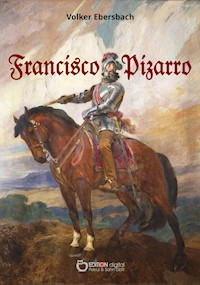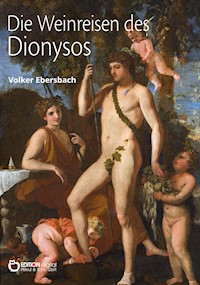6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Insgesamt 206 Anekdoten lassen das Leben von Heinrich Heine nachvollziehen, die Volker Ebersbach hier zum 200. Geburtstag des Dichters 1997 zusammengestellt hat. Und damit hat der Autor etwas getan, worauf offenbar schon lange gewartet wurde. Denn vieles hat sich in Heinrichs Leben ereignet, was sich eben auch anekdotisch erzählen lässt. Und so spannt sich der Bogen dieser ungewöhnlichen biografischen Annäherung an den Menschen und Künstler Heine von seiner Kindheit und Jugend in Düsseldorf und die Studentenzeit in Göttingen und Berlin über seine Aufenthalte in Hamburg und Lüneburg und seine Reisen bis zum Leben im Exil in Paris, das sowohl mit seinem Leiden in der „Matratzengruft“ als auch für ewig mit seiner großen Liebe zu der bildschönen, aber auch eigensinnigen Mathilde verbunden bleibt, seiner französischen Lebenspartnerin und Ehefrau – sein verflucht geliebtes Weib. Aber natürlich begegnen einem in diesem Buch auch viele bekannte Persönlichkeiten, mit denen Heine in seiner Zeit Kontakt hatte. Dazu gehören unter anderen Robert Schumann, Ludwig Börne, Friedrich Hebbel, Giacomo Meyerbeer, Ferdinand Lassalle, Karl Marx und Honoré de Balzac oder um wenigstens noch eine andere Frau zu nennen: Die französische Schriftstellerin und Salonnière Caroline Jaubert (1803 bis 1882), eine von ihm sehr geschätzte Konversations- und Korrespondenzpartnerin. Und jetzt zur Einstimmung noch eine kleine Kostprobe gefällig? Hier die Heine-Anekdote Nummer 1 aus dieser Sammlung: Bonmot Heinrich Heine behauptete gelegentlich, er wäre am 1. Januar 1800 geboren. Damit gab er sich nicht einfach als jünger aus, als er war. Sondern er verband mit seinem Geburtstag gern den Hinweis, er sei „einer der ersten Männer des Jahrhunderts.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Der träumerische Rebell Heinrich Heine
Anekdoten
ISBN 978-3-96521-588-7 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung eines Kupferstichs von Adelbert von Chamisso aus dem Gustav Schwab-Deutscher Musenalmanach für das Jahr 1837.
Das Buch erschien 1997 bei Hans Boldt Literaturverlag GmbH, Winsen/Luhe und Weimar (Weimarer Reihe).
© 2021 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I. RHEINISCHER FRÜHLING
1. Bonmot
Heinrich Heine behauptete gelegentlich, er wäre am 1. Januar 1800 geboren. Damit gab er sich nicht einfach als jünger aus, als er war. Sondern er verband mit seinem Geburtstag gern den Hinweis, er sei „einer der ersten Männer des Jahrhunderts.“
2. Frühe Rebellion
Heinrich Heine konnte mit vier Jahren lesen und schreiben. Als sich zeigte, dass sein Wissensdurst damit nicht gestillt war, wusste man sich keinen besseren Rat, als ihn in eine Mädchenschule zu schicken. Da fiel dem kleinen Genie aber bald das Stillsitzen schwer. Die Vorsteherin, eine strenge alte Dame namens Hindermans, hatte ein wachsames Auge und bestrafte ihn für jeden Mucks. Das weckte den Rebellen. In einem unbeobachteten Moment sah er einen Krug auf dem Tisch stehen. Flink leerte er ein ganzes Tintenfass in die frische Milch. Dann legte er die Hände auf den Rücken wie ein Alter und ging auf und ab, als wäre nichts geschehen. Als er die Schnupftabakdose der Frau Hindermans ausgeschüttet und Sand hineingetan hatte, stellte die Lehrerin ihn erbost zur Rede: „Warum hast du das getan?“ - „Weil ich dich hasse!“, antwortete das Kind.
3. Entlarvung
In der Schule gehörte Heine zwar zu den Begabtesten, aber nicht zu den Fleißigsten. Seine Mutter, die sein künstlerisches Talent erkannte, gab sich damit nicht zufrieden. Doch der Zeichenlehrer, den sie ihm bestellte, schlief während jeder Stunde ein. Heinrich zeichnete einen Eselskopf und heftete dem Schnarchenden das Blatt auf den Rücken.
Der Lehrer, dem auf der Straße eine Schar lachender, höhnender Kinder gefolgt war, kehrte empört zurück und beschwerte sich. Der Vater wunderte sich sehr. Wie, fragte er, könne einem jemand etwas an die Jacke heften, ohne dass man es bemerke! Heinrich hatte in einer Ecke gehorcht. „Papa!“, platzte er heraus: „Er schläft ja während der ganzen Stunde und träumt laut von seinen Schulden.“
4. Die Narrenjacke
Die Masern machte Heinrich zusammen mit seiner jüngeren Schwester durch. Um ihnen in der Zeit, die sie zu Hause bleiben mussten, die Langeweile fernzuhalten, gab ihnen die Mutter eine Kiste bunter Stoffreste. Ausgerechnet Charlotte wusste damit nichts anzufangen. Heinrich hatte sofort eine Idee: „Wir nähen daraus eine Narrenjacke!“ Auch beim Nähen zeigte der Junge mehr Ausdauer als das Mädchen. Doch als der Karneval kam, die beste Gelegenheit, die Narrenjacke zu tragen, durfte er sie nicht anziehen. Verdrossen schenkte der kleine Schneider sein Werk einem Nachbarsjungen. Der hob es auf, bis es, durch Dichterruhm zur Reliquie erhoben, für gute Freunde wieder in siebzehn Stücke zerschnitten wurde.
5. Namensnöte
Heines Vorname lautete eigentlich „Harry“. Ein Geschäftsfreund seines Vaters trug diesen im Grunde unverfänglichen, wegen seiner Erfolge im Stoffhandel sogar glückverheißenden Namen. Doch der Junge hatte viel Ärger damit. Ein Mann, der jeden Morgen mit einem Karren den Kehricht einsammelte, wegen dieser Arbeit „der Dreckmichel“ geheißen, trieb den Esel, der das Gefährt zog, mit dem Ruf „Haarüh!“ von einem Häuflein zum andern. Schulkameraden und Nachbarskinder machten sich bedenkenlos einen grausamen Spaß daraus, den kleinen Harry in dem Tonfall, den der Dreckmichel zu seinem Esel anschlug, „Haarüh“ zu rufen. Die Hänselei spann sich fort, weil sie wirkte. Einer fragte den andern in Harrys Beisein: „Was unterscheidet das Zebra vom Esel?“ Wie verabredet lautete die Antwort: „Der eine spricht zebräisch, der andere hebräisch.“ Auf die Frage, wie sich denn aber Dreckmichels Esel von seinem Namensvetter unterscheide, sah man einander ratlos an: „Den Unterschied wissen wir nicht.“ Ein hübscher Mitschüler, der gemerkt hatte, wie sehr Harry ihm zugetan war, schloss ihn in die Arme und säuselte ihm, Wange an Wange, ins Ohr: „Haarüh!“ Der Gassenjunge Jupp war sich nicht zu gut, frische Pferdeäpfel aufzulesen, um sie Harry mit dem Ruf „Haarüh!“ an den Kopf zu werfen.
Die Mutter versuchte, ihn zu beruhigen. Er solle viel lernen und gescheit werden, dann werde man ihn nie mit einem Esel verwechseln.
Jupp war der Enkel einer armen, gebrechlichen alten Frau, die, von Jupp geführt, mit anderen Bedürftigen regelmäßig bei Vater Heine erschien, um die Almosen der Armenkasse in Empfang zu nehmen. Der Armenpfleger fügte der Tüte manchmal eine zweite, größere bei, die sein Privatalmosen enthielt. Oft saß Harry dabei und sah zu. Die Alte wusste, dass nicht nur Klagen, sondern auch Schmeicheleien die Geberlaune beförderten, und so brach sie einmal in einen Wortschwall der Bewunderung für den Sohn des Herrn Heine aus. „Geh, Jupp“, sagte sie, „und küsse dem lieben Kind die Hand!“ Mit säuerlicher Grimasse gehorchte ihr der Enkel. Harry empfand seine Lippen wie den Stich einer Viper. Er griff in seine Tasche, holte alle Kupfermünzen, die darin klingelten, heraus und zählte sie Jupp auf die Hand.
Nicht lange, da klatschte dem Geber auf der Straße wieder zu dem verhassten „Haarüh!“ eine Handvoll Pferdeäpfel an den Kopf. Diesmal aber kam, als hätte der Dreckmichel selber gerufen, die passende Antwort aus einer Nebengasse, durch die der Esel gerade seinen Karren zog: „I-A!“
6. Das dritte Gebot
An einem Samstag brach in der Nachbarschaft der Heines Feuer aus. Eilig und mit großem Lärm und Gepolter erschien die Feuerwehr und bildete eine Kette, in der die wassergefüllten Brandeimer von Hand zu Hand gingen. Da aber die Löschmannschaft noch Leute brauchte, erging an die Schaulustigen die Aufforderung, mitzuhelfen, und auch Heinrich Heine, der mit seiner Schwester Charlotte vom Spielen herbeigelaufen war, sollte zupacken. Der Knabe nahm seine Hände nicht aus den Taschen, sondern erwiderte: „Das darf ich nicht, und ich tu’s auch nicht. Wir Juden haben heute Schabbes.“
7. Der Träumer
An einem Sommertag wurde es Harry über den Schularbeiten zu heiß. Er ging zum offenen Fenster und schaute sehnsüchtig hinaus. Unwiderstehlich zog es ihn ins Freie. Er stieg auf den zwei Fuß breiten Sims und streckte sich lang in die Sonne. Und schon überkam ihn Schlaf. Vorübergehende sahen den Jungen in seinen unruhigen Träumen sich bewegen und alarmierten seine Mutter. Was war zu tun? Jeden Augenblick, bei der leisesten Berührung, schon mit dem Knarren der Tür oder beim Rufen seines Namens, konnte das Kind in die Tiefe stürzen. Die Straße füllte sich mit Leuten, die den Atem anhielten und hinaufstarrten, Katholiken schlugen das Kreuz, manche halfen der Mutter, Federbetten, Decken und Kissen auszubreiten für den Fall des Falles. Man rief: „Er bewegt einen Arm! Jetzt wendet er den Kopf.“ Die Menge stand reglos, als die Mutter es dennoch wagte, auf Strümpfen ins Zimmer zu gehen, im Fenster erschien, die Arme ausgebreitet, als flehte sie zum Himmel, und mit beherztem Zugriff den Jungen hereinzog. In die erleichterten Hochrufe von unten fragte der Gerettete: „Mutter, warum hast du mich geweckt? Engel waren um mich, ich träumte, in einem Zauberhain zu sein, Vögel sangen liebliche Weisen, und ich dichtete die Worte dazu!“
8. Liebliche Störung
Der Gymnasiast Heine verliebte sich in ein schlankes, blond gelocktes Mädchen. Aber die schöne Tochter des Oberappellationsgerichtspräsidenten war unerreichbar. Als er bei einer Schulfeier Schillers Ballade „Der Taucher“ rezitierte, war die Aula voll besetzt. Nur in der ersten Reihe stand ein goldener Sessel leer. Da trat der hohe Herr verspätet ein und überließ seiner Tochter den Ehrenplatz, und Heine blieb stecken an der Stelle: „Und der König der lieblichen Tochter winkt.“ So heftig der Klassenlehrer soufflierte – der Schüler starrte auf das Mädchen im Sessel, bis er in eine Ohnmacht fiel. „Das muss die große Hitze im Saal sein“, sagte der Schulinspektor und ließ alle Fenster öffnen.
„Oh!“, rief Heine später aus, als man ihn daran erinnerte. „Wie war ich damals unschuldig!“
9. Gesamtkunstwerk
Ein Schüler der Düsseldorfer Malerakademie, Joseph Neunzig, porträtierte seine Freunde auf Elfenbein. Als auch der fünfzehnjährige Heine ihm saß, bemerkte der Kunstjünger, dass den Mund ständig ein satirischer Zug umspielte. „Den darfst du nicht verfehlen!“, verlangte das Modell. Die fertige Miniatur, in geschliffenes Glas gefasst, erschien Heine dann so wohlgetroffen, dass er in seiner Freude sagte: „So, nun wollen wir das Bild auch in Musik setzen lassen!“
10. Das rote Sefchen
Mil sechzehn Jahren verliebte sich Heine in die schlanke, magere, rothaarige Josepha. Sie lebte bei der „Göchin“, der Witwe eines Scharfrichters, die auch als Hexe verschrien war. Der Vater des fast gleichaltrigen Mädchens übte dasselbe verächtlich angesehene Handwerk aus wie der verstorbene Onkel. Das machte das „rote Sefchen“ mit seinem schulterlangen Haar, das, wenn sie es sich unterm Kinn zusammenband, ihren schneeweißen Hals wie abgeschnitten erscheinen ließ, sehr einsam. Sie kannte allerlei rheinische Volkslieder, und sie erzählte dem Jüngling, der als einziger ihre Nähe suchte, viel von dem Aberglauben, der sich um das Richtschwert spann. Obwohl man eine Klinge, die hundert Verurteilte geköpft hatte, zu vergraben pflegte, weil sie sonst angeblich Unheil brachte, hatte die „Göchin“ das Handwerkzeug ihres seligen Mannes wieder in ihr Haus geholt, um damit zu zaubern. Einmal holte Josepha dieses Henkersschwert aus der Kammer, schwang es kräftig empor und sang:
„Willst du küssen das blanke Schwert,
das der liebe Gott beschert?“
Der Verliebte aber, erkennend, dass Josepha sich nicht würde widersetzen können, ohne ihn zu verwunden, umschlang sie zu den Worten:
„Ich will nicht küssen das blanke Schwert –
ich will das rote Sefchen küssen!“
und küsste sie heftig auf den Mund.
11. Stockfische
Als Jurastudent in Bonn kleidete sich Heinrich Heine auffällig. Eine knallrote Mütze saß ihm weit hinten auf dem Kopf, sein Rock war von gelbem Nanking, im Winter von Flausch, die Mappe unter einen Arm geklemmt, vergrub er die Hände in den Hosentaschen, sein Gang war nachlässig und stolpernd, herausfordernd pendelte der Blick nach rechts und links. Mit Kommilitonen müßig am Rhein stehend, schwieg er lange. Auch die anderen taten nichts, als stumm den Fischern in einem Kahn zuzuschauen. Da knurrte Heine: „Passt auf, dass ihr nicht ins Wasser fallt! Die fangen Stockfische.“
12. Poetische Ader
„Warum bist du mir damals nicht böse gewesen?“, fragte Joseph Neunzig während der Studienzeit seinen Kommilitonen Heine. Bei einem kindlichen Spiel hatte sich der Steinwurf des Freundes an Heines Kopf verirrt. Aus der Platzwunde war Blut geronnen. Heine antwortete schmunzelnd: „Wer weiß, wozu das gut war! Hättest du nicht meine poetische Ader getroffen und mir einen offenen Kopf verschafft, wäre ich vielleicht kein Dichter geworden.“
13. Pseudonym
Während des Studiums stellten sich in Heines Lateinkenntnissen empfindliche Lücken heraus. Ein Philologe gab ihm Nachhilfe und las mit ihm Sallust und Vergil. Eines Tages brachte Heine die Zeitschrift „Hamburgs Wächter“ mit, schlug sie auf und fragte den Philologen, was er von den Versen eines gewissen mit ihm befreundeten Freudhold Riesenharf halte. „Ich“, bemerkte er nebenbei, „ich halte nicht viel davon.“
Der Philologe las und lobte ein Gedicht nach dem andern. „Aber das kann doch gar nicht sein“, wiedersprach Heine, „das Zeug ist ja keinen Schuss Pulver wert!“ Doch der Philologe beharrte: „Im Gegenteil, dieser Riesenharf ist ein Genie erster Größe!“ Da fiel ihm Heine um den Hals und jubelte: „Ich bins! Ich bins! Ich habe das gemacht!“
14. Gerupft
Ein Karrenschieber, der zu Beginn der Semesterferien Heines Gepäck in Düsseldorf von der Post nach Hause brachte, verlangte dafür unverschämt viel. Heine hatte gute Manieren und ließ sich nicht leicht aus der Ruhe bringen, musste sich aber in solchen Fällen sehr beherrschen, um nicht gewalttätig zu werden. Er zahlte mit wutblassem, aber ruhigem Gesicht. Dann griff er dem Kerl derb in den schwarzen Backenbart und gab sich erstaunt: „Verzeihung, mein Bester! Ich glaubte, das wäre ein falscher Bart!“
15. Gleichnis
Heinrich Heines jüngerer Bruder Max las gern die schnell vergessenen Modeschriftsteller der Zeit. „Max!“, sagte Heinrich eines Tages. „Solche Bücher verderben den Geschmack. Ich schenke dir ein anderes.“ Dazu holte er von seinem Tisch ein kleines schwarzes Pappbändchen. Es war Goethes „Faust. Der Tragödie erster Teil“. Auf die Innenseite des Deckels schrieb er folgende Widmung:
Dieses Buch sei dir empfohlen.
Lese es nur, wenn du auch irrst:
Doch wenn du’s verstehen willst,
wird dich auch der Teufel holen.“
Als Heine den Bruder 1852 daran erinnerte, erhielt er von Max folgende Antwortverse:
„Lieber Bruder, hab’s verstanden.
Leider, wie du’s selbst gedacht,
Doch den Goethe nicht begriffen,
der den zweiten Teil gemacht.“
II. DER UNGEZOGENE LIEBLING DER GRAZIEN UND MUSEN
16. Zuspruch
Heine bemerkte sofort, dass sein Göttinger Kommilitone Hermann Schiff, mit dem er sich befreundet hatte, heimlich dichtete. „Fuchs, du schreibst!“, sagte er ihm auf den Kopf zu, als er sich wie gewöhnlich auf das Sofa warf, eine Hand wegen notorischer Kopfschmerzen an der Stirn. „Meinst du, dass ich dir das nicht längst angesehen habe? Ziere dich nicht, lies mir eins von deinen Jungfernkindern vor.“
Der Kommilitone las, Heine hörte ihm zu, warf zu mancher Bemerkung ein herzliches „Bravo!“ ein und schlug kleine Verbesserungen vor. Schließlich sagte der „ungezogene Liebling der Grazien und Musen“, wie man ihn in Göttingen nannte, begeistert: „Gut! Sehr gut! Das Beste, was in neuster Zeit geschrieben wurde – mit Ausnahme von dem, was ich geschrieben habe!“
17. Duelle
Wegen eines Duells in Göttingen relegiert, setzte Heine sein Jurastudium in Berlin fort. Doch auch dort brachte ihm die lockere Zunge rasch eine Forderung ein. „Fuchs!“, titulierte er einen Kommilitonen und fragte etwas schnoddrig: „Ist dein Vetter nicht zu Hause?“
„Ich heiße Schaller und nicht Fuchs!“, korrigierte ihn der Angesprochene. „Und Berlin ist nicht Göttingen.“
Der Kommilitone Schmidt versuchte, beide zu beschwichtigen, aber Schaller schob noch eine Beleidigung nach. Er war hochgewachsen und glaubte sich, obwohl unerfahren, Heine auf der Mensur überlegen. Sekundanten wurden bestellt; die beiden Kampfhähne traten sich gegenüber. Auch Heine zeigte in der Handhabung der Waffe wenig Geschick. Die Sekundanten schwebten in größerer Gefahr, getroffen zu werden, als die Duellanten. Beide wandten einander fast den Rücken zu, sooft sie aufeinander losgingen. Plötzlich stieß Heine dem Gegner seine rechte Lende auf die Schlägerspitze, so dass er aus einer kleinen Stichwunde stark blutete. „Stich!“, rief er und ließ sich fallen. Da beim Hiebfechten eine Stichverletzung gegen den Komment verstieß, hatte er gewonnen.
18. „Gubitzen“
Einige seiner frühen Gedichte brachte Heine dem Berliner Publizisten Friedrich Wilhelm Gubitz. Der Gönner las die Verse des mageren, blassen, ein wenig übernächtigt blickenden Studenten mit Wohlwollen. Eigenwillige Reime ließ er, nachdem der Verfasser sie als „dem Volkston gemäß“ gerechtfertigt hatte, gelten. Aber er warnte vor der Zensur, die ihm in die „Brautnacht“ einige Lücken reißen werde, so dass es ratsam sei, die zügellosen Stellen gleich zu ändern. Heine ließ sich dazu herbei. Jede Überarbeitung aus Rücksicht auf die Zensur nannte er aber von da an – „Gubitzen“.
19. Löffelstipendium
In Berlin studierte zur selben Zeit wie Heine auch der spätere Dramatiker Christian Dietrich Grabbe. Während Heine von seinem Onkel Salomon, einem Hamburger Bankier, unterstützt wurde, lebte Grabbe vom Familiensilber. Seine Mutter hatte ihm ein halbes Dutzend silberne Löffel, dieselbe Anzahl Kaffeelöffel und eine große Suppenkelle in Baumwolle gewickelt.
Als sich die beiden kennenlernten, war „Goliath“, die Suppenkelle, bereits verzehrt, und sooft sie sich trafen und einander nach dem Befinden fragten, sagte Grabbe lakonisch: „Ich bin an meinem dritten Löffel“, oder: „Ich bin an meinem vierten Löffel.“ Als die großen Löffel dahinwaren und die Kaffeelöffel an die Reihe kamen, hörte Heine, es werde nun „schmale Bissen geben“ und bald „gar keine Bissen mehr“.
20. Kein Federlesen
Während Heine sich mit Karl Lebrecht Immermann gut vertrug, reizten ihn Grabbes derbe Witze immer wieder zu scharfen Erwiderungen. Als er eines Abends auf Grabbes Spitzen nichts mehr zu entgegnen wusste, zischte er: „Ich werde mich mit der Feder rächen!“