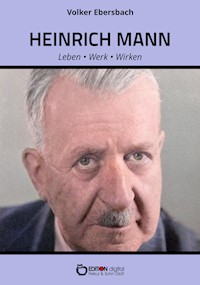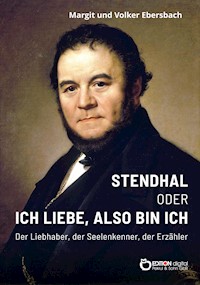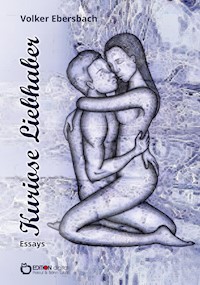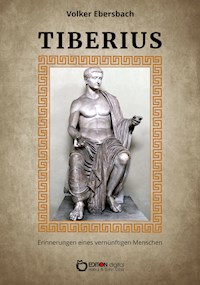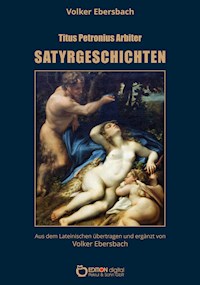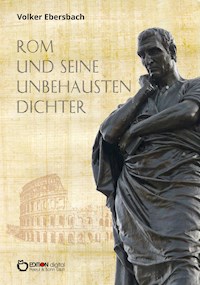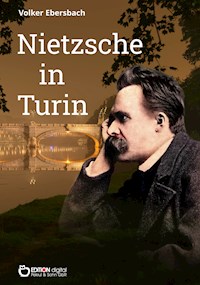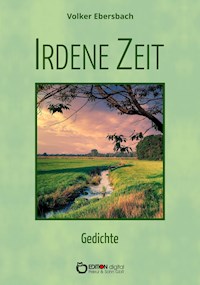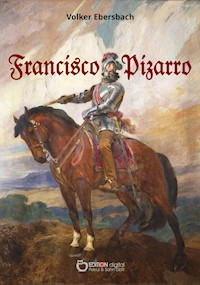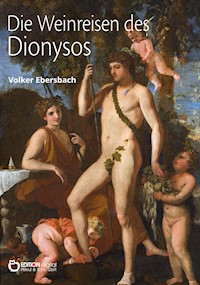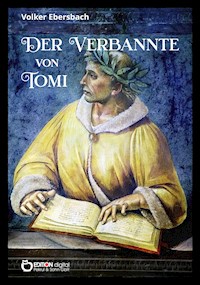
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es hat ihn erwischt: „Der Bote gab nun das Griechische auf und wiederholte seine Meldung in der Sprache der Weltbeherrscher. Die Getin schlurfte in die Weiberstube und schnatterte dort mit ihrer Tochter weiter. Auch der Präfekt wandte ein, die Gepäckstücke könnten getrost eine Nacht auf dem Schiff bleiben. Er habe keinerlei Nachricht, dass ein Verbannter aus Rom unterwegs sei nach Tomi: Was er denn mit diesem Gepäck zu tun habe! Was für eine Schlamperei, ihm noch einen Verbannten in die schlecht befestigte Stadt zu schicken! Der eine, den er schon habe, der hundertjährige Lump aus Athen, sei ihm lästig genug. Alle seine Kräfte binde hier der äußere Feind. Die Bewachung eines Staatsverbrechers – es sei doch wohl einer? – stelle für ihn eine Zumutung dar. Was man sich auf dem Palatin in Rom denn dächte!“ Und doch stimmt es. Ein Verbannter aus Rom trifft auf Tomi ein, das heute Constanta heißt und in Rumänien liegt. Der Verbannte heißt Ovid und ist der berühmte Verfasser der „Ars amatoria“, der „Liebeskunst“, der irrtümlich geglaubt hatte, dass er sich mit diesem Thema jeglicher politischer Intrigen entzogen habe. Doch er hatte eher unfreiwillig etwas gesehen: „Ich darf bei Gefahr meines Lebens darüber nicht sprechen“, murmelte Ovid verwirrt. „Es war nichts, was den Staat gefährdet hätte.“ „Das kann ich mir nicht denken.“ „Nun denn“, sagte Ovid, „schlicht und einfach: Ich kam versehentlich hinzu, als des Kaisers Enkelin die Ehe brach. Ich sah, was kein Sterblicher sehen durfte. Aktäon sah nur die nackte Diana und musste sterben. Ich sah die nackte kaiserliche Dame und einen nackten Mann bei einem Frevel. Einer, der mir übelwollte, sah, dass ich sah. Ich hätte keinerlei Gebrauch davon gemacht. Aber vielleicht wollte er auch, dass ich sah und gesehen wurde. Denn hernach las er dem Kaiser aus meinen Liebesdichtungen vor und machte ihn glauben, ich, der ich harmlose Leute nichts anderes lehrte, als mit der Liebe richtig umzugehen, sei der Lehrmeister dieses Verbrechens gewesen.“ Ovid lachte auf. „Als ob eine Julia dieses Lehrers bedurft hätte, da schon ihre Mutter, des Kaisers Tochter, ein stadtbekanntes Flittchen war. Das alles ist so widersinnig. Ich verstehe den Kaiser nicht. Er muss …“ Verzweifelt versucht Ovid, rehabilitiert zu werden und wieder zurück nach Rom zu dürfen. Wird es ihm gelingen? Im Mittelpunkt der anderen beiden historischen Erzählungen stehen Seume und Dostojewski, ihr Leben und ihr Werk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Der Verbannte von Tomi
Historische Erzählungen
ISBN 978-3-96521-590-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta unter Verwendung von: Portrait of Ovid by James Godby, after Giovanni Battista Cipriani, 1815.
Das Buch erschien 1984 im Buchverlag Der Morgen, Berlin.
© 2021 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Der Verbannte von Tomi
I. Ankunft
1
Am späten Nachmittag verbreitete sich in der Stadt das Gerücht, das Gepäck eines römischen Verbannten sei eingetroffen. Der Stadtpräfekt Sextus Quillius Postumus wurde aus seinem Wohnhaus zum Hafen gerufen. Zunächst fertigte der Türhüter den Boten des römischen Schiffes „Cassis“ mürrisch ab. Der Präfekt werde sich morgen darum kümmern. Doch der Seemann, nicht willens, sich von einem Sklaven abweisen zu lassen, betrat mit seinen knarrenden Stiefeln den Vorraum, ohne auf die Einwände des Türhüters zu achten. Da durchquerte die Frau des Präfekten, eine Getin, mit langen Schritten das Atrium und verstellte dem Boten keifend den Weg. Aus dem holprigen Gemisch griechischer und getischer Satzfetzen, denen das Weib mit barbarischer Wucht Beschimpfungen in ihrer Muttersprache nachschleuderte, schloss der Bote, dass sie die Stille zu schützen vorgab, in der sich der Hausherr um die rhetorischen Übungen seines Sohnes Lucius kümmerte. Sie verstummte erst, als Quillius Postumus selbst hinter ihr erschien, seinem beherrschten, an langes Schweigen gewohnten Gesicht mit Mühe die Fassung bewahrte und unter Anrufung der Götter sein tristes Schicksal beklagte. Klatschend schlug er sich mit dem Stock, der den Fleiß seines Sohnes überwachte, in die Handflächen, warf wie eine dritte und siegreiche sprachliche Streitmacht knappe lateinische Befehle in das Gefecht aus griechischer Rede und getischer Widerrede und stiftete einen Römischen Frieden im Kleinen.
Der Bote gab nun das Griechische auf und wiederholte seine Meldung in der Sprache der Weltbeherrscher. Die Getin schlurfte in die Weiberstube und schnatterte dort mit ihrer Tochter weiter. Auch der Präfekt wandte ein, die Gepäckstücke könnten getrost eine Nacht auf dem Schiff bleiben. Er habe keinerlei Nachricht, dass ein Verbannter aus Rom unterwegs sei nach Tomi: Was er denn mit diesem Gepäck zu tun habe! Was für eine Schlamperei, ihm noch einen Verbannten in die schlecht befestigte Stadt zu schicken! Der eine, den er schon habe, der hundertjährige Lump aus Athen, sei ihm lästig genug. Alle seine Kräfte binde hier der äußere Feind. Die Bewachung eines Staatsverbrechers – es sei doch wohl einer? – stelle für ihn eine Zumutung dar. Was man sich auf dem Palatin in Rom denn dächte!
Der Bote wartete respektvoll, ohne etwas Neues zu erwidern: Das Gepäck müsse in Tomi ausgeladen werden, der Besitzer komme von Thrakien her auf dem Landweg nach und wolle es ordnungsgemäß hier vorfinden. Die kaiserliche Anweisung trüge der Verbannte selbst bei sich. Die Wetterlage lasse in den nächsten Tagen Sturm befürchten, das Schiff lichte deshalb noch vor Tagesanbruch den Anker und segle nach Histria weiter.
„Aha“, sagte der Präfekt und wies dem Boten im Atrium eine Sitzgelegenheit zu. „Und man lässt ihn so einfach den Landweg benutzen? Man ist sicher, dass er hier ankommt? Gerade Thrakien ist unzureichend befriedet, für Staatsverbrecher ein idealer Schlupfwinkel!“
Der Bote radebrechte, der Verbannte sei ein vornehmer Herr. Er habe sein Wort gegeben und dafür einen Begleitsoldaten erhalten. Die kaiserliche Anweisung ordne schonendste Behandlung an und schlösse jeden Fluchtversuch aus. Sie trage das persönliche Siegel des Kaisers.
„Also tatsächlich ein Staatsverbrecher“, seufzte der Präfekt und erhob sich, um den Boten zum Hafen zu begleiten.
„Vielleicht kein so schwerer“, stammelte der griechische Seemann. „Denn er ist zwar verbannt worden, hat aber weder sein Vermögen noch sein Bürgerrecht verloren. Er beteuert jedermann seine Unschuld und nennt sich einen in Ungnade gefallenen Dichter.“
Der Präfekt lachte auf. „Das glaube ihm, wer will. Ich kenne die Ungnade des Augustus. Wegen eines Dichters bemüht er sie nicht.“
Er nahm seinen Mantel, schickte einen Sklaven hinüber zur Präfektur, um den Schreiber zu benachrichtigen, und folgte dem Boten zum Hafen.
2
Lucius Quillius, der Sohn des Stadtpräfekten, rollte die rhetorischen Abhandlungen zusammen und legte sie ins Regal. Er beschloss, diesen unerwarteten Urlaub vom Lateinischen zu feiern, und nahm sich die griechischen Dichtungen vor, die sein Vater stillschweigend duldete, obwohl er sie verachtete, wenige Gesänge des waffenklirrenden Homer, ein paar Oden des taktgewandten Pindar, eine Sammlung des süßen und zugleich kenntnisreichen Kallimachos, alles Papyrusrollen, die Artemisios, der reichste griechische Kaufmann des Ortes, bei seinem Ableben vor zwei Jahren dem Präfekten für die Erziehung seines lesehungrigen, aufgeweckten Jungen vermacht hatte.
Er las nicht lange. Immer wieder stellte er eine faustgroße Bronzebüste seines Lieblingsdichters Kallimachos, ebenfalls ein Erbstück des Kaufmanns, auf die Stelle der Rolle, wo er seine Lektüre unterbrach, blickte zur Decke des Raumes, murmelte etwas und skandierte dazu mit der Hand das Versmaß. Die hehre „Ilias“ des Homer, die ihm der Vater im Gegensatz zu der zweiflerischen, wehleidigen und, wie er sich ausdrückte, östlich zwiespältigen „Odyssee“ erlaubt hatte, regte ihn zu eigenen Versen an, zu einem kleinen Epos über den Bürgerkrieg der Römer, einer bescheidenen poetischen Darstellung des für die ganze Welt heilsamen Aufstiegs Oktavians zum Augustus, zum ersten Bürger Roms, zum weisen, gütigen und gerechten Lenker der Staatsgeschicke, den bei seinem, wie zu hoffen war, noch fernen Hinscheiden gewiss die Götter unter sich aufnehmen würden.
Der Vater, froh, dass der frühreife Knabe dafür die unverbindlichen Lyrismen aufgab, mit denen er begonnen hatte, erlaubte ihm das Versemachen unter der Bedingung, dass er das zunächst griechisch entworfene Werkchen anschließend ins Lateinische übersetzte. Anfangs hatte der Stadtpräfekt versucht, ihm „die Verse aus dem Hintern zu trommeln“. Doch von Artemisios war der gutnachbarliche Rat gekommen, ein so begabtes Kind nicht in allzu strenge Verbote zu zwängen. Was man früh lerne, könne man später einmal gewinnbringend anwenden. Es sei vielleicht schon unklug gewesen, den freundschaftlichen Umgang mit dem hundertjährigen athenischen Philosophen zu unterbinden. Von ihm hatte das Kind Griechisch gelernt, noch ehe der Vater es aus der Weiberstube holte, um ihm das Lateinische einzubläuen. Der hundertjährige Lump in seiner hündischen Hütte am Stadtrand hatte in den Halbgeten, der gleichsam in den Hosenbeinen seiner barbarischen Mutter herangewachsen war, zum ersten Mal das wohlgestaltete Gewächs einer Kultursprache gepflanzt, denn auch das Griechisch der Ortsansässigen klang wild und hart.
Der Stadtpräfekt hoffte nach mehr als dreißig Jahren Dienst nicht mehr, in das heimatliche Rom zurückberufen zu werden. So setzte er seinen Ehrgeiz daran, seinem Sohn Lucius, sobald ihm die getische Mutter nicht mehr anzumerken wäre und sein Latein ebenso leicht dahinflösse wie das Griechische, mit einem Zehrgeld nach Rom zu schicken. Quillius hatte in jungen Jahren, ehe der Bürgerkrieg zwischen Oktavian und Antonius ihn unter die Soldaten rief, selbst eine rhetorische Ausbildung begonnen und kannte ihren Wert. Vielleicht schaffte es Lucius, in der Hauptstadt die Kunstfertigkeit seiner Rede zu vervollkommnen und Advokat zu werden. Vielleicht gelänge es ihm, in den Kanzleien die längst zugesagte, nur immer wieder verschleppte Rückgabe der väterlichen Güter in Apulien zu erwirken. Der Präfekt schloss nicht aus, ein Gedicht in lateinischen Versen über die Taten des Kaisers, des Vaters des Vaterlandes, werde seinem Sohn in Rom alle Türen öffnen.
Lucius nahm die kleine Bronzebüste vom Text des Homer, rollte ihn wieder ein und verschnürte die Bänder. Die Nachricht, das Gepäck eines Verbannten sei eingetroffen, beschäftigte seine Gedanken so sehr, dass ihm die Verse zerrannen wie verschütteter Wein, der den Kelch nicht erreicht, weil man, erregt durch ein Gespräch bei Tisch, den Lederschlauch ungeschickt angefasst hat. Wenn das Gepäck eintraf, musste der Verbannte bald selbst erscheinen. Und er käme aus Rom.
Er verließ sein Zimmer, durchquerte das dämmrige Peristyl, wo an den Säulenkapitellen noch die vorjährigen Schwalbennester klebten, und trat in die terrassenartige Portikus, die in den Garten führte. Die rohen, ungleichen Säulen dieses Anbaus waren bei Ausschachtungen im Hafen gefunden worden. Ionische Kapitelle verrieten ihre Herkunft aus Milet. Also stammten sie noch aus der weit entfernten Zeit, in der die ersten griechischen Kaufleute sich an dieser rauen Küste angesiedelt hatten. Unwillkürlich verlangsamte Lucius seinen Schritt, denn den Vater sah er immer nur sehr bedächtig in diesem Säulengang auf und ab schreiten, wenn ein Schiffsherr Neuigkeiten aus der Ägäis oder gar aus Rom gebracht hatte, denen er etwas für seine eigene Zukunft oder für die seines Sohnes entnehmen konnte.
Als er den äußeren Rand der Terrasse erreicht hatte, spähte er über die graubraunen Binsendächer des Hanges hinab zum Hafen und suchte unter den Schiffen, die mit gerefften Segeln vor der Mole lagen, die große römische Galeere, die das Gepäck des Verbannten gebracht haben konnte. Sie war nicht schwer zu entdecken, denn vorn lagen nur drei kleinere ruderlose Handelsschiffe, wie sie zwischen Byzanz und Histria an der Küste zu pendeln pflegten, das eine, soeben eingelaufen, vollgesteckt mit irdenen Ölkrügen, die anderen beiden leer. Dahinter streckte sich der gewaltige Schiffsleib mit seinen Ruderreihen wie ein erstarrter Tausendfüßler. Auch an einen lauernden Skorpion erinnerte er, denn das Heck krümmte sich aufwärts wie ein stachelbewehrter Schwanz.
Die See lag glatt; aber diese Glätte war nicht geheuer auf dem ungastlichen Pontus, den die Griechen mit beschwörerischem Eigensinn „Euxinus“, den Gastlichen, nannten. Sie spiegelte das graublaue, fade, rosig durchschimmernde Gewölk des Spätnachmittagshimmels und färbte sich weit draußen unter dichteren Wolken schwarz. Lucius kniff die Augen zusammen, um genauer zu erkennen, was im Umkreis der Galeere vorging. Das Zwielicht verriet ihm nur die winzigen Silhouetten der Verladesklaven. Gebeugt unter der Last der Säcke, glitten sie in lückenloser Reihe den Steg hinab, verschwanden in einem Lagerschuppen und kehrten von dort mit Kisten über einen anderen Steg aufs Schiff zurück. In Abständen waren Aufseher postiert. Die Wasserfläche des Hafenbeckens warf ihre abgehackten, rhythmischen Rufe, mit denen sie den Trab der Sklaven im Gleichschritt hielten, den Hang hinauf. Peitschen knallten, sobald einer der Träger aus der Reihe wankte. Die Säcke und Kisten drückten die Schultern der Träger so weit nach vorn, dass ihr Gang, wären die Hände nicht rücklings in die Last verkrallt gewesen, wieder dem der Vierbeiner ähnlich gesehen hätte.
„Lucius, du erkältest dich“, rief aus der Portikus eine Mädchenstimme. Es war seine Schwester Quillia. Sie brachte einen Wollumhang, den sie ihm über seine Tunika hängte.
Sie blieb neben ihm stehen. „Wartest du auf den Mann aus Rom?“
„Vorerst kommt nur sein Gepäck“, belehrte Lucius das Mädchen. Seit er rhetorische Studien trieb und seine Zukunft in Rom sah, hatte er sich angewöhnt, seine zwei Jahre ältere Schwester herablassend zu behandeln. Sie wurde ganz von der Mutter erzogen und hatte nur das rohe, mit getischen Lauten und Wörtern vermischte Griechisch der Einheimischen gelernt. Die Mutter nannte sie mit ungelenker Zunge „Lilla“, und sie selbst konnte ihren Namen nicht deutlicher aussprechen. So riefen sie denn auch der Präfekt und sein Sohn.
3
Sie spähten gemeinsam zum Hafen. Etwas abseits die aufrechtstehende Gruppe, das mussten die Soldaten sein. Sie standen zwischen einem Haufen übereinandergeworfener Schilde und einer Gitterpyramide aus zusammengestellten Spießen. Lucius suchte dort die Gestalt des Vaters und Gegenstände, die das Gepäck des Verbannten sein konnten.
„Warum bist du so neugierig auf ihn?“, fragte er. „Er wird kein Jason sein.“
„Wer war Jason?“
„Dieser griechische Abenteurer, der die Königstochter Medea entführte.“
„Ach ja, jetzt weiß ich“, sagte Lilla. Sie besann sich auf die Legende, die von den Griechen dieser Gegend in Umlauf gebracht worden war. „Das ist, nicht wahr, die Kolchierin, die auf der Flucht hier an diesem Strand ihren Bruder Ampsyrtos zerstückelt haben soll, um ihren Vater bei der Verfolgung aufzuhalten?“
„So ist es“, bestätigte Lucius. „Derlei bringt nur eine Barbarin fertig.“
„Du bist selbst ein halber Barbar“, sagte Lilla, die den gehässigen Unterton kannte.
„Aber bald bin ich wie unser Vater ein ganzer Römer. Einer kommt aus Rom ans Ende der Welt, ein anderer geht dafür vom Ende der Welt nach Rom. Ich erkenne den ausgleichenden Willen der Götter.“
„Das wird den Vater viel Geld kosten“, bemerkte Lilla, „und ich muss noch ein paar Jahre auf meine Mitgift warten. Wer weiß, ob der junge Artemisios sich so lange geduldet. Seit sein Vater tot ist, steht er dem Haus vor, und jeder in Tomi sagt, dass er eine Frau braucht.“
Lucius ergriff ihre Hand, hielt aber nur den Ringfinger fest. „Er hat dir den Verlobungsring gebracht. Unser Vater hat dich am Sterbebett des alten Artemisios seinem Sohn versprochen. Er kann nicht zurück, er würde ehrlos, und das verträgt sein Geschäft nicht.“
„Ja, ja“, setzte Lilla fort, „und die Tochter des römischen Präfekten gibt er gewiss nicht wieder her.“ Sie kannte die Kette der Argumente, mit der auch ihre Mutter abgespeist wurde, wenn sie nörgelte, in der Weiberstube sei kein Platz für zwei erwachsene Frauen.
Um sich von der Anstrengung des Fernblicks zu erholen, schweifte der Blick des Bruders unwillkürlich auf die Straße ab, die sich zwischen Flechtzäunen und Binsendächern den Hang heraufwand und hinter der Hecke, von der die Terrasse der Präfektenvilla begrenzt wurde, die Höhe des Stadthügels erreichte. „Da kommen sie!“, rief er aus.
Vier behelmte und geharnischte Soldaten schritten in halblautem Gespräch auf dem Damm zwischen den Wagenspuren heran. Die Kurzschwerter klapperten mit den Knäufen gegen den unteren Rand der Brustpanzer. Sie trugen paarweise zwei große bronzebeschlagene Truhen, deren rötliche Bemalung von Seewassergüssen rissig geworden war. Wo die Straße auf den kahlen Platz mündete, den die Hecken und steinernen Mauern der vornehmsten Villen umgaben, setzten die Soldaten die Truhen ab und sahen sich suchend um. Das Gespräch brach ab. Hier und da lugten über die Mauern die Köpfe neugieriger Haussklaven. Den letzten Satz hatte Lucius genau verstanden: „Diesem gichtigen Waldkater möchte ich nicht als Soldat in die Pfoten kommen, geschweige denn als Verbannter.“
Der Präfekt war gemeint. Dass ihn die Gicht plagte, las jeder Fremde auf den ersten Blick seinen hölzernen Bewegungen ab, sosehr er seiner Steifheit auch den Ausdruck von Würde zu geben suchte. Auch den Vergleich mit einem Kater fand Lucius treffend, denn in dem breiten, eintrocknenden Greisengesicht seines Vaters traten die Backenknochen stark hervor, die Querfalten der Stirn wurden über der Nase von zwei senkrechten Furchen gekreuzt, und aus den Grübchen seiner Wangen hatte ein verborgener Gram tiefe Löcher gemacht. Eine Narbe schräg über der rechten Wange verstärkte die katzenhaften Züge, die der unentschiedene Kampf zwischen Stolz und Demütigung hinterlassen hatte.
Die vier Soldaten verglichen ihren Standort mit dem Weg, der ihnen beschrieben worden war. Einer bemerkte Lucius und Lilla.
„Heda, ihr beiden Hübschen! Wo ist die Villa des Stadtpräfekten Sextus Quillius Postumus?“ Hunde kläfften auf, Hühner gackerten.
„Ihr steht davor“, antwortete Lucius, „aber der Eingang ist auf der anderen Seite.“
Die Soldaten standen mürrisch um die Truhen herum, ließen in den Armöffnungen der Harnische ihre Schultern rollen und schauten hinunter zum Hafen. Die große Galeere glitt mit den rhythmisch pendelnden Kämmen ihrer Ruderreihen quer durch das Hafenbecken in die „Sturmbucht“ unter dem Leuchtfeuer, wo sie, falls das Wetter schon in der Nacht umschlüge, sicherer lag als an der Mole.
„Gehören die Truhen dem Verbannten?“, fragte Lucius.
„Beim Neptun, so ist es!“, versicherte der eine Soldat. „Und bist du der Sohn des Präfekten?“
Lucius bestätigte es geschmeichelt.
„Dann können wir den Plunder ja hier stehenlassen. Haben uns genug damit abgeplagt! Jetzt müssen wir auch noch um den ganzen Hafen herumlaufen, damit wir wieder auf die ‚Cassis’ kommen. Lasst eure Sklaven die Sachen ins Haus bringen und lebt wohl.“
„Wartet!“, rief Lilla.
„Was wünschst du, Nymphe?“, fragte der Soldat mit spöttischer Verbeugung. Auch die anderen drei, die schon losgegangen waren, blieben noch einmal stehen.
„Wo ist er selbst?“
„Was weiß ich! Irgendwo auf der Straße zwischen Odessus und Kallatis. Ein paar Tage musst du dich noch gedulden. Kannst es wohl nicht erwarten, dass er dich verführt?“
„Ich denke, er ist ein Dichter!“, rief Lucius verwundert.
„Und was für einer!“, antwortete der Soldat. „Ganz Rom kennt seine Sauereien auswendig.“
Lachend zog der kleine Trupp ab. Die beiden Truhen standen dicht an der umfänglichen grünbraunen Schlammpfütze, die sich jedes Jahr von der Schneeschmelze bis zur Sommerdürre zwischen der Villa des Präfekten und dem mit steinernen Mauern umfriedeten Anwesen des Kaufmanns Artemisios ausbreitete. Regenwasser und Spüllicht liefen darin zusammen und lockten herumstreunende Hausschweine an. Einem davon war nach langem Herumwaten endlich etwas Fressbares in den schmatzenden Rüssel geraten, ein Apfel oder eine Rübe, herabgefallen von einem der Bauernkarren, die alle Tage über den Platz holperten, den Garnisonskasernen am Hafen zu. Die grinsenden Kiefer des Schweines zermalmten bedächtig den Fund. Andere liefen herbei, hoben die schmutztriefenden Lefzen und beäugten den kauenden Eber.
Lilla wollte wissen, was mit den Truhen geschehen sollte. Aber sie bekam keine Antwort. Lucius eilte ins Haus, rief ein paar Sklaven beim Namen und ließ die Truhen des Verbannten hereinholen. Im Atrium versuchte er sie zu öffnen. Aber die Schlösser waren von einer so kunstreichen Art, wie Lucius noch keine gesehen hatte. Plötzlich stand der Vater hinter ihm und herrschte ihn an: „Lass die Finger davon!“
Lucius fuhr herum. „Die Soldaten haben sehr unehrerbietig über dich gesprochen. Du musst sie bestrafen lassen.“
„Hör mal, Früchtchen“, drohte der Präfekt, „ich werde dich wieder in die Weiberstube stecken! Erst schnüffelst du an fremder Leute Hab und Gut, dann klatschst du auch noch. Ein Römer tut so etwas nicht. Hast du verstanden?“ Dann ging er hinaus und fertigte das Fuhrwerk ab, das er dem verbannten Dichter entgegenschickte.
4
Drei Tage später stand der Erwartete im Atrium. Es war hoher Mittag, und der Präfekt hatte am Hafen zu tun. Lucius lag auf einem Polster am Rand des Wasserbeckens, dessen verstopfte Fontäne schwieg, und war eingenickt. Die Stimme des Türhüters, der den Verbannten hereingeführt hatte, weckte ihn.
Lucius sah in ein schmales Gesicht. Über den wettergeröteten Schläfen lichtete sich das schwarze, graudurchsetzte, nach vorn gekämmte Haar ein wenig. Die Stirn schob dünne, knochig hervortretende Brauenlinien über tiefe Augenhöhlen, in deren Schatten ein großer, graublauer Blick ruhte. Die kräftig gebogene Nase trat zwischen hageren Wangen umso deutlicher hervor, aber das breit geschwungene Kinn zog den schmallippigen Mund so in die Länge, dass sich von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln hin zwei tiefe, schräge Furchen gebildet hatten. Über der wollenen Reisetunika trug der Ankömmling eine braune Pelzjacke, die er unterwegs erworben haben musste, denn sie war von einheimischer Machart. Auch die Beine steckten in Fellstiefeln, wie sie die Geten hier trugen und an die sich auch die Griechen gewöhnt hatten.
Lucius richtete sich auf und musste noch immer an dem Mann emporsehen. Eine breite lederne Reisetasche mit silbernen Schnallen stand auf den Fliesen. Die Hörner einer Kithara schauten heraus.
„Ich suche den Präfekten Sextus Quillius Postumus“, sagte der Verbannte.
Verwirrt rief Lucius einen Sklaven heran, um ihn zum Hafen zu schicken, und zischte abweisend zur Tür der Weiberstube, aus der mit wirren Haaren seine Mutter und seine Schwester lugten.
„Ich bin sein Sohn. Er wird gleich kommen“, sagte Lucius und bemühte sich um saubere lateinische Aussprache.
Der Verbannte breitete überrascht die Arme aus und legte sie Lucius freundschaftlich auf die Schultern. „So bist du es, von dem ich seit Monaten die ersten lateinischen Worte höre!“
„Ist es wahr, dass du ein Dichter bist?“, fragte Lucius.
„Es ist wahr. Aber was bedeutet das hier am Pontus, am Ende der Welt?“
„Du könntest mein Lehrer werden.“ Lucius erschrak selbst über seine Dreistigkeit. Aber er wollte seinen Wunsch lossein, bevor der Vater kam.
Der Verbannte sah Lucius kurz an und dann über ihn hinweg. „Sind meine beiden Truhen schon angekommen?“, fragte er kalt.
„Mein Vater hat sie in sein Zimmer stellen lassen.“
Lucius lud den Dichter ein, sich zu setzen, doch der zog es vor, zwischen zwei Säulen auf und ab zu wandeln, die Schultern zurückgenommen, aber das Haupt vorgebeugt und das Kinn nachdenklich an die Innenseite seiner rechten Faust schmiegend, die Linke in die Pelzjacke gekrallt.
Lucius blieb verlegen abseits und versuchte seine Neugier zu bändigen. Das Wort „Staatsverbrecher“ klang ihm noch im Ohr, das der Vater gebraucht hatte. Aber was konnte einem Dichter die Feindschaft des Kaisers eintragen? Traf die Vermutung des Vaters zu, so kam ihm Essig statt Wein ins Haus. Lucius wusste im voraus, dass sein Bürgerkriegsgedicht dem Verbannten nicht gefallen würde, der vielleicht selbst eins verfasst hatte, nur eben aus der staatsfeindlichen Sicht der gestürzten Senatsaristokratie. Sein ganzes Auftreten ließ das vermuten. Aber an der Hand des Verbannten hatte Lucius bereits den Ring erkannt, der ihn als Angehörigen des Ritterstandes auswies.
Auch die höhnische Bemerkung fiel Lucius ein, mit der einer der Soldaten darauf hingewiesen hatte, dass der Dichter sittlich anstößige, vielleicht gar obszöne Verse schrieb. Vielleicht büßte er für eine Verunglimpfung des Augustus. Neulich war Lucius mitten in der Gedichtsammlung des Kallimachos auf Verse eines Römers gestoßen, eines gewissen Catullus, der den vergöttlichten Julius Cäsar und seine Anhänger mit obszönen Anspielungen zu beschimpfen wagte. In seiner Besorgnis, der Vater würde ihn über dieser Lektüre unverhofft antreffen, zu der es ihn immer wieder mit seltsamer Gewalt zog, war er lieber damit zu ihm gelaufen, um ihm zu melden, welches Schriftgut man in den Häusern griechischer Kaufmannsfamilien noch aufbewahrte. Aber der Präfekt hatte die Gedichte sonderbar ruhig an sich genommen, ihm befohlen, sie zu vergessen, und dann die Rolle im Kohlenbecken verbrannt.
„Achtung, der Präfekt!“, rief aus dem Vorraum der Türhüter.
Mit langen hastigen Schritten erschien der Vater im Atrium. Der Verbannte hob den Kopf und zog aus seiner Pelzjacke eine Schriftkapsel. „Ich komme aus Rom“, sagte er. „Ich bin der verbannte Dichter Publius Ovidius Naso.“ Und indem er dem Präfekten die Schriftkapsel reichte, fügte er hinzu: „Meine unbestreitbare Verfehlung beruht auf einer Verirrung, die ich zutiefst bedaure.“
II. Das Opfer
1
Der Präfekt schien aus dem Schriftstück, das er der Kapsel entnommen hatte, nicht klug zu werden. Sein Blick wurde linkisch und ausweichend. Er bot dem Gast an, das Dampfbad zu benutzen, und lud ihn zum Essen ein. Doch der Dichter fragte, wo er ein Lamm kaufen könne, das er im Tempel der Minerva zum Dank für seine Rettung aus Seenot und anderer Gefahr seines Leibes opfern wolle. Es läge ihm viel daran, dieses heilige Gelübde zu erfüllen, noch bevor er selbst etwas zu sich nähme.
„Hat das nicht bis morgen Zeit?“, fragte der Präfekt. „Der Tempel der Minerva wird mittags geschlossen. Der Opferpriester ist ein alter, gebrechlicher Mann. Um diese Zeit ruht er gewöhnlich, man müsste ihn wecken.“
Der Dichter rieb, Unzufriedenheit bezähmend, eine Hand um die andere und entgegnete: „Es genügt, wenn man mir den Tempel aufschließt. Das wird ein Diener machen können. Ich habe selbst zeitweilig dem Priesterkollegium meines Stadtviertels angehört und bin im Opferzeremoniell der Minerva geübt genug, um es selbst vorzunehmen.“
Die dicke, blaurasierte Oberlippe des Präfekten sträubte sich und quoll unter den ergrauten Haarbüscheln der Nasenlöcher hervor. Lucius kannte diesen Zug. Gern hätte er den Gast auf die Zwecklosigkeit seines Widerspruches hingewiesen.
„Unter keinen Umständen!“, sagte der Präfekt. „Es obliegt mir auch, strengstens die Einhaltung des römischen Zeremoniells in den Tempeln zu überwachen. Griechen und Asiaten mögen ihren abwegigen Kulten an den Stätten nachgehen, die ihnen großzügigerweise zugewiesen wurden. Ich bin meiner Behörde dafür Rechenschaft schuldig, dass in Tempeln, die der Kaiser persönlich bezahlt hat, peinlichst genau nach der Sitte unserer Vorväter geopfert wird und der Priester dafür die Gebühren erhält.“
„Was unterstellt man mir da!“, sagte Ovid. „Ich kann mich mit meinem Leben dafür verbürgen, dass ich das römische Zeremoniell einhalte, denn ich komme aus Rom.“
Der Präfekt hob die Brauen. Seine Augen wurden immer kleiner. Er legte gewinnende Einfachheit in seine Worte, nur in seinem Blick glomm Schläue. „Das besagt nichts. Gerade die Hauptstadt ist seit langem eine der schlimmsten Brutstätten eingeschleppter fremdartiger Kulte. Selbst in den ältesten und ehrbarsten Familien wird die Religion unserer Väter nach und nach durch Vermischung mit abwegigen Neuerungen entstellt. Ich kenne Rom. Mag sein, es ist lange her. Aber ich kenne es gut genug, um heute noch einschätzen zu können, was sich bis zu uns ans Ende der Welt herumspricht.“
„Dann dürfte hier allerdings auch bekannt sein“, erwiderte der Verbannte, „wie entschieden der Imperator Augustus dafür eingetreten ist, die Reinheit unserer Kulte wiederherzustellen. Ich selbst habe mit meinem letzten Buch, das ich leider nicht ganz habe fertigstellen können, nach Kräften versucht, dazu beizutragen.“
Der Präfekt musterte Ovid ungläubig. Dann überflog er noch einmal das Schriftstück mit dem kaiserlichen Siegel. „Ich wäre der letzte“, bemerkte er, „die Ehrlichkeit eines römischen Ritters in Zweifel zu ziehen. Aber was hier steht, klingt anders.“
„Solche Bedenken sind mir begreiflich“, antwortete Ovid. „Ich bin sicher, dass ich sie zerstreuen kann. Doch nicht jetzt. Ich bin außerstande, einen Bissen zu genießen oder irgendetwas zu tun, bevor ich Minerva das zugesicherte Opfer gebracht habe.“
„Ich mache einen anderen Vorschlag“, sagte der Präfekt. „Nicht weit von hier haben die dankbaren Einwohner unseres Städtchens dem Augustus und der Roma einen Tempel errichtet. Er ist Tag und Nacht geöffnet, und es steht jedem frei, dort ein Opfer darzubringen. Minerva wird es gewiss billigen, hat sie doch gerade dem Erhabenen oft genug hilfreich zur Seite gestanden.“
Der Dichter war schon bei den ersten Worten beinahe entsetzt zurückgewichen. „Augustus lebt!“, rief er nun aus. „Welch eine Lästerung! Wenn er wüsste … In Rom zweifelt zwar niemand an seiner dereinstigen Vergöttlichung, aber einen Tempel … Ich finde keine Worte! Ich bin gern bereit, dem vergöttlichten Julius Cäsar meine Ehrerbietung zu zollen.“
„Dazu besteht die Möglichkeit im Tempel des Augustus und der Roma“, sagte unbeirrt der Präfekt. „Mein Sohn Lucius wird mitgehen und auch das Lamm besorgen. In zwei Stunden bitte ich zu Tisch.“
Ovid maß den Jungen noch einmal von Kopf bis Fuß. Der Präfekt ließ einen Sklaven die Reisetasche des Dichters fortbringen und rief einen Bewaffneten. Ovid protestierte: „Ich bin kein Gefangener.“
„Sachte, sachte“, beschwichtigte ihn der Präfekt. „Ich denke nur an die Sicherheit meines Gastes! Die Ruhe dieser Gegend täuscht. Wir leben in einer Festung. Die Palisaden und Wachttürme rund um die Stadt sind kein Zierrat. Es gibt Überfälle. Gerade am Tag, wenn die Tore offen sind, schleichen sich manchmal Geten herein, entführen wehrlose Leute und fordern dann hohe Lösegelder. Nicht einmal den Barbaren, die sich bei uns angesiedelt haben, kann man trauen. Ich hielte die Tore auch tagsüber verschlossen und ließe sie nur bei Bedarf öffnen. Aber es besteht Anordnung, den Frieden des Augustus in allen Teilen des Reiches durch mehrstündiges Offenhalten der Stadttore zu ehren.“
„Ich fürchte keinen Überfall“, sagte Ovid. „Auf der dichtbesiedelten Landenge von Korinth wäre ich beinahe ausgeraubt worden, in Rom selbst versuchte jemand noch vor meiner Abreise, sich an meinem Vermögen zu vergreifen. Hingegen von der thrakischen Küste bis hierher hat mich, so öde die Straße, so menschenleer die Gegend zuletzt auch war, niemand behelligt. Seit ich jedoch in diesem Haus bin … Ich muss schon sagen …“
„Dieses Misstrauen verdiene ich nicht“, klagte der Präfekt kopfschüttelnd. „Meinen liebsten Gast würde ich nicht anders behandeln. Zugegeben, ich habe selten Gäste. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich etwas täppisch bin.“ Er schickte den Bewaffneten hinaus.
Ein Sklave hielt dem Dichter die Pelzjacke, die er ihm abgenommen hatte, wieder bereit.
„Ich bin ein Kriegsmann, dem manchmal Grobheiten unterlaufen“, fuhr der Präfekt fort. „Ich habe zu selten Gelegenheit, mich mit jemandem lateinisch, also menschenwürdig zu unterhalten. Man wird hier im Lauf der Zeit beinahe selbst zum Barbaren. Auch ich habe Rom gesehen, auch ich habe Rhetorenschulen besucht! Aber die Wirren der Zeit haben mir das Los zugeworfen, hier an diesem entlegenen Ort dem Erhabenen zu dienen. Wir werden uns schon verstehen lernen.“
Der Verbannte schritt durch den Vorraum und warf dem Türhüter eine Münze hin. Lucius folgte ihm. Draußen brachte er die Hunde zum Schweigen. Auf der Straße sagte der Dichter barsch: „Geh vor mir“! Sie passierten die Schildwache des Tores, das die Landzunge mit dem Stadthügel, um den sich die vornehmsten Villen, die Verwaltungsgebäude und die Hafenanlagen scharten, von der äußeren Stadt trennte. Die Straßen belebten sich. Bei einem Viehhändler kauften sie ein Lamm. Dann führte Lucius den Dichter durch ein Seitengässchen auf einen Platz, den die Reste abgerissener Häuser säumten. Unkrautstauden wucherten aus den Mauern. In der Mitte stand, aus den Abbruchsteinen errichtet, ein roher, würfelförmiger Bau mit vier ungleichen korinthischen Säulen, die ein Tympanon trugen. Dahinter verrieten halb fertige Stufen in einer ovalen Baugrube, dass dort eine Arena angelegt wurde. „Hier soll ein neues Forum entstehen“, erklärte Lucius. „Mein Vater hofft, durch Handel die unruhigen Völkerschaften dieser Gegend unserer Stadt zu verbinden.“
Sie betraten den Innenraum des Tempels, der, weil er nur aus einer Reihe dicht unter der Holzdecke offengelassener Fensterluken etwas Licht erhielt, höher wirkte, als er war. An der Rückwand erhoben sich zwei Statuen. Die eine war der Torso eines griechischen Jünglings, dessen Füße und Hände ein Stümper mit minderwertigem Marmor ersetzt hatte. Dem Hals war ein etwas zu großer Porträtkopf des Augustus aufgesetzt worden. Er ragte in die hellere Zone zwischen den oberen Fenstern des Raumes. Daneben saß, behelmt und mit Schild und Speer gerüstet, ein grobgemeißeltes Bildnis der Göttin Roma.
Der Priester erschien, nachdem Lucius eine Klapper betätigt hatte, und nahm das verschüchterte Lamm entgegen, das plötzlich zu blöken begann. Sie gingen gemeinsam wieder hinaus. Der Priester gab Lucius einen Wink, ihm beim Öffnen der Torflügel zu helfen. Dann schleifte er das Lamm, dessen zusammengebundene Hufe zappelten, zu dem Altarklotz, der in der Mitte zwischen Treppe und Säulenreihe aufragte.
„Wären wir in Rom, hätte ich einen Stier geopfert“, sagte Ovid.
„Wir sind in Rom“, sagte der Priester spitz. „Rom ist überall da, wo man dem Augustus und der Roma opfert.“ Ein Sklave entzündete zwei Leuchter an der blakenden Ölfunzel, die er mitgebracht hatte, und stellte die Opferschale bereit. Der Priester ließ sich ein Messer reichen und trieb den Sklaven zur Eile an. Ohne Überleitung begann er einen alten Apollohymnus zu leiern, dem bei der Anrufung der Name des Augustus eingefügt war. Mit Gesten bedeutete er, dass Lucius und der Fremde die Beine des Lammes halten sollten, das sich heftig zu sträuben begann.
„Halt“, unterbrach ihn Ovid, „ich wünsche dem vergöttlichten Julius Cäsar zu opfern.“
„Schon recht“, anwortete der Priester, gab dem Sklaven einen Wink und sang weiter. Der Sklave ging in den Tempel, holte aus einem Schrein eine kleine Bronzebüste, die nur durch die mit einer Haarsträhne dürftig verdeckte Glatze und die tiefen Furchen in den Wangen Ähnlichkeit mit dem ermordeten Diktator wahrte, und stellte sie auf den Altar.
„Ich wünsche, dass es mit dem Opfergerät und dem Ritus der Minerva geschehe“, beharrte Ovid.
„Dies ist das Opfergerät der Minerva“, zischte der Priester ärgerlich und sang weiter. Der Dichter gab auf. Er hielt mit Lucius das Lamm, der Priester öffnete dem Tier den Hals und ließ das Blut in die silberne Schale strömen. Dann schnitt er den erschlafften Leib auf, trennte die Eingeweide heraus und gab das ausgeweidete Lamm dem Sklaven. Der trug es fort. Er häufte die Eingeweide auf einen Bronzeteller, übergoss sie mit Öl und zündete sie an. Die Flamme schlug kurz empor und erhellte den Altar. Ein flackernder Schein fiel in den Tempel und erreichte den ins Leere blickenden Kopf des Augustus und tanzte über die polierte Cäsarbüste. Blut und Wein, die der Priester, nun eine Hymne auf Minerva anstimmend, ins Feuer tröpfeln ließ, verzischten auf dem schmorenden und sich schwärzenden Opfer. Der Rauch fächerte sich in der schwach bewegten Luft und wölkte in den freien Himmel. Die Stimme des Priesters zitterte. Er unterbrach sich hüstelnd. Der Dichter kehrte aus seiner Andacht zurück, nahm die Hände aus der Luft und schaute stirnrunzelnd auf die ausgestreckte Greisenhand. Dann gab er eine Silbermünze hin. Die Hand schloss sich nicht. „Man muss mehr geben“, flüsterte Lucius. Ovid seufzte und gab und wandte dem Tempel den Rücken, bevor die Flamme über seinem Opfer erloschen war.
2
Der Sturm, der zwei Tage lang vom Pontus über die Küste gefegt war, hatte eisige, klare Luft aus dem Norden herangetragen. Von der Steppe her schien die Nachmittagssonne grell über die Stadt, das noch immer bewegte Meer ragte dunkelblau wie ein Stück Nachthimmel zum klaren Horizont empor, und noch in weiter Entfernung flimmerten darauf Schaumkämme wie Sterne.
Ovid ließ sich die äußere Stadt zeigen.
„Da ist nicht viel zu sehen“, sagte Lucius. „Nur auf der Landzunge und in der Umgebung des alten Marktes gibt es Steinhäuser. Mein Vater hofft, dass der Frieden den Wohlstand unserer Bürger hebt. Aber er meint auch, je mehr Güter wir anhäufen, umso unruhiger werden die schweifenden Völkerschaften jenseits des großen Stromes Hister, den man in Rom, glaube ich, Danubius nennt.“
Der Dichter betrachtete den Jungen. Ein Schmunzeln flog um seinen Mund. „Du sprichst, als mühtest du dich mit einer rhetorischen Einsetzübung ab.“
Lucius wurde verlegen. „Anderen Umgang pflege ich auch nicht mit der Sprache, deren die Herren der Welt sich bedienen. Wenn ich lese, bevorzuge ich das Griechische, und wenn ich selbst schreibe, benutze ich es ebenfalls.“
Was er denn schreibe, erkundigte sich der verbannte Dichter.
„Ach, wenig“, antwortete der Junge und verfiel dabei ins Griechische. „Und das Wenige taugt wohl nichts. Es gibt ja noch so viel zu lesen. Ich denke manchmal, es ist Übermut, selbst etwas zu schreiben, ohne alle Dichter gelesen zu haben. Aber je mehr ich lese, desto zaghafter werde ich beim Schreiben. Wenn ich von vornherein weiß, dass es schlechter ausfallen wird als die Bücher, die es schon gibt – wozu fange ich überhaupt an? Und wenn ich etwas Gutes lese, empfinde ich schon fast denselben Genuss, als hätte ich es selbst geschrieben. Wenn mir ein Dichter aus dem Herzen spricht, schlüpfe ich in ihn und vermeine alsbald, er selber zu sein.“
Lucius blieb stehen. Er hatte den Gast vom Tempel des Augustus und der Roma an die nächstgelegene Stelle der Palisaden geführt, um von dort auf die Landzunge zurückzukehren, damit der Umweg nicht allzu weit ausfiele. Nun standen sie auf dem Geländestreifen zwischen Palisaden und Hütten, der von Zeit zu Zeit umgepflügt wurde, damit im Verteidigungsfall das wuchernde Unkraut nicht hinderlich wäre. Trotzdem hatten die Anwohner in den zurückliegenden friedlichen Jahren das Gewohnheitsrecht ertrotzt, die Innenseite der Palisaden für sich zu nutzen. Hier lehnten Brennholzstapel daran, dort wurden sie als Rückwand für einen Schuppen oder ein Waschhaus genutzt. Hühnerställe und Schweinekoben breiteten sich aus. Sogar eine Holzhütte klebte am Fuß eines Wachtturms. Davor hockte ein Greis, dessen grobe, geflickte Kleidung seltsam von dem sauber gekämmten, schulterlangen weißen Haupthaar und dem zwar langen, aber dennoch sichtlich gepflegten Bart abstach.
„Ich fürchte, mein Vater missbilligt es, und bitte deshalb um Verschwiegenheit: Es gibt schon einen Verbannten hier. Du hast gewissermaßen einen Kollegen, einen mehr als hundertjährigen Philosophen aus Athen. Der lehrte mich das Griechische. Ich möchte euch einander vorstellen.“
Ovid sah neugierig zu dem Alten hinüber. Der Philosoph, der blicklos vor sich hin gesprochen hatte, begrüßte Lucius, indem er ihm übers Haar strich. „Wo warst du so lange?“
„Ich darf nicht mehr“, antwortete Lucius. Der Dichter trat näher und wartete unbeweglich. „Du bekommst Gesellschaft. Dies ist ein verbannter Dichter aus Rom.“
„Ich bin selber verbannt genug“, sagte der Alte mürrisch und schaute zur Seite.
Ovid verneigte sich kurz, nannte seinen Namen und verlangte den des Greisen zu wissen.
„Unwichtig“, antwortete der Philosoph. „Wir haben uns nichts zu sagen. Die Römer sind meine Feinde, denn sie sind die eigentlichen Barbaren. Gute Dichter haben sie nicht. Und auch gute Dichter treiben nichts als Firlefanz.“ Er warf den Kopf zurück, griff mit seinen kurzen Fingern in eine nicht vorhandene Kithara und plärrte absichtlich schrill den Anfang einer Ode. Kopfschüttelnd und lachend unterbrach er sich. „Kindisches Zeug, um zu vergessen, dass man lebensmüde ist. Man wird es aber nur noch mehr davon.“ Er verzerrte sein Gesicht zu einer tragischen Grimasse und heulte sophokleische Verse.
Gaffer stellten sich auf, vorwiegend Weiber, die einander anrempelten und loslachten. Der Philosoph lachte mit und rieb sich Tränen aus den Augen. Plötzlich musterte er Ovid. Stille trat ein. „Du wirst es hier nicht lange machen“, sagte er dumpf.
„Nun ja“, bemerkte der Dichter, „das Versehen, das mich hierherbrachte, dürfte bald aufgeklärt sein.“
„Das meine ich nicht“, sagte der Alte. „Du bist krank, ich sehe es. Aber hier ist kein Badeort, das lass dir gesagt sein. Ich bin jetzt hundertsechs Jahre alt und hause hier seit der Schlacht bei Philippi. Aber dich samt deinem Kaiser überlebe ich noch! Nicht weit von hier, heißt es, ist Orpheus, der Sänger, von Mänaden in Stücke gerissen worden. Was gibt es da zu jammern? Er wollte ohnehin nicht mehr leben. Man kommt nicht aus Versehen an den Pontus, schon gar nicht als Dichter. Man kommt an den Pontus, weil man reif ist dazu!“
3
In der Villa des Präfekten roch es nach einem Festessen. Quillius Postumus empfing den verbannten Dichter in einer frischen Toga und bestätigte, dass der Aufwand ihm gelte. Er habe noch Zeit zu baden und die Kleider zu wechseln. Lucius huschte in die Küche, wo seine Mutter und seine Schwester zwei Sklavinnen umherscheuchten, und sah in die Töpfe.
Ovid konnte sich nicht erklären, was ihm die, wie ihm schien, übertriebene Gastfreundschaft des Präfekten einbrachte. Während er ins Dampfbad hinabstieg, wo ihm ein Syrer mit Tüchern, Schwämmen, Öl und duftenden Essenzen aufwartete, während er sich in der hölzernen Wanne streckte und den Thymiandampf einatmete, wandte er immer wieder überraschend den Kopf, ob sich ihm niemand mit einer Waffe näherte. Seit seiner überstürzten Abreise aus Rom argwöhnte er überall gedungene Mörder. Auch sein plötzlicher Entschluss, von Thrakien aus auf dem Landweg nach Tomi zu reisen, wurzelte in dieser Angst. Lieber wollte er Barbaren in die Hände fallen als römischen Schergen, die vielleicht heimlich an einer abgelegenen Küste vollziehen sollten, was in der Öffentlichkeit Roms den Glanz der kaiserlichen Milde getrübt hätte. Lieber wollte er der Nachwelt verschollen gelten in den Bergen Thrakiens wie Orpheus, denn an keinem Geringeren maß er sich. Nun war er aber doch gänzlich unbehelligt in diesen Ort gelangt, dessen Namen er zum ersten Mal gehört hatte, als ihm für seinen Weg in die Verbannung das Begleitschreiben mit dem kaiserlichen Siegel ausgehändigt worden war. Den Tod fürchtete er mehr als alles andere; und doch hatte er, sooft er sich das öde Nest an der Steppenküste, Skythien unmittelbar benachbart, vorzustellen versuchte, unwillkürlich gehofft, ein gewaltsamer Tod werde es ihm ersparen, dort jahrelang sein Leben zu fristen. Er schwankte zwischen dem Grauen zu leben und der Angst vor dem Sterben.
Vom Badesklaven entlassen und von einem Tafelsklaven ins Triklinium geleitet, legte er sich nicht auf das zugewiesene Polster, sondern blieb aufrecht und steif sitzen, von Unbehagen befangen, und sprang auf, als der Präfekt und sein Sohn eintraten. Er war erschrocken, dann aber von sich selbst peinlich berührt, denn es wirkte wie Unterwürfigkeit. Verwirrt zögerte er, die erneute Begrüßung der beiden zu beantworten. Stattdessen riss das Tappen eines Tafelsklaven, der sich aus dem Hintergrund näherte, ruckartig seinen ganzen Körper herum. Schon wieder glaubte er sich bedroht.
Der Präfekt schlug einen aufgeräumten Ton an. Er hoffe, das gefüllte Ferkel und ein guter zyprischer Wein, zwanzig Jahre alt, werde wechselseitig die Zungen lösen, der Gast möge gestatten, dass der noch nicht volljährige Lucius am Mahl teilnehme, und als Ersatz für die unvergleichlich geistvolle römische Geselligkeit, die er vorläufig entbehren müsse, mit dem vorliebnehmen, was das bescheidene Haus eines Präfekten am Ende der Welt bieten könne.
Der Verbannte wollte etwas erwidern. Aber um seine Mundwinkel zuckte es wie bei einem Stotterer. Seine Augen suchten Fußboden und Decke des Raumes ab, seine Hände fuhren auseinander und zeigten die Innenseiten. Als sei plötzlich etwas in ihm gerissen, fielen die unter dem Faltenwurf seiner Toga knochig sich abzeichnenden Schultern ein, und sein Kopf schob sich vor, als spüre er eine Hand im Genick.
„Ich erinnere mich jetzt“, sagte der Präfekt, als die Vorspeise aufgetragen war, „dass ich den Namen Ovidius Naso schon hier in diesem Raum habe nennen hören …“ Er sah seinen Gast abwartend an. „Falls es einem Dichter etwas bedeutet, an unserem rauen Gestade nicht ganz unbekannt zu sein. Es war ein römischer Legat, der die Befugnisse der hiesigen Selbstverwaltung und die meinigen gegeneinander abwog und neu regelte. Es gab da gewisse Misshelligkeiten. Der Mann verkehrte in den gebildetsten Kreisen, kannte Maccenas, Vergil und Horaz persönlich. Leben sie übrigens noch?“
Ovid schüttelte den Kopf.
„Von Ovid allerdings sprach er wie von etwas Besonderem und, wie mir schien, mit weniger Ehrerbietung. Es ging, glaube ich, um Meisterschaft und Dauer von Dichterwerken. Über Ovid äußerte er sich mit kühler Herablassung. Als wäre er ein erstaunliches, aber fehlgeleitetes Talent. Er könne sich niemals zu epochalen Leistungen aufschwingen, solange er sich der Verantwortung für die öffentlichen Dinge entziehe. Ja, genau so drückte er sich aus. In dem Einerlei hier prägt sich einem so etwas unauslöschlich ein. Eigentlich machte der Legat sich nichts aus Versen. Theaterskandale und Klatsch aus der kaiserlichen Familie bewegten ihn viel heftiger. Man weiß ja, die Vertrauten des Kaisers verbreiten meistens die größten Gemeinheiten über ihn. Er schien es aber zu bedauern, dass Ovid für seine schlüpfrigen Sachen Verse bemühte, statt sie von Schauspielern und Tingeltangelmädchen auf den Märkten vorspielen zu lassen.“
Ovid, anfangs befremdet, dass über ihn wie über einen Abwesenden gesprochen wurde, fragte betreten, wann das gewesen sei.
„Oh, ich weiß nicht genau, vielleicht vor zehn, vielleicht vor zwanzig Jahren.“ Der Präfekt lächelte gekünstelt und schnitt, den Vorleger beiseite schiebend, selbst das Ferkel an.
„Nun sehe ich ihn also vor mir, den berühmten Dichter Naso“, fuhr der Präfekt fort und sah dem Verbannten munter ins Gesicht. „Seinem Beinamen jedenfalls macht er alle Ehre.“
Ovid fragte, wie das gemeint sei.
Der Präfekt hatte witzig sein wollen. Aber die verständnislose Nachfrage brachte ihn in Bedrängnis.
„Ich meine dieses offenbar hartnäckig vererbte Familienmerkmal, die lange, edel gebogene Nase.“
Ovid lächelte verlegen und schwieg.