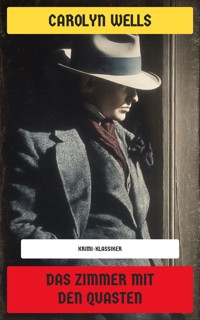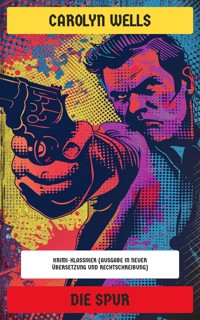1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Carolyn Wells' "Die bronzerne Hand" entführt den Leser in eine Welt voller Rätsel und Spannung, typisch für die Detektivliteratur des frühen 20. Jahrhunderts. Der Roman entfaltet sich in einer geschickten Mischung aus Intrige und Geheimnis, während ein Verbrechen von mysteriöser Natur die Aufmerksamkeit von Detektiven und Amateuren gleichermaßen auf sich zieht. Wells' Schreibstil vereint Scharfsinn mit einem ungewöhnlichen Esprit, der es versteht, die Leser in den literarischen Kontext der klassischen Whodunit-Erzählung zu verwickeln. Sie versteht es meisterhaft, Spannung durch präzise geschriebene Dialoge und eine sorgfältig konstruierte Handlung aufzubauen. Carolyn Wells war eine äußerst produktive Autorin, deren schriftstellerische Karriere sich über mehrere Genres erstreckte, von Detektivromanen bis hin zu Kinderliteratur. Geboren im späten 19. Jahrhundert, wurde sie tief beeinflusst von den Veränderungen und dem kulturellen Umbruch ihrer Zeit. Ihre Liebe zum Detail und ihre Faszination für Rätsel und Geheimnisse prägten ihre Werke tiefgreifend. Besondere Inspiration schöpfte sie aus der damals aufkommenden Popularität von Detektivgeschichten, einer literarischen Tradition, der sie mit ihrem einzigartigen Stil und ihren brillanten Plots neuen Schwung verlieh. "Die bronzerne Hand" ist ein Meisterwerk, das sowohl Kenner des Genres als auch neue Leser begeistert. Wells' kunstvoller Umgang mit Sprache und Plot schafft ein Leseerlebnis, das sowohl unterhält als auch zum Nachdenken anregt. Empfohlen für alle, die spannende und intelligente Literatur schätzen, bietet dieses Werk einen Einblick in die Feinheiten der Ermittlungsarbeit und die menschliche Psyche. Ein Muss für jeden Liebhaber klassischer Kriminalliteratur, das die Faszination für das Spiel der Logik und den Entwirrungskomplex unterstreicht. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die bronzerne Hand
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL I
DER GIPFEL
Es waren mal vier Typen – alle echt mies. Das heißt, jeder war mies, aber keiner war komplett mies. Das ist niemand.
Die vier waren durch ihre Interessen eng miteinander verbunden und unterschieden sich in ihrer Art und dem Ausmaß ihrer Schlechtigkeit.
Einer war der Handlanger, einer war der brutale Schläger, einer war der Drahtzieher hinter allem und einer war der Judas Iskariot, der die Tasche trug und die ganze Bande verriet.
Das Gute in jedem von ihnen war mehr oder weniger erkennbar. Einer war super nett zu seiner Mutter, die nie von seiner Schlechtigkeit gehört hatte und es auch nicht glauben würde, wenn sie davon erfahren hätte. Einer war großzügig und gab gerne Geschenke. Niemand bat ihn jemals vergeblich um materielle Hilfe. Einer war der Verfechter der Unterdrückten und stand in jedem Kampf immer auf der Seite der Unterlegenen und half ihnen. Und einer – nun, er machte es sich zur Ehrensache, geliehene Bücher immer zurückzugeben. Vielleicht war seine gute Eigenschaft die ungewöhnlichste von allen.
Der eine war ein sympathisch aussehender Kerl mit tief liegenden Augen und einem strahlenden Lächeln. Der andere war unscheinbar, hatte aber markante, wenn auch ausdruckslose Gesichtszüge, die auf einen unbeugsamen Willen hindeuteten. Der dritte hatte feine, asketische Gesichtszüge, die seine wahre Natur verschleierten und ihm als Maske dienten. Und der vierte war von unscheinbarer Erscheinung, wie die meisten Männer.
Einer war ein ziemlich bekannter Fußballspieler gewesen. Einer war Bauingenieur gewesen und war immer noch höflich. Einer war heimlich abergläubisch. Und einer war süchtig nach Kreuzworträtseln, Bridge, Schach und Krimis, Süchte, die normalerweise zusammen auftreten.
Die vier Männer kommen in dieser Geschichte vor, ebenso wie einige andere Männer und ein paar Frauen, die zu gegebener Zeit auftauchen werden.
Vor vielen Jahren schrieb Kipling:
„Das Passagierschiff ist eine Dame, und sie sieht nie aus und braucht auch nichts.“
Und vielleicht war die vornehmste Dame, die jemals die Wellen befuhr, das Passagierschiff Pinnacle, als es an einem Sommernachmittag den New Yorker Kai verließ und Kurs auf Liverpool nahm.
Ohne zu schauen oder zu beachten, dampfte sie majestätisch den Hudson hinunter und hinaus aufs Meer.
Viele ihrer Passagiere blieben, nachdem sie sich mit ihren Freunden auf dem Pier die Kehle heiser geschrien hatten, an Deck, um zuzusehen, wie die Wolkenkratzer entlang der Skyline von Manhattan immer kleiner wurden.
Die Pinnacle war, wie ihr Name schon sagt, das Nonplusultra unter den Dampfschiffen. Sie war in Wahrheit der Inbegriff von Luxus, und die Passagiere der Ersten Klasse, die die Gangway überquerten, repräsentierten vielleicht genug Gold, um das Schiff zum Sinken zu bringen.
Passend dazu hatte die Natur einen perfekten Tag zum Segeln beschert.
Obwohl es der erste Tag im Juli war, schien der Juni noch nachzuhalten, und das Blau von Meer und Himmel wurde von einer Sommersonne vergoldet, die ihre Strahlen freundlicherweise abmilderte, indem sie ab und zu hinter weißen Wolken verschwand.
Eine angenehme Brise trug zusätzlich zum Wetter bei, und wie ein alter Dichter es ausdrückte:
„alles voller Leben und Licht war“.
Nachdem die Freiheitsstatue passiert war, hatte der Deckssteward plötzlich alle Hände voll zu tun, um zu erklären, warum er hartnäckigen Passagieren Sitze zugewiesen hatte, die schon lange von anderen reserviert waren.
Aber der Deckssteward war ein sympathischer Typ, der mit seinem strahlenden Lächeln und seiner beschwichtigenden Art die meisten seiner Zugeständnisse an Bestechung und Korruption durchgehen ließ.
Zur Teezeit waren alle Stühle beschriftet, und die meisten der begünstigten Frauen waren in ihre Kabinen gegangen, um ihre Blumen und Geschenke zu begutachten, während die Männer Bekannte aufsuchten und ihnen Zigarren anboten.
Aber der Ruf des Tees lockte viele auf ihre Liegestühle, und die Reisegefährten plauderten und tauschten sich aus.
„Cox ist an Bord“, sagte Amy Camper zu ihrem Mann, während sie ein Tablett auf ihren Knien balancierte und Tee in zwei Tassen einschenkte.
„Ja, ich habe ihn gesehen. Der schmierige Oscar ist in bester Verfassung.“
„Das ist er immer. Er scheint allein zu sein.“
„Ich glaube, er hat eine Sekretärin oder eine Art Assistentin. Ich werde ihn jedenfalls nicht stören. Sag mal, Amy, Lily Gibbs ist auch hier.“
„Oh Gott! Kann ich dieser Frau denn nie entkommen? Na ja, sie wird sich bestimmt bald an Oscar Cox hängen.“
„Das wird sie tun. Hat sie sogar schon – zumindest steht ihr Liegestuhl direkt vor seinem. Schau mal.“
Amy Camper schaute pflichtbewusst hin und sah Oscar Cox, den Ölmagnaten, in einem Stuhl in der hintersten Reihe sitzen, während die lebhafte Miss Gibbs in der Reihe davor saß.
Es war Samstagnachmittag, und nach dem Tee fühlten sich alle entspannt und freundlich, und die Sitzenden beobachteten die Vorbeigehenden, während diese wiederum über ihre trägen Nachbarn diskutierten.
Zwei junge Männer gingen auf dem Deck auf und ab.
Es waren Pollard Nash und Harold Mallory, die sich erst seit zwanzig Minuten kannten.
Jemand hatte einem von ihnen gesagt, er solle den anderen suchen, und das Ergebnis war eine sofortige gegenseitige Sympathie.
„Ich frage mich, wer dieses Mädchen ist“, sagte Nash, als sie an einer stillen Gestalt in schlichter, eleganter Kleidung vorbeikamen, die verträumt aufs Meer hinausblickte.
„Das ist schon das vierte Mädchen, über das du dich wunderst“, meinte Mallory. „Du bist ein kleiner Wunderer, Nash.“
„Ja, das bin ich immer. Ich bin wohl von Natur aus neugierig. Aber dieses Mädchen übertrifft alle anderen. Eine Prinzessin in Verkleidung, würde ich sagen.“
„Dann ist sie nicht besonders gut getarnt, denn sie hat all die Unnahbarkeit und Verachtung, die man normalerweise mit Königshäusern verbindet.“
„Nun, das können wir erst herausfinden, wenn wir es schaffen, uns richtig vorzustellen. Das ist das Schlimmste an diesen tollen großen Booten. Alle sind unnahbar. Ich mag die altmodischen kleinen Kähne, wo man Bekanntschaften schließen kann, wenn man will.“
„Die sind geselliger. Aber mir gefällt die Zurückhaltung und Exklusivität dieser Boote besser. Wer will schon, dass alle möglichen Leute einen anrempeln und lautstark begrüßen und so?“
„Hallo, da ist Cox, der Ölmann. Kennst du ihn?“
„Nein, kennst du ihn?“
„Nein, aber bald werde ich ihn kennenlernen. Er ist ein Typ, mit dem ich mich gerne unterhalten würde.“
„Warum sagst du ihm das nicht einfach? Er sieht gelangweilt und wahrscheinlich einsam aus.“
„Er würde mich über Bord werfen.“
„Vielleicht auch nicht. Trau dich doch, es zu versuchen. Ich steh daneben und fang dich auf, wenn du über die Reling gehst.“
Angestachelt durch Mallorys Sticheleien blieb Nash in der Nähe des Stuhls des Millionärs stehen.
„Mr. Cox, richtig?“, sagte er in einem lässigen, freundlichen Ton.
„Ja“, sagte Oscar Cox. „Kennen wir uns?“
„Das werden wir gleich sein“, sagte der unerschütterliche Nash. „Ich bin Pollard Nash, und das ist mein neuer Freund Mallory. Sehen Sie, Mr. Cox, ich könnte Dutzende von Leuten an Bord holen, um uns vorzustellen – aber was bringt das?“
Nash war einer dieser blauäugigen Menschen, denen man kaum kühl begegnen konnte. Seine Art strahlte eine angenehme, uneigennützige Herzlichkeit aus, und neun von zehn Menschen hätten ihm gegenüber wohlwollend reagiert.
Außerdem war Oscar Cox bester Laune. Er hatte kürzlich etwas erreicht, was er sich sehr gewünscht hatte, er war auf dem Weg in einen langen Urlaub und hatte alle geschäftlichen Sorgen und Ängste hinter sich gelassen. Die letzten Wochen waren anstrengend, ja sogar gefährlich gewesen, aber sie waren vorbei, und jetzt, auf See, wo alle Streitigkeiten beigelegt, alle Probleme gelöst und alle Gefahren überwunden waren, war der große Mann geistig, moralisch und körperlich mit sich selbst im Reinen.
Das erklärte, warum er amüsiert über Nashs Dreistigkeit kicherte, anstatt ihn zu beschimpfen und ihn wegzuschicken.
„Das stimmt“, erwiderte er und lächelte die beiden Männer vor sich an. „Gehen wir ins Raucherzimmer und schauen wir mal, was wir tun können, um unsere Bekanntschaft zu festigen – vielleicht sogar eine Freundschaft.“
Als er von seinem Stuhl aufstand, zeigte sich, dass er jünger war, als sie gedacht hatten, denn sein weißes Haar täuschte. Tatsächlich war Oscar Cox gerade einmal fünfzig Jahre alt, und sein gesamter Körperbau spiegelte dieses Alter wider, aber sein weißes Haar, obwohl üppig und lockig, ließ ihn älter erscheinen.
Er war enorm reich, und obwohl es Leute gab, die ihn als „Profiteur“ bezeichneten, schätzten ihn seine Freunde, und davon hatte er viele, lediglich als einen gewieften und cleveren Geschäftsmann.
Seine Manieren waren charmant, außer wenn es ihm passte, unfreundlich zu werden, und auch in dieser Rolle war er sehr versiert.
Seine Kleidung war makellos und seine ganze Ausstrahlung die eines Mannes, der sich in jeder Situation wohlfühlte.
Das kurze Gespräch zwischen den dreien wurde von der Dame, die vor Cox saß, aufmerksam verfolgt – der schlagfertigen und geschäftigen Miss Gibbs.
„Kommen Sie bald wieder, Mr. Cox“, rief sie ihm nach, und er antwortete ihr nur mit einem lächelnden Nicken.
„Verdammt nervig“, meinte er, als sie die Niedergangstreppe hinuntergingen. „Manche Frauen sollte man über Bord werfen.“
„Sie scheint unangenehm zu sein“, sagte Mallory, der das eifrige Gesicht der Jungfer bemerkt hatte. „Aber es gibt auch reizende Menschen an Bord, einige, die ich gerne kennenlernen würde.“
„Das ist leicht zu regeln“, versicherte Cox ihm. „Was ich nicht für dich arrangieren kann, wird der Kapitän tun. Aber ich werde dich ein paar Leuten vorstellen. Die Campers sind nette Leute – junge Verheiratete, die innerhalb von 24 Stunden jeden kennen werden. Komm heute Abend zum Tanz in der Lounge, und sie werden den Rest erledigen.“
„Wir kommen auf jeden Fall“, versprach Nash. „Reist du alleine, Mr. Cox?“
„Ja, außer meinem Schutzengel, einem missratenen Freak, der auf meine Sachen aufpasst. Er heißt Hudder und ist dümmer als sein Name. Seid ihr allein hier?“
„Ja“, antwortete Mallory. „Ich mache einen kurzen, aber wohlverdienten Urlaub, und mein neuer Freund hier macht einen längeren, aber nicht so wohlverdienten.“
„Du weißt ja viel darüber“, lächelte Nash. „Aber da du mich vor einer halben Stunde noch gar nicht kanntest, muss ich zugeben, dass du mich ziemlich gut durchschaut hast.“
„Ja, das tue ich. Ich wette, deine Freunde nennen dich Polly.“
„Das natürlich“, warf Cox ein. „Wie könnten sie auch anders? Ein Mann namens Pollard lädt zu diesem Spitznamen ein. Wie lautet deiner, Mr. Mallory?“
„Hal Mall, so natürlich wie Polly’s. Und ich kenne Ihren Namen, Herr – Sie sind Glitschiger Oscar.“
„Ja, aber Gott sei Dank bezieht sich das Adjektiv auf Öl als Material und nicht auf irgendwelche Eigenschaften meines Charakters.“
„Das kann ich gut glauben“, sagte Mallory und lächelte kurz. Denn was auch immer Cox' Fehler oder Tugenden waren, er war weit entfernt von dem Typ Mann, den man als „schmierig“ bezeichnet.
Oscar Cox war direkt, fast schon unverblümt in seiner Ausdrucksweise, abrupt in seinen Aussagen und entschlossen in seinen Entscheidungen. Er war niemals jemand, der mit Schmeicheleien oder leeren Worten um sich warf.
Und er war ein guter Geschichtenerzähler. Kein Schwätzer, denn dieses Wort klingt nach einem langatmigen, eingebildeten Langweiler, sondern ein schneller, anschaulicher Redner, dessen Geschichten pointiert, prägnant und kurz waren.
Als das Gespräch auf ferne Länder kam, erzählte er von den mutigen Heldentaten seines Neffen und Namensvetters.
„Der junge Oscar Cox“, sagte er, „ist furchtlos und oft unvernünftig waghalsig. Er ist gerade auf Großwildjagd irgendwo in Südamerika. Das heißt, wenn das Großwild ihn nicht gejagt hat. Er ist auf einer ziemlich anstrengenden Expedition, und ich hoffe inständig, dass er lebend nach Hause kommt.“
Es wurden weitere Details über die Unerschrockenheit des jungen Mannes erzählt, und alle waren erstaunt, als der erste Hornruf die Annäherung der Essenszeit ankündigte.
Polly Nash und Hal Mall sicherten sich einen Tisch für sich allein in dem eleganten Restaurant und waren nicht überrascht, Cox allein an einem Tisch auf der anderen Seite des Raumes zu sehen.
Während sie interessiert die hereinströmenden Gäste beobachteten, sahen sie einige, die sie bereits kannten, und viele andere, die sie gerne kennenlernen würden.
„Bist du ein guter Tänzer, Hal?“, fragte Nash.
„Der beste der Welt.“
„Außer mir selbst. Bist du ein Bridge-Ass?“
„Nicht der Beste, aber ein solider, zuverlässiger Spieler.“
„Gut. Ich sehe uns schon nach ein oder zwei Tagen als die Seele der Party. Viele hübsche Mädchen, aber nicht so viele charmante junge Männer.“
„Ich bin eher ein Outdoor-Typ. Deck-Sportarten bedeuten mir mehr als Jazz im Salon. Da ist ja die altjungferliche Frau mit den Glubschaugen. In ihrer Abendgarderobe sieht sie noch unattraktiver aus, oder?“
„Ja, schon“, und Nash schaute kritisch auf die selbstgefällige Miss Gibbs, die in einem schwarzen Chiffonkleid glänzte, das von einer Reihe schwarzer Perlen über einer Schulter gehalten wurde. „Aber ich glaube, Mall, ich verachte die Dame nicht. Sie wirkt auf mich intelligent, einfühlsam und aufmerksam.“
„Was für eine Diagnose auf den ersten Blick! Na gut, du kannst sie haben. Ich nehme die geheimnisvolle Prinzessin. Sie ist heute Abend ein Traum.“
Nash drehte sich schnell um und sah das Mädchen, das ihm auf dem Deck aufgefallen war, allein den Raum betreten.
Obwohl sie sehr jung war, höchstens einundzwanzig, wie er schätzte, hatte sie eine Ausstrahlung und ein Savoir-faire, um die sie eine echte Prinzessin beneiden könnte. Aber es war die Selbstachtung und Selbstsicherheit eines amerikanischen Mädchens, eines Mädchens, das nach den besten amerikanischen Sitten und Gebräuchen erzogen worden war.
Sie trug ein helles, geblümtes Chiffonkleid, zierlich kurz und mit einem angenehm gerundeten Ausschnitt, eine Kette aus wunderschönen Perlen als einzigem Schmuck.
Es war ein Kontrast zu den klimpernden Perlen und zahlreichen Armbändern der meisten anwesenden Frauen, aber das Kleid stammte aus Paris und die Perlen waren echt, während das Gesicht des Mädchens selbst so naiv erfreut und so offen von der Szene vor ihr unterhalten war, dass sie mühelos alle Blicke auf sich zog.
Ohne jede Spur von Selbstbewusstsein ging sie durch den Raum, blieb an einem kleinen Tisch stehen und wechselte ein paar Worte mit dem herumstehenden Oberkellner.
Unterwürfig stellte er ihren Stuhl hin und erledigte seine notwendigen Aufgaben.
Polly Nash schaute ihn still bewundernd an.
Da er ein Fan der Opern von Gilbert und Sullivan war, zitierte er:
„The maid was Beauty's fairest Queen, With golden tresses, Like a real Princess's,”
„Sie sind nicht golden“, korrigierte Mallory ihn.
„Na ja, sie sind goldbraun, eine Art poliertes Gold – angelaufenes Gold, Altgold, wenn du so willst. Für mich sehen sie jedenfalls golden aus.“
„Du bist verliebt, es war Liebe auf den ersten Blick.“
„Ja, wie die Motte vom Stern. Du bist auch vernarrt. Nur denkst du, es sei klüger, es nicht zu zeigen.“
„Was mir an ihr am besten gefällt, ist ihre fröhliche Art. Sie scheint ihre Einsamkeit nicht zu spüren, sie ist ganz in ihre Umgebung vertieft. Warum glaubst du, ist sie allein?“
„Wahrscheinlich ist ihre Zofe seekrank. Ich frage mich, wer sie ist.“
„Das werden wir heute Abend herausfinden. Ich werde als Erster mit ihr tanzen. Der Kapitän wird mir den Weg ebnen.“
„Okay“, Nashs Blick war abgeschweift, ebenso wie seine Aufmerksamkeit. „Meine Güte, Mallory, da ist Trent – Max Trent!“
„Wer ist das? Eine Berühmtheit?“
„Nicht unbedingt. Aber er ist einer der besten Schriftsteller der Welt. Er schreibt Krimis, aber auch Literatur.“
„Du meinst, seine Geschichten sind Literatur? Das ist, als würde man veredeltes Gold vergolden und die Lilie bemalen. Eine gute Detektivgeschichte muss keine Literatur sein. Tatsächlich mindert gutes Schreiben ihre Stärke.“
„Wer redet hier von gutem Schreibstil? Seine Bücher sind die besten –.“
„Die Krimi-Spitze? Das ist nicht gerade eine große Ehre.“
„Na gut. So reden alle, die sich nicht für Krimis interessieren. Ich würde lieber diesen Mann treffen als all deine tanzenden Prinzessinnen oder schmierigen Würdenträger.“
„Nun, das wirst du wahrscheinlich hinbekommen. Der Captain kann das sicher arrangieren.“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht. Autoren sind eine exklusive Gruppe.“
Nach dem Abendessen schlenderten fast alle in den geräumigen und spektakulären Saloon, wo ein gutes Orchester bereits die Ohren der Musikliebhaber erfreute.
In der Mitte des großen Raumes befand sich eine Tanzfläche, während an den Rändern Tische und Stühle für diejenigen standen, die sie nutzen wollten.
Bald war es wie ein informeller Tanzabend. Wenn man es verdient hatte, wurde man sofort vorgestellt. Man lernte sich kennen, und die elegant gekleideten Männer und wunderschön gekleideten Frauen füllten die Tanzfläche mit einer strahlenden, sich wiegenden, lächelnden Menge, die für die Zuschauer ein faszinierendes Bild abgab.
Pollard Nash erreichte sein Herzenswunsch ohne jede Mühe. Denn als der Kapitän ihn dem Autor Max Trent vorstellte, empfing dieser Genie den Fremden sehr freundlich und schien ganz auf ein Gespräch aus zu sein.
Mallory war jedoch nicht so erfolgreich. Trotz aller guten Absichten gelang es Kapitän Van Winkle nicht, eine Vorstellung bei dem prinzessinnenhaften Mädchen zu erreichen.
„Sie ist ein Fräulein Forman“, sagte der Hauptmann. „Sie reist allein und wünscht keinerlei Bekanntschaften zu machen – es sei denn, sie wählt sie selbst.“
„Wer ist sie?“, fragte der enttäuschte Mallory. „Warum ist sie allein?“
„Ich weiß es leider nicht! Sie hat mir nichts erzählt, außer den Infos aus ihrem Reisepass. Aber ich würde sagen, sie kann gut auf sich selbst aufpassen. Wenn nicht, bin ich ja da, um auf sie aufzupassen. Bisher habe ich aber noch keinen Grund dafür gesehen.“
„Oh, okay. Dann stell mich doch bitte der Sirene in Schwarz dort drüben vor. Vielleicht tanzt sie ja mit mir.“
Der Kapitän starrte ihn an.
„Du neigst wohl zu Extremen, nicht wahr?“ sagte er lächelnd. „Fräulein Forman ist ohne Zweifel die Schönheit des Schiffs, während Fräulein Gibbs—.“
„Ja, sie sieht aus wie eine Köchin“, sagte Mallory freundlich, „aber sie ist meine Wahl.“
Er erklärte nicht weiter, dass er die Vorstellung hatte, dass Miss Gibbs die Art von Person war, die in kürzester Zeit jeden an Bord kennenlernen würde. Und dass er mit ihr als Freundin am Hof später vielleicht die Prinzessin erreichen könnte.
Lily Gibbs lächelte erfreut über das Erscheinen dieses äußerst vorzeigbaren jungen Mannes und tanzte voller schmeichelnder Freude mit ihm.
Sie kreisten über die Tanzfläche, und dabei erfuhr er viele Klatschinformationen über die Passagiere.
Fräulein Gibbs hatte die wenigen Sonnenstunden, die bereits vergangen waren, emsig genutzt, um Heu zu machen, und war mehr als bereit, ihr Wissen weiterzugeben.
Und später, als sie über eine kleine Erfrischung redeten, ließen sie sich auf eine regelrechte Orgie von Klatsch und Spekulationen über alle an Bord ein.
„Die Campers sind nette Leute“, verriet das Orakel. „Owen ist sportlich und so, aber er hat auch Köpfchen. Amy ist reizend, aber sie kommandiert ihn furchtbar herum. Sie ist fünf Jahre älter als er – aber sie sind glücklich, so wie die Dinge laufen. Der Mann, der gerade vorbeigegangen ist, ist Sherman Mason, ein New Yorker Clubmitglied.“
„Ist das seine Frau, die da bei ihm ist?“
„Oh nein! Er ist Junggeselle und verachtet Frauen, außer um ab und zu mit ihnen zu flirten. Er liebt das Tanzen.“
Da ihn diese Beschreibungen von Leuten, die ihn nicht interessierten, langweilten, wagte Mallory einen Sprung.
„Wer ist das ruhige kleine Mädchen, das dort drüben in der Nische mit den blauen Vorhängen sitzt?“
Fräulein Gibbs warf ihm einen raschen Blick zu.
„Jetzt kommst du also dazu? Ich wusste, dass du das unbedingt fragen wolltest.“
„Warum nicht? Sie ist eines der hübschesten Mädchen an Bord.“
„Ach, meinst du? Aber die beiden, die gerade auf uns zukommen, sehen viel besser aus als sie!“
Die erwähnten Mädchen waren vom Typ her eher temperamentvoll und trugen atemberaubende, supermodische Tanzkleider mit ausgefallenem Design.
„Natürlich“, erwiderte er lächelnd, „wenn du diesen Stil magst, interessiert dich das zurückhaltende kleine Ding nicht.“
„Sie ist gar nicht so schrecklich sittsam. Das ist Maisie Forman, und sie ist so unabhängig, wie man nur sein kann. Sie lässt sich nur mit Leuten ein, die sie sich selbst aussucht.“ Fräulein Gibbs wirkte ein wenig enttäuscht. „Mich hat sie nicht ausgesucht.“
„Mich auch nicht“, sagte Mallory mitfühlend und lächelte. „Lass uns eine Abmachung treffen. Wenn eine von uns sie kennenlernt, stellt sie der anderen vor. Wie findest du das?“
„Ein wenig einseitig …“ – doch Fräulein Gibbs sagte nicht, welche Seite sie meinte. „Wie dem auch sei, ich willigt ein“, und sie reichte ihre Hand darauf.
„Gute Jagd?“, fragte Hal Mallory Pollard Nash, als sie sich kurz vor dem Schlafengehen im Raucherzimmer trafen.
„Gut“, antwortete Nash. „Ich hab mich lange mit Trent unterhalten. Er ist super! Dann kam Oily Cox dazu, und er erzählte Geschichten, und Trent auch, und bald hörte eine ganze Gruppe von Leuten zu. Wie war dein Abend?“
„Nichts. Zumindest bisher. Vielleicht treffe ich sie später noch, aber ich bezweifle es.“
„Wen? Wen treffen?“
„Na, die Prinzessin, die wir im Speisesaal gesehen haben. Übrigens, sie heißt Forman – Maisie Forman.“
„Warum hast du sie nicht kennengelernt?“
„Sie ist zu exklusiv. Aber ich habe von dem Gibbs-Charmeur einiges über sie erfahren.“
„Oh ja, die Frau, die ein Auge auf Cox geworfen hat. Übrigens, Mallory, Cox hat ein paar Geschichten über seinen Neffen erzählt, der nach ihm benannt ist, weißt du. Und er hat ihn zu einem Finanzier in Chicago gemacht!“
„Und?“
„Erinnerst du dich nicht, dass er heute Nachmittag gesagt hat, der Typ sei ein Großwildjäger und jetzt in Südamerika?“
„Aber ein Geschäftsmann kann in seiner Freizeit doch auch jagen.“
„Ich weiß, aber Oily Cox hat heute Abend erzählt, dass sein gleichnamiger Neffe gerade in Chicago arbeitet. Er widmet sein ganzes Leben und seine ganze Energie dieser Arbeit und wird schnell zu einer Macht an der Börse im Westen.“
„Cox ist verrückt, denke ich ...“
„Nein, alles, nur das nicht. Was sagte Fräulein Gibbs über ihn?“
„Nichts. Wir haben ihn kaum erwähnt. Aber ich sag dir, diese kleine Dame hat über jeden auf diesem Kahn die Wahrheit im Griff. Sie tanzt, als hätte sie ihre Gummistiefel an, aber sie lässt sich von niemandem täuschen!“
„Nein?“
„Nein.“
KAPITEL II
DIE PASSAGIERE
Sonntagmorgen ist überall auf der Welt Sonntagmorgen.
Egal wie die Situation ist, egal wo man ist, egal wer die Leute sind, der Sonntagmorgen hat einfach seine eigene Atmosphäre, die man nicht übersehen kann.
Er ist völlig unkonfessionell, macht keine Unterschiede zwischen den Menschen und jeder spürt seinen Einfluss mehr oder weniger stark.
Aber das ist nicht unangenehm. Es ist eher wie ein Segen, mit seiner ruhigen, friedlichen Wirkung nach außen und seiner unterschwelligen Reinheit und Frömmigkeit.
Und der Sonntagmorgen auf der Pinnacle war ein bisschen wie das Lotusland, über das ein Dichter geschrieben hat, wo immer Samstagnachmittag ist. Die Sonne schien sanft golden, die Luft war flaumig weich und die blauen Wellen waren Berge, die wie kleine Lämmer hüpften.
Die Aussicht auf Bouillon und Sandwiches zog wie ein Magnet hungrige Passagiere, die seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatten, an Deck.
Sie kamen nicht einzeln, sondern in Scharen, gut gekleidet, gepflegt, mit guten Manieren und mehr oder weniger hörbar guter Laune.
Lily Gibbs saß schon früh auf ihrem Stuhl, aufmerksam und bereit, jede Kleinigkeit über ihre Nachbarn mitzubekommen.
Die Nachbarn, die meist mit ihren eigenen Angelegenheiten und ihren eigenen Begleitern beschäftigt waren, huschten um sie herum, ohne sie zu bemerken, während die weitläufige Reihe von Teppichen und Kissen ihren Platz fand.
Mallory und Nash machten ihre täglichen hundert Runden auf dem Deck und hielten oft an, um sich die Zeit am Sonntagmorgen zu vertreiben.
Zuvor hatten sie sich mit Garson, dem Deck-Steward, beraten, mit dem Ergebnis, dass sie nun Stühle mitten im Geschehen hatten. Das heißt, in unmittelbarer Nähe der Stühle von Oscar Cox und mehreren anderen finanziell bedeutenden Männern, den Campers und mehreren anderen gesellschaftlich bedeutenden Bürgern sowie einer Handvoll der überaus wichtigen jüngeren Generation.
Zwei von diesen stürzten sich auf die jungen Männer, als sie auf ihre Stühle zukamen, und beanspruchten sie für sich.
„Du kannst Gladys sein, Mr. Mallory“, zwinkerte Sally Barnes ihm zu, „und Mr. Nash gehört mir. Sei jetzt nett und besitzergreifend, okay?“
Die beiden Männer sprachen diese Sprache fließend und reagierten entsprechend, als sie die Plätze einnahmen, die die Mädchen ihnen zugewiesen hatten.
Das Quartett hatte sich schon vorher getroffen, und da es ihnen nicht gelang, die exklusive Miss Forman kennenzulernen, hatte Mallory vorgeschlagen, sich an diese hübschen kleinen Flapper zu hängen.
Die Mütter der Flapper saßen in der Nähe und lächelten nachsichtig über die Albernheiten ihrer geliebten Sprösslinge.
Dann erschien Oscar Cox an Deck.
Das Publikum stand nicht auf, aber sie erwiesen ihm die Ehre, sich in ihren Stühlen zur Seite zu drehen, ihre Hälse zu recken und ihn intensiv anzustarren, während er seinen triumphalen Auftritt hatte.
Ganz in Weiß gekleidet und eher wie ein Segler auf seinem eigenen Boot als wie ein einfacher Passagier aussehend, wurde er von einem seltsam aussehenden kleinen Mann begleitet, der ganz und gar den Eindruck eines Faktotums machte.
Ohne auf irgendetwas anderes zu achten, ging er auf Cox' Stuhl zu, breitete eine Decke aus, setzte seinen Chef darauf, faltete sie mit der Geschicklichkeit einer Briefumschlagmaschine über seinen Beinen zusammen und holte dann aus einer Tasche, die er trug, ein Lederkissen, einige Zeitschriften, eine blaue Brille und ein Fernglas hervor.
Er hängte die Tasche an die Stuhllehne und nach ein paar geflüsterten Worten und einem Nicken von Cox faltete er seine Flügel wie ein Araber und verschwand leise.
„Wie aufregend!“, rief Sally Barnes aus. „Mr. Cox hat einen Handlanger, einen Gefolgsmann, einen ...“
„Einen Vasallen, einen Leibeigenen an seiner Seite“, ergänzte Mallory. „Nun, er ist ein großer Mann, weißt du – ein Mann von Welt.“
„Liebesaffären?“, fragte Gladys hoffnungsvoll.
„Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn bisher nur oberflächlich. Aber ich werde es für dich herausfinden ...“
„Ich sag's ihr“, warf Cox selbst ein, der in Hörweite stand. „Ja, kleines Mädchen, ich mag Liebesaffären. Hat jemand Interesse?“
Cox hatte eine gewisse Ausstrahlung, und seine Worte zauberten nur strahlende Lächeln auf die Gesichter der aufmerksamen Mütter der Mädchen.
„Glauben Sie nicht meinem weißen Haar“, fuhr Cox fröhlich fort. „Es wurde in einer einzigen Nacht weiß, als ich einmal zu Tode erschreckt war. Ich habe übrigens einen Neffen, meinen Namensvetter, der Jahre jünger ist als ich und älter aussieht. Aber er ist Pfarrer – ein Geistlicher in Boston.“
„Ich dachte, er wäre in Südamerika“, sagte Nash plötzlich.
„Mein Neffe, Oscar Cox? Ich sag dir, er ist Pfarrer der Unitarier in Boston. Er ist seit fünf oder sechs Jahren in derselben Kirche. Seine Leute lieben ihn. Ich bin selbst nicht so begeistert von dem Jungen. Er ist mir zu sanftmütig. Aber er hat Hudder für mich gefunden – also bin ich ihm zu Dank verpflichtet. Kennst du Hudder? Mein Hausmeister? Er sieht komisch aus, ist aber super – echt super.“
„Ein faszinierender Kerl“, meinte Sally Barnes beiläufig. „Ist er Ausländer?“
„Nun, er hat spanische und italienische Vorfahren. Aber ich bin mir oft nicht sicher, ob er ein Teufel oder ein Dummkopf ist. Er hat Eigenschaften von beiden. Ohne ihn mache ich keinen Schritt, er ist so wichtig wie eine Zahnbürste. Also, wer hat Lust auf Shuffleboard oder Ringwerfen oder was auch immer ihr auf dem Sportdeck macht?“
Cox trat Hudders sorgfältig gefaltete Zeitschriften beiseite und sprang auf. Einen Moment später war der aufmerksame Begleiter an seiner Seite, schob ein oder zwei leere Stühle beiseite, half seinem Herrn ins Freie und sammelte die heruntergefallenen Zeitschriften ein.
Cox schüttelte den herumschwirrenden Helfer ungeduldig ab, suchte mit seinen Augen eine Gruppe junger Leute und ging mit großen Schritten über das Deck.
Er hielt inne, um nach den anderen zu schauen, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Reling und sah mit seinem großen, gut geschnittenen Gesicht selbstzufrieden und stolz aus; seine scharfen grauen Augen huschten in allgemeiner Vorfreude hin und her.
Etwa zwei Reihen hinter ihm lehnte Maisie Forman in ihrem Stuhl zurück, während neben ihr Max Trent aufrecht saß und eifrig über ein spannendes Thema redete.
Die allessehenden Augen des öligen Oscar nahmen sie in sich auf und huschten dann weiter zu ihren Nachbarn, ganz wie ein ruckartig schwenkender Suchscheinwerfer, der seiner Bahn folgt.
„Ist er nicht erstaunlich!“, flüsterte Maisie, als der Magnat vorbeiging und seine fröhliche Entourage ihm folgte.
„Ja“, sagte Trent und lächelte. „Er sieht aus wie ein Ereignis, das kurz davor ist, sich zu ereignen. Oder“, fügte er hinzu, „wie eine Spinne mit vielen Fliegen.“
„Du weißt doch nichts Schlechtes über ihn, oder?“, fragte das Mädchen.
„Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht, du etwa?“
„Gott, nein. Und ich will ihn auch nicht kennen.“
„Natürlich nicht. Ich wage zu behaupten, dass er in Ordnung ist, so wie solche Männer eben sind. Aber er ist sehr bodenständig, erdig. Wenn ich sage, dass ich ihn überhaupt nicht kenne, meine ich – äh – persönlich. Ich habe ihn gestern Abend in einer Menschenmenge getroffen, und er ist sehr kontaktfreudig. Er hat links und rechts Freunde gefunden.“
„Mach dir nichts aus ihm“, sagte das Mädchen und richtete ihre bernsteinfarbenen Augen auf ihn. In diesem Licht waren sie bernsteinfarben, aber manchmal schimmerten sie wie Beryll und Topas und all die Farbtöne, die altmodische Leute früher als haselnussbraun bezeichneten.
Jedenfalls waren es bezaubernde Augen, und Trent schaute ernst in sie, als er das unterbrochene Gespräch wieder aufnahm.
Die Prinzessin, wie Nash sie genannt hatte, war nicht so überheblich gegenüber Leuten, die sie mochte. Aber da sie alleine reiste, musste sie aufpassen, wo sie hintrat, und obwohl der Kapitän sie mit jedem in Kontakt bringen würde, den sie wollte, hatte sie sich bisher nur dazu herabgelassen, Max Trent, dem Geschichtenerzähler, ein Lächeln zu schenken.
Sie fand ihn interessant und unterhaltsam, und obwohl sie vorhatte, bald ein paar nette Frauen kennenzulernen, hatte sie das bisher hinausgezögert.
„Ja“, Trent nahm seine unterbrochene Erzählung wieder auf, „ich dachte, es würde mir bei meinen Detektivgeschichten nützlich sein, und so habe ich damit angefangen. Oh, ich weiß, dass es total angesagt ist, einen Fernkurs in irgendwas zu machen. Aber ich mache die Leute nach, die das machen. Ich beherrsche es, es beherrscht mich nicht. Und du wirst überrascht sein, ich habe nicht nur genug daraus gelernt, um meine Geschichten überzeugender und korrekter zu schreiben, sondern ich habe auch echt Interesse an der Detektivarbeit als Spiel gefunden.“
„Was! Du willst Detektiv werden?“
„Ich will keiner werden – ich bin einer. Ich habe mich nicht dafür entschieden. Diese Größe wurde mir auferlegt. Ich konnte einfach nicht anders. Sehen Sie, mit den Bruchstücken, die ich aus diesem Fernkurs mitgenommen habe, und meiner natürlichen Begabung für all diese Dinge bin ich einfach ein Detektiv.“
„Und wirst du – wie nennt man das? – Fälle übernehmen?“
„Oh nein, auf keinen Fall! Ich werde nicht als Detektiv arbeiten. Aber für meine Bücher ist das super. Verstehst du, ich kann bessere Detektivgeschichten schreiben, wenn ich selbst Detektiv bin.“
„Ja, das kann ich mir vorstellen!“ Sie senkte ihre Stimme. „Wer kommt da auf uns zu? Er sieht aus, als wolle er mit uns sprechen.“
Sie hatte richtig geraten, und einen Moment später blieb der Passant stehen.
„Guten Morgen, Mr. Trent“, sagte er auf ruhige, freundliche Weise. „Der Sonntag ist ein Tag, an dem jeder großzügig und wohltätig sein und seine Nächsten wie sich selbst lieben sollte. Darf ich mich also ein wenig zu euch gesellen?“
Sein Wesen und seine Rede entwaffneten Fräulein Formans plötzlich erwachten Widerwillen, und sie schenkte ihm ein solch einladendes Lächeln, dass Trent den Fremden sogleich vorstellte.
„Mr. Mason“, sagte er, „Mr. Sherman Mason aus New York.“
Trent gab Mr. Mason sofort einen Platz, und Maisie zog eine Hand aus den flatternden Enden ihres Schals, die sie festhielt, und reichte sie ihm zur Begrüßung.
Er setzte sich auf die verlängerte Vorderseite von Trents Stuhl, und das Gespräch drehte sich ganz natürlich um Bücher.
„Da kommt Ruth daher“, rief eine heitere, fröhliche Stimme, und Fräulein Gibbs, ganz ohne Einladung, gesellte sich zur Gruppe.
„Ich habe Sie gesucht, Mr. Mason“, schimpfte sie, „Sie haben mir versprochen, mich heute Morgen auf dem Deck spazieren zu führen.“
Hätte Sherman Mason seine Gedanken ausgesprochen, hätte er gesagt, dass er sie lieber über die Planke gehen lassen würde, aber er verbeugte sich nur, lächelte und bemerkte, dass der Morgen noch nicht vorbei sei.
„Nein“, stimmte Lily Gibbs zu, „und ich bin froh über deinen Abfall, denn so habe ich die Gelegenheit, die bezaubernde Miss Forman kennenzulernen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Lily Gibbs – Törichte Lily – so nennen mich manche!“ Sie kicherte passend dazu. „Oh, ich sehe schon, wir werden so gute Freundinnen werden!“
Sie suchte die Hand des Mädchens unter den umhüllenden Chiffonfalten des nutzlosen Schals und umfasste sie begeistert mit beiden Händen. „Liebe Miss Forman, wie froh bin ich, Sie meine Freundin nennen zu dürfen!“
„Danke“, sagte Maisie, und obwohl ihre Stimme süß klang, ließ etwas daran Miss Gibbs die Hand loslassen und sich aufrechter hinsetzen.
Sherman Mason, der alles beobachtet hatte, warf sich lächelnd in die Bresche, stand auf und sagte: „Komm, Miss Gibbs, sonst kommen wir vor dem Mittagessen nicht mehr zum Wandern.“
Die beiden gingen, und Trent schaute das vor ihm stehende Mädchen mit gerunzelter Stirn seltsam an.
„Ich konnte nichts dafür“, sagte er defensiv. „Detektive finden Verbrecher, aber sie können Verbrechen nicht verhindern.“
Maisie lachte leise.
„Natürlich konntest du nichts dafür. Ich kann nicht erwarten, dass ich vor der großen Armee der Geselligen geschützt werde. Und bitte denk nicht, ich sei hochnäsig. Das bin ich wirklich nicht, nur – allein, wie ich bin –.“
„Wie kommt es, dass du allein bist?“, fragte Trent leise und mit ernsthaftem Interesse, das seiner Frage jede Unhöflichkeit nahm.
„Nun, es ist einfach so gekommen, dass ich alleine überqueren muss. Wenn ich am Hafen von Liverpool ankomme, werde ich ordentlich und richtig versorgt werden.“
Während sie sprach, schaute sie aufs Meer hinaus, und ihre Antwort schien eher an sich selbst als an ihren Begleiter gerichtet zu sein.
„Bitte denk nicht, dass ich aufdringlich sein wollte“, bat er, und sie sagte schnell:
„Oh nein, das habe ich nicht. Es ist in Ordnung. Es macht nichts. Ich hätte eine Zofe mitbringen sollen, wissen Sie – aber das habe ich nicht getan. Ich werde mich einer lieben alten Dame oder einer netten jungen Matrone anschließen, dann wird alles gut.“
„Du bist sowieso in Ordnung“, sagte Trent zu ihr, „so richtig wie der Regen! Captain Van Winkle wird eine Anstandsdame für dich finden, wenn du wirklich eine willst. Aber warum lebst du nicht deine Privilegien als freie junge Amerikanerin aus und kümmerst dich selbst um dich?“
„Vielleicht werde ich das.“ Fräulein Forman wirkte noch immer zerstreut, und Trent war nicht überrascht, als sie ihre Bücher und Sachen aufhob und ihn mit einem lächelnden, doch würdevollen „Guten Morgen“ verließ.
Die ausgelassene Menge kam von ihren Deckspielen zurück, und Trent vertiefte sich schnell in ein Buch und zog seine Mütze über die Augen.
Unter dem Schirm hindurch sah er Oscar Cox vorbeigehen, umgeben von lachenden Mädchen und ihren Begleitern.
Er hörte Cox sagen: „... und bevor ich dieses Schiff verlasse, werde ich euch allen etwas erzählen, das euch vor Staunen umhauen wird! Bei Gott, das werde ich!“
Er lachte sein lautes, dröhnendes Lachen, das ansteckend, wenn auch unkonventionell war.
Der aalglatte Cox schloss links und rechts Freundschaften. Und obwohl er sich gerade inmitten einer Menge kreischender, kichernder Jugendlicher befand, fühlte er sich unter ihren tanzenden Müttern oder ihren klugen, gewitzten, geschäftstüchtigen Vätern genauso wohl.
Der Mann hatte ein Lebensmotto: Hol dir, was du willst.
Und jetzt, nach heftigen Kämpfen, hatte er bekommen, was er wollte, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem er etwas anderes wollte, war er zufrieden und glücklich.
Durch eine seltsame Laune der Natur vergeht der Sonntagmorgen immer wie im Flug, aber der Sonntagnachmittag zieht sich, außer für Verliebte, immer in die Länge.
An Bord der Pinnacle gab es, soweit man wusste, keine Verliebten, und der Sonntagnachmittag dauerte eine Woche lang.
Maisie Forman blieb in ihrer Kabine, weil sie keine Lust auf aufdringliche Fremde hatte.
Max Trent blieb auf seinem Platz, denn er fürchtete, wenn er zu seinem Liegestuhl ginge, würde Fräulein Forman ihn für lästig halten.
Die Flapper-Girls drängten sich in der einen oder anderen ihrer Kabinen zusammen und verglichen ihre Eroberungen, während ihre verehrenden Verehrer sich im Raucherzimmer versammelten und so taten, als wären sie Männer.
Fräulein Gibbs irrte ziellos umher, während sich die großen Finanzmagnaten versammelten und einander beim Geschäftemachen zuhörten.
Oscar Cox, der Größte und Klügste, sagte am wenigsten.
Sherman Mason und Owen Camper, die in den geschäftigen Märkten nur wenig weniger einflussreich waren, waren fast genauso still.
Hal Mallory und Pollard Nash, die die jüngeren Leute verachteten, hörten nur halbherzig den zurückhaltenden Meinungen und klugen Ratschlägen der Finanzgrößen zu und versuchten, Cox dazu zu bringen, lustige Geschichten zu erzählen.
Aber er war nicht in der Stimmung dazu und erwähnte nicht mal seinen etwas vielseitigen Neffen, der denselben Namen hatte.
Doch wenig später, als das Gespräch irgendwie auf Aberglauben und die Macht von Flüchen und all das kam, wurde Cox plötzlich munter.