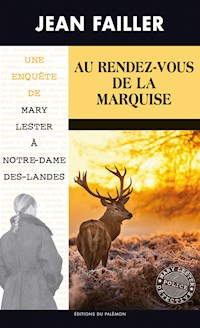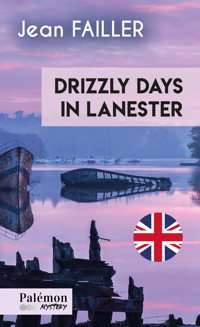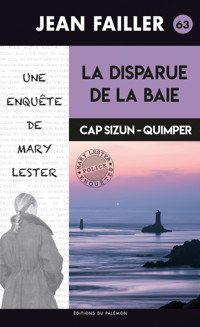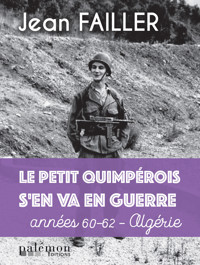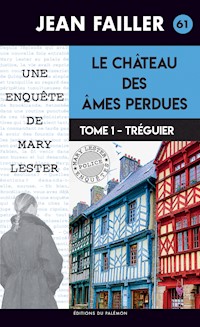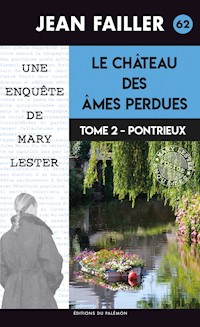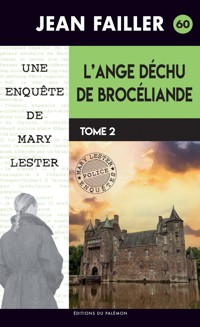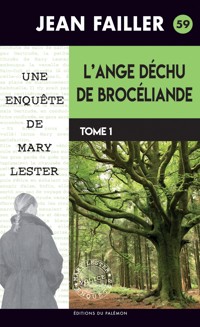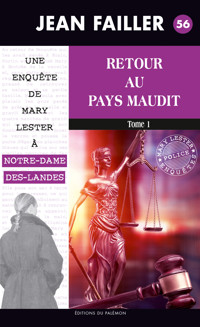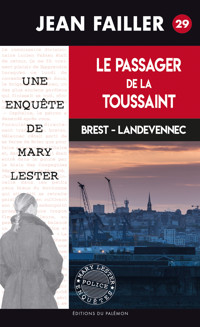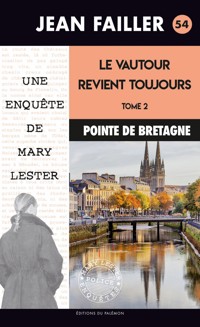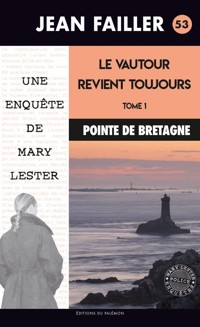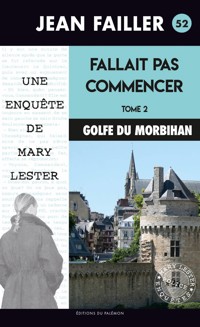Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Palémon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Bretagne Krimi
- Sprache: Deutsch
"Wenn man im Winter in der Mansarde eines bretonischen Hauses eine Leiche findet, die an Erfrierung starb, würde sich niemand in der Hafenstadt wundern. Wenn aber in der winzigen Mansarde vier erfrorene alte Menschen in eisiger Kälte auf ihren Betten gefunden werden, fragt man sich nach den Hintergründen dieser Tragödie.
Nun, wenn die Polizei irgendeiner Ecke der Bretagne ungewöhnliche Verbrechen aufklären muss, kann nur Mary Lester, Leutnant aus Quimper, die kriminellen Nebel lichten. Diesmal wird sie von Kommissar Colin angefordert. Der Chef der Behörde ist begeisterter Karnevalsnarr und in der Hochburg des bretonischen Karnevals Douarnenez will er die tollen Tage in vollen Zügen genießen.
So muss Mary auf sich gestellt in dem vier Tage dauernden Bacchanal den Fall lösen -umgeben von einer ausgelassen feiernden, tosenden Menge nicht nur friedlicher Karnevalisten und Närrinnen."
ÜBER DIE AUTORIN
Jean Failler, 1940 in Quimper geboren, ist Autor von Theaterstücken, historischen Romanen und Kriminalromanen. Er lebt und schreibt in L’Île-Tudy, in der Nähe von Quimper.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchcover
Titelseite
Dieses Buch ist ein Roman
Alle Ähnlichkeiten bzw. Übereinstimmungen mit Personen, Eigennamen, privaten Orten, Firmennamen, aktuellen oder vergangenen Situationen sind ausdrücklich dem Zufall geschuldet.
Ein herzliches Dankeschön an
Pierre Deligny
Nicole Gaumé
et au Docteur Pierre Boivin
Kapitel 1
Mary Lester schreckte aus ihrem Tiefschlaf hoch. Dröhnend klapperten Holzschuhe über das Pflaster der engen Gasse. Ihr schien es, als schrammte ein harter Gegenstand an der Mauer des Hauses entlang und auf dem Treppenabsatz öffnete sich eine Tür. Die Treppe ächzte unter schweren Schritten, ein Fenster öffnete sich knarrend, und jemand raunte wegen der frühen Uhrzeit verhalten:
„Alles klar?“
Eine raue, heisere Stimme, eine Stimme, die noch nie leise sprechen konnte, zerbrach mit einem Wort die Stille der schwindenden Nacht.
„Boucaille!“
Das reichte. Das reichte und sagte alles. Mary war die Bedeutung des Wortes vertraut, denn oft hatte sie als Kind die Ferien mit ihrem Großvater, einem Hochseefischer, auf See verbracht. Alles war grau, die Luft, die See, der Himmel – endloses Grau. Vollkommene Windstille, aber ein dünner Nieselregen, zäh, der ohne Unterbrechung vierundzwanzig Stunden niederrinnt, vielleicht sogar eine Woche lang. Boucaille – ruhig liegt die See, sanft, nur bewegt von einer langen Dünung, die aus dem weiten Atlantik heran rollt, und in der sich die Schiffe wiegen.
„Boucaille“ hatte der Seemann mit seiner markanten Stimme gesagt, und Mary hatte einen zufriedenen Unterton in der Bemerkung empfunden, die nun zwischen den vom Salz angegriffenen Granitmauern die düstere Gasse zum Meer hinunter verhallte.
Die Tage, an denen dieser Ruf im Morgengrauen ertönte, empfanden die Seemänner wie ein Geschenk des Himmels. Für die Fischerei könnte man sich kein besseres Wetter träumen; der Fisch ließ sich nach Belieben fangen.
Für die Sommerfrischler ist der „Bretonische Nieselregen“, wie sie ihn nennen, ein Alptraum – an genüssliches Bräunen auf feinem Sandstrand ist überhaupt nicht zu denken… Es sind die Tage der endlosen Dauerstaus, denn die Touristen, die bei diesem Wetter nichts mit sich anzufangen wissen, verstopfen mit ihren Autos die engen Straßen, die für diesen Andrang nicht geplant wurden. Es sind die Tage, an denen die Crèperien die Leute zurückweisen müssen, und an denen die Küstenorte von gestiefelten Menschenmassen heimgesucht werden, die wie Neufundländer in gelbem Ölzeug vermummt sind.
Aber es war Februar, und die Urlaubsgäste waren schon vor einer Ewigkeit in ihre Städte zurückgekehrt, und man erwartete sie auch nicht so bald – auf jeden Fall nicht vor Ostern. Der alte Hafen hatte seine winterliche Ruhe wiedergefunden. So war der Lauf der Zeit: Juli-August, zwei Monate Trubel, Stoßzeit, zwei Monate Leben. Es blieben zehn lange, ruhige Monate, zu ruhig.
Mary drehte sich im Bett, um auf ihre Uhr, die am Kopfende lag, zu schauen – halb sechs. Wie um die Angaben auf dem Leuchtzifferblatt zu bestätigen, tönten zwei kräftige Glockenschläge der benachbarten Kirche durch die Nacht. Einmal schlug sie für das Viertel, zweimal für die halbe und dreimal für dreiviertel und viermal, wenn die Stunde herum war. Gleich darauf löste die nächste Glocke sie ab und spulte die Schläge mit einem tiefen Ton nochmal ab. Dong… Dong… Dong… Freundlicherweise hatte die Gastwirtin, um dieses Glockengeläut ein wenig zu dämpfen, die Fenster mit Doppelverglasung ausstatten lassen. Schade nur, dass Mary die Angewohnheit hatte, bei offenem Fenster zu schlafen. Diese kleine Unbill hatte sie jedoch nicht daran gehindert, das kleine altmodische Hotel direkt am Hafen zu buchen. Neben einem Rentner Ehepaar schien sie der einzige Hotelgast zu sein.
Unter dem Fenster entwickelte sich ein kurzes Getuschel, dann entfernten sich Schritte hinab zum Ende der Gasse. Schließlich hörte man sie kaum noch. Sie hatten am Hafen die Steintreppe erreicht, die schon von Millionen eiligen und geschäftigen Sohlen benutzt worden war.
Mary stellte sich die beiden Silhouetten vor, angelehnt an das rostige, in die Mauer zementierte Eisengitter. Nahmen sie ihr zweites Frühstück aus einem runden Weidenkörbchen? Trugen sie die weiten Baumwollhosen und die geflickte, von Wetter und Waschlauge ausgebleichte Matrosenjacke?
Nein, es waren Hobbyfischer; sie machten am Bootssteg ein Plastikboot mit Außenbordmotor fertig, kein klassisches Holzboot mit Rudern.
Um elf Uhr kamen sie mächtig stolz mit ihrem Fang zurück: einem halben Dutzend Makrelen und einem Paar Hornhechten, die sie wie Trophäen hochhielten.
Ganz anders die professionellen Seeleute, die noch zur See fuhren. Sie musterten auf den großen, stählernen Fischdampfern an, die drei Wochen auf dem Meer blieben, um Seelachs in der Irischen See zu fangen. Ihre Familien lebten nicht in den engen Wohnhäusern am alten Hafen. Sie wohnten in Neubauten auf den Höhen von Ploaré.
Der alte Hafen war jetzt für die Freizeitskipper reserviert wie der von Tréboul und von Port-Rhu, der mit großem finanziellem und bautechnischem Aufwand in einen Museumshafen verwandelt wurde. Hier liegt jetzt eine ganze Flotte historischer Schiffe vor Anker. Die nicht mehr genutzten Konservenfabriken beherbergen nun Schiffsmodelle und Wracks, die aus dem Watt geborgen wurden. Auf diese Weise versucht Douarnenez, mit der lebendigen Erinnerung an glorreiche Zeiten zu überleben.
Mary drehte sich noch einmal um. Sie war jetzt endgültig wach. Ein farbloser Tag schlich sich langsam durch das Fenster. Sie stand auf und öffnete die Vorhänge. Wie der Seemann im Morgengrauen angekündigt hatte, war alles grau in grau, und obwohl es noch nicht regnete, dürfte der Nieselregen nicht auf sich warten lassen. Unten lag ein kleines, rot-schwarzes Boot an der Mole, überragt von seiner Laterne, die grüne Lichtstrahlen auf die Wasserlachen und die von der Ebbe freigelegten Steine warf. Sein Motor wirbelte eine schaumige Heckwelle auf. In der Ferne verloren sich die Monts d’Arrée im Nebel.
Mary betrachtete eine Weile die Landschaft, den Strand von Ris, umgeben von Badehäuschen, deren Rollos langsam verwitterten, die Villen, deren Fenster und Türen von Schlagläden aus Holz gesichert wurden, und die sich nur für drei Wochen im Jahr öffneten. Sie ließ die Vorhänge wieder fallen und legte sich aufs Bett. Als sie aufwachte, läutete es neun Uhr. Sie ging zum Frühstück nach unten in das Eckzimmer, das auch als Salon diente. Eine alte Dame mit weißem Haar grüßte sie verhalten.
Eine Tasse, die umgekehrt auf ihrer Untertasse ruhte, deutete den Platz an, den Madame Mével ihrem neuen Gast zugedacht hatte; er lag gleich an der Balkontür des Raumes. Die geschlossenen Fensterflügel führten auf einen kleinen Balkon, den die Herrin des Hauses im Sommer mit Geranien verzierte. Aber bis zur Zeit der mit Blumen geschmückten Balkone war noch weit, und die Geranien waren abgehängt worden. Nur die verrosteten Bolzen für die Blumenkästen zeugten noch von ihrer Pracht. Mary setzte sich vor ihre Tasse und betrachtete die Landschaft, während sie auf ihren Kaffee wartete.
In der Straße war es ruhig. An seinem aufgepallten Boot werkelte ein Seemann in blauem Matrosenhemd und schwarzer Schiffermütze. Er hatte es auf große Steinplatten geschoben, und im Moment räumte er es vollkommen leer.
In dem Zimmer herrschte eine angenehme Ruhe, die nur vom gelegentlichen Seufzen des Hundes der alten Dame unterbrochen wurde. Es war ein sehr alter Cocker Spaniel mit bleichem Haar, der auf ein Stückchen gerösteten Brotes hoffte.
Eine Uhr aus dem Pays Bigouden1, mit leuchtendem Kupfer verziert und glänzenden, gewachsten Seitenwänden, schlug die Zeit; und das goldene Pendel schwang hinter einem kleinen Fenster ähnlich dem Nabel eines reich verzierten Bauches.
Auf der verblassten Tapete hingen einige Gemälde. Vielleicht waren es Werke von Malern, die auf diese Weise ihre Pension bezahlt hatten. Sie zeigten große Segelschiffe oder Szenen aus dem Leben im Hafen, wie das Anlanden von Fisch oder das Zubereiten der Filets.
Der Boden war mit breiten Tannendielen bedeckt, deren Verwerfungen an vielen Stellen durch eiserne Klammern verbunden waren.
Die alte Dame reichte ihrem Hund ein Stückchen Brot und warf Mary einen entschuldigenden Blick zu.
„Er ist sehr alt, sagte sie, und ein Schlemmermäulchen!“
Sie beugte sich hinab, um das Tier, das sie mit traurigen Augen ansah, zu streicheln.
Mary lächelte ihr zu, und auch als die Wirtin ihr den Kaffee brachte, blieb sie schweigsam. Die Zeitung lag vor ihr auf dem Tisch, und während sie sie entfaltete, sprach die alte Dame sie nochmals an:
„Haben Sie gelesen, vier Personen sind in einem Zimmer tot aufgefunden worden?“
Die Wirtin, schon an der Treppe, hielt inne, ihre Hände in die Hüften gestemmt:
„Das ist grauenvoll. Heutzutage passieren Sachen! Vier Tote, keine hundert Meter von hier!“
Sie war eine energische Frau, von beachtlicher Statur, aber einem gewinnenden Äußeren. Sie hatte eine besondere Art, die Menschen zu mustern, eine Faust in der Hüfte, mit schwarzen Augen, die Lippen zusammengepresst – sie ist die Chefin und niemand anderes. Es wäre sicher nicht gut, sich mit ihr anzulegen.
Trotz der traurigen Geschichte lächelte Mary – ein wenig provokant – bei dem Akzent der Wirtin. Unnachahmlich, dachte sie. Sie täuschte sich, denn nach acht Tagen in Douarnenez ertappte sie sich dabei, die letzten Silben der Worte genau wie Madame Mével zu betonen. Sie fragte:
„Kennen Sie sie?“
„Nein, gnädige Frau!“ antwortete die Wirtin. „Ich kann mir nicht vorstellen, wer das war. Und dabei kenne ich hier jeden!“
Eine Stimme tönte aus dem Parterre:
„Ninette!“
Sie grummelte:
„Oh la, la!“
Und zu den beiden Frauen:
„Immer bin ich es, nach der man verlangt!“ Mit spitzer Stimme rief sie nach unten:
„Ich komme!“
Und, bevor sie verschwand, hielt sie einen Moment inne, Zeit für einen verzweifelten Blick:
„Ich habe keine Sekunde für mich!“
Die Treppe knarrte unter ihren Schritten. Mary schaute ihre Nachbarin lächelnd an, und die alte Dame fühlte sich bemüht, zu erklären:
„Sie will andeuten, sie ist sehr eingespannt!“
Mary nickte mit dem Kopf. Sie hatte wohl verstanden.
„Sie sind nicht von hier?“ fragte nun die alte Dame.
Dies war eher eine Feststellung als eine Frage. Mary verneinte, und die Dame mit dem weißen Haar präzisierte:
„Manchmal versteht man nicht, was die Leute sagen wollen. Es gibt Worte, Redewendungen, die man nirgendwo anders findet.“
„Und sie? Verstehen Sie sie?“ Die alte Dame richtete sich auf:
„Sicher, ich bin in Douarnenez geboren!“
Auch dieser Satz erklang ganz in dem Akzent der Worte, mit denen nach Ninette gerufen wurde.
Draußen hatte sich der Himmel immer noch nicht geöffnet. Die Luft fühlte sich an wie von Wasser gesättigt. Auf dem rostigen Eisengeländer der alten Mole hockten große Möwen und warteten auf was auch immer. Gelegentlich schlenderten Seeleute dicht an ihnen vorbei, doch sie bewegten sich nicht von ihrem Platz.
„Sie sind im Urlaub?“ fragte Mary höflich.
„Ja, wir wohnen in der Nähe von Paris… Nun ja, wir sind Rentner…“
„Und sie machen Urlaub außerhalb der Saison?“
„Seit Jahren kommen wir an Allerheiligen und zum Mardi Gras.“
Sie schaute zum Hügel des Plomarch’, der sich am Ende der Bucht erhob, und den man über eine schier endlose Granit-Treppe besteigen konnte:
„Sehen Sie, ich bin in dem kleinen weißen Haus, das man dort oben sieht, geboren, gleich am Meer. Als meine Eltern starben, stellten meine Brüder es zum Verkauf. Schließlich, als ich meine Brüder darauf ansprach …, aber es waren meine Schwägerinnen, die drängten … Zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht genug Erspartes, wir konnten es nicht kaufen.“
In ihrer Stimme lag eine tiefe Nostalgie, und es berührte Mary, als sie sah, dass Tränen über ihre Wangen flossen.
„Sie hätten gerne dort gewohnt?“ fragte sie.
„Aber ja!“ sagte die alte Dame mit Inbrunst, „Wir hätten dort das ganze Jahr über gelebt!“
Sie schloss die Augen. Zweifellos stellte sie sich vor, wie Fremde im Hause ihrer Kindheit lebten. Dann seufzte sie und in einer Vehemenz und Vulgarität, die man einer solch eleganten, distinguierten Person nie zugetraut hätte, fügte sie hinzu:
„Ah, wie mich die Leute ankotzen, sie gehören einfach nicht dazu!“
Aufs Neue hatte sie den Akzent ihrer Kindheit wiedergefunden und sprach mit erstaunlicher Heftigkeit. Es ging offenbar um ihre Schwägerinnen, die den Verkauf des Hauses der Familie betrieben hatten.
Mary trank ihren Kaffee aus, stellte die Tasse ab und erhob sich. Im Vorbeigehen streichelte sie den Hund.
„Auf Wiedersehen.“
„Auf Wiedersehen.“ sagte die alte Dame, Gedanken verloren in ihren Erinnerungen.
Mary ging ins Erdgeschoß hinunter, in die Bar, die zu dieser Tageszeit verwaist war. Die Chefin fegte mit energischer Hand die Sägespäne, die sie auf den Kacheln verstreut hatte, zusammen.
„Sie kommen zu Mittag?“
„Ich weiß es noch nicht…“
„Na ja, Corentin wird auf den Markt gehen…“
„Sorgen Sie sich nicht um mich, ich bin mittags auch mit einem Sandwich zufrieden.“
Und da die stattliche Frau sie mit einem vorwurfsvollen Blick musterte, fügte sie in freundlichem Ton hinzu:
„Sie haben doch sicher immer ein Stück Brot und ein paar Scheiben Schinken im Kühlschrank?“
Die Wirtin fegte mit dem Besen mehrmals heftig über die Kacheln, stoppte abrupt und sagte launig:
„Sicher! Noch ein wenig Butter und Cornichons. Aber das ist keine vernünftige Mahlzeit.“
Mary hob die Schultern und ging. Warum mussten die Leute sie immer wie ihre Tochter behandeln, ihr Ratschläge zur Ernährung geben, zur Art, wie sie sich kleidete. Lag es nicht an ihr, wie sie sich gab? Zu glauben, dass sie noch immer nicht erwachsen sei!
Vom Hafenbecken trennte das Hotel nur eine etwa 12Meter breite Straße. Im Sommer wurde sie zur Fußgängerzone, und die Bistros am Meer erweiterten ihre Terrassen zur besonderen Freude der Sommergäste.
Noch immer zog sich das Meer zurück und die am Quai vertäuten Schiffe sanken eins nach dem anderen in den schwarzen Schlick des Hafens.
An der Mole hatte der Seemann sein Boot geleert und stapelte das Material auf der Kaimauer. Es war so viel, dass Mary sich fragte, wie dieser ganze Basar in solch einer Nussschale Platz finden konnte. Mit Hilfe von drei Männern, die ihm zuschauten, drehte er das Boot kieloben. Die Möwen beobachteten sie dabei, unbeweglich; mit ihren gelben Schwimmfüßen hockten sie auf dem Handlauf des rostigen Eisengitters.
Unaufhörlich senkte sich der Sprühregen nieder, und man konnte kaum bis zum Hafendeich sehen. Mary zog die Kapuze ihres Duffelcoats über den Kopf und ging hoch zur Stadtmitte. Am Vortag hatte sie einen Parkplatz gleich hinter ihrem Hotel gefunden, und das Kommissariat befand sich nur wenige hundert Meter entfernt. So beschloss sie, zu Fuß zu gehen.
Die Straßen, die zum Herz der Stadt hinaufführten, stiegen steil an und wirkten verlassen. Man lief über unregelmäßiges Pflaster, und erst an dem Platz vor den Markthallen gab es ein wenig Abwechslung. Von hier war es nicht mehr weit bis zum Kommissariat.
1 Landschaft in der Bretagne bei Cap Caval
Kapitel 2
Kommissar Colin musste sich auf die nahende Rente einstellen. Er war ein stattlicher Mann, mit müdem Gesicht, der, als Mary eintrat, seine schweren Lider hob. Er blieb sitzen und verwies mit einem Kopfnicken zu einem Stuhl, betrachtete sie, während sie sich setzte, und sagte schließlich mit einer erdigen Stimme:
„Inspektor Lester … Ich habe schon von Ihnen gehört, mein Mädchen!“
Die Vertrautheit der Ansprache verblüffte Mary. Kommissar Colin bemerkte dies und lächelte:
„Das erstaunt Dich was, dass ich dich mein Mädchen nenne?“ fragte er.
Sich von einem Kommissar bei der ersten Ansprache „mein Mädchen“ nennen zu lassen, war sicher nicht normal, schon gar nicht beim zweiten Mal auch noch geduzt zu werden. Sie war sprachlos, und der Kommissar fuhr fort:
„Mädchen, davon habe ich sechs. Wie alt bist Du?“
„Sechsundzwanzig, Herr Kommissar.“
„Meine älteste Tochter ist dreißig, und die jüngste neunzehn. Nun, wie Du siehst…“
Mary konnte nicht erkennen, weshalb diese Vaterschaft eine derartige Vertraulichkeit rechtfertigte, aber der Akzent des guten Mannes bereitete ihr Freude: es war der gleiche, den sie bei Ninette, der Gastwirtin, und bei der alten Dame gehört hatte, als sie sich an das Haus ihrer Kindheit erinnerte.
„Sind Sie Douarneniste, Herr Kommissar?“ Der Kommissar schmunzelt aufs Neue:
„Woran sieht man das?“ Sie lächelt ihrerseits:
„Man hört es deutlich!“
„Ah…“
Es wurde still, sie betrachteten sich, dann sagt Colin:
„Wie kommt es, dass man Dich wegen der vier Toten geschickt hat…“
Aus seiner Westentasche zog er ein Päckchen Boyard-Mais Zigaretten, und mit einem Döschen Streichhölzer ergänzte er das Equipment.
„Ich biete Dir keine an“, entschuldigte er sich, „denn Mädels mögen die nicht. Sie rauchen nur Englische oder Amerikanische.“
„Ich rauche überhaupt nicht.“, sagte sie.
„Ah“, erwiderte er gelassen und blies eine blaue Rauchwolke in die Luft.
„… aber der Rauch stört mich nicht.“
„Umso besser, mein Mädchen, umso besser.“
Es wurde still im Raum, auf dem Schreibtisch lagen zwei regionale Tageszeitungen, die „Telegramme“ und die „Ouest-France“, nachlässig zusammengelegt. Der Kommissar musste sie gerade gelesen haben, als Mary eintrat.
„Nun“, sagte Mary, „man hat sie alle vier hier bei Ihnen getötet?“
Colin sah sie ernst an.
„Man hat vier Tote im gleichen Zimmer gefunden, das ist richtig. Aber niemand hat bisher nachgewiesen, dass sie ermordet wurden.“
Mary verzog skeptisch ihren Mund, und der Kommissar antwortete mit einem gewinnenden, charmanten Lächeln:
„Natürlicher Tod? Glauben sie wirklich?“
Und da Colin nichts weitersagte, fügte sie hinzu:
„Man hat mich wegen vier natürlicher Tode hierhin geschickt?“
„Was machst Du bei der Polizei?“ fragte Colin unvermittelt.
Als Mary ihn wegen der Frage, die sie irritierte, erstaunt anschaute, ergänzte er:
„Keines meiner Mädchen hätte jemals die Idee gehabt, diesen Job zu machen!“
„Und was machen Ihre Mädchen?“
Er musste hüsteln, weil er den Rauch zurückhielt:
„Kinder, Blagen!“
„Sie sind alle verheiratet?“
„Verheiratet, nicht verheiratet, was weiß ich? Auf jeden Fall bin ich achtzehn Mal Großvater!“
Mary konnte ein Lachen nur mühsam unterdrücken:
„Mein Kompliment!“
„Ich wüsste nicht wofür“, sagte Colin mit verdrossener Stimme.
„Die letzte, die Kleine auch?“
„Auch was?“
„Ich wüsste gerne, hat sie auch Kinder?“
„Pff!“ stöhnte Colin, „Das ist das Schlimmste! Sie hat vier!“ Überrascht rief Mary aus:
„Vier Kinder mit neunzehn?“
„Ja, zwei Mal Zwillinge!“
Er schaute sie an mit einem Blick zwischen Stolz und Verzweiflung, einer so ulkigen Ausstrahlung, dass sie nicht anders konnte – Mary platzte vor Lachen. Colin schaute sie an, als hätte ihn ihr Lachen verletzt. Sie hielt ihre Hand vor den Mund:
„Entschuldigen Sie“, Herr Kommissar.
„Du machst dich wohl über mich lustig, was!“ sagte er mit gequältem Lächeln. Es war keine Antwort, nur eine simple Feststellung.
„Aber nein, Kommissar, ich mache mich nicht über Sie lustig!“
„Warum lachst Du dann?“
„Also, geben Sie doch zu, dass Ihre Geschichte nicht alltäglich ist. Und schließlich sind Kinder doch Leben, Freude!“
„Wenn man will“, sagte Colin, säuerlich.
Durch eine Handbewegung fiel Asche auf die Glasplatte seines Schreibtisches. Er pustet sie hinunter und sagte:
„Nun, ich bin froh, dass Du da bist, denn die Geschichte mit den vier Leichen in einem Raum. Das sieht nicht gut aus!“
„Ah!“ sagte Mary, immer noch amüsiert.
„Morgen ist Faschingsdienstag, der Mardi Gras beginnt.“
Mary sah ihn fragend an: „Was hat der Mardi Gras damit zu tun?“
Auch der Kommissar betrachtete sie – wie jemand von einem anderen Stern.
„Du hast noch nichts davon gehört?“
„Doch, aber ich weiß nicht…“
„Was weißt Du nicht?“
„Was der Mardi Gras damit zu tun hat!“
Plötzlich erhob sich der Kommissar. Er war wesentlich größer als Mary sich vorgestellt hatte, als er sich über die Unterlagen auf seinem Schreibtisch beugte.
„Da sollte nichts passieren, am Mardi Gras! Alle Jahre ist er da, von Februar bis Anfang März. Vier Leichen, die mir mitten in den Mardi Gras platzen, wie das Elend über die arme Welt!“
Mary musste sich die Augen reiben, die Worte des Kommissars wirkten einfach surrealistisch.
Sie nahm sich fest vor, im Kommissariat einen Inspektor zu finden, der ihr das erklären konnte.
Schließlich fragte sie:
„Können Sie mir etwas über die Sache erzählen?“
„Ich?“ sagte Colin, „Auf keinen Fall!
Die Antwort verschlug ihr die Sprache. Der Kommissar öffnete die Tür und brüllte auf den Flur:
„Fanchic!“
Dann machte er, zu Mary gewandt, eine beschwichtigende Geste; er schien sagen zu wollen: „Warte ein wenig…“
Ein Mann trat ein, ohne sich die Mühe zu machen anzuklopfen:
„Du hast mich gerufen, Jean-Louis?“
„“Ja“, grummelte der Kommissar. Er deutete mit der Hand auf Mary.
„Das ist Inspektor Mary Lester, die uns wegen der vier Leichen in der Rue Obscure zugeteilt wurde. Erzähl ihr alles, was du weißt.“
Er ging zur Tür:
„Ich, ich habe zu tun… Entschuldige mich Kleines, ich hab’ es eilig!“
Mary sah mit ungläubig aufgerissenen Augen, wie sich die Tür hinter ihm schloss.
Kapitel 3
Inspektor Le Meunier ließ sich auf dem Platz des Kommissars nieder, dabei reichte er Mary lächelnd die Hand:
„Herzlich Willkommen im Dorf!“
François Le Meunier, Fanchic genannt, war ein kleiner, rundlicher Vierzigjähriger mit einer äußerst sympathischen Ausstrahlung. Mary betrachtete ihn, verwundert, und trotz einer gewissen Skepsis lächelte er:
„Das haut Sie um, was, so ein Empfang!“
Mary musste in der Tat den Äußerungen des Inspektors Le Meunier zustimmen, so etwas hatte sie wirklich nicht erwartet. Sie warf einen Blick zur Türe, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich fest verschlossen war, und sagte, gebeugt über den Schreibtisch, mit gedämpfter Stimme:
„Hören Sie, Le Meunier, ich liebe keine voreiligen Schlüsse, noch möchte ich schlecht über meine Vorgesetzten sprechen, aber Ihr Kommissar, ist er nicht ein wenig … bizarr?“
„Aber nein“, sagte Le Meunier gelassen. „Er ist der beste Typ der Welt!“
„Daran zweifle ich nicht, aber…“
„Lassen Sie nur, er ist ein wenig anders. Sie müssen wissen, es dauert Monate, bis er sein Kostüm für den Mardi Gras fertig hat, und jetzt hat er auch noch vier Tote am Hals!“
Mary stütze ihre Stirn auf die Hand und schloss die Augen. Ja das war es. Es passte Le Meunier überhaupt nicht in seine Pläne zum Mardi Gras. Bestimmt, irgendwie wollte er aus der Sache rauskommen.
„Ich kann Ihnen sagen“, fuhr der Inspektor fort, „dass der brave Jean-Louis merkwürdig erleichtert war, als Quimper Ihre Ankunft ankündigte.“
Das war ungewöhnlich. Normalerweise empfingen die Vorgesetzten, zu denen Mary abgeordnet wurde, sie sehr freundlich und nicht mit solch offener Ablehnung.
Und dann diese Art der Männer, sich mit dem Vornamen anzusprechen, sich zu duzen. Das war häufig unter gleichaltrigen Inspektoren mit ähnlichen Aufgaben der Fall. Aber dass ein relativ junger Inspektor ohne anzuklopfen das Büro eines Kommissars, der kurz vor der Rente steht, betritt und ihn dabei auch noch Jean-Louis nennt, das überraschte sie doch ein wenig.
„Inspektor Le Meunier“ sagte Mary „klären Sie mich doch bitte über die vier Morde auf, aber zuvor, was ist das für eine Geschichte mit dem Mardi Gras?“
„Nun“ sagte Le Meunier, „das ist keine Geschichte, das ist ein Fest. Was sage ich, es ist das Fest. Ab morgen und während der folgenden vier Tage spielt die Stadt verrückt. Während des Gras verkleidet sich die ganze Stadt.“
„Sie wollen damit sagen, auch der Kommissar…“
„Gewiss, auch der Kommissar! Für nichts auf der Welt würde er den Gras versäumen.“
„Und Sie?“
Le Meunier verzog das Gesicht:
„Aber nein!“
Entschuldigend ergänzte er:
„Ich bin von Tréboul.“
„Wo liegt dieses Tréboul?“
Er machte eine ausholende Geste:
„Auf der anderen Seite des Wassers.“
Sie runzelte die Stirn. Hinter dem Schreibtisch des Kommissars hing ein Stadtplan. Le Meunier dreht seinen Sessel und deutete mit einem Lineal auf die Karte.
„Dort, dort ist Tréboul.“
„Aber“ sagte Mary, „das ist doch ein Viertel von Douarnenez!“
„Das ist Marokko!“ antwortete Le Meunier und drehte sich wieder zu Mary.
„Was bitte?“ fragte sie zunehmend irritiert.
„Marokko. So nennen die echten Douarnenisten Tréboul.“ Er lachte:
„Man kein Douarneniste sein, wenn man in Marokko geboren ist?“ Mary verstand nichts. Schließlich sagte sie:
„Weil Sie aus Tréboul stammen, nehmen sie nicht an den Festveranstaltungen teil?“
„Nein. Aber irgendjemand muss ja auf den Laden aufpassen! Na ja, und verkleiden ist wirklich nicht meine Sache.“
„Nun vier Tage lang…“
„Und vier Nächte,“ergänzte Le Meunier, „das ist die totale Fete.“
„Und der Kommissar?“
„Rechnen Sie nicht damit, ihn zu sehen!“
„Gut“, sagte sie nach kurzem Schweigen, „Würden Sie mir jetzt ein wenig von den vier Leichen erzählen?“
„Ja“, sagte Le Meunier und kratzte sich am Ohr.
Er wirkte verlegen und Mary musste ihn noch einmal auffordern:
„Beginnen Sie doch einfach ganz von vorn!“
„Ja“, sagte wieder Le Meunier und betrachtete sie prüfend, als würde er ihr nicht trauen.
„Nun, Dienstagmorgen, also gestern klopfte Madame Bernadette Perchec, die in der Rue Obscure wohnt, an die Tür ihrer Mieter, wie sie es jeden Morgen macht, um zu fragen, ob sie Brot möchten…“
Es entstand eine Stille, während er nach Worten suchte, und langsam fuhr er fort:
„Madame Perchec ist eine alte Dame, die ein altes Haus in der Straße, die zum Hafen hinunterführt, bewohnt.“
Mary setzte sich auf ihrem Stuhl zurück:
„Alles ist alt in Ihrer Geschichte“, sagte sie.
„Wenn Sie es nicht glauben wollen… Madame Perchec nimmt Mieter auf, nicht um Gesellschaft zu haben, sondern um ihre Pension aufzubessern, die übrigens ganz komfortabel ist. Ihr verstorbener Mann war Hauptbootsmann bei der Marine …“
„Ah… und man verdient viel als Hauptbootsmann?“
Le Meunier zeigte ein kurzes Lächeln:
„Das hängt davon ab, wie Madame Perchec es sieht, ja. Sie wird kaum ein Viertel ihrer halben Pension verbrauchen.“
„Geizkragen?“
„Eigentlich nicht. Höchst bescheidene Ansprüche; die Cousinen vom Land, die ihr Gemüse bringen, die Fischer, die sie mit Fisch versorgen und die Genügsamkeit eines Kamels…“
„Dann muss sie ja eine Menge Geld haben.“
„Wahrscheinlich… Aber das spielt keine Rolle. Madame Perchec ist nicht das Opfer in dieser Geschichte. Die Opfer sind namentlich Monsieur und Madame Lobek, Monsieur und Madame Le Marc.“
Er öffnete einen Ordner und entnimmt eine Akte.
„Wincelas Lobek, geboren 1919 in Poznań.“
„Ein Pole?“
„39 in Frankreich eingebürgert, hat den ganzen Krieg in der Französischen Armee gedient. Dann hat er bei Renault als Fräser und Werkzeugmacher bis zu seiner Rente gearbeitet. Der Mann von Antoine Baron, geboren in Ploubezre, 1917.“
„Und sie wohnen?“ Er korrigiert:
„Sie wohnten in Ploubezre…“
Er schaut auf seine Akte und präzisiert:
„Rue des Fontaines. Hier steht keine Nummer.“
„Das wären zwei“, sagte Mary, „… und die anderen?“
„Kommt schon. Francis Le Marc, geboren in Lesconil, Finistère, 1913, Ehemann von Paulette Chausson, geboren in Saint-Pol-de-Léon, 1915.“
„Sagen Sie, das sind alles keine Grünschnäbel mehr.“
„Wie bitte?“ sagte Le Meunier und runzelt die Stirn.
„Ich meine, sie standen nicht mehr in ihrer blühenden Jugend!“
Der Inspektor lachte kurz auf; kurz, als würde er nießen:
„In der Tat.“
Dann schaute er Mary an:
„Sehen Sie, alles an dieser Geschichte ist alt.“
„Und was machten die braven Leute zu viert in einem Raum?“
„Sie schliefen.“
„Tatsächlich. Einen ewigen Schlaf. Aber warum waren sie alle im gleichen Zimmer?“
„Aus Sparsamkeit.“
„Ah…“
Mary schaute ihn erstaunt an; Le Meunier präzisierte.
„Hey, ein Zimmer kostet weniger als zwei…“
„Schon … Aber warum waren sie in Douarnenez?“
„Die Religion, meine Liebe!“ sagte Le Meunier und kreuzte die Finger.
„– Ah… Fundamentalisten?“ fragte Mary.
„Nein, Protestanten, ganz einfach. In unserer Stadt gibt es ein protestantisches Gotteshaus, und es ist eine Religion, die in der Bretagne nicht häufig ist.“
„Vornehmlich katholisch geprägtes Terrain, wie jeder weiß“, ergänzte Mary.
„Ja“, sagte Le Meunier, „… noch etwas…“
„Was noch?“
„Die Religion unserer guten Douarnenisten scheint ein wenig komplizierter als es aussieht.“
Er schaute Mary an:
„Hier, sehen Sie, ist man hauptsächlich cathococo.“ Sie seufzte:
„Man könnte sagen, es ist nichts einfach bei Ihnen!“
„Sie sagen es. Und wenn ich sage catho, meine ich catho fundamentalistisch, in der Richtung von Monsieur Lefèvre, ein wenig strenger… Und wenn ich sage coco, ist das die stalinistische Zeit …“
Mary platzte vor Lachen:
„Diese Mischung dürfte sehr brisant sein.“
„Mehr als Sie denken.“ sagte Le Meunier, „Denn das alles hier ist geprägt von Heidentum; im Lauf der kommenden Tage werden Sie das merken.“
„Ah, dieser berühmte Mardi Gras!“
„Genau!“
„Aber sagen Sie“, wirft sie verwundert ein, „dann findet man da auch noch polnische Protestanten?“
„Ein Pole“, präzisierte Le Meunier, „ist genauso ein Bürger wie ein gebürtiger Franzose. Lobek wurde Madame Perchec anvertraut, als seine Eltern ins Exil geschickt wurden, denn sie waren Protestanten und ihre Art, Gott anzubeten, entsprach nicht dem Geschmack der Heiligkeit – wenn ich so sagen darf – an den Ufern der Weichsel.“
„Sie stammten doch von der Seine, wo man liberaler ist…“
„So ist es, und als die Zeit der Rente kam, zogen sie zurück in die Heimat der Frau, Ploubezre.“
„Sie besaßen ein Haus?“
„Nein, es waren einfache Mieter.“
„Und in Ploubezre gab es keine protestantische Kirche, das erklärte, warum sie zum Gottesdienst nach Douarnenez kamen.“
„Genau.“
„Und die anderen?“
„Die Le Marc?“
„Ja, Sie sagten mir, dass sie aus Lesconil stammten.“
„Der Mann. Wenn ich mich nicht irre. Lesconil ist ein kleiner Fischerhafen im Pays Bigouden.“
„Sie täuschen sich nicht?“
„Gibt es Protestanten im Pays Bigouden?“
„Nicht viele, aber es gibt welche. Lesconil war sogar zu Beginn des Jahrhunderts eine protestantische Enklave in einem rein katholischen Umland.“
„So weit so gut. Aber warum das alles?“
„Es scheint, dass sie in dieser Zeit dort einen Pastor hatten, der den Gottesdienst auf eine besondere Art zelebrierte.“
„Das ist alles?“
„Für mich, ja. Ich bin nicht hier, um eine Untersuchung zu verschiedenen Religionen zu machen…“
„Das stimmt, und trotzdem scheint es, dass sie sich da ganz gut auskennen. Also Monsieur und Madame Lobek mieten ein Zimmer bei einer Einheimischen, um bei den Zeremonien ihrer Religionsausübung zu unterstützen.“