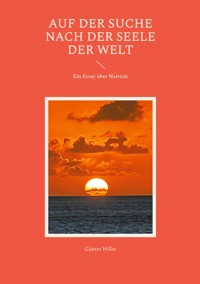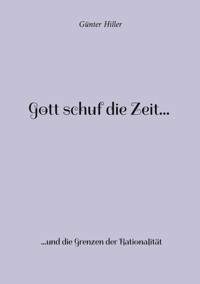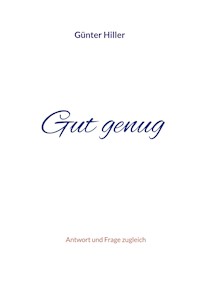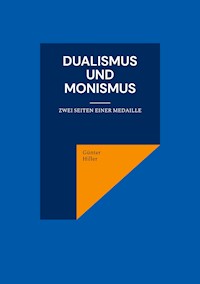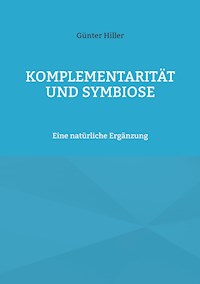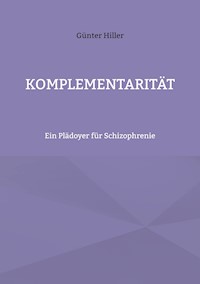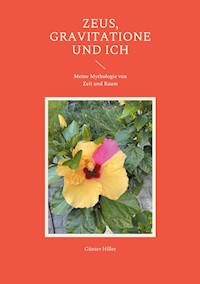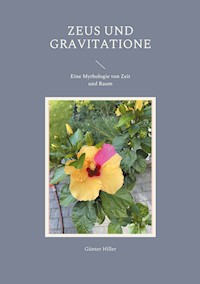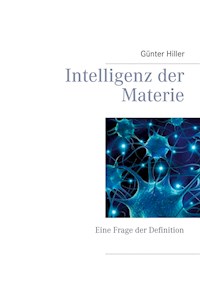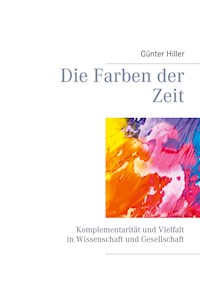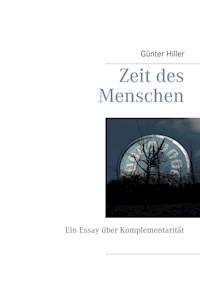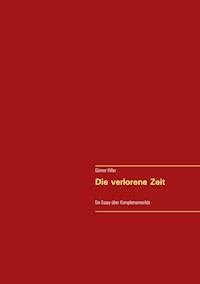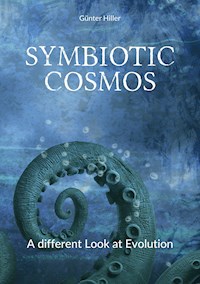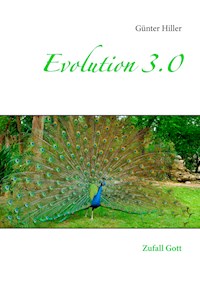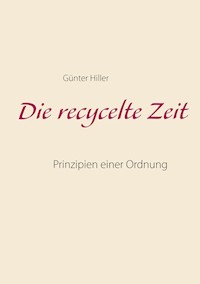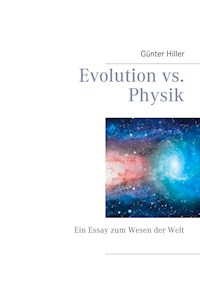
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Titel dieses Essays Evolution vs. Physik ist bewusst provokativ gewählt, um die Unterschiede zu beleuchten. Tatsächlich sind Evolution und Physik aber im gewissen Sinne komplementär und sollten sich daher ergänzen. Es gibt Aspekte, wo ein physikalischer Ansatz Vorteile hat, aber dieser Ansatz hat seine Grenzen und Ziel dieses Essays ist es, diese Grenzen aufzuzeigen. Diese Komplementarität beruht auf unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Physik beschäftigt sich mit Systemen, die per se vollständig sind und Erhaltungsgrößen beinhalten. Diese Vorstellung wird durch einen religiösen Monotheismus unterstützt, denn letztlich repräsentiert ein allmächtiger und allwissender Gott eine ultimative Erhaltungsgröße. Evolution dagegen basiert auf Unvollständigkeit, weil Vollständigkeit eine Form von Perfektion darstellt und sich Perfektion und Evolution gegenseitig ausschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Vorwort
Wenn man versucht Evolution und Physik zu vergleichen, muss man zunächst definieren, was man jeweils unter Evolution und Physik versteht. Bereits bei dieser Frage erkennt man, dass es dafür keine klaren und eindeutigen Definitionen gibt.
Wenn man Physik studiert oder sich mit Physik beschäftigt, wird deutlich, dass man Materie auch als Informationsspeicher betrachten kann und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sich in der Welt dieser Informationsspeicher mühsam vergrößert, z.B. durch Kristallwachstum oder die Erschaffung höherwertiger Elemente (Periodensystem), ohne dass (tote) Materie Nutzen daraus ziehen kann.
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Physik ganz generell immer noch als Wissenschaft der toten Materie angesehen, obwohl die Grundideen der Evolution bereits seit mehr als 100 Jahren kursierten. Religionen gingen von der Vorstellung aus, dass der Sinn einer Vergrößerung des Informationsspeichers einem Gott (oder Göttern) vorbehalten ist und es Aufgabe des Menschen ist, diesen Sinn zu erkennen.
Die von Jean-Baptiste Lamarck und Charles Darwin entwickelte Evolutionstheorie bezog sich zunächst nur auf Biologie und biologisches Leben. Erst im 20. Jahrhundert wurde auch eine kulturelle Evolution in Betracht gezogen und bereits Friedrich Cramer bemerkte und verdeutlichte, dass die kulturelle Evolution weitaus schneller (ca. eine Million Mal) abläuft als die biologische Evolution.
Damit wurde eine Verallgemeinerung des Evolutionsbegriffs notwendig und man muss Lamarcks oder Darwins Vorstellungen als biologische Evolution spezifizieren. Evolution selbst ist somit mehr oder etwas anderes als biologische Evolution und auf diesen allgemeineren Evolutionsbegriff bezieht sich der Titel dieses Essays.
Wenn es neben der biologischen Evolution eine sehr viel schnellere kulturelle Evolution gibt, dann liegt der Gedanke nicht fern, dass auch sehr viel langsamere Evolutionsformen möglich und denkbar sind. Man erkennt sofort, dass die kulturelle Evolution auf der biologischen Evolution aufbaut und sich erst entwickeln kann, wenn die biologische Evolution die notwendigen Voraussetzungen bereitgestellt hat.
Diese notwendigen Voraussetzungen sind aber nicht festgeschrieben, sondern eher zufällig und Orts- und Artabhängig. Menschen und Delphine haben unterschiedliche Kulturen entwickelt und selbst Menschen haben in unterschiedlichen Regionen der Erde zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Kulturen geschaffen.
Ein Markenzeichen der Evolution ist Vielfalt und die Entstehung dieser Vielfalt ist einerseits zufällig, folgt andererseits aber auch bestimmten Mustern, aber anscheinend keinem starren oder perfekten Muster. Grundlage meiner Überlegungen ist die sehr einfache Tatsache, dass sich Perfektion und Evolution gegenseitig ausschließen. Die Anerkennung dieser simplen Tatsache hat allerdings ungeahnte Folgen.
Wenn man nach einer langsameren Evolution sucht, die die biologische Evolution entstehen lassen kann, muss man eine physikalische Evolution in Betracht ziehen. Eine viel langsamere physikalische Evolution ist natürlich viel schwieriger nachzuweisen, im Grunde genommen sogar unmöglich nachzuweisen, solange man nur physikalische Messmethoden verwendet.
Meine Freunde haben mich gebeten, die wichtigsten Punkte meiner Überlegungen in einem kurzen Essay zusammenzufassen. Diesem Wunsch komme ich hiermit nach.
Berlin, im Februar 2021
Günter Hiller
Abstract
Physik beruht auf der verbreiteten Annahme, dass Materie keine Intelligenz besitzt, wobei Intelligenz gemeinhin als Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten, betrachtet wird. Damit wird bewusst oder unbewusst Intelligenz mit Vernunft assoziiert, die man als das geistige Vermögen versteht, Zusammenhänge zu erkennen, zu beurteilen und sich dementsprechend sinnvoll und zweckmäßig zu verhalten. Dann assoziiert man mit Intelligenz auch Einsicht und Verstand, die geistige Fähigkeit des Menschen, Einsichten zu gewinnen, sich ein Urteil zu bilden, die Zusammenhänge und die Ordnung des Wahrgenommenen zu erkennen und sich in seinem Handeln danach zu richten.
Vernunft geht bereits von einem Istzustand aus und versucht rückwirkend Handlungsweisen zu rationalisieren. Das entspricht einer top-down Betrachtungsweise, die auch die herkömmliche Physik beherrscht. Intelligenz wird dadurch zur Fähigkeit einer sinnvollen Nachrationalisierung degradiert. Um dem zu entgehen, muss man eine andere Beschreibung von Intelligenz suchen und wählen. Eine viel allgemeinere Definition von Intelligenz ist beispielsweise die Fähigkeit, Informationsspeicher zu benutzen. Damit beschreibt Intelligenz eine Qualität, eine mehr oder weniger ausgeprägte Fähigkeit, einen rein quantitativen Informationsspeicher zu nutzen.
Wenn man Physik studiert oder sich mit Physik beschäftigt, wird deutlich, dass man Materie auch als Informationsspeicher betrachten kann und dann stellt sich natürlich die Frage, warum sich in der Welt dieser Informationsspeicher mühsam vergrößert, z.B. durch Kristallwachstum oder die Erschaffung höherwertiger Elemente (Periodensystem), ohne dass (tote) Materie Nutzen daraus ziehen sollte. Mit der vorangegangenen Definition erhöht ein wachsender Informationsspeicher zumindest die Intelligenzfähigkeit, nicht notwendigerweise die Intelligenz selbst.
Wenn jedoch (tote) Materie ihren Informationsspeicher vorteilhaft benutzen könnte, dann wäre Materie tatsächlich intelligent und nicht tot. Dann würde ein zunehmender Informationsspeicher natürlich auch mehr Vorteile mit sich bringen, mehr Quantität würde auch mehr Qualität nach sich ziehen. Genau das ist aber das Prinzip der Evolution, einer allgemeinen Evolution, die nicht auf Biologie oder Kultur beschränkt ist. Da es neben der biologischen Evolution eine sehr viel schnellere kulturelle Evolution gibt, liegt der Gedanke nicht fern, dass auch sehr viel langsamere Evolutionsformen möglich und denkbar sind. Man erkennt sofort, dass die kulturelle Evolution auf der biologischen Evolution aufbaut und sich erst entwickeln kann, wenn die biologische Evolution die notwendigen Voraussetzungen bereitgestellt hat.
Die notwendigen Voraussetzungen für Emergenz sind aber nicht festgeschrieben, sondern eher zufällig und Orts- und Artabhängig. Menschen und Delphine haben unterschiedliche Kulturen entwickelt und selbst Menschen haben in unterschiedlichen Regionen der Erde zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Kulturen geschaffen. Ein Markenzeichen der Evolution ist Vielfalt und die Entstehung dieser Vielfalt ist einerseits zufällig, folgt andererseits aber auch bestimmten Mustern, aber anscheinend keinem starren oder perfekten Muster. Grundlage meiner Überlegungen ist die sehr einfache Tatsache, dass sich Perfektion und Evolution gegenseitig ausschließen. Die Anerkennung dieser simplen Tatsache hat allerdings ungeahnte Folgen, mit denen sich dieses Essay befasst.
Evolution basiert auf einer bottom-up Betrachtungsweise und beschreibt eine fortlaufende Schöpfung, deren Ende nicht absehbar ist. Damit widerspricht sie einer Genesis, einem Urknall und der traditionellen Physik. Eine fortlaufende Schöpfung beinhaltet Emergenz, die Entstehung neuer Ordnungsstrukturen. Das ist der gravierende Unterschied zwischen einer top-down und einer bottom-up Betrachtung, bei einer bottomup Betrachtung entstehen Gesetzmäßigkeiten nacheinander, bei einer top-down Betrachtung sind diese Gesetzmäßigkeiten bereits intrinsisch vorgegeben. Beispielsweise ist der Elektromagnetismus ein intrinsischer Bestandteil der Physik, aber nicht notwendigerweise ein intrinsischer Bestandteil einer evolutionären Welt.
Physik ist die Beschreibung unserer Beobachtungen (in) der Welt. Da Wahrnehmung als Aufnahme von Informationen verstanden werden kann, ergibt sich zwangsläufig, dass Informationen eine endliche Geschwindigkeit besitzen müssen. Wäre die Informationsgeschwindigkeit unendlich, wären alle Informationen gleichzeitig überall und es gäbe folglich weder Zeit noch Raum. Nach unserem Verständnis ist dafür Trägheit verantwortlich, wahrnehmbare Informationen müssen demnach träge sein. Warum Informationen träge sind oder träge werden, entzieht sich jedoch unserer Beobachtungsfähigkeit, wir können nur vermuten, dass größere Trägheit die Informationsgeschwindigkeit verringert.
Einstein definierte die Lichtgeschwindigkeit c als größtmögliche Informationsgeschwindigkeit, was aber gleichbedeutend ist mit der Annahme, dass die Physik und mit ihr der EM intrinsische Bestandteile der Welt sind. Diese Betrachtungsweise schließt von vorneherein eine physikalische Evolution oder eine Emergenz der Physik selbst aus. Eine physikalische Evolution lässt sich naturgemäß nicht physikalisch nachweisen, sondern nur vor dem Hintergrund einer noch langsameren Evolutionsform, wie beispielsweise einer kosmischen Evolution.
Wenn man eine kosmische Evolution nicht berücksichtigt, muss man alle kosmischen Beobachtungen zwangsläufig physikalisch erklären und das führt zu Widersprüchen, zu Paradoxien. Ein Beispiel dafür ist die bekannte und von Edwin Hubble ziemlich genau vermessene astronomische Rotverschiebung. Physikalisch lässt sie sich (nur) mit dem Doppler-Effekt erklären und mit einem expandierenden Universum. Die damit einhergehenden Modellvorstellungen (Urknall etc.) sind so abenteuerlich, dass nicht einmal eingefleischte Physiker Gefallen daran finden. Einen Ausweg aus diesem Dilemma würde eine kosmische Evolution bieten, die eine andere Erklärung für die Rotverschiebung als den Doppler-Effekt zuließe.
Gravitation lässt sich tatsächlich nicht physikalisch erklären, da es bisher keine technische Möglichkeit gibt, Gravitation zu verändern oder abzuschirmen. Wir nehmen Gravitation als Sekundäreffekt riesiger Massen war, als Anziehung riesiger Massen, aber für eine genauere Betrachtung der Gravitation reicht das elektromagnetische Auflösungsvermögen bei weitem nicht aus. Hier werden die Grenzen der Physik und physikalischer Messmethoden deutlich. Wir können zwar den Einfluss der Gravitation auf elektromagnetische Wellen beobachten und berechnen (Einsteins ART, allgemeine Relativitätstheorie), aber nicht den Einfluss der Gravitation auf atomare Spektrallinien hier auf der Erde empirisch ermitteln!
Eine evolutionäre Betrachtungsweise lässt eine Extrapolation unserer erdnahen Physik auf den gesamten Kosmos nicht zu. Diese Annahme ist nicht beweisbar, vermeidet aber all die Paradoxien, die durch die Annahme unveränderlicher Naturgesetze verursacht werden.
Inhalt
Einleitung
Energieerhaltung
Auflösungsvermögen
Evolution
Komplementarität
Wahrnehmung
Zeit der Evolution
Universum
Symbiose
Essenz
Paradoxien
Fazit
Literatur
Die Dosis ist das Gift
Paracelsus
Einleitung
Unter Naturwissenschaft versteht man die Beschreibung unserer Beobachtungen der Natur, wohlgemerkt nicht die Beschreibung der Natur, sondern die Beschreibung unserer Beobachtungen. Das ist im doppelten Sinn bedeutsam, zum einen ist eine Beobachtung bzw. ein Beobachter unvermeidlich und immer ein Teil des Systems und zum anderen kann die Beschreibung niemals völlig objektiv sein, denn sie schließt immer die Subjektivität des Beobachters mit ein.
Auch wenn wir die Natur nicht direkt beobachten, sondern mit Hilfe von Instrumenten, müssen immer die Eigenschaften der Beobachtungsmethode mit einbezogen werden. Allein die Geschichte der Messmethoden zeigt, wie dramatisch die Messgenauigkeit in den zurückliegenden Jahrhunderten verbessert wurde. Mit der Fehlerrechnung wurde den Beobachtern zudem ein Mittel an die Hand gegeben, ihre Messgenauigkeit statistisch zu erfassen.
Diese Fehlerrechnung ist mindestens so bedeutsam wie die Aufzeichnung der Messergebnisse selbst, aber dazu noch später. Praktisch jede moderne naturwissenschaftliche Beobachtung basiert auf der Beschreibung einer zeitlichen Veränderung verschiedener Beobachtungsgrößen, auch Geschwindigkeit und Beschleunigung basieren auf einer Zeit. Man erkennt sofort, wie wichtig eine genaue Zeitmessung für die modernen Naturwissenschaften ist.
In der Antike, man denke nur an Sonnenuhren oder Sanduhren, war eine genaue Zeitangabe oder Zeitmessung nicht so einfach wie mit modernen Chronometern oder Stoppuhren. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse waren dadurch einerseits auf zeitunabhängige Prinzipien, wie beispielsweise das Archimedische Prinzip, ausgerichtet oder aber auf langsame und regelmäßige Veränderungen, die der Genauigkeit der Zeitmessung angemessen waren.
Es ist nur natürlich, dass man bei ungenauen Zeitangaben nach zeitunabhängigen Erhaltungsgrößen sucht. Aus heutiger Sicht wird sofort deutlich, dass sich diese Erhaltungsgrößen immer nur auf die jeweilige Messgenauigkeit bzw. das jeweilige Auflösungsvermögen beziehen können. Wenn mögliche Veränderungen kleiner sind als das verfügbare Auflösungsvermögen, dann sind diese Veränderungen praktisch nicht beobachtbar, gewissermaßen nicht existent!
Die Suche oder der Wunsch nach Perfektion zieht sich durch das ganze Altertum bis hinein in den Monotheismus. Der allmächtige und allwissende Gott, der Hüter der einen und einzigen Wahrheit ist die letztendliche Abstraktion dieser menschlichen Perfektionsmystik. Im Griechischen bezeichnet Mystik Berichte und Aussagen über die Erfahrung einer göttlichen oder absoluten Wirklichkeit sowie die Bemühungen um eine solche Erfahrung.
Über Jahrhunderte bzw. Jahrtausende wurde das menschliche Denken und die Vorstellung der Menschen von dieser Mystik geprägt und gipfelte im 1. Buch Mose, das hebräisch Bereschit und altgriechisch Genesis genannt wird. Es ist das erste Buch des jüdischen Tanach, des samaritanischen Pentateuch sowie des christlichen Alten Testaments, und damit das erste Buch der verschiedenen Fassungen des biblischen Kanons. Nach dieser Vorstellung ist die Welt ein von Gott geschaffenes geschlossenes oder vollständiges System.
Ein vollständiges System ist dadurch gekennzeichnet, dass es in ihm Erhaltungsgrößen mit den zugehörigen Erhaltungssätzen gibt. Herkömmliche Physik setzt immer vollständige Systeme voraus, die entweder bestimmt sind (Klassische Physik) oder unbestimmt sind (Quantenphysik). Aus diesen Erhaltungssätzen entwickelten sich eine Vielzahl physikalischer Gesetze, die heute das Grundgerüst der Physik bilden.
Solange die Genauigkeit dieser Gesetze besser ist als die jeweils verwendete Messgenauigkeit, sind diese Gesetze gegen eventuelle Kritik gefeit. Physikalische Gesetze sind perfekte Gleichungen und wenn Abweichungen von dieser Perfektion Zehnerpotenzen kleiner sind als die verwendete Messtechnik empirisch nachweisen kann, dann gibt es keinen wissenschaftlichen Grund, an diesen Gesetzen zu zweifeln.
So formte sich das Bild einer exakten Wissenschaft und wurde durch jede weitere Messung immer weiter bestätigt. Mögliche Widersprüche wurden weggebügelt, denn die Vorteile einer exakten Wissenschaft sind die Fähigkeit zu exakten Vorhersagen. Dieses Wunschdenken ist noch heute die Triebfeder, in vollständigen Systemen zu denken.
Erst den Biologen gelang es, dieses Denkmuster zu verlassen und eine Vollständigkeit in Frage zu stellen. Eine Evolutionslehre wurde erstmals von Jean-Baptiste de Lamarck zu Anfang des 19. Jahrhunderts und wenig später von Charles Darwin angestoßen, hat aber nur begrenzt Einzug in die Physik gehalten. Die Unveränderlichkeit physikalischer Gesetze und Konstanten wird von den meisten Physikern als heiliger Gral, als die DNA unseres Universums betrachtet.
Der Evolution wird dann derart Tribut gezollt, dass unterschiedliche Universen eine unterschiedliche DNA besitzen können, also in Form einer Multiversen-Theorie. Dann kann natürlich das Universum nicht mehr das Ganze sein.
Der einzige Grund für die Annahme anderer Universen ist die Annahme, dass die DNA unseres Universums unveränderlich ist, also nicht mutieren kann. Heute wissen wir, dass unsere eigene DNA mutieren kann, zwar nur sehr langsam und geringfügig, aber sie kann. In unserem Körper sind viele Mechanismen eingebaut, die eine Mutation verhindern sollen, was auch größtenteils gelingt.
Wenn man Bestimmtheit und Vollständigkeit als Systemparameter betrachtet, ergibt sich die angeführte Tabelle. Zu beachten ist dabei, dass Unvollständigkeit Bestimmtheit ausschließt. Ein bestimmtes System muss vollständig sein!
Art der Lehre
Bestimmtheit
Vollständigkeit
Klassische Physik
Ja
Ja
Quantenphysik
Nein
Ja
Evolutionslehre
Nein
Nein
Die Zielsetzung dieses Essays ist zu verdeutlichen, dass man die Evolutionslehre als eine Verallgemeinerung der Quantenphysik auf unvollständige Systeme begreifen kann, so wie auch die Quantenphysik eine Verallgemeinerung der klassischen Physik auf unbestimmte Systeme darstellt.
Dann könnte man aber auch die Bezeichnung Evolutionslehre durch Evolutionsphysik ersetzen, was verdeutlicht, dass es sich letztlich um die gleiche Wissenschaft handelt, nur jenseits jeglicher Beschränkungen. Die einzige Bedingung dafür ist, auf Erhaltungssätze zu verzichten, dessen bekanntester der Satz von der Erhaltung der Energie ist.
Hier stellt sich natürlich die fundamentale Frage, ob nicht sogar der monotheistische allmächtige und allwissende Gott bereits eine Erhaltungsgröße repräsentiert oder zumindest unbewusst als eine solche interpretiert wird. Diese Aussage stellt keinesfalls einen Gott in Frage, sondern einzig seine Interpretation und das ist letztlich keine wissenschaftliche Frage mehr. Können sich unvollständige Menschen Vollständigkeit überhaupt vorstellen, ohne in Wunschdenken zu verfallen?
Energieerhaltung
Ein wichtiges Merkmal physikalischer Überlegungen und der daraus resultierenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind die Erhaltungssätze. Wenn in einem System solche Erhaltungssätze gelten, bezeichne oder definiere ich dieses System als vollständig, vollständig in Bezug auf diese Erhaltungsgröße. Wenn ich im Folgenden den Begriff Vollständigkeit benutze, beziehe ich mich explizit auf den zugehörigen Erhaltungssatz.
Der wohl wichtigste und bekannteste Erhaltungssatz der Physik ist sicherlich der Satz von der Erhaltung der Energie, den ich am Beispiel eines Pendels erläutern möchte. Ein einfaches Pendel besteht aus einer Metallkugel, die mit einem Faden aufgehängt ist. Die Schwingung des Pendels lässt sich als Energiewandlung