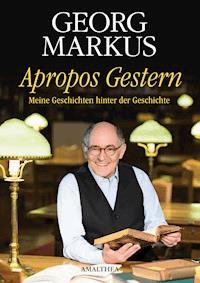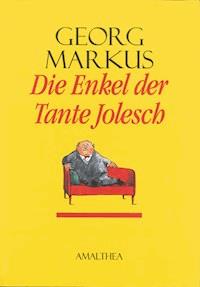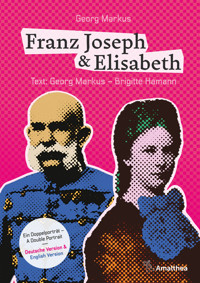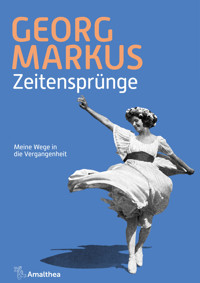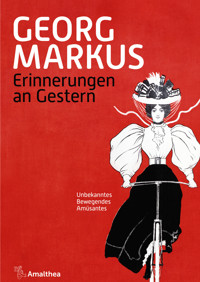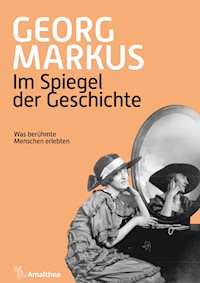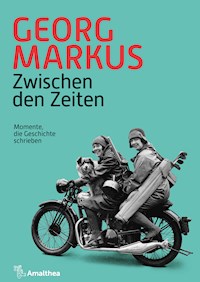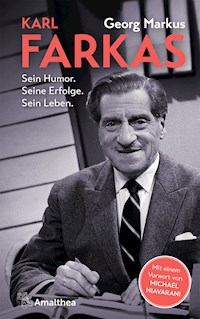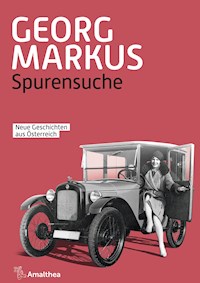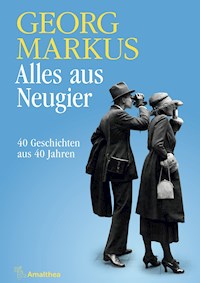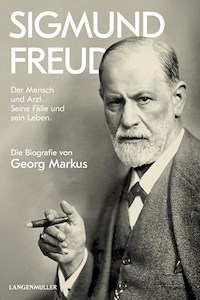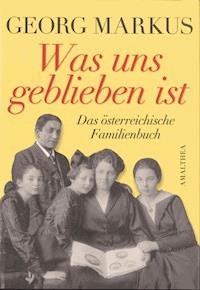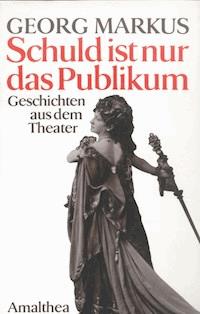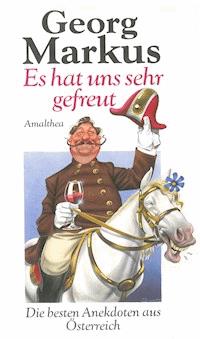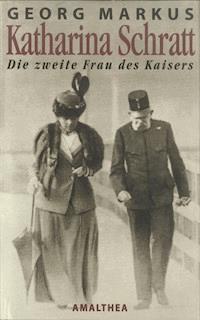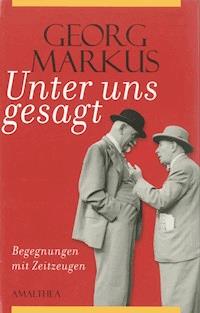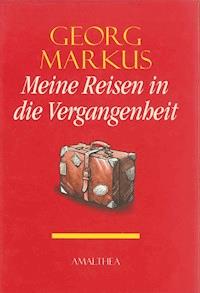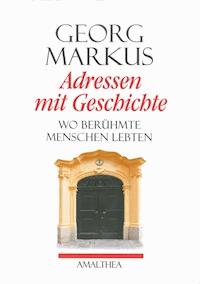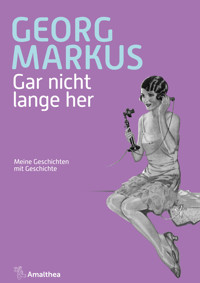
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt wenige, die wie Georg Markus die Gabe haben, Vergangenes so lebendig werden zu lassen, als wäre es eben erst passiert: Er beschreibt den dramatischen Moment, in dem Kronprinz Rudolf um ein Haar Kaiser Franz Joseph erschossen hätte, ebenso fesselnd wie die Entführungen des Industriellen Walter Michael Palmers und des Sohnes von Frank Sinatra. Er erzählt die Liebesgeschichte einer Wienerin mit Columbo-Darsteller Peter Falk so taktvoll wie er die Faszination der Weltstars Sophia Loren, Jack Lemmon und Walter Matthau erklärt. Der Bestsellerautor schildert Kriminalfälle um Franz Lehár, Paula Wessely und Leo Slezak und porträtiert berühmte Wiener Cafés und deren legendäre »Bewohner« Oskar Werner und Helmut Qualtinger. Und das so amüsant, dass Geschichte zum Vergnügen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
GEORG MARKUS
Gar nicht lange her
Meine Geschichten mit Geschichte
Mit 69 Abbildungen
Bleiben wir verbunden!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.atund abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unteramalthea.at/newsletter
Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen undNeuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgenSie uns auf Instagram oder Facebook unter@amaltheaverlag
Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected]
Redaktioneller Hinweis:
In Fällen, in denen aus Gründen der Stilistik das generische Maskulinumverwendet wird, sind grundsätzlich immer alle Geschlechter gemeint.
© 2025 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Am Heumarkt 19, A-1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagfoto: © Illustrated London News Ltd/Mary Evans/picturedesk.com
Lektorat: Rainer Höltschl
Korrektorat: Christine Kanzler
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz, Erding
Gesetzt aus der 12,75/17,35 pt Chaparral Pro Light
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-293-8
eISBN 978-3-903441-48-4
INHALT
Wie lange ist’s her?
Vorwort
KAISERLICH-KÖNIGLICHES I.
Was wurde aus Sisis Schwester Helene …
… die Kaiser Franz Joseph heiraten sollte?
Attentat nicht ausgeschlossen
Wollte Kronprinz Rudolf den Kaiser töten?
Der letzte Wagen des letzten Kaisers
Kaiser Karl verleiht sein Auto
ACH, WÄRE ER NUR EIN MALER GEBLIEBEN
Der verstoßene Schwiegersohn
Johann Strauss distanziert sich
Klimts Geliebte spricht
Ein intimes Tonband taucht auf
Der »Führer« als Kunstmaler
Als Künstler hätte Hitler nicht Geschichte geschrieben
Der Raubmord an der Witwe …
… des Malers Wassily Kandinsky
ÄRZTE UND IHRE PATIENTEN
Der Arzt, der im Urwald ordinierte
Albert Schweitzer rettet die Ärmsten der Armen
Tod im Fernsehstudio
Friedrich Hacker starb während einer Livesendung
Hausarzt mit über hundert Jahren
Ein Besuch bei Europas ältestem Mediziner
KRIMINALFÄLLE
Raubmord im Bristol
Ein ungewöhnlicher Kriminalfall im Luxushotel
Drei Wiener Kriminalfälle …
… und ihre prominenten Opfer Franz Lehár, Paula Wessely und Leo Slezak
»Sie klingen nicht wie Sinatra«
Die Entführung des Frank Sinatra junior
»Ich habe mich zum Nachtmahl verspätet«
Die Entführung des Walter Michael Palmers
TYPEN UND ORIGINALE
»Kyselak war hier«
oder Wie man berühmt werden kann
Ein Fiaker macht Karriere
Der diskrete Josef Bratfisch
Der treue Diener Ketterl
Keiner stand dem Kaiser so nahe wie er
Eine Ohrfeige von der Reichsgräfin
Die seltsamen Auftritte der Beatrice Triangi
Der echte »Hauptmann von Köpenick«
Die Geschichte des Schusters Wilhelm Voigt
ADEL VERPFLICHTET
»Wer nicht dazugehörte, den übersah man«
Österreichs Aristokratie
Herr von Knigge benimmt sich schlecht
Der Ahnherr der feinen Sitten war nicht immer fein
Das »Fuchs-Schlößchen« hat es nie gegeben
Das Märchen vom Geschenk der Maria Theresia
LOVESTORYS
Das süße Wiener Mädel …
… und was aus ihm wurde
Der verliebte General
Eine Affäre zwischen Krieg und Leidenschaft
Coco Chanel und Herr von Pantz
Ein Baron schreibt Modegeschichte
Columbos große Wiener Liebe
Peter Falk und die Schauspielerin Susanne Widl
FILMSTARS
Weltstar voller Selbstzweifel
Keine Heldenrollen für Jack Lemmon
Der Hüne mit dem Dackelblick
Der Komödiant Walter Matthau
Immer noch im Dienste Ihrer Majestät
James Bond lebt auch nach seinem Tod weiter
Rendezvous mit einer Legende
Sophia Loren in Oberösterreich
SELBST ERLEBTES
»Des is doch ka Beruf für mich«
Wie ich Journalist wurde – und blieb
Die Fürstin und das Gift
Das aufregende Leben der Elisabeth Thury
Wie ich Stift Melk zu einer Standuhr verhalf
oder Das Wunder im Benediktinerkloster
ZWEI KATASTROPHEN
Caruso überlebt das große Erdbeben …
… von San Francisco
Tod auf der Titanic
Die österreichischen Passagiere
NACHTRAG ZU NACHRUFEN
Allein und fern der Heimat
Oskar Werners einsamer Tod
Mein Nachbar Helmuth Lohner
Persönliche Erinnerungen
»Weil ich nichts anderes kann«
Nachruf auf Otto Schenk
KAISERLICH-KÖNIGLICHES II.
Die einzige Liebesheirat …
… unter den Töchtern Maria Theresias
Schön sein wie Sisi
Eine Kaiserin als Vorbild
Ein Leben im Schatten von Mayerling
Kronprinzessin Stephanies Liebesaffäre
IM KAFFEEHAUS
Wiens ältestes Kaffeehaus
Wo Mozart und Beethoven auftraten
Familienkrieg im Hause Hawelka
Die berühmten Buchteln, next generation
Qualtingers Wohnzimmer
Wiens Künstlertreff Gutruf
Quellenverzeichnis
Bildnachweis
Namenregister
Wie lange ist’s her?
Vorwort
Was wurde eigentlich aus jener Prinzessin, die beinahe Kaiserin von Österreich geworden wäre, hätte sich Kaiser Franz Joseph nicht im letzten Augenblick in deren jüngere Schwester Sisi verliebt? Die verhinderte Braut hieß Helene in Bayern und hatte, wie so viele in ihrer Familie, ein schweres Schicksal. Mehr davon im Kapitel KAISERLICH-KÖNIGLICHES I.
Kaum 200 Jahre sind seit Sisis und Franz Josephs Heirat vergangen, das mag für viele Leser eine lange Zeitspanne sein, für mich ist es: »Gar nicht lange her«. Ist es auch nicht, wenn man das 19. Jahrhundert der Menschheitsgeschichte gegenüberstellt, die vor sechs Millionen Jahren begann.
Vor nicht ganz 140 Jahren kam es zu einem Jagdunfall, der im Verdacht steht, gar keiner gewesen zu sein: Kronprinz Rudolf sollte auf der Pirsch in Mürzsteg auf Hochwild schießen, zielte aber in Richtung seines Vaters, Kaiser Franz Joseph, den er um Haaresbreite verfehlte, ein Wildhüter wurde dabei verletzt. Selbst ein Enkel des Thronfolgers meinte, dass Kronprinz Rudolf damals den Kaiser töten wollte. Immerhin hat er ein Jahr später unter Beweis gestellt, dass er zu solch einer Tat fähig war.
MALER stehen im Mittelpunkt des nächsten Kapitels: Franz von Bayros war der Schwiegersohn des Walzerkönigs Johann Strauss, bis dieser den Mann seiner Stieftochter zur Scheidung zwang. Gustav Klimts Geliebte hinterließ auf einem Tonband ihre Erinnerungen an das Malergenie. In einem weiteren Abschnitt werden Hitlers ungelenke Versuche geschildert, sich in Wien als Kunstmaler zu etablieren. Berichtet wird in diesem Kapitel auch über den bis heute ungeklärt gebliebenen Raubmord an der Witwe des großen Expressionisten Wassily Kandinsky.
Unter den ÄRZTEN finden sich der berühmte Urwalddoktor Albert Schweitzer, der Terror- und Aggressionsforscher Friedrich Hacker, der während einer Livediskussion im Fernsehstudio starb, und István Körmendi, der älteste aktive Arzt Europas. Ich besuchte ihn in seiner Ordination in Budapest, in der er mit seinen 102 Jahren immer noch täglich seine Patienten betreut.
ADEL VERPFLICHTET nicht zum Weiterlesen, dies kann aber empfohlen werden. Erzählt wird hier, wie sich die Liechtensteins mit den Habsburgern zerstritten, wie die Schwarzenbergs zu ihrem riesigen Vermögen kamen und wie – auch das ist eigentlich »Gar nicht lange her« – der Abstieg der Aristokratie in Österreich begann und das Bürgertum immer mehr Einfluss erlangte. Und: Obwohl Herr von Knigge als Ahnherr des guten Benehmens bekannt ist, hat er sich selbst mitunter alles andere als gut benommen.
In Rodaun am Stadtrand von Wien steht das barocke »Fuchs-Schlössl«, das laut Überlieferung seinen Namen der ehemaligen Eigentümerin Gräfin Maria Karoline Fuchs verdankt. Doch die hat das prunkvolle Anwesen weder gekannt noch besessen oder gar bewohnt. Hier erfahren Sie, wie es zu dem Ammenmärchen um die Gräfin Fuchs gekommen ist. Tatsächlich gewohnt hat in dem Schlössl der Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal.
Pikant wird es im Kapitel LOVESTORYS. Hier geht es um die gar nicht romantische Geschichte des »süßen Wiener Mädels«, das durch Arthur Schnitzler zu einer literarischen Figur wurde. Unglaublich die Affäre des Generalstabschefs Franz Conrad von Hötzendorf, der sich als mächtigster Militär der k. u. k. Armee weniger um seine Aufgaben im Ersten Weltkrieg als um seine große Liebe kümmerte. Rund 3000 seiner Liebesbriefe an Gina von Reininghaus sind erhalten geblieben.
Modegeschichte schrieb die Liaison des österreichischen Barons Hubert von Pantz mit der französischen Couture-Ikone Coco Chanel. Bei Cocos Besuchen im Salzburger Schloss Mittersill trug der Hausdiener des Barons einen Trachtenjanker, der sie zum Entwurf eines der berühmtesten Kleidungsstücke aller Zeiten inspirierte: des Chanel-Kostüms.
»Columbos große Wiener Liebe« beschreibt das Verhältnis des wohl berühmtesten Fernsehinspektors der Welt, Peter Falk, mit der schönen Österreicherin Susanne Widl. In ihrem ersten großen Geständnis dieser Amour fou erzählt Frau Widl ab Seite 180, wie und wo sie Peter Falk kennenlernte und wie sie den Weltstar 27 Jahre lang regelmäßig heimlich treffen konnte.
Der Übergang von Columbo zum Kapitel FILMSTARS ist ein fließender. Es enthält Porträts der Hollywoodlegenden Jack Lemmon und Walter Matthau und erzählt die in Kitzbühel handelnde Entstehungsgeschichte des Geheimagenten James Bond. Ich berichte auch von meiner Begegnung mit Weltstar Sophia Loren 1978 in Franking bei Braunau in Oberösterreich.
Über SELBST ERLEBTES informiere ich auch im nächsten Kapitel: Von den Anfängen und Anekdoten aus meinem Journalistenleben über eine Fürstin, die wegen mehrfachen Mordversuchs vor Gericht stand, bis zur Geschichte einer verloren geglaubten antiken Standuhr, der ich – ohne es zu wissen – zu ihrer Rückkehr in das Benediktinerstift Melk verhalf.
Unter den KRIMINALFÄLLEN finden sich drei berühmte Künstler, die zu Opfern von Einbrechern und Erpressern wurden: Franz Lehár, Paula Wessely und Leo Slezak. Zwei weitere Fälle sorgten – in ganz unterschiedlichen Milieus – in den 1960er- und 1970er-Jahren für ungeheures Aufsehen: die Entführung von Frank Sinatra junior in den USA und die Geiselnahme des Wiener »Strumpfkönigs« Walter Michael Palmers in Österreich.
Mitunter ist’s ein kleiner Schritt von ernsten Themen zu eher komischen. Bei den TYPEN UND ORIGINALEN machen Sie Bekanntschaft mit einem sonderbaren Herrn Kyselak, mit einem singenden Fiaker, einem kaiserlichen Kammerdiener, einer in anrüchigen Varietés tanzenden Reichsgräfin und dem als »Hauptmann von Köpenick« berühmt gewordenen Schuster Wilhelm Voigt.
Von zwei KATASTROPHEN am Beginn des 20. Jahrhunderts handelt das Kapitel »Caruso überlebt das große Erdbeben von San Francisco« und ein weiteres über die österreichischen Passagiere der Titanic.
In einem meiner früheren Bücher* habe ich meine Erinnerungen und Nachrufe auf Legenden wie Peter Alexander, Johannes Heesters, Fritz Eckhardt, Paul und Attila Hörbiger, Paula Wessely, Marcel Prawy, Hugo Portisch und Udo Jürgens niedergeschrieben, hier bringe ich drei NACHTRÄGE ZU NACHRUFEN, nämlich auf Oskar Werner, Helmuth Lohner und Otto Schenk.
Und weil’s so viele Geschichten aus dem Hause Habsburg gibt, gelange ich gegen Ende des Buches zu KAISERLICH-KÄNIGLICHES II. Selbst bei der Heirat von Maria Theresias Lieblingstochter kann man auch nach 260 Jahren immer noch »Gar nicht lange her« sagen. Noch näher an unsere Zeit gelangen wir im Kapitel »Schön sein wie Sisi«, das vom Schönheitskult der Kaiserin Elisabeth handelt. »Ein Leben im Schatten von Mayerling« enthüllt, dass nicht nur Kronprinz Rudolf fremdging, sondern auch dessen Frau Stephanie.
Für IM KAFFEEHAUS besuchte ich schließlich drei Traditionscafés in der Wiener Innenstadt: zuerst das Frauenhuber, Wiens ältestes Kaffeehaus, danach war ich Zeuge eines innerfamiliären Streits bei den Hawelkas und zu guter Letzt begab ich mich in »Qualtingers Wohnzimmer«, ins Gutruf.
Drei ehrwürdige Lokale, zusammen über 400 Jahre alt. Und doch ist auch die Zeit seit ihrer Gründung »Gar nicht lange her«.
GEORG MARKUS
Wien, im August 2025
Danksagung
Der Autor dankt folgenden Personen für Auskünfte und Anregungen zu diesem Buch: Wolfgang Binder, Georg Czedik-Eysenberg, Johannes von Duisburg, Michael Gryksa, Gregor Henckel-Donnersmarck, Günter, Amir, Michael und Herta Hawelka, Rudolf Humer, Gabi Jacoby, István Körmendi, Birgit Kühnl, Katharina Reigersberg, Norbert Rubey, Franz Schubert, Susanne Widl, Anca und Alexander Zah sowie Rainer Höltschl, Jurek von Lingen und Cara Wappenschmidt vom Amalthea Verlag und Dietmar Schmitz.
*Im Spiegel der Geschichte, Wien 2022.
KAISERLICH-KÖNIGLICHES I.
Was wurde aus Sisis Schwester Helene …
… die Kaiser Franz Joseph heiraten sollte?
Es ist eine der beliebtesten Geschichten aus dem Hause Habsburg. Kaiser Franz Joseph fährt im Sommer 1853 nach Ischl, um dem Wunsch seiner Mutter zu entsprechen, seine Cousine Herzogin Helene in Bayern näher kennenzulernen und möglichst bald zu heiraten. Doch der junge Monarch würdigt Helene kaum eines Blickes und verliebt sich in deren Schwester Elisabeth, die eigentlich nur als »Anstandsdame« nach Ischl mitgereist ist. Franz Joseph entscheidet sich für die erst fünfzehnjährige Sisi als künftige Ehefrau und Kaiserin. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, der Rest ist bekannt.
Weniger bis gar nicht bekannt ist hingegen die weitere Bestimmung Helenes, der »verhinderten« Braut. Auch sie musste in ihrem Leben viele Schicksalsschläge hinnehmen.
Tatsächlich hätte die »Kupplerin«, Erzherzogin Sophie, die eigenmächtige Wahl ihres Sohnes vorhersehen müssen: Während man Elisabeth wegen ihrer zarten Gestalt, der feinen Gesichtszüge und des prachtvollen Haares schon als Kind bewundert hatte, galt ihre um drei Jahre ältere Schwester als weit weniger attraktiv. Selbst Franz Josephs Mutter fand die »arme Helene« nach einem früheren Treffen in Innsbruck »gar nicht hübsch«. Dass Sophie ihre Nichte dennoch zur künftigen Kaiserin von Österreich machen wollte, hatte zweifellos dynastische Gründe, denn Helene war die älteste Tochter ihrer Schwester Ludovika und des Herzogs Max in Bayern, weshalb sie eine wesentlich bessere Ausbildung als ihre Schwestern genossen hatte. Man hielt sie deshalb auch für besonders klug und gebildet (was sie übrigens auch war). Doch für Franz Joseph zählten, zumindest was seine künftige Frau betraf, dynastische Gründe weniger als Schönheit und Charakter. Und Helenes Charakter soll eher schwierig gewesen sein. Gegen Sisi sprachen einzig ihre etwas gelblichen Zähne.
Eigentlich war Prinzessin Helene in Bayern (Bild) als Ehefrau für Kaiser Franz Joseph vorgesehen. Doch der entschied sich für Sisi.
Auch wenn es keine schriftlichen Belege dafür gibt, gilt als erwiesen, dass Erzherzogin Sophie und ihre Schwester Ludovika den Kaiser am 18. August 1853, seinem 23. Geburtstag, in Ischl mit Helene verloben wollten. Dass Franz Joseph dies ablehnte, war für Helene – in der Familie Nené genannt – eine große Niederlage, überhaupt weil die fromme, aber liberal denkende Prinzessin ohnehin als »schwer vermittelbar« galt.
Franz Josephs Entscheidung änderte aber nichts an der liebevollen Beziehung der beiden Schwestern zueinander. »Solange sie (nach Sisis Hochzeit in Wien, Anm.) vereinigt waren, steckten sie immer beisammen«, lässt Ludovika ihre Schwester Marie von Sachsen in einem Brief wissen.
Und dann findet sich doch noch, förmlich im letzten Augenblick, ein Mann für Helene. Herzog Max und seine Frau Ludovika hatten nach etlichen Fehlschlägen die Königsidee, die durch den Aufbau des europaweiten Postwesens zu den reichsten Fürsten des Landes zählende Familie Thurn und Taxis zur Jagd nach Bayern einzuladen, inklusive Erbprinz Maximilian, der sich sofort für Helene erwärmte.
Ein Thurn und Taxis war einer Herzogin in Bayern zwar nicht ebenbürtig, doch König Maximilian von Bayern zog sein Veto als Oberhaupt des Hauses Wittelsbach bald zurück, da er einsah, dass neben dem Erbprinzen weit und breit keine Alternative in Sicht war. Außerdem bemühte sich Sisi bei Franz Joseph um Zuspruch, da das Wort des Kaisers natürlich Gewicht hatte. Dabei dürfte ein Rest von schlechtem Gewissen mitgespielt haben, weil Elisabeth ihrer Schwester den kaiserlichen Gemahl »weggeschnappt« hatte. So bekam sie auch die Zustimmung des Kaisers.
In der Familie Thurn und Taxis wiederum war Herzogin Helene schon aus Standesgründen hochwillkommen. Die Hochzeit fand am 24. August 1858, viereinhalb Jahre nach der Heirat ihrer Schwester Sisi, in Possenhofen statt.
Helene behielt zeitlebens ihr sehr gutes Verhältnis zu ihrer Schwester Elisabeth, aber auch zum Kaiser. Als Sisi 1860 an einer schweren Tuberkulose litt und von ihren Ärzten zur Genesung nach Korfu geschickt wurde, eilte Nené sofort an ihr Krankenbett, an dem es ihr gelang, die unter Appetitmangel leidende Schwester zu regelmäßigem Essen zu bewegen und mit ihr Ausflüge zu unternehmen. Außerdem fuhr Helene danach von Korfu nach Wien, um dem besorgten Kaiser über den (sich langsam bessernden) Zustand seiner Frau Bericht zu erstatten.
»Helene bringt ein großes Opfer, das ihr so schwer wird, aber sie sagte, der Kaiser hätte sie so dringend darum gebeten, er hätte ihr so unbeschreiblich leidgetan – der arme, liebe Kaiser«, schreibt ihre Mutter Ludovika an Marie von Sachsen. Nené hatte Franz Joseph längst die seinerzeitige Ablehnung verziehen, umso mehr, als sie mittlerweile erkannt hatte, dass Sisis Los als Erste Dame der Donaumonarchie alles andere als wünschenswert war.
Darüber hinaus erwies sich Helenes Ehe mit dem Prinzen Thurn und Taxis – ganz im Gegensatz zu sämtlichen Ehen ihrer sieben erwachsen gewordenen Geschwister – als überaus glücklich. Doch nachdem Helene ihrem Mann zwei Söhne und zwei Töchter geschenkt hatte, begann dieser an einem schweren Nierenleiden zu laborieren, dem er am 26. Juni 1867 im Alter von 35 Jahren erlag – übrigens nur sieben Tage nach einer anderen Familienkatastrophe, der Hinrichtung Kaiser Maximilians von Mexiko, des Bruders Kaiser Franz Josephs. Nach dem Ableben ihres Mannes musste Helene noch den Tod ihrer zwanzigjährigen Tochter Elisabeth, verehelichte Braganza, und ihres 22-jährigen Sohnes Maximilian ertragen. Nach all den Verlusten zog sich Helene vollkommen zurück und lebte nur noch für ihren Glauben.
Als sie 1890 im Alter von 56 Jahren selbst schwer erkrankte, war es nun an Elisabeth, die unter starken Schmerzen leidende Schwester aufzusuchen. Die Kaiserin reiste nach Regensburg ins Schloss der Familie Thurn und Taxis, wo es laut Tagebuch von Sisis Tochter Marie Valerie an Helenes Sterbebett zu diesem Dialog kam:
»Wir beide hatten in unserem Leben harte Zeiten auszuhalten«, sagte Mama. »Ja, weil wir ein Herz besitzen«, erwiderte Tante Nené, ehe sie ihre letzten Worte sprach: »Ach ja, das Leben ist doch ein Jammer und ein Elend.«
Der Tod ihrer Lieblingsschwester war ein schwerer Schlag für Elisabeth. Niemand in ihrer Familie war ihr so nahegestanden wie Helene, die einmal dazu bestimmt war, Kaiserin von Österreich zu werden. Eine Stellung, die sie ihr – ohne es gewollt zu haben – weggenommen hatte.
Wäre Franz Joseph mit Helene glücklicher geworden als mit Elisabeth? Abgesehen davon, dass die Frage »Was wäre, wenn?« in der Geschichtsschreibung unzulässig ist, steht lediglich fest, dass Helene nicht so oft auf Reisen gegangen wäre wie Elisabeth und den Kaiser somit nicht so viel alleingelassen hätte. Andererseits starb sie acht Jahre vor ihrer jüngeren Schwester Sisi, wodurch Franz Joseph auch diese Zeitspanne in noch größerer Einsamkeit verbracht hätte. Vor allem aber: Franz Joseph hat Elisabeth – und nur Elisabeth – wirklich geliebt.
Attentat nicht ausgeschlossen
Wollte Kronprinz Rudolf den Kaiser töten?
Der unglaubliche Vorfall ereignete sich am 3. Jänner 1888, ein Jahr vor Mayerling, und wurde nie aufgeklärt. Kronprinz Rudolf gab damals im Revier des kaiserlichen Jagdschlosses von Mürzsteg einen Schuss ab, der seinen Vater, Kaiser Franz Joseph, nur um Haaresbreite verfehlte. Ein Wildhüter wurde dabei verletzt. Die Frage lautet: War es wirklich ein Unfall? Oder steckte etwas ganz anderes dahinter?
Zunächst: So ziemlich das Einzige, was den Thronfolger mit seinem Vater verband, war die Liebe zur Jagd. Franz Joseph hatte Rudolf sehr früh zum Weidmann erzogen und ihm schon als Kleinkind vom Ischler Büchsenmacher Leithner einen Jagdstutzen anfertigen lassen. In Rudolfs rund zwanzigjähriger Karriere als Jäger ergibt sich laut Schussliste »eine Gesamtstrecke von rund 50 000 Stück Wild«.
Das Jagdunglück von Mürzsteg ist erwiesen und wurde bereits in der 1928 von Oskar von Mitis verfassten ersten großen Rudolf-Biografie beschrieben: »Nur um Haaresbreite fehlte es damals, dass der Thronfolger seinen Vater erschoss, … als im Höllengraben bei Mürzsteg auf Kahlwild gejagt wurde. Der Trieb ging, nachdem sowohl der Kaiser wie der Kronprinz ziemlich viel geschossen hatten, bereits dem Ende zu, als dem Kronprinzen noch ein Rudel Hochwild kam. Er beschoss das Wild, und als es immer weiter flüchtend für ihn immer weniger erreichbar wurde, vergaß er die alte Regel, verließ seinen Stand und schoss nochmals, als das Wild schon gegen den Stand des Kaisers zog. Die Kugel traf den hinter dem Stand des Kaisers sitzenden Träger Martin Veitschegger aus Mürzsteg beim Ellenbogen in den Ärmel. Dieser erhielt vom Kaiser 50 Gulden und der Kronprinz durfte an dem Trieb am nächsten Tag nicht teilnehmen. So war durch das völlig regelwidrige Verhalten des Thronfolgers die Gefahr einer unerhörten Katastrophe, die mit unabsehbaren Folgen verknüpft gewesen wäre, heraufbeschworen worden.«
Die Liebe zur Jagd war so ziemlich das Einzige, was Kronprinz Rudolf mit dem Kaiser verband.
Nie war in diesem Zusammenhang eine andere Version als die eines Unfalls verlautet worden. Bis der Schriftsteller Rolf Hochhuth* im August 1988, ein halbes Jahr vor der Wiederkehr des hundertsten Mayerling-Gedenktages, in einem Artikel in der Wiener Tageszeitung Die Presse ein Gespräch wiedergab, das er mit dem 1981 verstorbenen Enkel des Kronprinzen geführt hatte.
Hochhuth schreibt, er sei einmal beim Prinzen Franz Josef Windisch-Graetz** zu Gast gewesen. Wie nicht anders zu erwarten, entwickelte sich das Gespräch zwischen Windisch-Graetz und Hochhuth bald in Richtung Mayerling. Plötzlich sagte der Prinz zum Schriftsteller: »Gern sagt man das ja nicht als Enkel, aber mein Großvater hat geschossen auf den Kaiser! Auf der Jagd hat er’s versucht, ihn umzubringen, aber der Schuss ging in den Arm des Büchsenspanners. In dem Moment, als er dem Kaiser ein neu geladenes Gewehr hinhielt, bekam er an seinem linken Unterarm den Schuss. Der Kaiser, kreidebleich, kam von seinem Anstand herab und hat vor der versammelten Gesellschaft seinen Sohn aufgefordert, sofort die Jagd zu verlassen. Schon dass der Kronprinz dort seinen Stand aufgebaut hatte, ließ auf ein Attentat schließen: So postiert man sich nicht, dass man so leicht den Nachbarn treffen kann.«
Der Enkel war »überzeugt, der Jagd-›Unfall‹ sei durchaus – Rudolf war ein Meisterschütze – keiner gewesen, sondern ein Attentat«. Laut Hochhuth war Windisch-Graetz völlig freizusprechen von der Verdächtigung, leichtfertig und unbewiesen seinen Großvater eines Mordanschlages gegen den Urgroßvater bezichtigt zu haben. Der Prinz sah in seinem Großvater einen bedeutenden Politiker, der verzweifelt war, an seinem starrsinnigen Vater vorbei keine Reform zur Rettung der Monarchie durchsetzen zu können, und deshalb in die gewaltsame Opposition, ja bis zum Mordversuch, gedrängt worden sei … »Das«, fügte Hochhuth seinem Bericht an, »wollte ich überliefern.«
Guillaume Windisch-Graetz hat mir gegenüber im Jahr 1993 bestätigt, dass das Gespräch seines Vaters mit Rolf Hochhuth stattgefunden hat und sein Vater tatsächlich davon überzeugt war, Rudolf hätte versucht, den Kaiser zu ermorden.
Anzufügen ist noch eine Stelle aus einem Brief Rudolfs an seine Gemahlin Stephanie, in der er über den verhassten deutschen Kaiser schreibt: »Den Wilhelm möcht ich höchstens einladen, um ihn durch ein Jagdabenteuer aus der Welt zu schaffen.«
Der Brief stammt aus dem Jahr 1888, in dem sich der mysteriöse Jagdunfall ereignete. Ein Jahr später hat Kronprinz Rudolf in Mayerling bewiesen, dass er es sich nicht nur vorstellen konnte, sondern dass er durchaus in der Lage war, auf einen Menschen zu schießen.
*Rolf Hochhuth, deutscher Dramatiker, 1931–2020
**Prinz Franz Josef von Windisch-Graetz, 1904–1981, war der Sohn der »roten Erzherzogin« Elisabeth Windisch-Graetz und des Fürsten Otto Windisch-Graetz. Er war somit der Enkel des Kronprinzen Rudolf und Urenkel Kaiser Franz Josephs.
Der letzte Wagen des letzten Kaisers
Kaiser Karl verleiht sein Auto
Da standen die beiden Herren einander gegenüber. Karl I., der letzte Kaiser der k. u. k. Donaumonarchie und Victor Adler, der Führer der österreichischen Sozialdemokratie. Die ersten Novembertage des Jahres 1918 waren ins Land gezogen und der 31-jährige Monarch sah in den Gesprächen mit dem 66-jährigen Parteiführer die letzte Chance, sein vom Untergang bedrohtes Reich doch noch retten zu können.
Der einstige Armenarzt Victor Adler tat sich schwer bei den Verhandlungen, denn er litt an Herzschwäche, Asthma und Wassersucht. Und doch erlaubte es die akute Staatskrise nicht, sich zurückzuziehen. Hier eine Besprechung mit dem k. u. k. Außenminister, da vermittelnde Worte mit revolutionären Gruppierungen und in Schönbrunn fast täglich eine Unterredung mit dem Kaiser.
Gerade weil die Gespräche mit Victor Adler für den Kaiser von existenzieller Bedeutung zu sein schienen, bemühte er sich auf die entgegenkommendste Weise, dem todkranken Mann die Koordination seiner vielen Termine zu erleichtern.
»Ich lasse Sie heute Nachmittag mit dem Wagen aus der Stadt holen«, soll Kaiser Karl dem Parteiführer angeboten haben, »und später wird Sie der Chauffeur wieder nach Hause bringen.«
Victor Adler schüttelte den Kopf und blieb verlegen vor dem Monarchen stehen. »Das wird nicht gehen«, erklärte er.
»Ja, warum denn nicht?«, fragte Karl.
»Majestät, heute kommt mein Bub aus der Strafanstalt Stein zurück …, ich wollte ihn von der Bahn abholen.«
»Der Bub«, das war Friedrich Adler, Victor Adlers Sohn, der zwei Jahre zuvor den k. k. Ministerpräsidenten Karl Graf Stürgkh im Wiener Hotel Meißl und Schadn erschossen hatte. Kaiser Karl hatte den zu lebenslanger Haft Verurteilten wenige Tage davor begnadigt.
»Aber das macht doch nichts«, erklärte der Monarch. »Holen Sie ihn mit dem Auto von der Bahn ab und dann kommen Sie zu mir!«
Und so war’s dann auch: Victor Adler holte seinen Sohn, den Mörder des Ministerpräsidenten, mit dem »hofgrün« lackierten »Leibwagen Seiner Majestät« von der Bahn ab. Sie fuhren gemeinsam nach Schönbrunn. Und während sein Vater in den kaiserlichen Gemächern mit Karl I. sprach, wartete der Bub draußen vor dem Schloss im Hofauto.
Mit dem »Leibwagen Seiner Majestät« ließ Kaiser Karl I. den Sohn Victor Adlers aus der Strafanstalt Stein abholen.
Eine Woche später wurden sowohl Victor Adler als auch die österreichisch-ungarische Monarchie zu Grabe getragen.
Die Geschichte des Hofautos geht aber weiter. Der zwei Tonnen schwere und 45 PS starke Wagen der Marke Gräf & Stift war 1914 vom Obersthofstallmeisteramt für die »Allerhöchste Verwendung« bestellt, aber von Kaiser Franz Joseph nicht benützt worden. Indes ließ sich der damalige Thronfolger und spätere Kaiser Karl mit der Karosse an alle Fronten des Weltkrieges fahren.
Sobald er dann als Kaiser das Auto benützte, wurde die österreichische Kaiserkrone anstelle einer Nummerntafel montiert. Karl scheint seinen Hofwagen so lieb gewonnen zu haben, dass er ihn 1919, nach dem Zusammenbruch der Monarchie, mit ins Schweizer Exil nahm. Dort geriet das Automobil spätestens mit dem frühen Tod des Ex-Kaisers in Vergessenheit.
Erst 1974 wurde der Hofwagen wiederentdeckt, von der damaligen Gräf & Stift AG aufgekauft und nach Österreich zurückgeholt.
Der Schriftsteller Anton Kuh hatte schon in der Ersten Republik die Forderung aufgestellt, dass das letzte Auto des letzten Kaisers nebst anderen Kuriosa in einem Wiener Museum mit dem Titel »Altösterreich« ausgestellt werden müsse. Zumal der Kaiserwagen ein Sinnbild »für die liebenswürdige Form des österreichischen Zusammenbruchs« sei.
Anton Kuhs Forderung hat sich erfüllt. Auch wenn das Museum nicht den Titel »Altösterreich« trägt – das Hofauto kann heute in der Wagenburg des Schlosses Schönbrunn besichtigt werden.
ACH, WÄRE ER NUR EIN MALER GEBLIEBEN
Der verstoßene Schwiegersohn
Johann Strauss distanziert sich
Es ist eines der berühmtesten Bilder, auf dem Johann Strauss Sohn zu sehen ist. Der Meister am Konzertflügel in seinem Salon sitzend, umgeben von berühmten Freunden und Familienmitgliedern, unter ihnen die Komponisten Johannes Brahms und Carl Goldmark, »Schanis« Brüder Josef und Eduard, der Bildhauer Victor Tilgner sowie des Walzerkönigs dritte Frau Adele. Diese hatte das 86 mal 134 cm große Ölgemälde als Geschenk für ihren Mann bei dem damals berühmten Maler Franz von Bayros in Auftrag gegeben. Hätte sie gewusst, welch weitreichende Folgen die Erschaffung des Bildes nach sich ziehen würde – sie hätte wohl darauf verzichtet.
Aber schön der Reihe nach. Johann Strauss stand im Herbst 1894 aus Anlass seines fünfzigjährigen Berufsjubiläums im Mittelpunkt zahlreicher Feierlichkeiten, hatte er doch am 15. Oktober 1844 im Casino Dommayer in Hietzing seinen ersten Auftritt als Kapellmeister absolviert. Die Wiener Philharmoniker gaben jetzt, ein halbes Jahrhundert danach, Strauss zu Ehren ein Festkonzert und die Gesellschaft der Musikfreunde verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft. Es war naheliegend, dass sich auch Ehefrau Adele mit einem dem Anlass entsprechenden Geschenk einstellen würde.
Den Abend bei Johann Strauss, so der Titel des Bildes, hat es in dieser Konstellation nie gegeben, der 28-jährige Maler Franz von Bayros hat das hochkarätige Zusammentreffen für sein Ölgemälde erfunden und in seinem Atelier auf Leinwand gebannt. Und sich bei dieser Gelegenheit selbst – bescheiden neben Brahms sitzend – gleich dazugezeichnet.
Adele Strauss geb. Deutsch hatte eine neunzehnjährige Tochter namens Alice, die aus ihrer ersten Ehe mit dem 1877 verstorbenen Bankier Anton Strauß* stammte. Wie Alice und Franz von Bayros ein Paar wurden, ist nicht überliefert, sie waren jedenfalls schon verlobt, als Bayros das fertige Bild im prunkvollen Palais Strauss in der Igelgasse** abgeliefert hat.
Man weiß, dass Johann Strauss eine enge Beziehung zu Alice hatte und sie wie eine eigene Tochter behandelte. Den Beweis dafür liefert sein Testament, in dem er sie großzügig mit Tantiemen und Autorenrechten bedachte. Und die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, Alice schätzte und bewunderte ihren berühmten Stiefvater sehr.
Wie auch immer sie einander näherkamen, Alice Strauss und Franz von Bayros feierten jedenfalls im Februar 1896 Hochzeit, bei der kein Geringerer als Johannes Brahms als Trauzeuge fungierte. Ehen wurden damals, besonders in diesen Kreisen, eher selten aus Liebe geschlossen, dafür waren meist ganz andere Gründe ausschlaggebend. Für den um neun Jahre älteren Bayros war es zweifellos auch aus geschäftlichen Gründen von Vorteil, die Tochter des populärsten Komponisten seiner Zeit zu ehelichen; Johann Strauss wiederum »erhoffte sich durch die Verbindung seiner Stieftochter mit einem Adeligen zusätzliche gesellschaftliche Anerkennung. Tatsächlich hatte zu dieser Zeit Franz von Bayros Kontakt zu maßgeblichen gesellschaftlichen Kreisen«, erklärt der Wiener Bayros-Experte Michael Gryksa.
Franz von Bayros war 1866 in Agram, heute Zagreb, als Sohn eines Eisenbahnbauingenieurs der Südbahngesellschaft zur Welt gekommen. Der Vater Otto von Bayros entstammte einer alten spanischen Adelsfamilie und stand im Range eines Marquis, die Mutter Maria war bürgerlicher Herkunft.
Auch wenn Bayros heute als Jugendstilmaler, Zeichner und Grafiker weitgehend vergessen ist, wurde er zur Jahrhundertwende oft in einem Atemzug mit Egon Schiele genannt. Das lag vor allem daran, dass beide durch erotische Abbildungen bekannt und wegen »Herstellung und Verbreitung unzüchtiger Darstellungen« angeklagt und verurteilt wurden.
Nach dem Besuch der Kunstakademien in Wien und München richtete sich Franz von Bayros 1891 in einem Pavillon am Wiener Südbahnhof ein Atelier ein, in dem schließlich auch sein berühmtestes Bild, Ein Abend bei Johann Strauss, entstand. Ein Bild, das ihm Anerkennung – aber auch Ächtung und Zurückweisung einbrachte.
Und das hat mit seiner Ehe mit Alice zu tun, die 1898, also nach nur eineinhalb Jahren, nicht nur geschieden, sondern auch – als hätte es sie nie gegeben – »für nichtig erklärt« wurde. Nicht genug damit, wurde der Kontakt zwischen der Familie Strauss und Herrn von Bayros von einem Tag zum anderen abgebrochen, jede vorherige Verbindung zu leugnen versucht – alle diesbezüglichen Dokumente wurden vernichtet.
Franz von Bayros’ berühmtes Bild Ein Abend bei Johann Strauss, in das sich der Maler (im Kreis neben Johannes Brahms) selbst dazu malte. Darunter ein Ausschnitt, der Brahms und Bayros (rechts im Bild) zeigt.
Doch es sollte noch schlimmer kommen: als man nämlich überlegte, was mit dem Bild des verstoßenen Schwiegersohnes geschehen sollte. Vernichten war keine Option, dafür war das Gemälde zu wertvoll und mittlerweile auch schon zu bekannt.
Also entschloss sich das Ehepaar Adele und Johann Strauss, das Konterfei des Franz von Bayros auf dem von ihm geschaffenen Bildnis übermalen zu lassen. Auch wurde sein Name bei der neu gestalteten Bildbeschreibung unkenntlich gemacht und – als Höhepunkt der Ablehnung – die Signatur des Malers getilgt!
Die Maßnahmen zeigen, dass hier keine »gewöhnliche« Scheidung vorlag, sondern ein außerordentliches Ärgernis. Und so war das auch – jedenfalls aus Sicht der Familie Strauss.
»Am 20. Januar 1897 endete der Friede im Strauß-Palais«, schreibt Strauss-Forscher Franz Mailer. »Alice, verehelichte de Bayros, entschloss sich endgültig, das Zusammenleben mit ihrem Gatten zu beenden. Sie wollte nicht länger hinnehmen, dass Feri de Bayros nicht imstande war, die Ehe auch tatsächlich zu vollziehen, weil sich seine völlige Impotenz längst schon herausgestellt hatte. Da offenbar eine friedliche Trennung nicht möglich war, ging Alice vor Gericht und klagte auf Scheidung. Eine erbitterte Auseinandersetzung war die Folge. Die Öffentlichkeit erfuhr von den Vorgängen nichts.«
Sehr wohl jedoch der jüngste Strauss-Bruder Eduard, der sich in einem Brief an seine Schwägerin Adele im April 1897 als Ohrenzeuge zur Verfügung stellte: »Bezüglich Deiner Frage, entspreche ich hiermit Deinem Wunsche und theile Dir mit, dass Bayros mir sagte, er sei schon ein halbes Jahr vor seiner Verheirathung impotent gewesen, und nur, dass sein Arzt ihm versprach, ihn in 3 Monaten herzustellen, veranlasste ihn, den Hochzeitstag festzustellen. Dieß seine Worte.«
Das k. k. Landesgericht Wien akzeptierte 1897 den Scheidungsgrund, worauf Franz von Bayros in Berufung ging. Doch am 24. Mai 1898 wurde die Ehe dann vom k. k. Obersten Gerichtshof wegen des »auf Seite des Ehegatten bestandenen Ehehindernisses/Immerwährendes Unvermögen, die ehelichen Pflichten zu leisten/für ungültig erklärt«. So geschehen ziemlich genau ein Jahr vor dem Tod des Walzerkönigs.
Franz von Bayros gab daraufhin – gerade 32 Jahre alt geworden – sein Wiener Atelier auf und zog nach München, wo er sich als Illustrator erotischer Literatur, Zeichner für Zeitungen und Exlibris-Gestalter einen Namen machte. 1911 führte jedoch ein weiterer Prozess gegen ihn und seine Verleger wegen »Herstellung und Vertreibung unzüchtiger Darstellungen« zu seiner Flucht aus München und der Rückkehr nach Wien, wo er wieder künstlerisch erfolgreich tätig war. Er starb am 2. April 1924 im Alter von 57 Jahren in Wien.
Alice Strauß war nach überstandenem »Scheidungskrieg« 22 Jahre alt und ging danach noch drei Ehen ein: Am 2. März 1899, ein Jahr nach der rechtskräftigen Scheidung von Bayros, heiratete sie den Wiener Pianisten Richard Epstein, mit dem sie zwei Kinder hatte. 1926 wurde Gustav Seidl ihr dritter Mann, und 1929 ehelichte sie den ehemaligen k. u. k. Oberst Rudolf von Meyszner, durch den sie, obwohl »Volljüdin«, die Nazizeit überleben konnte.
Doch im Juni 1939 startete das Kampfblatt Der Stürmer