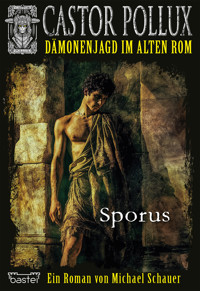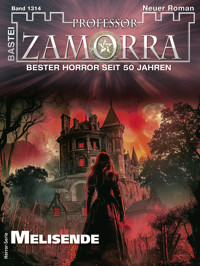1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Sie waren zu siebt.
Langsam trotteten sie durch die unendlich scheinenden Abwasserkanäle der Stadt. Der Gestank, die Feuchtigkeit und die Dunkelheit machten ihnen nichts aus, sie waren es gewohnt, sich dort zu bewegen, wo kaum ein Mensch sich freiwillig hinbegab. Wenn eine der zahlreichen Ratten ihren Weg kreuzte, so machte diese auf der Stelle kehrt und suchte quiekend das Weite. Die Tiere spürten die unheilvolle Aura, die von den Wesen ausging ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Ghouls in New York
Vorschau
Impressum
Ghouls in New York
von Michael Schauer
Sie waren zu siebt.
Langsam trotteten sie durch die unendlich scheinenden Abwasserkanäle der Stadt. Der Gestank, die Feuchtigkeit und die Dunkelheit machten ihnen nichts aus, sie waren es gewohnt, sich dort zu bewegen, wo kaum ein Mensch sich freiwillig hinbegab. Wenn eine der zahlreichen Ratten ihren Weg kreuzte, so machte diese auf der Stelle kehrt und suchte quiekend das Weite. Die Tiere spürten die unheilvolle Aura, die von den Wesen ausging.
Der Anführer blieb stehen und legte den massigen Schädel in den Nacken. Aus toten Augen starrte er nach oben. Etwa zwei Yards über ihm unterbrach eine Scheibe aus Metall die triste Gleichförmigkeit der Betondecke. Lärm drang durch die haarfeine Lücke zwischen Scheibe und Decke zu ihnen herab. Ein dumpfer Klangteppich aus Motorengeräuschen, heulenden Sirenen und Stimmen aus hunderten Kehlen.
Dort oben gab es Menschen. Und wo Menschen waren, da war der Tod nicht fern.
Sie hatten ihr Ziel erreicht. Sie waren wieder zu Hause ...
Wenn Pedro Montega schlechte Laune hatte, dann kam ihm besser keiner zu nahe. Und heute hatte er schlechte Laune, verdammt schlechte sogar. Birdie, sein Kollege, hatte es bereits zu spüren bekommen, als er ihn heute Morgen wie immer mit dem Firmentransporter abgeholt hatte.
Der hochgewachsene Afroamerikaner hatte Montega mit einem enthusiastischen »Guten Morgen« begrüßt, aber der hatte nur etwas Unverständliches gegrunzt und in seinen Kaffee gestarrt. Birdie kannte ihn lange genug, um zu wissen, was das bedeutete. Also hatte er heimlich die Augen verdreht und war losgefahren. Ihr erstes Ziel für heute lag etwa zehn Minuten entfernt, unweit des Times Square.
Verdammte Schlampe, dachte Montega, und meinte damit seine Frau Juliana. Immer wieder trieb sie ihn zur Weißglut mit ihrem Genörgel. Weiterbilden solle er sich. Die Abendschule besuchen. Etwas Besseres aus sich machen als einen Kanalarbeiter.
Aber, bei der heiligen Jungfrau, sie hatte seinen Job gekannt, als sie vor zwei Jahren geheiratet hatten. Wenn es unter ihrem Stand war, mit einem Mann zusammen zu sein, der seine Brötchen damit verdiente, die New Yorker Kanalisation in Schuss zu halten, dann hätte sie eben die Finger von ihm lassen sollen. Schließlich war sie es gewesen, die sich ihm vor drei Jahren förmlich an den Hals geworfen hatte.
Der Sechsundzwanzigjährige schnaubte und nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Das Getränk war schon beinahe kalt, was seine Laune nicht gerade besserte.
»Wieder Ärger mit Juliana?«, fragte Birdie vorsichtig. Langes Schweigen konnte er nicht aushalten, dafür plapperte er einfach zu gerne.
Montega antwortete nicht, aber immerhin ließ er sich zu einem knappen Nicken hinreißen.
»Blöde Weiber«, sagte Birdie, während er konzentriert auf den dichten Vormittagsverkehr achtete.
Ihm war klar, dass das kein besonders gehaltvoller Kommentar war, aber aus Erfahrung wusste er, dass schon das kleinste Zeichen von Solidarität unter Männern Montegas Laune aufbessern konnte.
»Aber echt«, brummte der und nippte an seinem Pappbecher.
Birdie grinste. Das waren schon zwei Wörter gewesen, ein deutliches Zeichen, dass sich die Stimmung seines Kollegen langsam aufhellte. Als wenn nach einem stürmischen Gewitter die Sonne hinter einer sich auflösenden grauen Wolkendecke hervorlugte.
Wenige Minuten später hatten sie ihr Ziel erreicht. Birdie parkte den Wagen am Straßenrand, und die beiden Kollegen stiegen aus. Sofort umfing sie der übliche Lärm, das Geräusch von hunderten Motoren, Sirenen und Menschen, die vorbeihasteten und sich miteinander unterhielten oder in ihre Smartphones plapperten. New York war eine schnelle und laute Stadt, wirkliche Ruhe herrschte nie, schon gar nicht hier in Manhattan.
Pedro Montega hatte bereits die Ladeklappe geöffnet und hievte die Absperrungen heraus. Gemeinsam bauten sie den rotweißen Zaun rund um den Kanaldeckel auf. Gleich würden sie den Deckel öffnen, und natürlich durfte es keinesfalls passieren, dass ein argloser Passant das Loch übersah und hineinstürzte. An dieser Stelle ging es gut zweieinhalb Yards in die Tiefe.
Montega drückte ein Ende seines Werkzeugs, das Ähnlichkeit mit einem Stemmeisen hatte, in die dafür vorgesehene Aussparung und hebelte den runden Deckel aus seiner Fassung und über den Rand. Dann bückte er sich und schob die schwere Platte noch ein Stück weiter zur Seite. Jetzt war die Lücke groß genug, damit er sich hindurchzwängen konnte.
»Ich gehe schon mal rein«, sagte er, setzte seinen weißen Sicherheitshelm auf und schlüpfte in die braungelben Schutzhandschuhe. »Lass mir dann den Schlauch runter.«
»Alles klar, Boss«, bestätigte Birdie. Und fügte leise hinzu: »Schon elf Wörter. Es geht aufwärts.«
Montega kletterte in die Öffnung. Sofort fanden seine Füße Halt auf den in die Wand eingelassenen Metallsprossen. Längst konnte er die Kanalschächte nicht mehr zählen, die er in seinem Leben schon hinab- und hinaufgestiegen war. Eine reine Routinesache, aber dennoch bewegte er sich mit großer Vorsicht, setzte einen Fuß vor den anderen und umklammerte mit den Händen fest die Sprossen. Mehr als ein Kollege war bereits aus purer Nachlässigkeit in die Tiefe gestürzt. Erst vor einem halben Jahr hatte sich der alte Ben einen komplizierten Beinbruch zugezogen, als er den Halt verloren und aus zwei Yards Höhe auf dem Boden aufgeschlagen war.
Unten angekommen, zog Montega die Taschenlampe aus der Halterung an seiner Sicherheitsweste und knipste sie an. Der Lichtfinger erhellte die ihn umgebende Schwärze. An dieser Stelle des rund 7400 Meilen langen Abwassersystems war der Kanal etwa anderthalb Yards breit. Mit den Füßen stand er in einer wenige Inches tiefen, schwarzen Brühe. Der Geruch hier unten hätte die meisten Menschen angewidert die Nase rümpfen lassen, aber Montega nahm ihn schon gar nicht mehr wahr.
Er legte den Kopf in den Nacken. Von Birdie war noch nichts zu sehen. Vielleicht hatte sich der Schlauch auf der Rolle verklemmt, das kam schon mal vor. Ihre Aufgabe war es, mit Wasserdruck den groben Schmutz von den Wänden zu entfernen, bevor sich zu viel davon festsetzte.
Ein Geräusch hinter ihm.
Montega drehte sich um und leuchtete. Es hatte sich angehört wie ein Scharren, aber da war nichts. Allerdings machte der Tunnel fünf Yards vor ihm eine sanfte Biegung, deshalb konnte er nicht allzu weit sehen.
Das Geräusch wiederholte sich, gefolgt von einem leisen Plätschern, als sei etwas in das flache Abwasserrinnsal gefallen.
»Hallo?«, rief Montega.
Keine Antwort. Dafür raste in diesem Moment ein Feuerwehrauto direkt neben der Schachtöffnung vorbei. Montega vernahm die charakteristischen, ohrenbetäubend lauten und jaulenden Sirenen und hörte für einen Moment nichts anderes mehr.
Nachdem die Sirenen verklungen waren, starrte er für einen Moment in die Dunkelheit, dann setzte er sich vorsichtig in Bewegung. Er hatte sich die Geräusche keinesfalls eingebildet. Möglich, dass es Ratten waren. Aber Montega wollte es genau wissen. Er kannte die Geschichten von Menschen, die angeblich in der Kanalisation lebten, und der Anflug einer Gänsehaut lief ihm über den Rücken.
Selbst gesehen hatte er noch nie jemanden, nur Geschichten gehört. Dasselbe galt für die Krokodile, die angeblich irgendwann jemand als Babys in der Toilette heruntergespült haben sollte. Eine urbane Legende, die nicht totzukriegen war.
Als er die Biegung erreichte, drang ein übler, irgendwie süßlicher Geruch in seine Nase, so intensiv, dass er sogar den üblichen Gestank hier unten überlagerte.
»Pedro? He, Pedro!«
Birdie rief nach ihm. Offenbar war der Schlauch jetzt einsatzbereit.
Montega wandte den Kopf. »Einen Moment, ich muss gerade etwas nachprüfen«, rief er über die Schulter.
»Alles klar, sag Bescheid.«
Er wandte seinen Blick wieder nach vorne – und erstarrte. Im Lichtkreis der Taschenlampe stand, wie hingezaubert, ein Wesen, das nichts ähnelte, was Montega kannte oder schon einmal gesehen hatte.
Tote, gelb glühende Augen inmitten einer Fratze, die kaum mehr war als die grässliche Karikatur eines menschlichen Gesichts, funkelten ihn an. Das Wesen hob eine krallenbewehrte Klaue, packte ihn am Hals und riss ihn an sich. Wie Stahlklemmen legten sich die eiskalten Finger um seine Kehle, drückten brutal und unbarmherzig zu. Scharfe Klauen ritzten seine Haut, warm floss das Blut aus den Wunden hervor. Die Taschenlampe entglitt ihm und verschwand mit einem Platschen im Wasser. Er wollte schreien, brachte aber keinen Ton heraus.
Einige Sekunden später war alles vorbei.
»Pedro? Sag mal, was machst du denn da unten?«
Birdie wurde langsam ungeduldig, aber es schwang auch ein Hauch von Besorgnis in seiner Stimme mit.
Pedro Montega antwortete nicht. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits tot, und seine Leiche war von dem unheimlichen Angreifer in die Tiefen der Kanalisation verschleppt worden.
†
»Was für eine Schweinerei.«
Detective Matt Miller schob seine Schiebermütze in den Nacken und blickte in die Grube. Der Oktobermorgen war kühl, der Himmel eine einzige graue Fläche. Es wehte ein leichter Wind, und immer wieder setzte Nieselregen ein.
Miller nahm die Kopfbedeckung ab und fuhr sich mit der anderen Hand durch das rotblonde Haar, das für seine dreiundvierzig Jahre noch erstaunlich dicht war. Er war nicht besonders groß, und unter seinem rotschwarz karierten Hemd war der stetig an Umfang gewinnende Bierbauch nicht zu übersehen. Aber er verfügte über einen scharfen Verstand, und das war in seinem Job das Wichtigste.
»Und das haben Sie heute Morgen entdeckt?«, fragte er.
»Ja, Detective, heute Morgen, Detective. Gestern war das noch nicht so, ich schwör's, Detective.« Jerry Bloom, der Friedhofsgärtner, ein dürrer großer Mann, dessen Kleidung mindestens eine Nummer zu groß war, nickte hektisch mit dem Kopf. Miller fühlte sich an einen Geier erinnert, der nach Beute schnappte. »Ich mache hier jeden Morgen meine Runde und sehe nach dem Rechten, Detective.«
Miller sah sich um, als könne er das Bild vor ihm damit vertreiben. Selbst bei diesem düsteren Herbstwetter wirkte der Marble Cemetery malerisch mit seinen vielen Bäumen und Wiesen. Der Friedhof war kaum dreihundertfünfzig Yards vom 9. Polizeirevier entfernt, aber Miller war trotzdem mit seinem Wagen, einem Ford Crown Victoria, hergefahren. Er hasste es, zu Fuß zu gehen, obwohl ihm mehr Bewegung nur guttun würde, wie seine Frau Vicky immer sagte.
Notgedrungen widmete er sich wieder dem Tatort, einem Loch in der Erde, direkt unterhalb eines pompösen Grabmals. Die Inschrift informierte darüber, dass Mrs. Mira Mantagua, neunundachtzig Jahre alt zum Zeitpunkt ihres Ablebens, erst vor fünf Tagen hier neben ihrem vor dreizehn Jahren verstorbenen Gatten Ethan begraben worden war.
Offenbar waren die Mantaguas gut situiert gewesen, denn ein Grab auf diesem Friedhof war viel zu teuer, als dass sich ein Normalverdiener eines hätte leisten können, wusste Miller. Entsprechend selten fanden hier Beerdigungen statt.
Das Loch war unförmig und ungleichmäßig, als hätte jemand mit bloßen Händen die Erde herausgerissen. Es maß gut zwei Yards in der Länge und einen in der Breite und war damit groß genug, damit Miller den Sarg aus Kirschholz am Grund der Grube deutlich sehen konnte.
Der Sargdeckel bestand aus zwei Teilen. Der obere war geöffnet und gab den Blick auf die Verblichene frei. Ihr von schlohweißem Haar umrahmter Kopf ruhte auf der Kante des Sargs, als habe jemand versucht, sie herauszuziehen – oder sie nachlässig wieder hineingeschoben. In ihrem Hals, ihrer Brust und ihrer Hüfte klafften mehrere faustgroße Löcher. Das weiße Kleid, in dem man sie bestattet hatte, war an diesen Stellen zerrissen und ausgefranst.
Miller war kein Gerichtsmediziner, aber er hatte keine Zweifel daran, dass es sich bei den Wunden um Bisse handelte. Seine scharfen Augen erkannten selbst aus dieser Entfernung deutlich die Zahnabdrücke.
Wer, zur Hölle, buddelte ein Grab frei, brach den Sarg auf und tat sich an der Leiche gütlich?
Für einige Augenblicke blieb sein Blick auf dem Gesicht der Toten haften. Ein friedlicher Ausdruck lag darauf und bildete einen Kontrast zu den schaurigen Wundmalen, die man ihrem toten Körper zugefügt hatte.
Er hatte die Verstorbene nicht gekannt, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass es ihr gefallen hätte, posthum von irgendeinem Verrückten angeknabbert zu werden. Und um einen Verrückten musste es sich ja wohl handeln. Kein normaler Mensch würde auf so eine abartige Idee kommen.
»Was passiert denn jetzt, Detective?«, riss ihn der Gärtner aus seinen Gedanken.
Miller nahm die Mütze ab und fuhr sich wieder durchs Haar. Das war so ein Tick von ihm, den er sich einfach nicht abgewöhnen konnte. »Ich denke, wir werden Mrs. Mantagua zur Leichenbeschau bitten. Wir müssen wissen, was es mit diesen Wunden auf sich hat«, antwortete er.
Das mit den Bissen behielt er für sich, dem Gärtner waren sie offenbar nicht aufgefallen. Kein Wunder, die Gläser seiner Brille waren dick wie die Böden von Limonadenflaschen.
Von Süden näherte sich ihnen eine kleine Gruppe Beamter, bestehend aus zwei Uniformierten und zwei Kollegen in Zivil. Das waren die Jungs von der Spurensicherung, wie Miller feststellte.
»Danke, Mister Bloom«, sagte er. »Sie können jetzt gehen. War sicher ein Schock für Sie, als Sie das entdeckt haben. Ruhen Sie sich ein bisschen aus.«
»Kann man wohl sagen, Detective. Bin schon ziemlich lange hier, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich hoffe, Sie finden die, die das gemacht haben, Detective.«
»Wir tun unser Bestes, Mister Bloom.«
»Danke, Detective.«
Der Gärtner nickte noch einmal heftig mit dem Kopf, dann lief er den Polizisten entgegen und wandte sich Richtung Ausgang. Matt Miller winkte seinen Kollegen zu. Der Nieselregen hatte erneut eingesetzt und durchweichte allmählich seine dünne Herbstjacke.
Was für ein Tag, dachte er.
†
Sie saßen in der Dunkelheit und hatten Hunger.
Kein menschliches Auge hätte die Schwärze hier unten durchdringen können, doch sie waren keine Menschen und konnten in der Finsternis ebenso gut sehen wie bei Tageslicht.
Einige Yards über ihnen neigte sich der Tag allmählich seinem Ende zu. Die Sonne ging bereits unter, doch noch immer wimmelte es von Menschen. Sie würden einige weitere Stunden warten, bevor sie an die Oberfläche stiegen.
Sie wussten, dass ihre Aktivitäten bereits Aufmerksamkeit erregt hatten, doch in einer Millionenstadt wie dieser, in der täglich tausende Dinge geschahen, würde alles bald wieder vergessen sein. Hier gab es viele Friedhöfe und unzählige Gräber. Ein wahres Festmahl wartete darauf, dass sie zugriffen, um ihren bohrenden Hunger zu stillen.
Der Mensch, den sie im Kanal geholt hatten, war ein besonderer Leckerbissen gewesen. Andere waren auf der Suche nach ihm, doch nachdem sie den Mann getötet hatten, hatten sie sich tief in das Labyrinth der Tunnel und Schächte zurückgezogen, bevor sie ihn schließlich verspeisten. Jetzt waren von ihrem Opfer nur blanke Knochen übrig. Niemand würde sie jemals finden.
Und niemand würde diese Geschehnisse mit ihnen in Verbindung bringen, schon allein deswegen, weil keiner ahnte, dass Wesen wie sie überhaupt existierten.
Mit einer Ausnahme.
Schwach spürten sie die unheilvolle Präsenz des Feindes.
Er war der letzte der Jäger, der Einzige, der von ihnen übrig geblieben war. Sie erinnerten sich an den lange zurückliegenden Kampf, bei dem viele ihrer Brüder vernichtet worden waren. Um ihr Schicksal nicht zu teilen, hatten sie damals die Flucht ergriffen.
Aber der Feind war nun schwach, und er war allein. Die Zeit hatte für sie gearbeitet.
Er wusste, dass sie hier waren, er spürte ihre Anwesenheit ebenso wie sie die seine. Sie konnten es kaum erwarten, dass er sich ihnen stellte. Diesmal würden sie den Sieg davontragen.
Eine der Kreaturen stieß bei der Erinnerung an die Geschehnisse von vor Jahrhunderten ein klagendes Heulen aus, doch die anderen beachteten ihn gar nicht. Jede hing ihren eigenen, dunklen Gedanken nach, während an der Oberfläche die Nacht langsam den Tag ablöste.
Einige Stunden später erhob sich der Anführer und sprach zu seinen Gefährten mit einer tiefen, knurrenden Stimme, die jedem menschlichen Lauscher das Blut in den Adern hätte gefrieren lassen.
Schließlich rappelten sich alle auf und wandten sich nach Süden. Im Gänsemarsch marschierten sie durch die Tunnel. Nur das Plätschern bei jedem ihrer Schritte und ab und an ein leises Stöhnen waren zu hören, als die schaurige Prozession unaufhaltsam ihrem Ziel zustrebte.
†
»Ich gehe mal kurz zu Matt rüber«, sagte Detective Logan Jericho.
Detective Emma Harper, seine Partnerin, sah von ihrem Computer auf. »Wieder ein bisschen Klatsch bei der Arbeit? Du bist schlimmer als jede Frau, Logan.«
»Danke für dein Verständnis, Emma. Ach, übrigens, ich wollte dich schon lange fragen, ob wir uns nicht mal zum Dinner verabreden wollen.«
Emma lachte glockenhell auf. »Wir arbeiten jetzt seit sechs Monaten zusammen, und in dieser Zeit hast du mich das ungefähr achtundneunzigmal gefragt. Und die Antwort lautet wie immer Nein. Lunch okay, Dinner nicht okay. Denn Dienst ist Dienst ...«
»... und Schnaps ist Schnaps«, vollendete Jericho den Satz, den er ebenfalls ungefähr achtundneunzigmal gehört hatte. »Alles klar, aber ich bleibe dran.«
»Wenn du es nicht tust, wird mir irgendwann glatt was fehlen.«
Sie schenkte ihm ein Lächeln und wandte sich wieder ihrer Arbeit zu.
Jericho verließ mit einem leisen Seufzen das Büro, ging zum Kaffeeautomaten und füllte zwei Pappbecher mit dem dampfenden Getränk. Seine Versuche, Emma zu einem gemeinsamen Abendessen zu überreden, waren nur halb im Scherz gemeint. Sie war nicht nur eine hervorragende Polizeibeamtin, sondern darüber hinaus ein bezauberndes Wesen, das er gerne näher kennengelernt hätte.
Obwohl sie Ende dreißig war, sah sie aus wie Mitte zwanzig. Mit ihren großen braunen Augen, den weichen Gesichtszügen und den glatten, schulterlangen braunen Haaren wirkte sie ein bisschen wie eine Prinzessin aus dem Märchenbuch. Aber ihr Äußeres täuschte. Emma konnte ganz schön zulangen, was schon so mancher Kriminelle auf schmerzvolle Weise hatte erfahren müssen. Mindestens einmal in der Woche besuchte sie eine Kampfschule und hielt sich fit.
Aber er akzeptierte ihre Einstellung, sich nicht mit Kollegen einzulassen, und blieb professionell, auch wenn es ihm manchmal schwerfiel.
Mit den heißen Bechern in den Händen schlenderte er über den Gang, bis er vor der wie immer offenen Tür von Matt Miller stand. Sein Kollege telefonierte gerade.