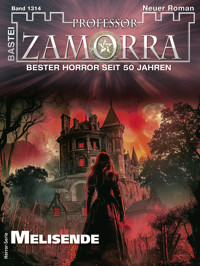1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Welt, die von Vampiren beherrscht wird. Es gibt nur noch wenige Menschen, eingepfercht in Gefängnissen, um mit ihrem Blut synthetische Nahrung für die Untoten herzustellen. Einer dieser Gefangenen ist Mac Washington, in der früheren Welt Agent des FBI. Er verfügt über eine besondere Gabe. Eine übersinnliche Fähigkeit, die sich der neue Herrscher von New York zunutze machen will. Denn ein Vampirkiller treibt im Big Apple sein Unwesen - und ausgerechnet Mac Washington, der Mensch und ehemalige FBI-Agent, soll ihn stellen und ausschalten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Euer Blut ist unser Leben
Special
Vorschau
Impressum
Euer Blutist unser Leben
von Michael Schauer
»Unrein!«, schrie die Stimme in seinem Kopf. »Das Blut ist unrein!«
Seine Lider flatterten. Seit Langem schon waren die Stimmen seine ständigen Begleiter. Diese jedoch war neu, kraftvoll und fordernd. Kurz nach seiner Verwandlung hatte er sie erstmals vernommen. Die anderen waren seitdem verstummt.
»Du musst mir dienen!«, verlangte sie. »Schwöre es!«
»Ich schwöre es«, erwiderte er. »Wer bist du?«
»Mein Name ist Camaraba.«
»Das ist er. Ich bin ganz sicher. Amelie, wir haben ihn gefunden.«
Amüsiert beobachtete Adrian Dobra, wie sich der grauhaarige Franzose und die blonde junge Frau gegenseitig um den Hals fielen. Der Mann hieß Maurice LeCleur und hatte sich ihm als Professor für Geschichte aus Paris vorgestellt, Amelie Bouval war seine Assistentin.
Der Name des Dritten im Bunde, der wie unbeteiligt danebenstand, lautete Emil Despage. Im Gegensatz zu seinen Begleitern schien er kein Rumänisch zu sprechen.
LeCleur hingegen beherrschte die Sprache überraschend gut, obwohl er sie mit einem grässlichen Akzent garnierte. Amelie konnte immerhin ein paar Brocken.
Generell hielt Emil Despage meistens den Mund. Dafür machte er ständig Fotos. Auch jetzt fummelte er an seiner Kamera herum.
Unwillkürlich musste Dobra grinsen. LeCleur hüpfte begeistert vor dem fast brusthohen Sarkophag auf und ab, während Amelie jauchzend in die Hände klatschte. Sie waren wie kleine Kinder, die sich über eine besondere Überraschung freuten.
Der Grund für ihre Aufregung war die Mumie, die in dem offenen Steinsarg lag. Die braune Haut erinnerte Dobra an trockenes altes Leder. Die Züge in dem hageren Gesicht ließen sich nur erahnen, die Augen waren geschlossen. Sofern der Tote Kleidung getragen hatte, war sie längst zu Staub zerfallen.
Ein unterarmlanges, fingerdickes und verrostetes Stück Metall steckte in Brusthöhe in dem ausgetrockneten Körper. Wie ein riesiger Nagel, der ihm durchs Herz getrieben worden war. Vielleicht eine Schwertklinge. Eine sehr effektive Methode, um ein Leben zu beenden, fand Dobra.
Der Franzose schlug ihm mit einer Hand auf die Schulter. Ein breites Grinsen stand in seinem länglichen Gesicht mit den hochstehenden Wangenknochen. Dobra schätzte ihn auf Anfang sechzig. Seine Augen jedoch leuchteten wie die eines jungen Mannes.
»Danke, Adrian«, sagte er auf Rumänisch. »Ohne Sie hätten wir ihn nie gefunden.«
Dobra nickte ihm gönnerhaft zu. »Für gutes Geld leiste ich gute Arbeit.«
Amelie strahlte. Sie war sehr hübsch und konnte kaum halb so alt sein wie ihr Chef. Obwohl sie es sich nicht anmerken ließen, wäre Dobra jede Wette eingegangen, dass die zwei was miteinander hatten. Allein wie sie sich gelegentlich ansahen, sprach dafür. Für so etwas hatte er einen Blick. Warum sie es zu verbergen versuchten, war ihm dagegen nicht klar. Vielleicht war Despage der Grund dafür.
Die drei Franzosen waren gestern in seinem Dorf aufgetaucht. Im Wirtshaus hatte LeCleur den Gästen, unter denen sich auch Dobra befand, den Grund für ihre Anwesenheit erklärt. Sie waren auf der Suche nach der halb zerfallenen Burgruine.
Die anderen Dorfbewohner hatten sich bei dieser Eröffnung wenig begeistert gezeigt. Sie waren abergläubisch und fürchteten sich vor dem Gemäuer, wie Dobra wusste. Keiner von ihnen hätte sich auch nur in die Nähe getraut.
Die Alten erzählten sich, dass dort die sterblichen Überreste eines Mannes namens Vlad Drăculea begraben lagen. Angeblich war er ein Fürst und Kriegsherr gewesen, der vor vielen Jahrhunderten in einer glorreichen Schlacht trotz hoffnungsloser Unterzahl eine feindliche Armee in die Flucht geschlagen hatte. Den Legenden nach habe er Gefangene mit Vorliebe gepfählt und sich an ihren Qualen ergötzt, während er unter ihren Augen sein Abendmahl verspeiste.
Aber das war nicht der Grund, weswegen sie seinen Namen nur zu flüstern wagten. Es hieß nämlich auch, Drăculea sei von einer Hexe verflucht worden und treibe bis heute in den Mauern sein Unwesen.
Über derlei konnte Dobra nur müde lächeln. An Spukgeschichten hatte er noch nie geglaubt, dafür war er einfach zu bodenständig. Sie waren genau das, Geschichten eben, nichts weiter.
Zugegeben, die dunklen Mauern der Burg und der einzige verbliebene Turm, der einem mahnenden Finger gleich in den Himmel ragte, boten einen durchaus unheimlichen Anblick. Ihn scherte es trotzdem nicht.
Als kleiner Junge hatte er einmal einen Ausflug dorthin unternommen. Außer alten Steinen hatte er nichts entdecken können. Als seine Eltern das herausfanden, hatte sein Vater ihm die Tracht Prügel seines Lebens verabreicht. Seitdem war er nicht mehr dort gewesen. Vergessen hatte er die Ruine natürlich nie.
Deshalb hatte er sich auch sofort – und als Einziger – angeboten, LeCleur und seine Begleiter hinzuführen. Bei seinen Worten hatten die anderen die Augen niedergeschlagen und sich bekreuzigt. Er glaubte sogar, leise gemurmelte Gebete vernommen zu haben. Was noch etwas war, worum er sich nicht scherte. Für das Geld, das ihm die Franzosen für diese simple Aufgabe zahlten, hätte er sie auch direkt in die Hölle geführt, sofern er den Weg dorthin gekannt hätte.
Nur widerwillig hatte der Wirt den Fremden seine einzigen beiden Gästezimmer im ersten Stock überlassen. Am Morgen waren sie in aller Frühe aufgebrochen. Die Ruine lag knapp drei Stunden entfernt. Die letzte halbwegs ordentliche Straße in der Umgebung endete im Dorf, also gingen sie zu Fuß.
Auf dem Weg hatte Dobra feststellen müssen, wie sehr der Zahn der Zeit an ihm nagte. Als kleiner Junge hatte ihm der Marsch nichts ausgemacht. Mit beinahe sechzig Jahren schmerzten ihm nach der Hälfte der Strecke Beine und Rücken. Zudem kroch der eisige Wind unter seinen Mantel und ließ ihn frösteln. Aber er biss die Zähne zusammen und kämpfte sich an der Spitze ihrer kleinen Kolonne Schritt um Schritt weiter. Das Geld war jede Strapaze wert.
Die Burg befand sich auf einem steil ansteigenden Hügel, was ihn auf den letzten Metern fast völlig aus der Puste brachte.
LeCleur, obgleich kaum jünger, schien dagegen mit jedem Schritt munterer zu werden. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, war er schnurstracks auf den Turm zugesteuert und hatte mit Despages und Amelies Hilfe einen fast mannshohen Haufen meist faustgroßer Steine vor der Mauer zur Seite geräumt.
Auch Dobra hatte sich an der Arbeit beteiligt. Zu seinem großen Erstaunen hatten sie einen schmalen Eingang freigelegt.
Die Öffnung war so niedrig, dass selbst Amelie den Kopf einziehen musste. Ein Gang führte in einem flach abfallenden Winkel gut fünfzig Meter tief in eine Kammer, in deren Zentrum der Sarkophag stand. Die Gruft war so klein, dass sie zusammen gerade so eben Platz darin fanden.
Ohne die Taschenlampen der Franzosen wäre es hier drin stockdunkel gewesen.
Dobra fragte sich, was LeCleur an einer alten Mumie so besonders finden mochte. Er hatte keine Ahnung, was ein Professor für Geschichte eigentlich machte und wofür er eine Assistentin brauchte, aber das hatte er für den Job auch nicht wissen müssen. Soweit er das verstanden hatte, wollten sie den Toten mitnehmen, um ihn in einer Stadt namens Paris in einem Museum auszustellen. Um was es sich dabei handelte, hatte er sich während ihrer Wanderung bei einer Verschnaufpause von Amelie erklären lassen. Gab es tatsächlich Leute, die Geld dafür ausgaben, um sich altes Zeugs anzuschauen?
Despage begann zu fotografieren, was klackende Geräusche verursachte. LeCleur raunte Amelie etwas auf Französisch zu. Ihre Stirn legte sich in Falten, und ihre Antwort schien LeCleur nicht zu gefallen, denn er stieß ein unwilliges Schnaufen aus.
Mit seinen behandschuhten Fingern griff er nach dem rostigen Metall, das aus der Mumie ragte. Rasch legte ihm Amelie eine Hand auf den Arm, konnte aber nicht verhindern, dass seine Fingerspitzen das Metall berührten.
Die Wirkung war frappierend!
Vor ihren Augen begann der Nagel zu zerbröseln wie ein trockener Kuchen. Gleich darauf war nur ein Häuflein Rost übrig, der auf der Brust des Toten aufgeschichtet lag. Im Schein der Taschenlampen schwebten feine Partikel zur Decke empor.
LeCleur stand wie vom Donner gerührt, Amelie hatte die Augen weit aufgerissen, und Despage stellte das Fotografieren ein. Damit hatten sie offensichtlich nicht gerechnet.
Dobra war weniger überrascht. Das Metall musste Jahrhunderte alt gewesen sein. Ein Wunder, dass es sich überhaupt so lange gehalten hatte.
Allmählich wurde es Zeit, dass sie wieder ins Freie kamen. Hier drin war die Luft stickig und roch nach Moder. Das Atmen fiel ihm allmählich schwer.
Den Sarkophag konnten sie unmöglich tragen, also würde jemand die Mumie herausheben müssen. Er hatte so eine Ahnung, wer aus ihrer Gruppe für diese Aufgabe vorgesehen war.
»Wir sollten hier raus«, wandte er sich an den Professor, der nach wie vor den Rosthaufen anstarrte. »Schlechte Luft.«
»Er hat sich aufgelöst.« LeCleur sah ihn verwundert an, als sei Dobra eben erst zu ihnen gestoßen.
»Das Metall war alt. Alt und brüchig. Sie sind doch nicht wegen eines großen Nagels hergekommen, oder?«
Furcht stahl sich in LeCleurs flackernden Blick. Dobra fühlte sich mit einem Mal unbehaglich. Was war nur los mit dem Mann?
»Maurice!«, schrie Amelie.
Der Kopf des Professors ruckte herum.
Dobra sah in den Sarkophag, und seine Kinnlade klappte nach unten, die Nackenhaare stellten sich ihm auf. Das war nicht möglich. Das musste eine Täuschung sein.
Die Mumie hatte die Augen geöffnet. Keine menschlichen Augen, vielmehr die eines Wolfs. Aus gelben Pupillen sah sie ihn direkt an.
Niemand sprach ein Wort oder bewegte sich. Alle vier standen da wie zu Salzsäulen erstarrt.
Ganz langsam hob die Mumie die rechte Hand und spreizte ihre klauenartigen Finger. Der lippenlose Mund öffnete sich und entblößte zwei Reihen makelloser Zähne, was Dobra noch erstaunlicher vorkam als die Tatsache, dass sie sich überhaupt bewegte.
Wie die Augen war auch das Gebiss nicht menschlich. Eher wie das eines Raubtiers.
Amelie stieß einen gellenden Schrei aus, der von den Wänden zurückhallte und Dobra in den Ohren schmerzte.
Sie mussten hier weg, und zwar sofort!
Die Mumie hob auch die andere Hand. Ihre Finger krallten sich auf beiden Seiten um die Ränder des Sarkophags. In einer blitzschnellen Bewegung zog sie sich hoch und stand im nächsten Moment aufrecht vor ihnen, wobei ihr Schädel beinahe gegen die Decke stieß.
Ihre Klauen schossen auf Despage zu und umklammerten seinen Kiefer. Ein kräftiger Ruck, ein Knacken wie von einem brechenden Ast. Obwohl Dobra schräg hinter dem Franzosen stand, konnte er ihm plötzlich ins Gesicht sehen.
Dobra warf sich herum. Amelie und LeCleur waren ihm egal, jetzt ging es ums Überleben.
Er zog den Kopf ein und rannte den Gang hinauf. Hinter sich hörte er verzweifelte Schreie. Seine linke Schulter schrammte gegen die steinerne Wand. Ein vorspringender scharfer Stein zerschnitt Jacke und Pullover und ritzte die Haut darunter. Den brennenden Schmerz nahm er kaum wahr.
Endlich hatte er den Ausgang erreicht. Zu seiner Linken befand sich das Tor, durch das sie die Burg betreten hatten. Er rannte darauf zu.
Auf halber Strecke ließ ihn ein heftiger Stoß gegen seine Schultern stürzen. Mit dem Gesicht voraus knallte er auf den harten Steinboden. Sterne explodierten vor seinen Augen.
Bevor er sich wieder aufrappeln konnte, wurde er gepackt und auf den Rücken gedreht.
Die Mumie war über ihm. An ihrem Kinn glänzte Blut. Sie hatte sich verjüngt. Die lederartige Haut wirkte gestrafft, die Gesichtszüge waren deutlich zu erkennen. Auf dem eben noch kahlen Schädel wuchs ein feiner Haarflaum.
Das war das Letzte, was er sah, bevor sich messerscharfe Zähne in seine Kehle gruben und ihn verzweifelt aufschreien ließen.
Die Welt begann sich zu drehen, dann versank er in tiefer Schwärze.
†
Zehn Jahre später.
»Halt mal an!«, sagte Bob Cannon auf dem Beifahrersitz und deutete mit seinem ausgestreckten Zeigefinger auf etwas jenseits der Windschutzscheibe. »Ich glaube, da vorn liegt einer.«
»Du hast recht«, stimmte sein Partner Dennis Pulcher zu und steuerte den Streifenwagen an den Straßenrand. Der Motor erstarb. Gleichzeitig öffneten sie die Türen und stiegen aus.
Nur das fahle Licht des fast vollen Mondes beleuchtete den leblosen Körper. Vorsichtig näherte sich Cannon, wobei er sich aufmerksam umsah. Dennis folgte dicht hinter ihm.
Die männliche Leiche lag auf dem Rücken. Ihr Haar war blond und kurz geschnitten. Der Mann trug einen blauen, abgenutzten Anzug und ein vergilbtes Hemd unter dem Jackett. Seine geöffneten Augen waren zum Himmel gerichtet.
In seiner Brust steckte ein Stück Holz, so dick wie ein Unterarm und ebenso lang. Noch im Tod hielt er den rechten Arm ausgestreckt, als habe er versucht, seinen Mörder abzuwehren.
»Schon wieder einer«, sagte Dennis. »Der wievielte ist das jetzt?«
»Keine Ahnung.« Cannon schüttelte den Kopf. »Zu viele, das steht fest.«
»Wann sind wir das letzte Mal an dieser Stelle vorbeigekommen?«
Cannon nahm seine Dienstmütze ab und kratzte sich im Nacken. »Kann keine Stunde her sein. Da lag er definitiv noch nicht hier. Den hätten wir wohl kaum übersehen.«
»Also können wir den Killer nur knapp verpasst haben. Mann, ich wünsche mir nichts mehr, als den Mistkerl auf frischer Tat zu ertappen. Willst du wissen, was ich gerne mit ihm machen würde?«
»Ich kann's mir vorstellen, Dennis.«
»Bleib du hier, ich gebe der Zentrale Bescheid.«
Dennis machte auf dem Absatz kehrt und marschierte zum Streifenwagen zurück, während Cannon neben dem Opfer in die Hocke ging. Seine Augen fixierten das Mordwerkzeug. Dem Anschein nach handelte es sich um einen Ast, der von Zweigen befreit und an einem Ende zugespitzt worden war. Die Spitze steckte zwar im Körper und war dadurch nicht zu sehen, doch wie sonst hätte der Täter das Herz des Unglücklichen durchstoßen können? Alles war genau wie bei den anderen Opfern.
Es hatte sie auf dem Nachhauseweg in einem der verlassenen Straßenzüge in New York erwischt. Von der Tatwaffe abgesehen gab es keine Spuren, und einen Ast konnte man sich nun wirklich überall besorgen. Allein im Central Park wuchsen Tausende Bäume.
Seitdem die Mordserie vor gut vier Wochen begonnen hatte, war fast jede Nacht ein weiteres Opfer aufgefunden worden. Cannon wäre jede Wette eingegangen, dass der arme Teufel vor ihm in der Fabrik gearbeitet hatte, denn auch das gehörte zu den Gemeinsamkeiten. Dem Vernehmen nach griff unter dem Personal allmählich die Angst um sich. Verständlich, aber nicht gut. Geradezu beunruhigend.
Seine Stirn legte sich in Falten. Neben dem linken Knie des Toten lag eine Visitenkarte. Er bückte sich und hob sie mit spitzen Fingern auf. Auf der Vorderseite war der Schattenriss eines nackten weiblichen Oberkörpers abgebildet. Daneben war in geschwungenen roten Lettern das Wort Sensual geschrieben. Die Adresse stand auf der Rückseite.
Der Laden befand sich in der Webster Avenue, was nicht weit von ihrem Standort entfernt war. Sicher einer dieser Nachtclubs, die in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen waren.
»Hast du dir wohl ein bisschen Spaß gegönnt, bevor es dich erwischt hat, mein Junge«, murmelte Cannon.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Instinktiv glitt seine Hand zu seiner Waffe, die er am Gürtel trug. Doch es war bloß Dennis, der seinen Funkspruch abgesetzt hatte.
»Sie schicken einen Wagen, um ihn abzuholen«, sagte er.
Cannon zeigte ihm die Visitenkarte. »Sieh mal. Das lag neben ihm.«
»Sensual«, las Dennis. »Offenbar hat er vor seinem Tod zumindest ein wenig Freude gehabt.«
»Vielleicht war der Mörder ebenfalls dort und hat ihn verfolgt. Was bedeutet, dass der Killer von einer der Ladys gesehen worden sein könnte.«
Dennis schmunzelte. »Bist du unter die Detectives gegangen?«
»Ich meine ja nur.«
»Wir liefern die Karte im Revier ab. Sollen die sich darum kümmern.«
Sie vertrieben sich die Wartezeit, indem sie die Umgebung im Auge behielten. Dabei konnten sie ihr Unbehagen kaum verbergen. Cannon trat von einem Fuß auf den anderen, während sich Dennis ständig die Nasenwurzel rieb.
Nach schier endlosen zwanzig Minuten kam endlich der Wagen.
†
Während sie sich dem Mann näherte, behielt ihn Marinia genau im Blick. Er lehnte an der Hauswand und hatte die Augen geschlossen. Was bloß ein Trick sein konnte. Vielleicht wartete er nur darauf, bis sie nahe genug heran war, um sich auf sie zu stürzen. Gut möglich, dass sich seine Freunde in der Nähe versteckt hielten.
Sie überlegte, die Straßenseite zu wechseln, kam aber zu dem Schluss, dass ihr das auch nichts nützen würde, wenn er es auf sie abgesehen hatte. Ihre Nervosität steigerte sich ins Unermessliche.
Jetzt hatte sie ihn erreicht. Er schien sie nicht zu bemerken. Als sie an ihm vorbei war, warf sie einen schnellen Blick über die Schulter. Der Mann rührte sich nicht. Falscher Alarm.
Erleichtert setzte sie ihren Weg fort. Sie musste aufhören, sich verrückt zu machen. Sie hatten sie zwar gesehen und verfolgt, doch es war ihr schnell gelungen, sie abzuschütteln. Ihr Apartment befand sich zwei Meilen von der Stelle entfernt, an der es passiert war. Woher sollten sie wissen, wo sie wohnte?
Sie hatte darüber nachgedacht, sich an die Cops zu wenden, die Idee aber wieder verworfen. Mit denen hatte sie keine guten Erfahrungen gemacht.
Nie wieder würde sie sich darauf einlassen, einen Kunden nach Hause zu begleiten, schwor sie sich. Sowieso hatte sie damit gegen ihre Prinzipien verstoßen. Schließlich konnte man nie wissen, an wen man geraten war und was er von einem verlangte, wenn er erst einmal die Tür ins Schloss gezogen hatte.
Im Club dagegen wagte niemand irgendwelche Sperenzchen, was nicht zuletzt Chuck zu verdanken war. Chuck war ein Riese, der Marinia um mehr als einen Kopf überragte, obwohl sie für eine Frau großgewachsen war. Er war nicht besonders schlau, betrachtete die Huren im Sensual aber als seine persönlichen Schäfchen und setzte jeden vor die Tür, der sich nicht an die Regeln hielt. Regeln, die von ihnen bestimmt wurden.
Nur hatte dieser spezielle Kunde ihr ein paar großzügige Extrarationen versprochen. Er war ganz vernarrt in sie gewesen und hatte sie unbedingt für die ganze Nacht haben wollen.
Lange hatte sie mit sich gerungen, ob sie sich darauf einlassen sollte. Am Ende hatte sie das Angebot angenommen. Das Honorar war einfach zu verlockend.