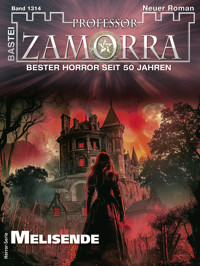2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux
- Sprache: Deutsch
Es ist nicht der Riss selbst, durch den die Finsteren in unsere Welt gelangen. Jedoch macht er den von Jupiter erschaffenen Schutzschirm durchlässig, weswegen es immer wieder zu Angriffen kommt. Bisher konnte Castor Pollux alle ihre Attacken abwehren, doch die Finsteren werden niemals aufgeben. Erst wenn der Riss geschlossen ist, kann die Menschheit vor ihnen sicher sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Auf den Spuren des Bösen
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Impressum
Auf den Spuren des Bösen
von Michael Schauer
Es ist nicht der Riss selbst, durch den die Finsteren in unsere Welt gelangen. Jedoch macht er den von Jupiter erschaffenen Schutzschirm durchlässig, weswegen es immer wieder zu Angriffen kommt.
Bisher konnte Castor Pollux alle ihre Attacken abwehren, doch die Finsteren werden niemals aufgeben. Erst wenn der Riss geschlossen ist, kann die Menschheit vor ihnen sicher sein.
WIE WAR´S WIRKLICH?
Die Neronia hat es tatsächlich gegeben, allerdings fanden sie im Frühjahr 65 n. Chr. statt und nicht im Herbst, wie im Roman geschildert. Fünf Jahre zuvor hatte Nero sie zum ersten Mal veranstaltet, allerdings nicht selbst daran teilgenommen. Zum Entsetzen des Senats beschloss er, sich bei der Zweitauflage höchstselbst mit den Musikern und Dichtern zu messen.
Dass ein Kaiser in die Rolle eines Kitharöden schlüpfte, galt – zumindest bei der Oberschicht – als höchst unschicklich. Zudem stand Rom noch unter dem Eindruck der blutigen Niederschlagung der Pisonischen Verschwörung. Vor diesem Hintergrund erschien vielen ein solches Spektakel ein kleines bisschen deplatziert. Nero kümmerte das wenig.
Um ihn von einem Auftritt abzuhalten, boten ihm die Senatoren sogar an, ihn vorab in allen Disziplinen zum Sieger zu erklären, was er zurückwies. Er wollte sich als Gleicher unter Gleichen dem Wettstreit stellen. Nur: »… gleiche Chancen gab es eben nicht, wenn der eine Mitbewerber absolute Macht über Leben und Tod besaß …«, wie Alexander Bätz in seiner lesenswerten Biografie »Nero« schreibt.
In dem vorliegenden Roman schildere ich, wie sich ein Mann namens Titus Flavius Vespasian den Unmut des Kaisers zuzieht, weil er während dessen Darbietung einschläft. Diese kleine Episode soll sich tatsächlich so abgespielt haben. Letztlich hat es Vespasian jedoch nicht geschadet. Nero begnadigte ihn und erteilte ihm 67 n. Chr. den Auftrag, einen jüdischen Aufstand niederzuschlagen. Eine schwere Aufgabe, die vollständig zu bewältigen erst Vespasians Sohn Titus sechs bis sieben Jahre später gelang.
Nero war da schon nicht mehr am Leben und Vespasian Kaiser geworden. Er galt als Pragmatiker, der sich daranmachte, die unter seinem Vorgänger zerrütteten Staatsfinanzen zu sanieren. In den Gärten von Neros Protzbau Domus Aurea ließ er das flavische Amphitheater errichten, heute besser bekannt als Kolosseum, eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Roms. Damit gab er faktisch dem Volk das von Nero annektierte Gelände zurück. Die Fertigstellung erlebte er nicht mehr, ein Jahr vorher starb er an einer Krankheit.
Vespasian hat der Nachwelt aber noch etwas anderes hinterlassen, und zwar die Redensart »Geld stinkt nicht«. Bei seinem Bemühen, neue Finanzierungsquellen zu erschließen, erhob er unter anderem eine Latrinensteuer, wovon sich sein Sohn Titus wenig begeistert zeigte. Daraufhin hielt ihm der Vater eine Handvoll Geldmünzen unter die Nase und fragte ihn, ob er etwas rieche …
Um beim Thema zu bleiben: Für den einen oder anderen Leser mag es irritierend anmuten, dass Castor und Kimon in einer Szene nebeneinander auf der Toilette einer Therme sitzen und dabei ungezwungen miteinander plaudern – zusammen mit über einem Dutzend anderer Männer. Tatsächlich waren die Latrinen damals auch Orte der Begegnung und des Zusammenseins. Man tauschte Klatsch und Neuigkeiten aus, während man sein Geschäft verrichtete – ohne störende Trennwände, versteht sich.
Michael Schauer
Auf den Spuren des Bösen
Die Schwärze um ihn herum wurde nur von dem leuchtenden Nebel erhellt, der in dichten Schlieren kniehoch über dem Felsboden waberte. Es war eiskalt, kälter noch als im All. Ein Mensch hätte in dieser Umgebung keinen Herzschlag lang überlebt, doch Elat war kein Mensch. Kälte hatte für ihn ebenso wenig Bedeutung wie Hitze, weswegen er auch in einem lodernden Feuer hätte stehen können, ohne die zerstörerische Kraft der Flammen zu spüren.
Elat war ein Gott.
Eine Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit und näherte sich ihm. Ein dünnes Lächeln umspielte Elats rissige Lippen.
Bis auf einen Lendenschurz war Mogum nackt. Kein Haar spross auf seiner vollkommen glatten, bernsteinfarbenen Haut. Der kahle Schädel lief zu seinem vorspringenden Kinn hin spitz zu, sodass er die Form eines Dreiecks hatte. Er nickte ihm zu und blieb einige Schritte von ihm entfernt stehen.
Als nächstes und letztes Mitglied ihrer Runde erschien Teren. Wie stets war er in eine schwarze Robe gehüllt, die ihm bis zu den Knöcheln reichte. Und wie gewohnt saß das vogelähnliche Wesen auf seiner linken Schulter, das er Skrabat nannte. Das Tier war groß wie ein Adler, womit jede Ähnlichkeit mit dem König der Lüfte aus der Menschenwelt jedoch bereits erschöpft war. Sein Gefieder hatte die Farbe von kalter Asche und war struppig wie das Fell eines Straßenköters. Ein messerscharfer, blauer Schnabel von der Länge einer Männerhand entsprang dem im Vergleich zum restlichen Körper überproportional großen Kopf. Skrabats milchige Augen waren auf Elat gerichtet.
Wie Mogum zuvor, nickte ihm Teren zur Begrüßung zu. Das pechschwarze, stumpfe Haar fiel ihm bis über die Schultern. Sein Gesicht mit der geraden Nase und den hohen Wangenknochen hätte nach menschlichen Maßstäben als anziehend beschrieben werden können. Wären da nicht die Augen gewesen, die wie kleine graue Steine in ihren tiefen Höhlen lagen.
»Seit unserer letzten Zusammenkunft ist viel Zeit vergangen«, ergriff Teren das Wort. »Wir sind deinem Ruf gefolgt, Elat. Was hast du uns zu sagen?«
In einer unwillkürlichen Geste strich Elat sein blutrotes Gewand glatt, das aus einem lederartigen Material gefertigt war. Mit einer Hand fuhr er durch sein dichtes, schlohweißes Haar, bevor er antwortete.
»Ankrabia wurde zurückgeschlagen, wie ihr sicher bereits wisst. Erneut mussten die Finsteren eine Niederlage hinnehmen.«
»Der Bezwinger ist stark«, grollte Mogum. »Er weiß die Waffe des verfluchten Mars gut zu gebrauchen. Seit sein Gefährte im Besitz des Schwerts einer Jägerin ist, ist er noch gefährlicher geworden.«
»Deine Worte sind gut gewählt«, erwiderte Elat. »Womöglich ist es an der Zeit, unsere Strategie zu überdenken.«
Die beiden anderen Götter tauschten einen schnellen Blick. Skrabat legte den Kopf schief. Er konnte nicht sprechen, verstand aber jedes Wort, wie Elat wusste.
»Woran genau denkst du dabei?«, fragte Mogum.
»Ich denke an den Zerstörer.«
Grenzenlose Überraschung breitete sich auf Terens Gesicht aus. In Mogums Augen war ein fragender Ausdruck getreten. Skrabat stieß ein Geräusch aus, das dem Knarren einer Tür ähnelte.
Teren hatte sich als Erster wieder gefangen. Unglauben schwang bei seinen nächsten Worten in seiner tiefen Stimme mit.
»Hast du vergessen, dass es Bestandteil des Pakts ist, den Zerstörer in seinem Schlaf ruhen zu lassen? Erwecken wir ihn, wird Jupiter die Glorreichen mobilisieren. Niemand kann erahnen, wie eine solche Schlacht enden würde.«
»Ich stimme Teren zu«, bekräftigte Mogum. »Das Risiko ist zu groß.«
Nur mit Mühe bezähmte Elat seinen aufwallenden Zorn. Wie mutlos seine Gefährten doch geworden waren. Wie verzagt, schwach und verweichlicht. Seitdem sie die Welt der Finsteren geschaffen und auf diese Weise Jupiter die Stirn geboten hatten, genügte es ihnen, sich zurückzulehnen und zuzusehen, wie ihre Geschöpfe Angst und Schrecken unter den Menschen verbreiteten, ohne jedoch jemals einen wirklich großen Sieg zu erringen. Hatten sie nicht einst die Erde erobern wollen, als Rache dafür, dass der Göttervater sie so schmählich übergangen hatte? Von diesem Anspruch schienen die beiden weit entfernt.
Offenbar waren die Jahrhunderte der Untätigkeit an Mogum und Teren nicht spurlos vorübergegangen. Seit Langem hatte er das Gefühl, dass sie sich mit dem Erreichten zufriedengaben. Doch stellten sie sich jemals die Frage, woraus dieses Erreichte eigentlich bestand? Sonderlich viel hatten sie zumindest seiner Meinung nach nicht vorzuweisen.
In Elat dagegen loderte die flammende Sehnsucht nach einem ruhmreichen Triumph. Seit es Vakaenos gelungen war, erneut einen Riss in den Schutzschirm zu schlagen, hatte er stattdessen zahlreiche Niederlagen mitansehen müssen. Rodan, Nara, Dardos, Telemach. Sie alle und Weitere waren gescheitert. Obendrein hatte sich Marton als herbe persönliche Enttäuschung erwiesen. Von großen Worten und Ankündigungen einmal abgesehen, hatte er in all der Zeit nichts zustande gebracht.
Eines hatte Elat durch diese Erfahrung immerhin gelernt. Niemals wieder würde er sich mit einem Sterblichen einlassen. Er hatte eine Narretei begangen, die er am liebsten vergessen hätte.
Aber in eine solche Versuchung würde er sowieso kein zweites Mal geraten, wenn er Teren und Mogum von seinem Plan überzeugen konnte. Mit der Hilfe des Zerstörers würden sie erst die Glorreichen vernichten und sich dann zu Herrschern über die Menschheit und die Götter erheben. Er war davon überzeugt, dass es gelingen konnte. Sie mussten es nur endlich wagen.
»Ich verstehe eure Bedenken«, begann er seinen Versuch, sie zu überzeugen, wobei er sich bemühte, dass ihm der Unmut über ihr Zaudern nicht anzumerken war. »Mogum hat recht, mit einem solchen Schritt gehen wir ein Risiko ein. Aber ich frage euch, ist jemals ein großer Sieg errungen worden, ohne etwas zu wagen?«
Wieder tauschten Mogum und Teren einen Blick, bevor ihm Mogum antwortete.
»Es steht eine Menge auf dem Spiel, Bruder. Wir könnten alles verlieren.«
»Das will ich nicht leugnen. Doch wie lautet die Alternative? Immer so weitermachen und darauf hoffen, dass es endlich einem unserer Geschöpfe gelingt, den Bezwinger niederzuringen? Wie viele Finstere sollen noch im See der vergessenen Seelen enden? Ich sage, lasst uns dem ein Ende setzen.«
Daraufhin setzte Schweigen ein, nur unterbrochen vom leisen Krächzen des Vogelwesens. Fast schien es, als würde sich Skrabat seine eigenen Gedanken über das Gesagte machen. Die weißen Augen rollten in ihren Höhlen, während sich sein Schnabel hektisch öffnete und wieder schloss.
»Das Ritual wird Aufmerksamkeit erregen«, ergriff Teren schließlich das Wort. »Jupiter könnte davon erfahren, noch bevor der Zerstörer erwacht ist.«
»Mach dir keine Sorgen. Wir werden einfach alles abstreiten. Ich habe keine Angst vor Jupiter.«
»Denkst du etwa, ich fürchte mich vor ihm?«, brauste Teren auf.
Elat schüttelte hastig den Kopf. »Das wollte ich damit gewiss nicht sagen.«
Und in Gedanken fügte er hinzu: Aber ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Teren hatte damals lange gezögert, bevor er sich ihnen angeschlossen hatte. Bis heute schien er seinen Respekt vor dem Göttervater nicht gänzlich abgelegt zu haben. Ohne Zweifel war er das schwächste Glied in ihrer Kette.
»Nur ein Narr würde nicht anerkennen, dass in Elats Worten Wahrheit liegt«, schaltete sich Mogum ein, bevor ein Streit zwischen ihnen ausbrechen konnte. »Vielleicht haben wir tatsächlich zu lange unsere Hände in den Schoß gelegt. Die Zeit rauscht an uns vorbei wie ein reißender Fluss. Sind wir nicht zu mehr bestimmt, als am Ufer zu liegen und ihr dabei zuzusehen? Deshalb sage ich, lasst es uns versuchen.«
Zufrieden wandte sich Elat an Teren: »Also, wie lautet deine Antwort?«
Es war Teren anzusehen, dass er einen Kampf mit sich ausfocht. Obwohl er alles andere als überzeugt wirkte, nickte er schließlich.
Innerlich jubelte Elat, doch er vermied es, seinen Triumph so offensichtlich auszukosten. Empfindlich, wie er war, könnte sich Teren ein weiteres Mal vor den Kopf gestoßen fühlen und seine Zustimmung zurückziehen, was fatal gewesen wäre. Einigkeit bedeutete Stärke, und davon brauchten sie eine Menge, um bei den bevorstehenden Schlachten als Sieger hervorzugehen.
Mit beiden Händen formte er einen Kreis in der Luft. Augenblicklich materialisierte sich fünf Fuß über dem Boden ein flirrender Ball in ihrer Mitte. Das Flirren verschwand und gab den Blick auf Bonifazius frei. Das Gesicht des Obersten Richters wurde wie stets von einer weiten Kapuze verborgen. Die kleinen Totenköpfe auf der Krempe seines Huts schienen sie anzugrinsen.
»Du hast mich gerufen, Herr«, sprach er das Offensichtliche aus.
»Ganz recht, Bonifazius«, bestätigte Elat. »Deine Götter haben eine Entscheidung getroffen, mit deren Umsetzung ich dich hiermit beauftrage.«
»Was immer ihr verlangt. Wie lautet euer Auftrag?«
»Bereite die Erweckung des Zerstörers vor.«
»Des Zerstörers?«
Obwohl er es nicht sehen konnte, hätte Elat geschworen, dass sich die Stirn des Richters fragend runzelte.
»Du hast richtig gehört. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, und es soll mit einem ruhmreichen Sieg enden. Du kennst das notwendige Ritual.«
»Sein Schlaf währt schon sehr lange. Ich bin nicht sicher, ob die vergessenen Seelen ausreichen, um ihn zu beenden.«
»Dann benötigen wir zusätzlich ein lebendes Opfer.«
»Ein weiser Gedanke, Herr. Um sicher zu gehen, sollten wir einen Finsteren auswählen, der über ein gewisses Maß an Macht verfügt. Die Energie eines einfachen Totenfressers etwa dürfte zu schwach sein. Uns bleibt nur ein Versuch. Scheitert das Ritual, ist der Zerstörer für immer verloren.«
Elat musste nicht lange darüber nachdenken. »Ich wähle Marton.«
»Marton?«
»Ich selbst machte ihn einst zu dem, was er ist. Seine Macht ist nicht allzu groß, doch sie wird ausreichen.«
Bonifazius’ Überraschung war ihm deutlich anzuhören, als er sagte: »Das wusste ich nicht. Ich dachte, er diente Ballurat.«
»Er hatte sich Ballurat angeschlossen, in der Tat. In Wahrheit jedoch war ich sein Herr. Nur durfte mein Name nie genannt werden. Marton zu einem der Unseren zu machen, war ein Experiment, das ich heute als gescheitert erachte. Der Druide hat sich als ebenso selbstgefällig wie feige erwiesen. Ich verlasse mich darauf, dass du mein Geheimnis bewahrst, Bonifazius. Mein Name darf nicht von seinem Versagen besudelt werden.«
»Nach dem Untergang von Ballurats Reich ist er verschwunden.«
»Finde ihn. Seine Aura sollte stark genug sein, damit du ihn bald aufspüren kannst.«
»Ich werde Tasch und ihre Jägerinnen auf ihn ansetzen.«
»Gut. Wage es nicht, uns zu enttäuschen. Ansonsten muss ich nämlich in Erwägung ziehen, dich selbst im See der vergessenen Seelen landen zu lassen.«
»Natürlich nicht, Herr.«
Der schwebende Ball löste sich so schnell auf, wie er erschienen war.
Elat straffte seine hagere Gestalt und sah erst Mogum und dann Teren an.
»Die Würfel sind geworfen, Brüder.«
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel. Obwohl es längst Herbst war, herrschte glühende Sommerhitze. Seit Stunden saß Cassia am Strand und sah aufs Meer hinaus, während der Wind mit ihren Haaren spielte. Die warme Luft war erfüllt vom Rauschen der Wellen, die sich unermüdlich an der Küste brachen. In der Ferne schaukelte ein Schiff auf dem Wasser. Es war zu weit draußen, als dass sie mehr hätte erkennen können als den Rumpf und das weiße Segel. Für ein Fischerboot war es zu groß, vielleicht handelte es sich um eine römische Galeere oder um Piraten.
Letztlich kümmerte es sie nicht.
Gedankenverloren strich sie mit den Fingern ihrer rechten Hand über die grünlich schimmernde Klinge des Hexentöters, der neben ihr im Sand lag. Das aus einem fremdartigen Metall geschmiedete Schwert mit der Doppelspitze hatte sich unter der Sonne so stark aufgeheizt, dass ein gewöhnlicher Mensch es kaum hätte berühren können, ohne sich daran zu verbrennen. Doch Cassia war kein gewöhnlicher Mensch.
Jedenfalls noch nicht.
Ihre Kräfte schwanden mit jedem Tag. Lange schon konnte sie keine andere Gestalt mehr annehmen. Eine Fähigkeit, die ihr bei der Erweckung von Colso gute Dienste geleistet hatte, auch wenn die Mission des Feuerdämons gescheitert und er vom Bezwinger vernichtet worden war.1
Dass sie sich nicht mehr verwandeln konnte, war nur der Anfang gewesen. Inzwischen gab es für sie keinen Zweifel, dass sie sich langsam, aber sicher von einer Halbdämonin in eine gewöhnliche Sterbliche zurückverwandelte. Diese Erkenntnis war ebenso schmerzlich wie furchterregend.
Gerne hätte sie Ballurat gefragt, ob sie ihre Kräfte bloß auf Bewährung erhalten hatte. Nur war ihr einstiger Förderer vernichtet und ihre Chance, vollständig zu einer Finsteren zu werden, damit gleich null. Im Gegenteil musste sie um ihr Leben fürchten, seit sie Bonifazius’ Gunst verloren hatte. Ihr Plan, diese mit dem Tod von Kaiser Nero zurückzuerlangen, war gescheitert2, was sie vor allem diesem unfähigen Telemach zu verdanken hatte. Sich mit dem überheblichen Lebenssauger einzulassen, war ein Fehler gewesen.
Es lag einige Wochen zurück, seit sie das letzte Mal von zwei Jägerinnen aufgespürt worden war. Mit dem Hexentöter hatte sie beide vernichten können, jedoch war es diesmal knapper gewesen als je zuvor. Eine fingerlange Narbe am linken Oberarm würde sie für den Rest ihres Lebens an den Kampf erinnern, den sie nur mit Mühe gewonnen hatte. Was angesichts ihrer Lage eine ziemlich kurze Zeitspanne sein konnte.
Da sie ein neues Versteck brauchte, war sie an Bord eines Frachtschiffs nach Korsika gelangt, wo sie nach einer Weile des ziellosen Herumstreunens die verlassene Hütte am Strand gefunden hatte. Das Holz, aus dem sie gebaut war, wirkte morsch und brüchig. Die Einrichtung bestand aus einem Bettgestell ohne Matratze sowie einem wackeligen Stuhl. Wer immer hier gelebt hatte, hatte entweder keine hohen Ansprüche besessen oder die restlichen Möbel mitgenommen.
Je weiter ihre Rückverwandlung voranschritt, desto regelmäßiger verspürte sie Hunger und Durst, weswegen sie von einem der Bäume in der Nähe einen langen Ast abgebrochen und an einem Ende zugespitzt hatte. Mit diesem provisorischen Speer ging sie täglich auf die Jagd nach den Fischen, von denen sich in Strandnähe glücklicherweise jede Menge tummelten. Nicht weit entfernt gab es zudem einen Bach, an dem sie sich mit Süßwasser versorgen konnte. Den Rest ihrer Zeit verbrachte sie damit, im Sand zu sitzen und darüber nachzugrübeln, wie es weitergehen sollte.
Bislang war ihr nichts eingefallen.
Rückblickend war der Pakt mit Telemach ihre letzte Chance gewesen, das Blatt noch einmal zu wenden. In ihrem geschwächten Zustand einen Angriff auf den Kaiser oder auf Castor Pollux zu wagen, lief auf Selbstmord hinaus. Und nachdem Telemach gescheitert war, würde sich mit Sicherheit kein weiterer Finsterer auf ein Bündnis mit ihr einlassen. Nach allem, was geschehen war, verströmte sie den bitteren Geruch der Niederlage.
Vielleicht war es ihr Schicksal, sich für immer an diesem verlassenen Strandabschnitt in einer halbverfallenen Hütte verstecken zu müssen.
Der Gedanke daran schnürte ihr die Kehle zu.
Wie aus dem Nichts stand Marton vor ihr. Er trug das gewohnte dunkle Gewand, das ihm bis zu den Knöcheln reichte. Das eisgraue Haar fiel ihm über die mageren Schultern. Seine Augen waren schwarz wie Kohlestücke, die Haut bleich.
Cassia reagierte sofort, griff nach dem Knochenheft des Hexentöters, sprang auf die Füße und ließ in einer fließenden Bewegung die scharfe Klinge gegen die Kehle des Druiden sausen. Zu ihrer grenzenlosen Überraschung ging sie durch ihn hindurch. Cassia begriff. Vor ihr stand nicht Marton leibhaftig, sondern lediglich ein Abbild von ihm, eine Erscheinung.
»Schnell reagiert«, sagte er anerkennend, wobei er seine spitz gefeilten Zähne entblößte. »Kein Wunder, dass dich die Jägerinnen bislang nicht zu fassen bekommen haben.«
»Wie hast du mich gefunden, und was willst du?«, knurrte sie.