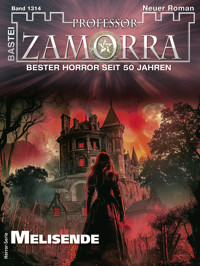1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Die mannshohe schwarze Statue stand im Zentrum der Lichtung, umgeben von uralten Bäumen. Obwohl es im Regenwald vor Leben nur so strotzte, herrschte hier eine tiefe Stille. Die Tiere des Dschungels machten einen weiten Bogen um diesen Ort, denn sie spürten, dass etwas Böses davon ausging. Bis zum Hals stellte sie den Körper eines bis auf einen Lendenschurz unbekleideten Mannes dar. Der Schädel dagegen war keineswegs menschlich. Armlange, an den Enden gewundene Hörner entsprossen der hohen Stirn. Fingerdicke Eckzähne ragten zwischen wulstigen Lippen hervor. Das Gesicht war eine verzerrte, mit tiefen Falten durchzogene Fratze. Die blinden Augen starrten in die Unendlichkeit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Schwarzer Himmel
Leserseite
Vorschau
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Schwarzer Himmel
von Michael Schauer
Die mannshohe schwarze Statue stand im Zentrum der Lichtung, umgeben von uralten Bäumen. Obwohl es im Regenwald vor Leben nur so strotzte, herrschte hier eine tiefe Stille. Die Tiere des Dschungels machten einen weiten Bogen um diesen Ort, denn sie spürten, dass etwas Böses davon ausging. Bis zum Hals stellte sie den Körper eines bis auf einen Lendenschurz unbekleideten Mannes dar. Der Schädel dagegen war keineswegs menschlich. Armlange, an den Enden gewundene Hörner entsprossen der hohen Stirn. Fingerdicke Eckzähne ragten zwischen wulstigen Lippen hervor. Das Gesicht war eine verzerrte, mit tiefen Falten durchzogene Fratze.
Die blinden Augen starrten in die Unendlichkeit.
»... bin ich der Meinung, dass wir von den indigenen Völkern lernen können. Sie leben im Einklang mit der Natur und kennen Geheimnisse, die in unserer modernen Welt vor langer Zeit verloren gegangen sind. Diese Geheimnisse zu lüften, könnte für uns vorteilhaft sein, trotz allem, was Wissenschaft und Technik inzwischen erreicht haben.«
Pascal Maront ließ seine Blicke über die Reihen schweifen. In dem großen Hörsaal wirkten die knapp vierzig Anwesenden wie Inseln in einem Meer aus freien Plätzen. Seine Vorlesungen waren selten gut besucht. Er wusste, dass er sich mit seiner unwirschen Art unter den Studenten nicht sonderlich beliebt machte und sie sich nur blicken ließen, wenn es nicht mehr zu vermeiden war. Einerseits bedauerte er das, andererseits konnte er nicht aus seiner Haut. Mit jungen Leuten hatte er im Grunde nie viel anfangen können.
»Was ist mit den Angehörigen dieser indigenen Völker?«, fragte ein Student, der ihm noch nie aufgefallen war. Vermutlich nahm er zum ersten Mal an einer seiner Vorlesungen teil. Sehr wahrscheinlich sogar, denn sonst hätte er gewusst, dass es Maront hasste, unterbrochen zu werden. »Welche Vorteile haben sie?«
Maront verzog das Gesicht. Auf Diskussionen verspürte er nun wirklich keine Lust. Er hätte sich die Abschlussvorlesung vor seiner Expedition schenken und lieber blau machen sollen.
Seit Tagen fieberte er seiner Abreise entgegen. Nach über einem Jahr der Vorbereitung war es endlich so weit. Im peruanischen Amazonasregenwald wollte er nach jenen geheimnisvollen indigenen Stämmen suchen, die vollkommen isoliert von der Außenwelt lebten. Man schätzte, dass noch etwa fünfzehn von ihnen existierten, obgleich die einzigen Beweise für ihre Existenz aus verschwommenen Fotos und nicht überprüfbaren Berichten von zufälligen Begegnungen bestanden.
Seit seiner eigenen Studentenzeit war er von der Vorstellung fasziniert, ein solches Volk zu erforschen. Zu erfahren, wie ihre familiären Strukturen aussahen, an welche Götter sie glaubten und welche Sitten und Gebräuche sie pflegten. Nicht zuletzt erlaubte ihre Art zu leben Rückschlüsse darauf, wie ihrer aller Vorfahren den Herausforderungen einer Welt ohne die geringsten Annehmlichkeiten getrotzt haben mussten. Hunderte Rätsel warteten darauf, gelüftet zu werden.
Im Vorfeld hatte es einigen Widerstand gegen seine Pläne gegeben, von Seiten der Studentenschaft ebenso wie von Kollegen. Sie hatten die Ansicht vertreten, man solle die Leute einfach in Ruhe lassen. Es war zu diversen heftigen Diskussionen gekommen.
Vor allem den Gegenwind der anderen Professoren konnte Maront nicht nachvollziehen. Hatten sie als Wissenschaftler denn nicht die Aufgabe, Unbekanntes zu erforschen und Neues zu entdecken? Sowieso wunderte er sich, dass niemand vor ihm auf diese Idee gekommen war.
Wenigstens hatten die peruanischen Behörden keine Schwierigkeiten gemacht. Sie schienen sich nicht sonderlich darum zu scheren, was ein französischer Anthropologe und Volkskundler in ihrem Dschungel zu suchen hatte.
»Wie ist Ihr Name, Monsieur?«, fragte er den Zwischenrufer, der ihn unverschämt herausfordernd ansah.
»Publieux. Maurice Publieux.«
»Gehören Sie zu meinen Studenten? Ich kann mich nicht erinnern, Sie schon einmal in meinem Hörsaal gesehen zu haben.«
»Nein, ich besuche Ihre Vorlesung als Gast.«
Auch das noch, dachte er. Er hasste Gäste.
»Dafür sind Sie reichlich vorlaut, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Aber gut, ich will Ihre Frage beantworten. So wie wir von den indigenen Stämmen lernen können, können sie auch von uns lernen. Zum Beispiel, indem wir ihnen bei Krankheiten helfen, denen sie heute noch schutzlos ausgeliefert sind.«
»Könnte ein Kontakt zur Außenwelt für die Angehörigen eines solchen Stammes nicht gefährlich werden?«
Maront runzelte die Stirn, wobei er ahnte, worauf Publieux hinauswollte.
»Wie meinen Sie das?«, fragte er dennoch.
»Sie haben gerade das Thema Krankheiten angesprochen. Da diese Menschen nie mit der Zivilisation in Berührung gekommen sind, besitzen sie keinerlei Abwehrkräfte gegen bei uns verbreitete Erreger.«
»Das ist ein sehr kluger Gedanke, Monsieur Publieux«, lobte er, obwohl er den kleinen Scheißer am liebsten vor die Tür gesetzt hätte. »Seien Sie versichert, dass ein Kontakt nur unter größten Vorsichtsmaßnahmen zustande kommen wird.«
Tatsächlich hatte er Einwegoveralls und Atemschutzmasken für die Reise besorgt. Ihm graute zwar davor, die Dinger im schwülheißen Regenwald tragen zu müssen, doch Publieux hatte nicht unrecht. Es galt, Vorsicht walten zu lassen. Nicht auszudenken, sollte ein Stamm von einer Seuche ausgerottet werden, die er zu verantworten hatte.
Offenbar genügte Publieux die Antwort nicht. Sein skeptischer Gesichtsausdruck sprach jedenfalls Bände.
»Hätten die Menschen Interesse an dem, was wir Zivilisation nennen, würden sie nicht so zurückgezogen im Dschungel leben, denken Sie nicht?«
Maront schnaufte. »Letztlich liegt jeglicher Kontakt oder Nichtkontakt in ihrer Entscheidung. Ich habe nicht vor, ihnen mit dem Lasso hinterherzurennen, falls das Ihre Vorstellung sein sollte.«
Publieux schüttelte den Kopf und sah ihn finster an, hatte zu Maronts Erleichterung jedoch nichts mehr hinzuzufügen. Zwei Minuten später beendete er die Vorlesung.
Am Abend saß er mit seinem Freund und Kollegen David LeCleur an ihrem bevorzugten Tisch im Le Bistro Du Perigord unweit des Pantheon und nippte an einem Glas Wein. Wie stets war das Bistro gut besucht. Stimmengewirr lag in der Luft. Großformatige Schwarzweißfotos an den Wänden zeugten von der langen Geschichte des Familienbetriebs. Es war einer der wenigen Orte, an denen er sich wirklich wohlfühlte.
David unterstützte sein Vorhaben vorbehaltlos. Eine Zeitlang hatte sogar im Raum gestanden, dass er ihn nach Peru begleitete. Leider hatten sich die Pfennigfuchser von der Universität geweigert, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Es hatte Maront viel Zeit und Mühe gekostet, ihnen überhaupt ein bisschen finanzielle Unterstützung aus den Rippen zu leiern. Sein Dekan machte aus seiner Skepsis Maronts Vorhaben gegenüber keinen Hehl. Herrgott, sie taten so, als habe er vor, die Eingeborenen an den Haaren aus dem Dschungel zu zerren.
»Ich bin froh, den Laden eine Weile nicht sehen zu müssen«, klagte er. »Die Ignoranz einiger Leute dort ist schwer zu ertragen. Sollte meine Mission erfolgreich sein, schreibe ich vielleicht ein Buch, werde reich und hänge meinen Lehrstuhl an den Nagel.«
David grinste. »Mach dir nichts draus«, tröstete er ihn und schob sich ein Stück Entenpastete in den Mund.
David war nicht einfach nur ein Freund, sondern streng genommen sein einziger. Wie Maront selbst galt der Mittvierziger mit dem stets sorgfältig gescheitelten Haar als Sonderling und Einzelgänger. Einen wesentlichen Teil ihrer Freizeit verbrachten sie gemeinsam.
Maront schielte auf die Entenpastete. Seiner Ansicht nach gab es in ganz Paris keine besseren als die im Le Bistro Du Perigord, und normalerweise bestellte er bei jedem Besuch eine Portion. Heute jedoch verspürte er keinen Appetit. Dieser vorlaute Student war ihm auf den Magen geschlagen.
»Schickst du mir eine Postkarte?«, fragte David und zwinkerte ihm zu.
Trotz seiner gedrückten Stimmung musste Maront lächeln und nahm einen Schluck von dem wirklich feinen Pinot Noir, den sie hier ausschenkten. Auf seinen geliebten Wein würde er eine Weile verzichten müssen.
»Du wirst von mir hören«, versprach er.
»Bei den Mashco Solitaro, wie sich die Angehörigen des Stamms selbst nennen, scheint es keine Kinder zu geben, ebenso wenig wie Greise. Zumindest habe ich bislang keine zu Gesicht bekommen. Der Stamm besteht also offensichtlich ausschließlich aus Menschen jüngeren bis mittleren Alters. Sie beten eine Götzenfigur an, der sie in regelmäßigen Abständen eine schwarze Flüssigkeit abzapfen und in einer Schale sammeln. Ich weiß, dass sich das seltsam anhört, aber so habe ich es beobachtet.«
David LeCleur hob den Blick und senkte gleichzeitig Pascal Maronts Brief, den er in Händen hielt. »Soll ich weiterlesen?«
Valentin Dejeune nickte. Der Chef des Pharmakonzerns Santé saß hinter seinem mächtigen Schreibtisch, die Hände vor der Brust gefaltet, und musterte ihn aus neugierigen dunklen Augen. Obwohl LeCleur mit einer Körpergröße von einem Meter achtzig nicht eben klein geraten war, überragte ihn Dejeune um einen halben Kopf. Er war ein Industrieller wie aus dem Bilderbuch. Hochgewachsen und bullig, mit breiter Brust und ebensolchen Schultern, das Gesicht kantig, das graumelierte Haar sorgfältig frisiert. Der dunkle Anzug des Endfünfzigers stammte nicht von der Stange, sondern aus einer Maßschneiderei.
»Fahren Sie fort«, verlangte er mit befehlsgewohnter Stimme.
LeCleur richtete seinen Blick wieder auf den Brief.
»Einmal gelang es mir, in einem unbeobachteten Moment einen Tropfen davon zu erhaschen. Die Wirkung war verblüffend. Als ich am Abend in meinen Handspiegel schaute, kam ich mir wenigstens zehn Jahre jünger vor, was sich jedoch als nicht von Dauer erwies. Am nächsten Morgen sah ich buchstäblich schon wieder etwas älter aus, gleichwohl noch immer nicht so alt wie vorher. Offensichtlich muss man sie regelmäßig einnehmen, um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen oder zu erhalten. Was erklären würde, wieso es in dem Stamm keine alten Menschen gibt. Nun frage ich mich, ob diese geheimnisvolle Flüssigkeit bloß einen rein kosmetischen Effekt hat oder ob sie tatsächlich das Altern aufzuhalten vermag. Was selbstredend eine Sensation wäre, mein lieber David.
Ich habe mir vorgenommen, das Geheimnis zu entschlüsseln. Jedoch muss ich vorsichtig vorgehen, da die Eingeborenen bedauerlicherweise nicht besonders freundlich auf mein Auftauchen reagiert und mich bereits einmal mit Speeren vertrieben haben. Außer ihrem Namen habe ich deshalb leider rein gar nichts über sie herausgefunden. Da es hier im Dschungel kein Mobilnetz oder gar Internet gibt, muss ich auf diese etwas anachronistische Weise der Kommunikation zurückgreifen, aber ich konnte es einfach nicht abwarten, dir von meiner Entdeckung zu berichten.
Ich werde diesen Brief Maykel aushändigen, einem meiner beiden Helfer, die ich in Iquitos angeheuert habe. Er arbeitete dort als Küchenjunge in einem Restaurant namens Huasai, in dem ich kurz nach meiner Ankunft einkehrte. Er war ganz froh, mal etwas anderes machen zu können außer Teller zu spülen und Gemüse zu schnippeln, und hat sich als tüchtiger und zuverlässiger Bursche erwiesen, ganz im Gegensatz zu seinem Kollegen Piero. Bei diesem habe ich jeden Morgen Angst, er könne sich über Nacht aus dem Staub gemacht haben, weil ihm jeder Handgriff zu viel ist und er nur auf seinen Lohn schielt. Bei Maykel kann ich mir sicher sein, dass er zurückkommt, sobald er den Brief in Iquitos aufgegeben hat.
Ich merke, ich komme ins Plaudern und lege deshalb an dieser Stelle den Stift beiseite. Auf bald, mein Freund. Dein Pascal.«
Dejeune änderte seine Sitzposition und beugte sich vor. »Das ist alles?«
LeCleur nickte. »Das ist alles.«
»Seit wann, sagten Sie, ist Professor Maront verschwunden?«
»Das Schreiben lag vor knapp zwei Monaten in meinem Briefkasten. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört, dabei sollte er längst wieder in Paris sein. Seine Abreise aus Peru hatte er für vor drei Wochen geplant. Ich habe in dem Hotel angerufen, in dem er die ersten zwei Tage nach seiner Ankunft untergekommen war. Nachdem er sich auf den Weg in den Dschungel gemacht hat, ist er dort nicht wieder aufgetaucht.«
»Hm«, machte Dejeune.
»Außerdem habe ich versucht, diesen Jungen in dem Restaurant zu erreichen, das Pascal erwähnt hat«, fuhr LeCleur fort. »Ich dachte, falls er wieder dort arbeitet, könnte er mir etwas über seinen Verbleib berichten. Tja, immer wenn ich dort anrufe, hebt entweder niemand ab oder eine Frau schreit etwas Unverständliches auf Spanisch in den Hörer und legt auf. Die scheinen viel zu tun oder einfach keine Lust zu haben, ans Telefon zu gehen.«
»Was ist mit der Universität? Machen die sich keine Sorgen, wo einer ihrer Professoren geblieben sein könnte?«
LeCleurs Miene verdüsterte sich.
»Sie glauben, dass er seinen Aufenthalt in Peru eigenmächtig verlängert hat und wollen abwarten, bevor sie ihn bei den dortigen Behörden als vermisst melden. Tatsächlich kam das in der Vergangenheit ein paar Mal vor, aber noch nie für so lange Zeit. Außerdem hätte er mir in dem Fall bestimmt einen weiteren Brief geschickt.«
Oder sie sind in Wahrheit ganz froh, dass sie ihn los sind, diese Drecksäcke, fügte er in Gedanken hinzu. Verwandte hatte Pascal nicht. Im Grunde gab es niemanden, der ihn vermissen würde.
»Sofern ich das richtig verstanden habe, liegt zwischen Iquitos und der Stelle, wo sich der Professor aufgehalten hat, ein eintägiger Marsch durch den Dschungel. Dieser Maykel könnte keine Lust gehabt haben, sich ein weiteres Mal als Postbote durch die Büsche scheuchen zu lassen. Was ich ihm nicht verdenken könnte.«
Mit einem Seufzer lehnte sich LeCleur in seinem Stuhl zurück. Er hatte darüber nachgedacht, auf eigene Faust nach Peru zu fliegen, um Pascal zu suchen. Eine innere Stimme hatte ihn darauf hingewiesen, dass das Wahnsinn wäre. Sollten die Eingeborenen seinen Freund gefangen halten oder ihn gar getötet haben, wie er insgeheim befürchtete, konnte er allein sowieso nichts gegen sie ausrichten. Im Gegenteil müsste er in diesem Fall selbst um Leib und Leben fürchten.
»Mein Gefühl sagt mir etwas anderes«, antwortete er. »Pascal ist etwas zugestoßen, davon bin ich fest überzeugt.«
»Hat er keine Angehörigen oder Freunde, die ihn ebenfalls vermissen?«
LeCleur schüttelte den Kopf. »Aus seiner Familie lebt niemand mehr, und er war nie verheiratet. Was Freunde angeht, da gibt es eigentlich nur mich. Wissen Sie, als mich vor ein paar Jahren meine Exfrau aus heiterem Himmel aus unserem Haus geworfen hat, ließ er mich bei sich unterkommen, bis ich mir eine eigene Wohnung gesucht hatte. Das werde ich ihm nie vergessen. Ich betrachte es als meine Pflicht, sein Verschwinden aufzuklären, wenn schon sonst niemand daran Interesse zu haben scheint. Er würde dasselbe für mich tun.«
»Und deshalb möchten Sie, dass ich Ihnen eine Art Rettungsmission finanziere, richtig? Jedenfalls hatte ich Sie so verstanden.«
»Sehen Sie's als Forschungsreise, Monsieur Dejeune.«
»Wegen dieser geheimnisvollen Flüssigkeit, meinen Sie?«
Jetzt beugte sich auch LeCleur vor, sodass ihre Gesichter kaum mehr als die Länge eines Unterarms voneinander getrennt waren. Die Miene seines Gegenübers blieb unbewegt.
»Ich bin zwar Anthropologe, doch die Wirtschaft ist mein privates Steckenpferd«, erklärte er mit fester Stimme. »Die La Tribune gehört zu den Zeitungen, die ich regelmäßig lese. Deshalb weiß ich, dass Sie seit langer Zeit nach einem Weg suchen, um das Altern aufzuhalten. Sie haben eine Menge Geld in das Projekt investiert, bislang jedoch ohne Erfolg. Manche sagen, Sie täten es für das Wohl der Menschheit, andere behaupten, dass es Ihnen nur um den Gewinn geht. Sicher ist, dass Ihnen eine solche Erfindung binnen kürzester Zeit Millionen, ach was, Milliarden einbringen könnte. Wer wird schließlich schon gerne alt? Was auch immer in Wahrheit Ihre Motivation sein mag, im peruanischen Dschungel könnte die Lösung auf Sie warten.«
Sein Gegenüber sah ihn schweigend an. Als LeCleur bereits anfing, sich unbehaglich zu fühlen, ergriff er wieder das Wort.
»Der Name meiner Großmutter lautete Loraine. Sie war eine Seele von Frau, und ich habe sie mehr geliebt als jeden anderen Menschen auf der Welt, meine Tochter Amelie ausgenommen. Sie starb, als ich vierzehn Jahre alt war, und hinterließ einen untröstlichen Enkel. Oft klagte sie über die äußeren Veränderungen, die das Alter mit sich brachten. In ihren jungen Jahren war sie eine Schönheit gewesen, die Männer liefen ihr in Scharen hinterher. Umso mehr quälte es sie, sich selbst verwelken zu sehen wie einen Strauß alter Rosen. Ihr Tod war auch eine Folge ihres Kummers über diesen Umstand. Seitdem bin ich entschlossen, dem natürlichen Alterungsprozess eines Tages einen Riegel vorzuschieben. Unsere Forschungen in dieser Angelegenheit werden übrigens nur zu einem Teil aus der Unternehmenskasse finanziert, den Löwenanteil steuere ich privat bei.«
Valentin Dejeune war mehrfacher Millionär, wie LeCleur wusste. Nach seinem Studium hatte er mit dem Vermögen, das er von seinem Vater geerbt hatte, eine pharmazeutische Firma gegründet, unter deren Dach sich bald die führenden Forscher des Landes versammelten. Nachdem das Unternehmen ein neues und erstaunlich wirksames Mittel gegen Bluthochdruck auf den Markt gebracht hatte, schoss der Aktienkurs durch die Decke. Der heute siebenundfünfzigjährige Dejeune verkaufte seine Anteile und gönnte sich für zwei Jahre eine Auszeit. Nachdem er die Welt bereist hatte, kehrte er nach Frankreich zurück und heuerte auf dem Chefsessel von Santé an, dessen Wert wiederum sich seit seinem Amtsantritt verdoppelt hatte.
Diese geheimnisvolle Flüssigkeit, die Pascal in dem Brief erwähnte, musste für ihn wie eine fette Wurst sein, die man einem hungrigen Hund vor die Nase hielt. Das war der Grund, warum sich LeCleur an ihn gewandt hatte.
»Es ist nicht einfach, einen Termin bei mir zu bekommen«, sagte Dejeune. »Umso erfreulicher, dass Sie so hartnäckig waren, Monsieur LeCleur. Sagen Sie mir nur eins, und seien Sie bitte absolut aufrichtig. Ihr Freund ist kein Spinner, der sich das alles nur eingebildet haben könnte?«
Er schüttelte den Kopf.
»Man kann über Pascal vieles sagen, aber ganz sicher nicht, dass er Illusionen aufsitzen würde. Ich kenne ihn seit über zehn Jahren. Er ist kein Fantast, sondern ein Wissenschaftler durch und durch. Seine Beobachtungen sind präzise wie eine Schweizer Uhr. Ich glaube jedes Wort, das er geschrieben hat.«
Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Unterhaltung zeigte Dejeune den Anflug eines Lächelns.
»Ich habe eine ausgesprochene Schwäche für Schweizer Uhren. Also gut, wir kommen ins Geschäft. Ich gehe davon aus, dass Sie mich begleiten wollen?«
»Ja, das möchte ich in der Tat.«
»Einverstanden. Ich stelle ein Team auf die Beine. In fünf Tagen geht's los. Das sollte reichen, damit Sie Ihre Angelegenheiten regeln können. Ich meine, Sie müssen wahrscheinlich Urlaub nehmen, oder?«
»Das bekomme ich hin.«
»Gut, sehr gut. Meine Assistentin wird sich bei Ihnen melden und Sie mit allen notwendigen Informationen versorgen. Uns steht eine möglicherweise sehr bedeutende Expedition bevor, Monsieur LeCleur. Sollte sich dieses angebliche Wundermittel als ein ebensolches erweisen, könnte damit ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit aufgeschlagen werden.«
Die Messerklinge aus dem Reifen zu ziehen war fast genauso schwer, wie sie hineinzustechen. Zischend entwich die Luft.